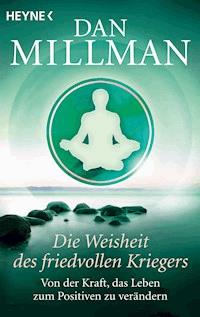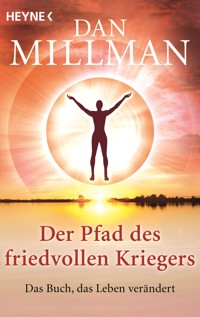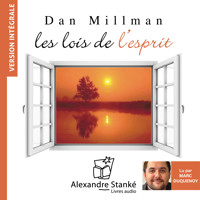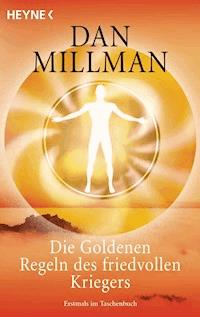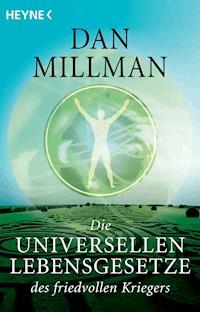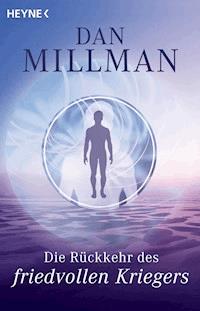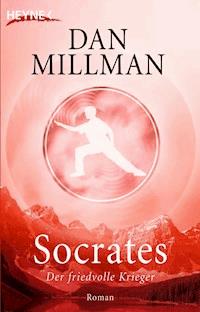5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ansata
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der friedvolle Krieger kehrt zurück
Ein verschollenes Schriftstück, das nichts weniger als die tiefsten Geheimnisse der menschlichen Existenz enthüllen soll. Eine Reise durch Licht und Dunkelheit, Triumph und Zweifel – hin zum Erwachen in einer neuen, grenzenlosen Bewusstheit: Die Suche nach dem Tagebuch seines verstorbenen Lehrers Socrates wird für Dan Millman zum größten Abenteuer seines Lebens. Was Dan nicht ahnt: Er ist nicht der Einzige, der alles dafür tun würde, dieses Buch in seinen Besitz zu bringen. So entwickelt sich ein atemberaubender Wettlauf über die Kontinente – von der Abgeschiedenheit der Mojave-Wüste in die Glitzerwelt asiatischer Großstädte, hin zum verbotenen Tempel in den Wäldern Chinas.
Dan Millmans Erfolgssaga begeistert Millionen Leser weltweit. Sie lässt jenes innere Potenzial entdecken, das in jedem von uns steckt: die unendliche Kraft, Weisheit und Genialität des friedvollen Kriegers.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
DAS BUCH:
Die Suche nach dem Tagebuch seines verstorbenen Lehrers Socrates wird für Dan Millman zum größten Abenteuer seines Lebens. Denn Dan ist nicht der Einzige, der alles dafür tun würde, diese verschollene Schrift in seinen Besitz zu bringen. So entwickelt sich ein atemberaubender Wettlauf über die Kontinente – von der Abgeschiedenheit der Mojave-Wüste in die Glitzerwelt asiatischer Großstädte, von einer verborgenen Schule in den Wäldern Chinas zu einem geheimnisvollen japanischen Tempel.
Packend, fesselnd, voller Einsicht und Weisheit – auf Dan Millmans Spuren können auch wir das innere Potenzial entdecken, das in jedem von uns verborgen ist: die unendliche Kraft, Weisheit und Genialität des friedvollen Kriegers.
DER AUTOR:
Dan Millman, in jungen Jahren einer der besten Kunstturner Amerikas, später Coach von Spitzensportlern, unterrichtet seit über zwanzig Jahren verschiedenste Formen des körperlich-geistigen Trainings. Seine Werke über die Lebenshaltung des friedvollen Kriegers sind zu wahren Kultbüchern geworden und haben eine Auflage von mehreren Millionen in neunundzwanzig Ländern erreicht.
www.peacefulwarrior.com
DAN MILLMAN
Der friedvolle Krieger
und das Geheimnis der verborgenen Schrift
Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt
von Kristof Kurz
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »The Hidden School. Return of the Peaceful Warrior« bei North Star Way, einem Imprint von Simon & Schuster Inc., New York, USA.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Erste Auflage 2017
German translation copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017 by Ansata Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
»The Hidden School«: Copyright © 2017 by Dan Millman
All Rights Reserved. Published by arrangement with the original publisher, North Star Way, a division of Simon & Schuster Inc.
Alle Rechte sind vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München, unter Verwendung eines Motivs von © Jukka Risikko/shutterstock
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-21878-2V002
www.ansata-verlag.de
All jenen gewidmet, die danach streben,
mit einem friedvollen Herzen
und dem Geist eines Kriegers zu leben.
* * *
Keine zwei Menschen
lesen jemals dasselbe Buch.
EDMUND WILSON
Inhalt
Vorwort
Erster Teil: Ein Buch in der Wüste
Zweiter Teil: Meister vom Taishan-Wald
Dritter Teil: Steine, Wurzeln, Wasser
Epilog
Dank
Vorwort
Dinge müssen nicht geschehen sein, um wahr zu sein. Geschichten und Träume sind Schatten-Wahrheiten, die andauern, wenn bloße Fakten zu Staub und Asche geworden und längst vergessen sind.
NEIL GAIMAN
Im Jahr 1966 – ich ging noch aufs College – lernte ich einen geheimnisvollen Tankwart kennen, den ich Socrates nannte und in Der Pfad des friedvollen Kriegers beschrieb. Er erzählte mir auch von einer Schamanin auf Hawaii, deren Schüler er vor vielen Jahren gewesen war. Außerdem berichtete er mir von einem Buch, das er in der Wüste verloren hatte, und von einer spirituellen Schule, die irgendwo in Asien verborgen war, doch leider gingen die dazugehörigen Details in der übergroßen Fülle meiner Erinnerungen an unsere gemeinsame Zeit wieder verloren.
Mit den Worten »Schluss mit den Lektionen, Junior. Es wird Zeit, dass du aus deinen eigenen Erfahrungen lernst«, schickte mich mein alter Lehrmeister in die Welt hinaus. Meine akademischen Studien hatte ich abgeschlossen, sodass ich als Dozent der Sportwissenschaften mit Schwerpunkt Kunstturnen und Bewegungskunst an der Stanford University in Kalifornien sowie am Oberlin College, Ohio, lehren konnte. Auch mein Privatleben entwickelte sich: Ich heiratete und wurde Vater einer Tochter.
Acht Jahre waren ins Land gegangen, seit ich zum ersten Mal Socs rund um die Uhr geöffnete Tankstelle betreten hatte. Auf den ersten Blick erschien mein Leben so perfekt wie damals als Collegestudent und Spitzensportler. Gleichwohl nagte ständig das Gefühl an mir, dass ich etwas verpasste – dass ich das wahre Leben verpasste, während ich darum rang, mich äußeren Erwartungen zu beugen. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits wieder geschieden.
Dann verlieh mir das College ein Forschungsstipendium, das mir Fernreisen ermöglichte, ja sie notwendig machte. Es ging um Geschichte und Hintergründe von Kampfkunsttraditionen und zugehörigen körperlich-geistigen Disziplinen. Sofort wurde meine Erinnerung daran wachgerufen, was Socrates seinerzeit erwähnt hatte. Es schien mir die ideale Gelegenheit zu sein, um meinen beruflichen Auftrag mit meiner ganz persönlichen Suche zu verbinden.
Dieses Buch erzählt die Geschichte einer weiten Reise auf verschlungenen Wegen, die kurz nach meinem Abenteuer auf Hawaii (nachzulesen in Die Rückkehr des friedvollen Kriegers) ihren Anfang nahm und unmittelbar vor dem dramatischen Finale in Der Pfad des friedvollen Kriegers ihr Ende fand.
Die erste Etappe, mein Aufenthalt auf Hawaii, hatte ich soeben hinter mich gebracht. Nun richtete ich den Blick auf Japan. Aber eine zufällige Entdeckung sollte dafür sorgen, dass es zunächst ganz anders kam. Wie heißt es doch so schön: »Wenn man etwas tun will, muss man zuvor etwas anderes tun.«
Alles begann an einem regnerischen Septembermorgen …
Erster Teil
EIN BUCH IN DER WÜSTE
Wir kämpfen gewaltfrei für eine bessere Welt.
Wir dürfen nicht erwarten, dass es einfach wird.
Wir werden nicht auf Rosen gehen …
Als Pilger der Gerechtigkeit und des Friedens
müssen wir die Wüste erwarten.
DOM HÉLDER CÂMARA
Eins
Im Morgengrauen betrachtete ich das wirbelnde Laub vor dem regennassen Fenster meines Hotelzimmers auf Oahu. Die dunklen Wolken passten prima zu meiner trüben Stimmung. Ich hing zwischen Himmel und Erde, trieb wurzellos, ziellos durchs Nirgendwo. Der Sommer mit Mama Chia auf der Insel Molokai war wie im Flug vergangen. Mein Stipendium war auf neun Monate angelegt, dann würde ich mich wieder meiner Lehrtätigkeit widmen müssen.
Ich schlich in Unterwäsche über den weichen Teppichboden, blieb vor dem Badezimmerspiegel stehen und betrachtete mich von oben bis unten. Habe ich mich verändert?, geht man da fragend in sich. Meine muskulöse Gestalt – geformt durch das Leistungsturnen auf dem College und die körperlichen Anstrengungen auf Molokai – sah aber aus wie immer. Ebenso das gebräunte Gesicht, das markante Kinn sowie mein Haar, das ich üblicherweise kurz trug und mir erst tags zuvor hatte schneiden lassen. Nur die Augen, die mir aus meinem eigenen Spiegelbild entgegenblickten, sie schienen verändert. Ob ich wohl eines Tages meinem alten Lehrer Socrates ähnlich sehe?
Als ich vor einigen Tagen auf Oahu angekommen war, hatte ich umgehend meine sieben Jahre alte Tochter angerufen. »Daddy, ich gehe auch weit weg, genau wie du!«, hatte sie aufgeregt berichtet. Sie und ihre Mutter waren im Begriff, nach Texas zu reisen, um dort mehrere Monate, wenn nicht länger, bei Verwandten zu bleiben. Nun wählte ich erneut die Nummer, die sie mir genannt hatte, doch niemand nahm ab. Also schrieb ich ihr eine Postkarte und versah sie mit spielerischen Verzierungen am Rand – wohl wissend, dass alle Postkartengrüße und -küsse einen abwesenden Vater nicht ersetzen konnten. Ich vermisste meine Tochter. Die Entscheidung, eine mehrmonatige Reise anzutreten, war mir nicht leichtgefallen. Ich steckte die Postkarte in ein ledergebundenes Notizbuch, das ich mir vor Kurzem gekauft hatte, um es als Reisetagebuch zu benutzen. Die Karte wollte ich später am Flughafen einwerfen.
Nun war es also wieder Zeit zu packen. Ich holte meinen Rucksack aus dem Schrank, der mir auf vielen Reisen gute Dienste geleistet hatte, und breitete meine Habseligkeiten auf dem Bett aus: zwei Hosen, zwei T-Shirts, Unterwäsche, Socken, eine dünne Jacke und ein Polohemd für besondere Anlässe. Laufschuhe komplettierten meine minimalistische Garderobe.
Zum Schluss nahm ich die etwa fünfundzwanzig Zentimeter große Samuraifigur zur Hand, die ich in einer Meereshöhle vor Molokai gefunden hatte – für mich ein Zeichen dafür, dass Japan mein nächstes Ziel sein sollte. Schon lange wünschte ich mir, vor Ort einen direkten Einblick in Zen-Praxis und bushido – den »Weg des Kriegers« – zu erhalten. Ja, und womöglich war ja in Japan die verborgene Schule zu finden, von der Socrates gesprochen hatte. Mein Flug war für den morgigen Tag gebucht. Während ich also den alten Rucksack packte, stieg ein kaum wahrnehmbarer, aber wohlbekannter Geruch daraus auf. So duftete der fruchtbare rote Boden des hawaiianischen Regenwaldes.
Ein paar Minuten später fiel mir ein, dass ich die Postkarte wohl vergessen würde, wenn ich sie nicht aus dem Buch nahm. Ich öffnete den Rucksack erneut und versuchte, es herauszuziehen, ohne die halbwegs säuberlich gefaltete Kleidung wieder in Unordnung zu bringen. Aber es bewegte sich keinen Millimeter. Verärgert zerrte ich daran. Offenbar hatte sich seine Metallschließe im Innenfutter verfangen. Ich hörte und spürte, wie der Stoff riss, während ich ungeduldig zog. Als ich hineingriff, berührte ich eine leichte Ausbuchtung an der Stelle, wo sich das Futter gelöst hatte. Meine Hand ertastete dort etwas, und ich zog es heraus. Zu meiner Überraschung stellte es sich als Briefumschlag heraus. Darauf befand sich eine Notiz in Mama Chias Handschrift:
Socrates hat mich gebeten, dir diesen Brief zu geben, wenn du bereit dafür bist.
Bereit wofür?, fragte ich mich verwirrt. Vor meinem geistigen Auge erschien meine hawaiianische Lehrerin mit dem silbernen Haar und dem offenen Lächeln, ihren fülligen Leib in einen Muumuu mit Blumenmuster gehüllt. Ganz aufgeregt vor Neugier, öffnete ich den Umschlag und las Socrates’ Brief.
Dan, das einzige Heilmittel für die Jugend sind Zeit und wachsender Durchblick. Als wir uns zum ersten Mal begegneten, flogen meine Worte an dir vorbei wie Laub im Wind. Du wolltest sie verstehen, aber du warst noch nicht bereit, sie zu hören. Ich spürte, dass es nicht einfach für dich werden würde – umso mehr, da du der Überzeugung warst, weiser als deine Altersgenossen zu sein.
Da dir Chia diesen Brief überreicht hat, suchst du nun wohl im Osten nach Antworten. Aber wer als Suchender im Osten um milde Gaben der Einsicht bettelt, wird nur ein paar winzige Krümel empfangen. Geh nur, wenn du selbst etwas von Wert auf den Tisch der Weisheit legen kannst. Das ist kein leerer Spruch. Zuvor musst du ein Buch finden, das ich vor Jahrzehnten in der Wüste verloren habe.
Wieder einer von Socs typischen Scherzen, fiel mir dazu nur ein. Ich konnte sein Pokerface und sein Augenzwinkern förmlich vor mir sehen! Ich soll nicht nach Japan fliegen, sondern ein Buch in der Wüste suchen?In welcher Wüste überhaupt? Der Stoßseufzer blieb mir jedoch im Halse stecken, während ich weiterlas.
Ich glaube, was ich damals in diesem Buch, meinem Tagebuch, notiert habe, könnte eine Brücke zwischen Tod und Wiedergeburt schlagen, vielleicht ist es sogar das Tor zur Unsterblichkeit. Diese Einsichten wirst du gut gebrauchen können, bevor all dies vorüber ist. Aber das sind nur Vermutungen, da ich leider vergessen habe, was genau in dem Buch steht und wo es zu finden ist.
Die Geschichte des Buches ist eng mit meiner eigenen verknüpft: Ich wurde vor beinahe hundert Jahren in Russland geboren und als Kind auf eine Kadettenanstalt geschickt. Viel später, als ich mich bereits auf dem Pfad des Kriegers befand, begegnete ich im zentralasiatischen Pamirgebirge einer Gruppe verwirklichter Meister: einem Zen-R-oshi, einem Sufi, einem Kabbalisten und einer christlichen Nonne. Sie lehrten mich vieles, doch das meiste davon vermochte ich erst viele Jahre später in mein Leben zu integrieren. Gegen Ende des Ersten Weltkriegs, ich war etwa Mitte vierzig, wanderte ich in die Vereinigten Staaten aus. Ich besuchte die Abendschule und lernte unter großen Mühen, Englisch zu schreiben und zu sprechen wie ein Amerikaner. Anschließend arbeitete ich erst auf dem Bau und dann als Automechaniker, wofür ich eine gewisse Begabung hatte. Ich zog nach Oklahoma, wo meine Tochter als Lehrerin arbeitete. Zehn Jahre später kehrte ich nach New York zurück.
In meinem sechsundsiebzigsten Lebensjahr spazierte ich eines Abends durch das Viertel, das heute als Greenwich Village weltberühmt ist. Unter der Markise eines bestimmten Antiquariats blieb ich immer gern stehen, um die Bücher im Schaufenster zu betrachten. Heute schob mich eine plötzliche Windbö förmlich in den Laden hinein. Eine Klingel kündigte meine Ankunft an und verstummte sofort wieder, als hätte man eine Decke darüber geworfen. Der muffige Geruch Tausender alter Bücher erfüllte die Luft. Ich schlenderte durch die engen Gänge zwischen den Regalen und schlug ein paar Bände auf. Sie knarzten beim Öffnen wie arthritische Gelenke. Normalerweise würde ich mich an solche Details weder erinnern noch sie erzählen, doch was an jenem Abend geschah, hat sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt.
Mein Blick fiel auf die wohl älteste Frau, die ich je gesehen hatte. Sie saß an einem kleinen Tisch. Während ich sie musterte, legte sie die Linke auf ein Büchlein mit ledernem Verschlussband und Schnappschloss. Es sah mir nach Tagebuch beziehungsweise persönlichem Notizbuch aus. Mit der Rechten blätterte sie beiläufig in einem der anderen Bücher auf dem Tisch und griff dann nach einem Stift, als wollte sie etwas notieren. Doch stattdessen wandte sie sich um und sah mich an.
Die Haut ihres faltigen Gesichts ähnelte dem Ledereinband des Buchs vor ihr, aber unter den buschigen Augenbrauen funkelten überraschend junge Augen. Schwer zu sagen, ob sie lateinamerikanische, indianische oder asiatische Wurzeln hatte. Ihr Antlitz schien sich ständig zu verändern, je nachdem, wie das Licht darauf fiel. Ich nickte ihr noch kurz zu und wollte schon wieder gehen, als sie mich zu sich rief. Zu meiner Überraschung sprach sie mich mit einem Spitznamen aus meiner Jugend an – demselben Namen, bei dem auch du mich riefst.
»Socrates.«
»Anscheinend kennen Sie mich, aber ich weiß nicht, wer Sie …«
»Nada«, sagte sie. »Mein Name ist Nada.«
»Sie heißen ›Nichts‹?«, fragte ich erstaunt.
Sie lächelte und entblößte ihre wenigen verbliebenen, gelben Zähne.
Ich versuchte fieberhaft, mich daran zu erinnern, wann und wo wir uns begegnet sein konnten. Um Zeit zu schinden, erkundigte ich mich danach, was sie da schrieb.
»Unsere Zeit ist kostbar«, lautete die unerwartete Auskunft. Sie sprach mit spanischem Akzent und legte eine Hand auf meinen Arm. »Meine Arbeit ist beinahe vollbracht.« Sie schrieb etwas auf einen Zettel und gab ihn mir. »Komm morgen zu dieser Adresse. Du wirst wissen, was zu tun ist.« Sie richtete sich langsam auf. »Komm nicht zu spät. Die Tür ist offen.«
Am nächsten Morgen fand ich mich kurz nach Sonnenaufgang bei dem Mietshaus ein, dessen Adresse sie mir aufgeschrieben hatte. Ich ging in den ersten Stock und klopfte leise an eine Tür am Ende eines dunklen Flurs. Keine Antwort. »Die Tür ist offen«, hatte sie gesagt. Ich drückte die Klinke herunter und trat ein.
Zuerst dachte ich, die kleine Wohnung wäre verlassen, da sie bis auf einen alten Teppich und ein paar Kissen völlig leer war. Wie die Klause eines Zen-Mönchs oder einer katholischen Nonne. Dann hörte ich Musik. Sie war so leise, dass ich mich fragte, ob sie aus dem angrenzenden Raum kam oder meiner Erinnerung entstammte. Ich bemerkte den Schein einer Lampe und ging darauf zu. Als ich an einem Fenster vorbeikam, spürte ich eine kalte Brise. Ich fand die Alte über dem Schreibtisch zusammengesackt, ihr Kopf ruhte auf den Armen, darunter das Buch, welches ich schon kannte. Daneben lag der offenbar zum Schnappschloss gehörige Schlüssel. Ein Stift war ihr aus den altersschwachen Fingern gefallen. Ich tastete nach ihrem Arm – er fühlte sich so kalt und trocken wie Pergament an. Nur eine leere Hülle bleibt irgendwann von einem Menschen.
Ich strich sanft über ihr dünnes Haar. Die Morgensonne tauchte ihr Gesicht in einen ätherischen Glanz. Da wusste ich wieder, wer sie war!
Ich zählte fünfunddreißig Jahre, als ich Nada kennenlernte. Sie war eine christliche Mystikerin aus Spanien, die zur Gruppe meiner Lehrmeister im Pamir gehörte. Nur nannte sie sich damals María. Fast vierzig Jahre später, im Antiquariat, hatte sie mich wiedererkannt. Ich dagegen vermochte mich ihrer nicht zu erinnern. Wohl deshalb hatte sie sich als »Nada« bezeichnet.
Sie hatte ihr Ende nahen gefühlt. Auf dem Tisch lag noch ein Umschlag, auf den sie eine Telefonnummer und drei Worte gekritzelt hatte: »Feuerbestattung. Keine Hinterbliebenen.« Ich öffnete ihn und fand darin eine Summe Geldes, wohl genug für ein Begräbnis. Ich steckte das Büchlein in meinen Rucksack und den Schlüssel in die Hosentasche. Nachdem ich sie noch eine Weile betrachtet und mich stumm von ihr verabschiedet hatte, ging ich, ohne die Tür hinter mir zu schließen.
Sobald ich in meiner eigenen Wohnung war, kam es mir vor, als wäre ich soeben aus einem Traum erwacht, obwohl mir das Gewicht des Buchs in meinem Rucksack das Gegenteil bewies. Nachdem ich vom Flurtelefon aus das Bestattungsunternehmen angerufen hatte, setzte ich mich und nahm das Buch zur Hand. Doch öffnete ich es nicht. Noch nicht. Ich wusste nicht, was die alte Nonne hineingeschrieben haben mochte, doch es war mit Sicherheit kein Unterhaltungsroman. Was immer es sein mochte, ich würde es mit gebührendem Respekt behandeln. Und zuvor sollten ihre sterblichen Überreste auf angemessene Weise bestattet sein.
Ein paar Tage später erhielt ich die Urne mit der Asche Nadas, die früher María geheißen hatte.
Frühmorgens darauf betrat ich den Central Park von Süden her, ließ Umpire Rock hinter mir und schlug die Richtung zum Conservatory Garden ein. Als ich die Gartenanlage erreichte, fand ich sie noch abgeschlossen vor. Ich kletterte über den Zaun und wählte ein friedvolles Plätzchen im überwucherten Kakteengarten für meinen Zweck. Sobald die Strahlen der aufgehenden Sonne die Wüstenpflanzen berührten, verstreute ich die Asche unter ihnen.
Nach einer Minute stillen Gedenkens nahm ich das Buch heraus und öffnete das Schloss. Dann schlug ich auf gut Glück eine Seite auf. Sie war leer. Ich blätterte zur nächsten Seite. Wieder nichts. Ich blätterte weiter. Nur leere Seiten!
Meine anfängliche Enttäuschung verwandelte sich schnell in Belustigung. Nun fiel mir auch wieder ein, welcher ganz besondere Sinn für Humor jener María, die ich Jahrzehnte zuvor erleben durfte, zu eigen gewesen war. Ein leeres Buch als letzte Geste an die Welt, das war Zen pur, und es hätte ihr wohl ein feines Lächeln entlockt, mich hier und jetzt so düpiert dastehen zu sehen.
Als sie »Du wirst wissen, was zu tun ist« gesagt hatte, war ich davon ausgegangen, dass sie damit die Feuerbestattung und das Verstreuen der Asche gemeint hatte. Genauso wie ich gedacht hatte, dass sich der Hinweis, ihre Arbeit sei beinahe vollbracht, auf ihr erfülltes und sich nun dem Ende zuneigendes Leben bezog.
Ich wollte das Buch gerade wieder schließen, als mein Blick endlich auf die allererste Seite fiel. Darauf befand sich unter einem Datumseintrag – 11. März 1946, ihr Todestag – ein Eintrag, mit zittriger Hand geschrieben. Zwei Botschaften hatte sie mir noch hinterlassen können, während sie ihre letzten Atemzüge tat. Die erste war eine Geschichte, die ich zwar schon kannte, nun aber mit vertiefter Aufmerksamkeit las:
Ein Kaufmann aus Bagdad schickte seinen Diener zum Markt. Der Diener kehrte vor Angst schlotternd zurück. »Herr, ich wurde auf dem Markt angerempelt. Als ich mich umdrehte, sah ich den Tod. Er machte eine drohende Geste, und ich rannte davon. Bitte entlasst mich und stellt mir ein Pferd zur Verfügung. Ich will nach Samarra reiten und mich dort verstecken.«
Sein Herr lieh ihm ein Pferd, und der Diener floh.
Später erblickte der Kaufmann den Tod in der Menge. »Warum hast du meinem Diener gedroht?«, wollte er wissen.
»Ich habe deinem Diener nicht gedroht«, antwortete der Tod. »Ich war nur überrascht, ihn hier in Bagdad zu sehen, da ich doch heute Abend mit ihm in Samarra verabredet bin.«
Angesichts ihres hohen Alters und des nahenden Endes war es nur zu verständlich, dass Nada eine Geschichte über die Unausweichlichkeit des Todes niederschrieb. Aber warum hatte sie diese in ihren letzten Minuten ausgerechnet mit mir teilen wollen? Die Antwort steckte in den beiden letzten Zeilen am Ende der Seite:
Mein Lieber: Nur der Tod ist ein Ratgeber, der dich ins Leben zurückholen kann. Fülle die leeren Seiten mit deines eigenen Herzens Weish…
Das letzte Wort hatte sie nicht mehr ausbuchstabieren können. Jetzt erst begriff ich die Bedeutung des Satzes »Du wirst wissen, was zu tun ist«. Ihr letzter Wille und Testament waren gleichzeitig Segen und Bürde für mich.
Als ich das Buch schloss und in meinen beiden Händen barg, war es, als hielte ich sie selbst darin, als wäre ihre Seele aus ihrem Körper und zwischen die Seiten geflogen.
Zwei
Socrates konnte doch nicht ernsthaft wollen, dass ich in der Wüste nach einem leeren Buch suchte! Schließlich habe ich schon eins, fand ich und warf einen Blick auf mein eigenes zukünftiges Tagebuch, dem ich die Entdeckung des Briefs zu verdanken hatte. Es besaß ebenfalls Schnappschloss mit Schlüssel und ledernem Halteband – wie das Buch, das Socrates beschrieben hatte. Und sah bereits so mitgenommen aus, wie auch ich mich fühlte. Ich holte tief Luft und tauchte wieder in seine Geschichte ein:
Von der » Weisheit meines Herzens« hatte sie geschrieben. Aber was wusste mein Herz denn schon? Was hatte ich gelernt, das weiterzugeben sich lohnte? Indem sie mir auftrug, die leeren Seiten eines schmalen Buchs zu füllen, wurde mir eine Aufgabe erteilt, die weit über das alltägliche Leben hinauswies. Allerdings war ich kaum in der Lage, sie zu erfüllen. War ich dazu fähig, etwas von Bedeutung zu schreiben? Ich bezweifelte es.
Wie ich da so mit dem Buch auf dem Schoß im Kakteengarten saß, mochte ich mir nicht einmal vorstellen, überhaupt irgendetwas hineinzuschreiben. Stattdessen beschloss ich, es sei Zeit für eine Veränderung. Ich fasste den Plan, quer durchs Land und durch die Wüste im Südwesten zu reisen und anschließend meinen Lebensabend an der Westküste der Vereinigten Staaten zu verbringen. Sobald ich mich in Kalifornien oder vielleicht auch Oregon häuslich niedergelassen hätte, könnte ich immer noch daran denken, zum Stift zu greifen.
In den nächsten Tagen räumte ich meine Wohnung, stattete dem Antiquariat noch einen Besuch ab und schlenderte ein letztes Mal durch die Stadt – doch die Sehenswürdigkeiten, die ich besichtigte, waren rein geistiger Natur. Ich blätterte in meinen Erinnerungen wie in einem Buch.
Dabei musste ich an dich denken, Dan. Zweifellos warst auch du mit Schwierigkeiten und Zweifeln konfrontiert, als du versuchtest, das, was ich dir offenbarte, zu verarbeiten und danach zu leben. Immer noch stellt sich mir die Frage, wie viel ein einzelner Mensch überhaupt tun kann, um das Leben seiner Mitmenschen zu verbessern oder zu erleuchten. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Wissen allein nichts von den Schwierigkeiten des Lebens wegnimmt. Doch ein tieferes Verständnis und ein erweiterter Horizont können uns dabei helfen, allen Widrigkeiten standhaft und mit und offenem Herzen zu begegnen. Hiermit stelle ich dir die Aufgabe, mein verlorenes Tagebuch zu finden. Dabei wird sich zeigen, was du aus unserer gemeinsam verbrachten Zeit gezogen hast.
Ja, dieser Brief stammte zweifellos von Soc. Und ja, höchstwahrscheinlich hatte er ihn erst vor ein paar Jahren geschrieben. Was darin stand und wie er dafür gesorgt hatte, dass er schließlich an mich gelangte, all das bewies klar und deutlich, dass er zu diesem Zeitpunkt im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war. Zum ersten Mal hatte er mir gestattet, einen Blick in seine persönliche Vergangenheit zu werfen. Was hatte ihn dazu gebracht, sein Innenleben so freimütig zu offenbaren?, fragte ich mich. Vielleicht vermisst mich der alte Knacker so sehr wie ich ihn.
Mit diesen Gedanken im Hinterkopf las ich weiter.
Lass mich mit meiner Geschichte fortfahren, damit du verstehst, was mein Tagebuch zu bieten hat und wie ich es verloren habe: Ein paar Tage nachdem ich New York verlassen hatte, kam ich in Denver an. Von dort waren es nur ein paar Zwischenstopps bis zu den Sangre de Cristo Mountains und weiter nach Santa Fe in New Mexico. Dort blieb ich ein paar Tage und zog dann nach Albuquerque weiter, von wo aus ich auf der Route 66 per Anhalter nach Westen wollte.
Der Fahrer, der mich mitgenommen hatte, hielt etwa eine Stunde westlich von Albuquerque bei einem indianischen Pueblo an. Er sagte, in der Nähe sei so etwas wie eine Schule, und machte eine unbestimmte Handbewegung, wie um mir den Weg anzuzeigen. Klar war jedenfalls, ich sollte aussteigen.
Als sich der Staub des davonfahrenden Lastwagens gelegt hatte, erkannte ich am Horizont, grob in der Richtung wie vom Trucker bezeichnet, mehrere verstreute Erhebungen. Dabei hätte es sich aber wohl genauso gut um eine Geisterstadt oder eine Fata Morgana handeln können. Ich hielt nichtsdestotrotz darauf zu, denn bevor ich weiterzog, wollte ich zumindest meine Feldflasche auffüllen.
Wenige Minuten später kam ich an einem großen Granitbrocken und mehreren Kakteen mit purpurfarbenen Blüten vorbei – schon komisch, woran man sich so alles erinnert – und erreichte schließlich ein aus Lehmziegeln erbautes Gebäude. Es schien tatsächlich eine Art Schule zu sein, denn im staubigen Hof neben einem gepflegten Garten spielte eine Schar Kinder.
Während ich meine Feldflasche mit einer Handpumpe aus einem Brunnen auffüllte, kam ein kleines Mädchen zu mir herüber und stellte sich vor. Mit großer Selbstsicherheit verkündete sie, dass sie später an dieser Schule Lehrerin sein würde. Dieses Mädchen erwähne ich deshalb, weil sie wichtig sein könnte, denn ich traf sie später nochmals. Emma war wohl ihr Name. Ja, das könnte sein.
Auf dem Highway hielt ich wieder den Daumen raus und wurde bald mitgenommen. Wir fuhren einen Tag, eine Nacht und bis zum nächsten Abend. Mein Nachtlager schlug ich etwa fünfzig Meter von der Straße entfernt auf, irgendwo in der Mojave-Wüste Arizonas oder womöglich bereits im Süden Nevadas. Beim Einschlafen dachte ich an die Bestattung von Nadas Asche im Kakteengarten.
Ich erwachte in der stillen Wüstennacht und fühlte mich wie in einer anderen Wirklichkeit – als hätte ich Peyote oder eine andere psychotrope Substanz zu mir genommen. Eine wahre Flut der Inspiration brach über mich herein. Ich schnappte mir das Buch und schrieb im Mondlicht einfach drauflos.
Gleichzeitig stieg meine Körpertemperatur. Ich geriet in einen Fieberzustand, der mir erlaubte, meinen bewussten Verstand auszublenden und auf den von mir beschriebenen Seiten die Früchte eines tieferen Verständnisses zu versammeln. Mein Verstand konnte mit der Flut der Gedanken schier nicht mithalten, ich wusste weder, ob ich ganze Sätze aufs Papier brachte, noch, ob diese überhaupt einen Sinn ergaben. Ich schrieb und schrieb, übermannt vom Fieber, ohne mir in irgendeiner Weise der eigenen Worte oder meiner Umgebung bewusst zu sein. In meinem Kopf hämmerte es, mir schwindelte, ich war verwirrt. Die Wüste hatte mich im Griff, erst mit sengender Hitze, dann mit durchdringender Kälte. Samarra, dachte ich. Das ist Samarra.
Von dem, was als Nächstes geschah, sind mir nur traumähnliche Eindrücke geblieben: Ich zog den Highway entlang … schrieb … schlief in einem ausgetrockneten Flussbett … schrieb … taumelte und fiel … schrieb weiter … Tag und Nacht … ein Tag verging, womöglich auch zwei oder drei, sie zogen vorbei wie die Seiten in einem Buch, in dem Buch der alten Nonne. Ich weiß noch, wie ich aus einem Lastwagen ausstieg und dabei den Rucksack mit meinen Aufzeichnungen fest umklammert hielt. Vielleicht habe ich mit einem Fremden gesprochen, vielleicht mit mehreren. Über das, was ich niedergeschrieben hatte – über die Unsterblichkeit.
Irgendwann bekam ich Angst, dass mir jemand das Buch wegnehmen oder dass ich es in der Wüste verlieren könnte. So muss ich es an einen sicheren Ort gebracht haben. Ja, ich versteckte es, um es später zu holen. Aber wo? Vielleicht bin ich auf einen Hügel gestiegen. Eindrücke von Licht und Dunkel. Ein Tunnel. Ein hochgelegener Ort, das weiß ich noch. Danach nichts mehr – an mehr kann ich mich nicht erinnern.
Das Fieber stieg und fiel. Manchmal überkamen mich die Schatten der Finsternis, dann wieder erlebte ich Momente äußerster Klarheit, unsagbar schöne Lichtspiele. Irgendwann, als ich eine Wüstenstraße entlangstolperte, kam ich wieder zu mir. Könnte sein, dass es noch oder wieder in der Mojave geschah, ob nun in Arizona oder Nevada, wahrscheinlich aber irgendwo im dortigen Grenzgebiet. Sicher weiß ich es nicht. Wieder nahm mich einer mit, dann noch einer und so weiter. Endlich begriff ich, dass ich unwissentlich die Straßenseite gewechselt haben musste. Es ging wieder nach Südosten, zurück nach Albuquerque!
Ich war immer noch so fiebrig, dass ich nur noch wusste, woher ich kam, aber nicht, wohin ich wollte. Mehr als einmal ertappte ich mich dabei, wie ich abwesend vor mich hinmurmelte, wie ich in der glühenden Landschaft mit den Insekten und anderen Tieren – wirklich oder eingebildet – sprach. Wie aus dem Nichts tauchte irgendwann ein Einheimischer in meinem Wachtraum auf. Ein Latino, glaube ich. Er goss Wasser über meinen Kopf.
Meine nächste Erinnerung ist, dass ich ein kühles Tuch auf meiner Stirn spürte und eine weiße Zimmerdecke über mir erblickte. Ich lag in einem sauberen Bett. Ein junger Arzt eröffnete mir, dass ich fast gestorben wäre und in einem Krankenhaus westlich von Albuquerque liege. Ich denke, es könnte sich in der Nähe der Schule, vor der ich meine Feldflasche füllte, befunden haben.
Noch war ich sehr schwach und verlor immer wieder das Bewusstsein. Mein verschmutzter Rucksack mit meinen Habseligkeiten lag auf einem Stuhl neben dem Bett. Erst später fiel mir auf, dass das Buch nicht mehr da war. Ich erinnerte mich nur noch vage daran, es versteckt zu haben, geschweige denn, wo genau.
Nach meiner Entlassung aus dem Krankenhaus wollte ich es unbedingt wiederfinden und lesen, was ich geschrieben hatte. Umgehend fuhr ich erneut per Anhalter nach Westen. Unverwandt durch Auto- und Lastwagenfenster starrend, zermarterte ich mir das Hirn: Wodurch nur konnte ich mich an das Versteck erinnern? Verzweifelt hielt ich nach Orientierungspunkten Ausschau, die mir vertraut vorkamen. Gespannt lauschte ich nach innen, wartete auf ein Zeichen. Aber alles vergeblich.
Doch ich mochte die Hoffnung nicht aufgeben. Noch als ich mich längst in Berkeley niedergelassen hatte, erwartete ich geduldig das Auftauchen irgendeiner Erinnerung. Weder Zeit noch Ort aber waren ins Bewusstsein zu heben. Es sollte mir wohl nicht vergönnt sein. Dieser Brief ist übrigens das Längste, was ich seither jemals wieder zu Papier gebracht habe. Jetzt, beim Schreiben, erstehen immer und immer wieder die gleichen schemenhaften Bilder vor meinem inneren Auge: ein dunkler Ort, ein Tunnel, die sonnengebräunte Haut eines Einheimischen, weiße Vorhänge, die Stimme eines Kindes …
Ich weiß, damit wirst du nicht viel anfangen können. Doch Dan, denk immer daran: Wo immer du hingehst, da wird sich auch ein Pfad auftun.
»Ein Pfad wird sich auftun?«, begehrte ich auf. »O bitte, Soc, das kann doch nicht alles gewesen sein!« War es aber, sonst hätte er sich daran erinnert und es mit mir geteilt.
Ich dachte an unsere gemeinsame Zeit zurück. Socrates schien wahrlich nur sehr selten abgelenkt oder in Gedanken versunken. Und wenn es ausnahmsweise der Fall war, hatte er dann über die Eintragungen in seinem Tagebuch nachgegrübelt? Hatte er versucht, sich ihrer zu erinnern?
Und was für eine Rolle spiele ich in dieser Geschichte?, so lautete die bohrende Frage. Schon sah ich wieder einmal ein ganz bestimmtes Ereignis aus meinem eigenen Leben vor mir: als mein Motorrad und ich urplötzlich von einem Straßenkreuzer in voller Fahrt aus dem Weg geräumt wurden, sodass ich in hohem Bogen mit zerschmettertem Bein auf dem Asphalt landete. Ich weiß noch sehr genau, was mir just in diesem für mich so folgenreichen Moment durch den Kopf ging: Das kann unmöglich gerade passieren. Eben das dachte ich jetzt auch. Das alles ergab doch keinen Sinn! Socrates hatte keine Ahnung, wo er das Buch versteckt hatte, aber er wollte, dass ich es suchte … Ich nahm mir den Schluss des Briefes vor:
Vielleicht könnte etwas, das ich in das Buch geschrieben habe, nützlich für dich sein. Vielleicht sind es aber auch nur Fieberfantasien. Der Weg ist das Ziel, Dan. Vielleicht ist dieser Schatz die Suche wert. Lass dich von deinem inneren Licht leiten.
Gute Reise!
Socrates
Ich faltete den Brief zusammen und steckte ihn wieder in den Umschlag. Dabei dachte ich daran, wie ich Socrates das letzte Mal leibhaftig gesehen hatte: in einem Krankenhausbett in Berkeley. Er hatte sich aufgesetzt und sah einigermaßen gesund, wenn auch etwas blass aus. Kein Wunder, immerhin war er dem Tod knapp von der Schippe gesprungen. Er musste den Brief irgendwann in den folgenden Wochen oder Monaten geschrieben und anschließend Mama Chia zur sicheren Aufbewahrung geschickt haben.
Die Sonne Hawaiis ging auf und verwandelte die Blätter der Bäume in leuchtende Smaragde, doch ihr Anblick war für mich getrübt von drängenden Fragen: Warum hat Socrates mir diese Aufgabe gestellt? Ist das eine Initiation, eine Prüfung – seine Art und Weise, das Zepter weiterzureichen? Oder hatte er sich schlicht zu alt gefühlt, um selbst danach zu suchen? Als wir uns kennenlernten, behauptete er, sechsundneunzig Jahre alt zu sein. Seither waren acht Jahre ins Land gegangen, aber immer noch spürte ich seine Gegenwart, sah ihn deutlich vor mir. Ganz so, wie er sich die ölverschmierten Hände mit einem Lappen abwischte oder Gemüse für eine Suppe, einen Salat oder eine andere Mahlzeit schnitt, die er spät in der Nacht im Büro jener alten Tankstelle für uns zuzubereiten pflegte.
Zunächst musste ich also diese Schule und das Krankenhaus in der Nähe von Albuquerque finden. Dummerweise erstreckt sich die Mojave-Wüste von Südkalifornien über ganz Arizona bis nach Nevada. »Dann muss ich ja nur mehrere Tausend Quadratmeilen absuchen«, murmelte ich sarkastisch, ganz wie früher, als mein Lehrer noch neben mir saß. »Ich fliege einfach nach Albuquerque, fahre auf deinen Spuren nach Westen in die Mojave und fange halt an zu graben.«
Oder ichhalte mich an den ursprünglichen Plan und fliege nach Japan. Das Ticket hatte ich bereits. Ich war doch schon mehr oder weniger auf dem Weg dorthin. Die Wüste im Südwesten der USA dagegen lag dreitausend Meilen weit entfernt in der entgegengesetzten Richtung!
Ich konnte ja schlecht jedes kleine Krankenhaus in New Mexico abklappern und dort in jahrzehntealten Patientenunterlagen wühlen. Ich habe schon früher schwierige Dinge gemeistert, aber die Aufgabe, die Soc mir hier gestellt hat, ist nicht einfach nur schwierig. Sie ist unmöglich! Wieder tigerte ich durchs Hotelzimmer und führte Selbstgespräche: »Tut mir leid, Soc, diesmal nicht! Ich werde nicht monatelang den Don Quijote der Mojave spielen und jeden Stein im Südwesten umdrehen. Das kann ich nicht und das werde ich auch nicht!«
Andererseits konnte ich nicht beiseiteschieben, was er mir für den Fall angekündigt hatte, dass ich mit leeren Händen, ohne das Buch, nach Japan kommen würde: als »Suchender, der um milde Gaben der Einsicht bittet«. Außerdem hatte ich Socrates noch nie etwas abgeschlagen. In diesem Augenblick fiel mir eines meiner Lieblingsbücher ein: Der Herr der Ringe, wo erzählt wird, wie dem kleinen Frodo wider jede Vernunft und Wahrscheinlichkeit das Unmögliche gelingt. Aber das ist doch nur eine Geschichte, ermahnte ich mich. Nicht das wahre Leben!
»Wenn die Gelegenheit an die Tür klopft, dann sollten deine Koffer gepackt sein« – auch das hatte Socrates einmal gesagt. Meine Koffer waren gepackt – für die Japanreise! Alles war arrangiert. Was, wenn ich diesen Brief gar nicht gefunden hätte? Was, wenn er noch im Innenfutter meines Rucksacks schlummern würde? Aber ich hatte den Brief gefunden. Oder er mich. Mit einem tiefen Seufzer schob ich ihn in mein leeres Notizbuch und steckte beides in den Rucksack zurück.
Ich fühlte mich wie hin und her gerissen. Ich wollte doch nach Japan – und nicht obskure Schriften in der Wüste suchen! »Es ist besser, das zu tun, was du tun musst, als es aus gutem Grund nicht zu tun«, lautete demgegenüber ein weiterer dieser typischen Ratschläge meines Lehrers. Musste ich dieses Buch finden?
Ich beschloss, erst einmal eine Nacht drüber zu schlafen. Zuvor erinnerte ich mich ein weiteres Mal daran, die Postkarte an meine Tochter aufzugeben, sobald ich am Honolulu Airport ankam – ein Ort der Abreise, ein Ort der Entscheidungen.
Drei
Irgendwann in dieser Nacht muss der wirbelnde Derwisch in meinem Kopf zur Ruhe gekommen sein. Als ich aufwachte, wusste ich jedenfalls sofort, dass ich mich auf die Suche machen musste – das war ich meinem alten Lehrer schuldig. Gewiss, sein Brief würde nicht nur meine aktuellen Pläne, sondern möglicherweise mein ganzes Leben ändern – ob nun zum Guten oder zum Schlechten. Aber immerhin erlaubte mir das Forschungsstipendium, den Flug nach Japan in einen nach Albuquerque umzubuchen.
Sobald ich dort ankam, lieh ich mir bei einer kleinen Autovermietung einen alten Ford Pick-up zu sehr spartanischen Konditionen: Kaution in bar, kein Pannenservice – na, dann gute Fahrt. In einem Ausrüstungsgeschäft kaufte ich mir Wanderstiefel, gegen die ich meine ausgetretenen Turnschuhe austauschte, einen großen Seesack, eine Feldflasche, einen Hut mit breiter Krempe, einen Kompass, ein Taschenmesser, eine Stablampe, einen dünnen Schlafsack, eine Spitzhacke und einen Klappspaten, Sonnenmilch und ein Buch über das Überleben in der Wüste, dessen Lektüre mir nicht gerade Mut machte. Ich stopfte alles in den Seesack und warf ihn auf den Beifahrersitz. Dann floh ich vor der drückenden Hitze des späten Nachmittags in ein Motel.
Und so kam es, dass ich Anfang September 1974 – in meinem achtundzwanzigsten Lebensjahr – im prallen Sonnenschein durch die Old Town von Albuquerque wandelte. Zunächst löcherte ich die Einheimischen mit der komischen Frage, ob und wenn ja wo es vor dreißig Jahren im Einzugsgebiet der Stadt schon irgendwelche Krankenhäuser gegeben hatte. Außerdem ging ich Socs Brief noch einmal gründlich durch, was mich bewog, parallel die Suche nach dem kleinen Mädchen anzutreten, das er auf so merkwürdige Art und Weise erwähnte. Wo beginnen? Bioläden und alternative Buchhandlungen schienen keine schlechte Wahl, in der Annahme, dass jemand, der sich einst als kleines Kind zu Socrates hingezogen fühlte, in seinem späteren Leben solche Orte aufsuchen würde. Also nervte ich die Leute dort mit Erkundigungen nach einer Frau, die Mitte dreißig sein musste, möglicherweise Emma hieß und als Lehrerin arbeitete – vielleicht. Ganz direkt erkundigte ich mich nach einem Mann namens Socrates, der hier einmal auf der Durchreise war – vor Jahrzehnten, um genau zu sein. Welchen Spuren hätte ich sonst nachgehen sollen?
Die Ladenbesitzer kannten weder eine hiesige Lehrerin namens Emma noch einen Socrates (natürlich abgesehen von dem griechischen Philosophen, sofern sie Buchhändler waren). Sackgasse auf Sackgasse, eine leere Seite nach der anderen. Im Geiste rief ich diese geheimnisvolle Emma herbei, gab mir alle Mühe, durch Raum und Zeit hindurch zu ihr in jener Sphäre vorzudringen, wo wir alle miteinander verbunden sind: Wo bist du?
Der Tag ging schon zur Neige, als in dem kleinen Plattenladen, wo ich gerade meine Fragen abspulte, eine fesch gekleidete ältere Dame mein Gespräch mit dem Inhaber mitbekam. »Verzeihung, aber sind Sie sicher, dass sie Emma heißt? Ich kenne eine Ama, die als Grundschullehrerin in einem Vorort arbeitet«, mischte sie sich ein.
Also gut. Wenig später stand ich vor einer Schule am westlichen Stadtrand. Ein Schild mit der Aufschrift: WEGEN SOMMERFERIEN GESCHLOSSEN prangte höhnisch an der Tür. Da ich nun aber schon einmal hier war, klopfte ich nichtsdestotrotz, allerdings ohne mir große Hoffnungen zu machen. Und siehe da, es erschien eine Angestellte. »Ja, eine Ama hat hier mal ein Jahr lang unterrichtet. Ich glaube, sie wechselte in eine der Pueblo-Schulen an der Route 66, westlich von hier.«
Ich bedankte mich, und im Hinausgehen bemerkte ich aus dem Augenwinkel, dass sie sofort nach dem Telefon auf ihrem Schreibtisch griff. Die Gute ist ja ziemlich beschäftigt, dachte ich noch.
Ich nahm die Spur auf, auch wenn sie mir nicht besonders heiß vorkam, und muss sie zwischendurch noch verloren haben, da ich nicht wie geplant die Schule erreichte, sondern mich irgendwann vor einer Lehmziegelhütte wiederfand, an der ich bereits vorbeigekommen war. Neben dem Eingang sah ich ein mit der Hand beschriebenes Schild: SOUVENIRS. Unter einem behelfsmäßigen Sonnendach hingen Indianerdecken, darunter stapelten sich verschiedene Töpferwaren und andere Mitbringsel aus dieser schönen Gegend. In einem Eimer lagen Bernsteinbrocken, mit Skorpionen und anderen darin eingeschlossenen kleinen Wüstenbewohnern. Mit Schaudern erkannte ich eine Tarantel, eine Wolfspinne und die ebenso scheue wie tödliche Braune Einsiedlerspinne. Etiketten an den Steinen verrieten die Namen weiteren Getiers: Rindenskorpion, Geißelskorpion, Tausendfüßler. Auf einem Regal daneben hielt eine ausgestopfte Gila-Krustenechse Wache, und in dem Glaskasten darunter schlummerten in trauter Nachbarschaft Texas-, Seitenwinder- und Mojave-Klapperschlange – allesamt extrem giftig, aber dankenswerterweise verblichen und im Übrigen exzellent präpariert. Im Gegensatz zu mir musste der Ladeninhaber mit diesen freundlichen Bewohnern der Wüste, die uns umgab, auf vertrautem Fuße stehen. Wieder einmal fragte ich mich, was ich hier überhaupt zu suchen hatte.
Eine Stimme hinter mir ließ mich zusammenfahren. »Buenos días. Wie kann ich behilflich sein?« Es schien Socs Stimme zu sein! Doch als ich mich umdrehte, erblickte ich einen ganz anders aussehenden alten Mann mit vermutlich indianischen oder mexikanischen Wurzeln. Ich hatte ihn bisher gar nicht wahrgenommen, weil er wie angegossen ganz still zwischen seinen Schätzen saß, den Blick in ein und dieselbe Richtung, irgendwo draußen in der staubigen Luft haltend, während seine Hände beiläufig Perlen an den Saum einer bunten Decke knüpften. Seine bronzefarbene Haut wirkte so trocken wie die Wüste selbst. Unwillkürlich musste ich an die uralte Nonne denken, die Socrates in seinem Brief beschrieben hatte.
»Äh, ja … ich suche nach einer Frau namens Ama. Sie ist Lehrerin, glaube ich.«
Der alte Mann zeigte keinerlei Reaktion auf meine Worte, sondern nahm seelenruhig eine Perle nach der nächsten mit langsamen, anmutigen Bewegungen in die Hand.
Ich versuchte mich an das wenige Spanisch zu erinnern, das ich in der Schule gelernt hatte. »¿Señor, sabe usted … äh, dónde está … una escuela pequeña … y una señora, ähm … con nombre Ama?«
Seine Augen hellten sich auf, und er drückte den Rücken durch.