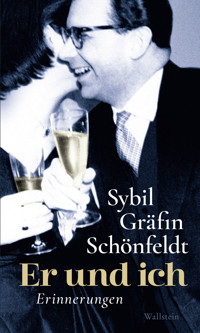17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ebersbach & simon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sybil Gräfin Schönfeldts bewegender Roman über eine Jugend unterm Hakenkreuz Die 17-jährige Charlotte steht kurz vor dem Abitur, als sie Ende 1944 zum Reichsarbeitsdienst (RAD) nach Oberschlesien eingezogen wird. Schulung, Appelle, militärische Disziplin, Kameradschaft, Treue und Gehorsam sind dem Mädchen aus einer Offiziersfamilie vertraut. Doch während sie Kartoffeln schält, Ställe ausmistet und Panzersperren baut, kommen ihr erste Zweifel am nationalsozialistischen System. Zur Gewissheit werden sie durch Charlottes Freundschaft mit Ruth, der Tochter eines Widerstandskämpfers. Eines Tages ist Ruth verschwunden – und die Russen stehen vor Stettin. "Es geht nicht um die Idee der sozialen Arbeit, die sehr viel älter ist als der Reichsarbeitsdienst und von den Nazis nur übernommen und ihren Zwecken gerecht wurde. Es geht um diese Nazis und diese Zwecke. Und eben die werden noch heute so zäh und erbittert verteidigt, dass es Schrecken verbreitet." Sybil Gräfin Schönfeldt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Sybil Gräfin Schönfeldt
Sonderappell
Roman
Inhalt
Sonderappell
Nachwort
Glossar
Sie fror. Es war morgens zwischen vier und fünf Uhr, und es regnete. Der Bahnhof war verdunkelt, und die Menschen, die auf dem Bahnsteig standen, bewegten sich kaum. Sie warteten vor dem Zug, die Türen waren noch offen, und die Mädchen standen neben den Eltern, klapperten vor Müdigkeit und Kälte und wussten nichts mehr zu sagen.
Charlotte stand neben den Großeltern. Der Großvater hatte den Kragen hochgeschlagen und die Mütze tief ins Gesicht gezogen. Seine Nase über dem grauen Schnurrbart war rot vor Kälte.
»Denk immer daran: Du trägst jetzt das Kleid des Führers«, sagte er, »du bist ein Soldat. Ein Soldat harrt dort aus, wohin ihn die Pflicht stellt.«
»Hast du auch die warme Wollunterhose angezogen?«, fragte die Großmutter, und als Charlotte nickte, hob sie ihr misstrauisch den Rocksaum hoch. Blaue Wolle, dick und warm, rechts gestrickt, mit einem Bündchen aus rechten und linken Maschen. Früher einmal ein Pullover, der Charlottes Onkel gehört hatte. Als die Großmutter erfuhr, dass Charlotte nach Oberschlesien fahren musste, hatte sie gesagt: »Ach was, bis der Junge aus dem Krieg zurück ist, braucht er den Pullover sowieso nicht. Und dann können wir immer noch weitersehen.« Daraufhin hatte sie den Pullover vorsichtig aufgeribbelt, die Wolle auf ein Holzbrett gewickelt, so lange in warmem Wasser geweicht, bis die krisselige Wolle wieder glatt aussah, und den Wickel trocknen lassen. Sie strickte schnell, und es machte ihr nichts aus, dass abends Stromsperre war. Sie konnte im Dunkeln stricken, und sie saß am grünen Kachelofen im Wohnzimmer in der Dämmerung, saß im Luftschutzkeller und strickte. Aus dem einen Pullover entstanden zwei Unterhosen, eine mit kurzen Beinen und eine mit langen. »Die wirst du schon noch brauchen«, hatte die Großmutter gesagt, und eine, die mit den kurzen Beinen, hatte Charlotte jetzt an. Die andere lag im Koffer, dem alten Schulkoffer des Onkels (»Der ist für diese Reise noch gut genug!«), und Charlotte hatte ihn schon im Abteil verstaut.
Alle Mädchen hatten wider Erwarten Sitzplätze erwischt, was im sechsten Kriegsjahr auch bei Nacht- und Nahverkehrszügen nicht selbstverständlich war. Sie würden quer durch Deutschland fahren in den Arbeitsdienst. Charlotte fuhr am weitesten. Andere Mädchen aus ihrer Klasse hatten Glück gehabt, wie die Eltern sagten: Sie kamen nur in Lager in der näheren Umgebung oder nach Sachsen. Das Ziel von Charlotte und einer anderen Klassenkameradin war ein Lager in Oberschlesien.
Charlotte war noch nie in Oberschlesien gewesen. Sie war ohnehin nicht viel gereist. Vor dem Krieg war sie noch zu klein gewesen, außerdem fuhr man höchstens zu einer Tante oder Großmutter aufs Land, und im Krieg konnte man kaum reisen, weil die meisten Hotels und Pensionen zu Genesungsheimen für Verwundete oder Heimen für die Kinderlandverschickung geworden waren. Und außerdem: Vier von den sechs Wochen Sommerferien mussten sie sich für den Ferieneinsatz verpflichten. Brombeerblätter sammeln (Wozu? Angeblich für Tee, aber Charlotte hatte die mühsam gesammelten Blätter immer nur in einem Holzschuppen hinter einem BDM-Lager auf dem Dachboden dampfend und stinkend verfaulen gesehen), Rüben verziehen, Spielzeug für den VDN basteln, in der Fabrik aushelfen. Ein Mädchen aus ihrer Klasse hatte einmal seinen Vater besucht, der als Soldat in Oberitalien stationiert war, und nach den Ferien hielt sie ein Referat über ihre Erlebnisse. Aber Charlottes Großvater kannte Oberschlesien. »Kalte Gegend!«, hatte er als einzigen Kommentar gesagt und die Herstellung der blauen Wollhosen mit Wohlwollen verfolgt.
Charlottes Großvater war fast 70. Er trug Uniform, Mütze und graugrünen Wehrmachtsmantel, Mützenrand gelb gesäumt, was bedeutete, dass er Kavallerist war, und Achselstücke geflochten, was bedeutete, dass er Major war. Er war Berufsoffizier und nach dem Ersten Weltkrieg viel zu früh pensioniert worden, weil es damals kein deutsches Heer mehr gab. Da er, wie viele, in der Inflation sein ganzes Vermögen verloren hatte, aber auch weil er sich langweilte, mit gerade 40 Jahren nichts als Major a. D. zu sein, hatte er zuerst versucht, als Kurdirektor in einer Stadt an der Ostsee, als Vertreter für Damenwäsche und als Bankangestellter zu arbeiten. Aber da er nur gelernt hatte, zu reiten und Soldaten auszubilden, endeten all diese Versuche in Pleiten, in seiner eigenen oder in der Pleite derjenigen, die so leichtsinnig gewesen waren, ihn zu beschäftigen.
Danach gab er es auf und lebte nur von seiner Pension, und da er hart und karg erzogen war, machte es ihm nichts aus, knapp und sparsam zu leben. Luxus und Wohlleben waren für ihn ohnehin Charakterschwäche, er ließ nie die Schlafzimmer heizen, und den großen kupfernen Ofen im Badezimmer brachte er selbst nur für das traditionelle Bad am Samstagabend in Glut. Er badete zuerst, dann kam die Großmutter, und wenn die Kinder an der Reihe waren, sein Sohn und Charlotte, tröpfelte das Wasser nur noch lau aus dem Hahn. Für Charlotte war es schön, dass der Großvater pensioniert war, denn er hatte immer Zeit für sie, und er brachte ihr bei, wie man jeut, wie man reitet und dass das Büchsenfett für Flinten und Gewehre auch gut gegen Rheumatismus ist. Als der Krieg ausbrach, zogen das Kind und der alte Mann los, um Holz und Kienzapfen für den Kachelofen zu sammeln, die Eier und die Äpfel, die die Bauern früher mit Pferd und Wagen in die Stadt gebracht hatten, im Rucksack zu holen und beim Briefträger, der einen großen Garten besaß, Johannis- und Himbeeren zu pflücken, die die Großmutter dann einmachte. Charlotte ging gern mit dem Großvater. Er sprach nie viel, aber er sprach jeden Menschen an, der ihn interessierte. Er unterhielt sich mit ihnen, und da er immer nur das fragte, was er wissen wollte, und das sagte, was ihm wichtig erschien, konnte Charlotte fast immer verstehen, um was es ging, und langweilte sich beim Zuhören nie.
Der Großvater war es nicht gewohnt, mit Kindern umzugehen. Selbst in der Kadettenschule groß geworden, hatte er auch seinen Sohn in ein Internat gesteckt. Seine Tochter war jedoch bei Charlottes Geburt gestorben, und so geriet er zum ersten Mal in die Gesellschaft eines Kindes. Er wäre gar nicht imstande gewesen, Charlotte anders als eine Erwachsene zu behandeln. Er erzählte ihr von seinem Elternhaus, von den Diners bei S. M. – so nannte er den letzten deutschen Kaiser –, bei dem die jungen Gardeleutnants immer leer ausgingen, weil sofort abserviert wurde, sowie S. M. den betreffenden Gang verzehrt hatte, und da er stets sehr hastig und wenig aß, wurde der nächste Gang aufgetragen, ehe die jungen Leutnants am Ende der Tafel überhaupt etwas auf die Teller bekommen hatten. Er erzählte ihr von seiner Liebschaft mit einer Soubrette und wie er es geschafft hatte, sie trotz Dienst nach Wien zu begleiten und im Varieté Ronacher zu bewundern. Er erzählte ihr, wie er und sein Bruder heimlich Hasen geschossen und an die eigene Köchin verkauft hatten, um ihr spartanisches Taschengeld aufzubessern.
Der Großvater nahm nie Rücksicht auf Charlotte, er war nicht sonderlich klug, er war auch strenger als die Väter ihrer Freundinnen, er verlangte absolute Pünktlichkeit und Ehrlichkeit, aber Charlotte wusste instinktiv, dass er der zuverlässigste Mensch auf Erden war.
Er freute sich fast, als er im Laufe des Krieges reaktiviert wurde, was bedeutete: Alle jungen und kriegstauglichen Offiziere waren entweder an der Front oder gefallen, man brauchte jedoch Männer für die Verwaltung und in den Kasernen, und deshalb holte man die alten, längst pensionierten Offiziere, so, wie man die längst pensionierten alten Lehrer und Lehrerinnen wieder geholt hatte. Mit dem bandagierten Arthritisbein auf einem Hocker oder dem Krückstock am Lehrerpult brachten diese Lehrerinnen Charlotte Französisch oder Erdkunde oder Geschichte bei und kümmerten sich nicht im Geringsten darum, dass man in der Nazizeit Geschichte anders beurteilte und interpretierte als in den Anfangsjahren der Emanzipation, in denen sie selbst studiert hatten.
Charlottes Geschichtslehrerin hatte gelassen erklärt: »Ich verstehe nichts von den Themen, die auf euren Lehrplänen stehen, und ich glaube, über den Lebenslauf des Führers und die Geschichte der Partei erfahrt ihr genügend in euren Dienstnachmittagen im BDM. Wir wollen uns stattdessen lieber um das kümmern, was bei euch offenbar bisher vernachlässigt worden ist: um das Zeitalter der Aufklärung.«
Der Großvater war stellvertretender Standortältester und Luftschutzoffizier der Stadt geworden. Er reiste auf Tagungen und erzählte Charlotte danach, wie weit man von einem Flugzeug aus selbst den Strahl einer abgeblendeten Autolaterne sehen könne. Er arbeitete Luftschutzübungen aus und hielt vor der NS-Frauenschaft Vorträge über Notwendigkeit und Art des Luftschutzes. Er fand es am sichersten, wenn man nach Einbruch der Dunkelheit überhaupt kein Licht mehr anzündete, und wachte streng darüber, dass jeder zweite Straßenbaum ein breites Band aus weißer Leuchtfarbe um den Stamm gemalt bekam, das nachts schwach schimmerte und ebenso wie die weißen Ränder an den Straßenkanten und Häuserecken die Fußgänger warnte. Als er einmal des Nachts vom Dämmerschoppen heimmarschierte und gegen einen Baum ohne weißes Band geknallt war, schimpfte er zwar wie ein Rohrspatz über diese Unzulänglichkeit, aber als sein blaues Auge wieder abgeklungen war, hatte bei ihm abermals das gesiegt, was er als Vernunft bezeichnete – »Wir müssen für den Endsieg sparen!« –, und er rannte in den Nächten ohne Mond nicht mehr so schnell und so blindlings drauflos.
Auch jetzt, auf dem verdunkelten Bahnhof, war sein Erstes gewesen, einen Beamten darauf hinzuweisen, dass an der Tür zur Fahrdienstleitung offenbar die Lichtschleuse fehlte: Das war ein dicker, schwarzer Vorhang, der hinter den Türen hing und verhinderte, dass Licht nach draußen fiel, wenn man den Raum verließ.
»Hast du auch genug zu essen mit?«, fragte die Großmutter.
»Ach Liebchen, mehr als genug!«
Die Großeltern hatten ihre gesamten Fleischmarken geopfert, damit »das Kind was Ordentliches auf dem Butterbrot hat«, wie die Großmutter zufrieden gesagt hatte, als sie den Stapel mit den Klappstullen in Butterbrotpapier einwickelte und auf jedes Päckchen mit ihrer feinen, ordentlichen Schrift schrieb: Leberwurst. Käse. Schmierwurst. Wie früher, wenn wir das erste Picknick im Wald gemacht haben, dachte Charlotte, und sie hatte plötzlich das Gefühl, dass etwas zu Ende ging.
Dann war noch die Nachbarin gekommen und hatte Äpfel und hart gekochte Eier gebracht. Sie stammten von Hühnern, die samt zwei Schafen in der ohnehin nicht mehr gebrauchten Garage lebten. Die privaten Autos waren gleich nach Kriegsbeginn beschlagnahmt worden: zuerst die Reifen, und als die Autos ein Jahr lang traurig und aufgebockt dagestanden und Staub gesammelt hatten, auch der Rest. Charlottes Großvater hatte seine Garage ganz aufgegeben.
»Wenn wir diesen Krieg gewinnen sollten, dann können wir immer noch sehen, was wir machen. Wenn wir ihn verlieren, dann gibt’s für uns sowieso kein Auto mehr.«
Äpfel von dem Baum, unter dem sich Charlotte mit den Nachbarskindern ein Zelt aus alten Decken gebaut hatte. Den sie im Blütenfrühling gezeichnet und dabei zum ersten Mal entdeckt hatte, wie gut helle Pastellkreide auf grauem Tonpapier wirkt. Der Kletterbaum. Der Baum, um den sie beim Kindergeburtstag Ringelreihen und Fangen gespielt hatten. Äpfel aus dem Paradies, blank gerieben und oben auf den Beutel mit all den Butterbroten gepackt, die sie sofort mit ihrem sanften, frischen Aroma durchdrangen.
Endlich ein Signal, Unruhe und lauter letzte Sätze: Hast du auch ein Taschentuch? Denk immer daran: anständig bleiben! Und schreib uns gleich, wenn du angekommen bist!
Die Mädchen stolperten in die Abteile. Die Brotbeutel prallten dumpf gegen die Holzwand. Wo sitzt du? Ist das mein Koffer? Mach doch noch mal ein Fenster auf!
Schemenhaft weiße Taschentücher, auf und ab. Tränen? Vielleicht, aber die meisten waren zu müde und hatten zu lange auf dem Bahnsteig gestanden. Sie waren froh, dass die Wartezeit vorbei war, und sie waren es gewohnt, irgendwohin transportiert zu werden: Fahrten mit dem BDM, Kriegseinsatz, Schulungen, Aufmärsche, Laienspiel vor Verwundeten, Ferieneinsatz.
Sie waren auch darin geübt, sich überall einzurichten. Auf Heuböden, Luftschutzmatratzen, in Wartesälen. Sie machten es sich auf den harten Holzbrettern so gemütlich wie möglich. Die Waggons waren nicht geheizt und nicht verdunkelt: Die Zugbeleuchtung wurde überhaupt nicht mehr angeschaltet, und ein milchiges Dämmerlicht drang durch die Scheiben, manchmal stoben rote Funken aus der Lokomotive vorbei. Langsam rappelte und klapperte der Zug durch die Nacht. Es war der 9. November 1944, und Charlotte und ihre Klassenkameradinnen waren 17 Jahre alt.
100 Kilometer weiter, dreimal umsteigen. Später verließen sie in einer Stadt am Rande des Harzes endgültig die fahrplanmäßigen Züge und mussten sich in einer leeren Schule melden, wo sich alle Mädchen des Jahrganges sammelten. Suppe aus dem Kochgeschirr. Ein paar Stunden warten. Bummel durch die Stadt mit den sechs anderen Klassenkameradinnen.
»Hoffentlich«, schrieb Charlotte auf der ersten Postkarte nach Hause, »werden wir in der Schule nicht schon in Lager eingeteilt, dann können wir sieben nicht mehr zusammen reisen. Ich schreibe Euch so bald wie möglich wieder …«
Unten auf der Karte unter »Absender …« stand im gleichen Violett wie die Sechspfennig-Führerbriefmarke gedruckt: »Der Führer kennt nur Kampf, Arbeit und Sorge. Wir wollen ihm den Teil abnehmen, den wir ihm abnehmen können.« Darunter quetschte Charlotte noch mit Bleistift: »Mit tausend Küssen, Eure Charlotte.«
Am Spätnachmittag wurden sie lagerweise eingeteilt und marschierten mit ihrem Gepäck wieder zum Bahnhof. Erste Trennung. Adressenaustausch. »Schreib, aber bestimmt!« Sonderzug Sammeltransport. Ungeheizt. Jedes Mädchen hatte seinen Sitzplatz, aber die Fensterscheibe in Charlottes Abteil war entzwei. Sie wickelten sich zuerst in Mäntel und in Schals. Charlottes Großmutter hatte ihr im letzten Moment noch die alte Schuldecke ihres Onkels oben an den Koffer gebunden. Charlotte löste jetzt den Bindfaden, und sie deckten sich die graue Wolldecke über die Knie. Als der Zug jedoch losfuhr, pfiffen Wind und Regen so durch das Loch, dass die Mädchen Alarm schlugen. Irgendwann kam ein Bahnangestellter und klemmte dicke Pappe vors Fenster. Es zog immer noch, aber es war nicht mehr so schlimm. Sie rückten dicht zusammen, damit eine die andere wärmte.
Als sie sich gerade eingerichtet hatten, hielt der Zug noch einmal, fast auf freiem Feld. Ein Trupp Mädchen stand im Nieselregen und kletterte herein. Eines kämpfte sich durch den Gang hindurch und hielt erschöpft vor ihrem Abteil.
»Ist hier noch Platz?«
Die Mädchen schauten sich um und lachten. Sie hockten dicht gedrängt, zu fünft auf den Holzbänken, die für vier Personen gedacht waren.
»Wirklich nicht?«, fragte das fremde Mädchen.
»Nicht mal im Gepäcknetz!«, antwortete eine.
»Was?«, fragte eine kleine Schwarzhaarige neben Charlotte. »Daran haben wir ja noch gar nicht gedacht!« Sie stand auf, sagte zu dem fremden Mädchen: »Warte mal!«, stieg auf die Bank und begann, die Koffer und Rucksäcke so umzuschichten, dass sie sich in dem einen Gepäcknetz gerade noch hielten, ohne beim nächsten Ruck des Zuges herauszufallen, während sie das leere Netz mit ihrer Wolldecke auspolsterte. »So!«, sagte sie stolz. »Schlafwagen erster Klasse! Wenn wir da umschichtig schlafen, ist immer ein Sitzplatz für dich frei!«
Das fremde Mädchen lächelte zögernd.
»Mensch«, protestierte ein anderes Mädchen, »das Netz kracht doch durch!«
»Na gut, dann lieg’ ich mal Probe!« Die Schwarzhaarige turnte, von den anderen gestützt und geschoben, ins Gepäcknetz, legte sich vorsichtig hin und stöhnte begeistert: »Herrlich, sag’ ich euch. Wie in Abrahams Schoß!«
»Das war ein Jude!«
»Na und?«, fragte die Schwarzhaarige unbekümmert. »Auf Blut und Boden kann ich nicht pennen!«
Eins der Mädchen begann nach der Melodie von Frère Jacques zu summen:
»Blut und Boden, Blut und Boden –
Erbhof, Erbhof –
viele, viele Kinder, viele, viele Kinder,
Mutterkreuz, Mutterkreuz!«
Ein anderes Mädchen fiel in den Kanon ein, und die Schwarzhaarige übernahm eine Terz tiefer die dritte Stimme.
»Seid ihr verrückt?«, fragte das fremde Mädchen. »Damit könnt ihr euch doch um Kopf und Kragen singen!«
»Wieso?«, fragte die Schwarzhaarige von oben und schaute zu, wie sich die Neue auf ihrem alten Platz einrichtete. »Singt ihr das denn nicht? Das ist doch nur Spaß!«
»Ich komme aus Berlin«, antwortete die Neue, »da nimmt man so was nicht als Spaß.«
Die andern schwiegen und schauten die Neue an. Niemand sagte etwas, und Charlotte war das Schweigen unbehaglich. War das eine Hundertfünfzigprozentige, wie der Großvater die fanatischen Nazis nannte? Oder hatte sie Angst? Hing das mit dem 20. Juli zusammen, mit dem Attentat auf den Führer? Sie erinnerte sich, wie irgendeiner von den Offizieren, die den Großvater manchmal besuchten, davon erzählt hatte, dass in Berlin Leute verschwunden seien und dass sich »das Klima verändert hatte«, worunter sich Charlotte nichts hatte vorstellen können.
Sie musterte das fremde Mädchen nachdenklich. Was mochte in Berlin wirklich anders sein als in der kleinen Stadt, aus der sie kam?
Da drehte sich die andre um und erwiderte Charlottes Blick. Einen Augenblick lang schauten sie sich stumm an. Das andere Mädchen hatte blonde Zöpfe, die mit zwei verschiedenen Zopfspangen zusammengehalten wurden. Charlotte lachte unterdrückt.
»Warum lachst du?«, fragte das andere Mädchen misstrauisch.
»Ich hatte mal eine Freundin«, Charlotte kicherte, »die verlor auch immer ihre Zopfspangen!«
Die andere lächelte zögernd. »Ja, und in Berlin kriegt man auch keine mehr.«
»Das ist bei uns genauso«, antwortete Charlotte.
Sie schauten sich wieder an, und Charlotte dachte: Nee, ‘ne Nazisse ist die bestimmt nicht, aber anders ist sie doch.
»Ich heiße übrigens Ruth«, sagte das fremde Mädchen.
Sie rollten durch Nacht und Tag, und abermals durch Nacht und Tag. Sie rollten, und sie hielten. Trupps von Mädchen stiegen aus, andere stiegen zu. Sie rollten und standen auf Abstellgleisen, und sie sahen, wie die fahrplanmäßigen Züge, wie Truppentransporte und Lazarettzüge an ihnen vorüberfuhren. Sie hielten des Nachts auf offenem Feld, und über ihnen brummten die Pulks von eigenen oder feindlichen Bombern vorbei. Sie standen in der Nacht, und die Gegend war taghell erleuchtet von Tannenbäumen, die langsam zur Erde segelten und den englischen und amerikanischen Bombern zeigten, wo ihre Ziele lagen. Flakscheinwerfer huschten wie weiße Lichtfinger durch das Dunkel, die Mädchen hörten die Detonation von Bomben, oder sie spürten nur, wie die Erde von unsichtbaren Einschlägen bebte. Sie sahen das ferne rot-düstere Flackerlicht am Horizont. Sie schliefen. Sie aßen ihre Butterbrote. Sie unterhielten sich. Sie bekamen auf leeren, verstaubten Bahnhöfen von NS-Schwestern in Kriegsuniform oder von der Frauenschaft aus den immer gleichen großen Aluminiumtöpfen den immer gleichen dünnen heißen Ersatzkaffee, manchmal mit Magermilch, in den Blechdeckel vom Kochgeschirr oder in die Feldflasche gekippt, und sie gingen auf dem Bahnsteig hin und her, die klammen Hände um die Becher gelegt, um die steifen Glieder zu bewegen. Sie steckten den Kopf unter die Pumpe, wenn es eine Pumpe mit Wasser gab, wuschen sich die Hände, putzten sich die Zähne und trockneten sich mit ihren Taschentüchern ab. Dann stiegen sie wieder ein und setzten sich wieder auf ihre Holzbänke. Sie konnten im Sitzen schlafen, ohne umzukippen, und sie schliefen oft. Sie verloren das Gefühl für Zeit und Ort. Sie froren nachts mehr als am Tag, und sie sprachen kaum noch miteinander. Manchmal hatten sie einen Anfall von Lustigkeit, neckten sich gegenseitig, kreischten und kicherten, erzählten von der Schule, spielten Kinderspiele wie »Ich sehe was, was du nicht siehst«, gerieten sich in die Haare und keiften, dann war es wieder vorbei, und sie fuhren und hielten und hielten und fuhren. Der Zug wurde geteilt, Waggons an andere Züge gekoppelt, es gab Abschiede und immer wieder den Satz: »Mach’s gut. Schreib mal.«
Der Beutel mit den Butterbroten wurde dünner, aber die Äpfel dufteten immer noch, und Charlotte hütete sie und aß nur dann einen, wenn ihr Durst zu groß wurde.
Irgendwann am dritten Tag waren sie fast am Ziel. RAD-Führerinnen drängelten sich durch den Zug, riefen die Namen der Lager auf und kündigten an, wer in Oppeln und in Breslau den Sammeltransport verlassen müsse und wer sich dann wo, bei wem zu melden habe. Charlotte kam mit ihrer Klassenkameradin und ein paar anderen Mädchen zusammen in ein Abteil und fragte: »Ist unser Lager so klein?«
»Nein«, sagte eins von den anderen Mädchen, »die meisten hier aus der Umgebung sind aber sicher schon da.«
»Schon lange?«
»Ach wo. Und du brauchst keine Angst zu haben. Wir haben nicht viel versäumt.«
Charlotte schaute aus dem Fenster: flach, flach, flach. Nur Kiefernwälder und Wiesen, wenig Dörfer, manchmal ein rauchender Schornstein, der Zwiebelturm einer Kirche. Es schneite dünn und staubig, aber der Schnee blieb nur in den tiefsten Furchen liegen.
Und dann waren sie da. Sie sammelten ihr Gepäck zusammen. Der Zug hielt an. Sie stiegen aus und standen wieder auf einem Bahnhof. Wie betäubt vom langen Sitzen und Fahren, stolperten sie mit ihren Koffern hinter der Führerin her. Es war fünf Uhr nachmittags, es begann gerade dunkel zu werden, und das graue Licht, das den Horizont schon verschluckt hatte, ließ alles noch trübseliger erscheinen. Der stumme Bahnhof stand einsam und verlassen zwischen schwarzen Feldern. Kein Baum und kein Strauch, keine Straße, nur ein von Radspuren aufgeweichter Lehmweg, der über einen Hügel führte.
Charlotte hatte braune Halbschuhe an, und nach den ersten Schritten war nichts mehr davon zu sehen. Sie hatte Mühe, die Füße aus dem schmatzenden Lehm zu ziehen, ohne die Schuhe zu verlieren. Selbst ihre Baumwollstrümpfe, zwei-rechts-zwei-links, waren lehmbespritzt, als sie den Hügel erklommen hatten. Dahinter senkte sich das Land zu einem flachen Tal, gleich vor ihnen ein altmodisches, großes Haus inmitten von Bäumen, dahinter erstreckte sich ein Dorf, von dem man nur die Dächer und den Kirchturm sah, der Rest verlor sich in bewaldeten Hügeln.
»Das ist unser Lager«, sagte die Führerin.
»Das große Haus?«, fragte Charlotte, freudig erstaunt, weil sie auf die üblichen verkommenen Baracken gefasst gewesen war.
»Ja. Früher ist es ein Gutshaus gewesen. Sehr geeignet für unsere Zwecke.«
Das Haus hatte ein gemauertes Fundament, der erste und der zweite Stock waren aus Holz, und die Balkone, die nach der Manier des ausgehenden 19. Jahrhunderts überall angebaut waren, hatten Geländer, die im gleichen grauen verwitterten Holzton schimmerten.
Im Park konnte man ein Rondell aus Buchshecken erkennen, und wo früher vielleicht ein Marmorputto oder eine Urne zwischen Rosen gestanden haben mochte, erhob sich die Fahnenstange.
Sie betraten das Haus durch den Hintereingang. Die Tür zur Küche stand offen, und Charlotte sah einen großen Raum, der nur trüb durch eine schwache Birne erleuchtet wurde, die hoch oben von der Decke pendelte. Links war ein riesiger Kohlenherd eingemauert, auf dem drei oder vier gewaltige Aluminiumtöpfe standen. Die Mitte des Raumes nahm ein langer Holztisch ein, an dem zwei Mädchen in blauen Leinenkleidern und mit roten Kopftüchern saßen und Weißkraut klein schnitten. Sie schauten stumm auf und erwiderten Charlottes Lächeln nicht. Sie schnitten weiter, und eine von ihnen streute eine Handvoll Kümmelkörner auf das geschnittene Kraut.
Die Führerin rief: »Bitte Beeilung! Ihr könnt vor dem Abendessen noch eure Spinde einräumen!«
Die Mädchen liefen hinter ihr her die Treppe hinauf. Im ersten Stock öffnete sich eine Halle, um die herum eine Reihe von Zimmern lag. Die meisten Türen standen offen, und in einer Tür lehnte ein großes, stattliches Mädchen mit roten Haaren und schrie: »Los, los, die Neuen sind da!«
»Platz gemacht«, sagte die Führerin, »in diese Kameradschaft kommen auch noch zwei.« Sie deutete auf Charlotte und ein anderes, dünnes Mädchen, das in Breslau zugestiegen war und seitdem noch kein einziges Mal den Mund aufgemacht hatte, und sagte: »Da hinein. Und danach gleich in die Kleiderkammer zum Einkleiden!«
Charlotte schaute sich nach Ruth um, konnte sie jedoch nirgends erblicken. Dann warf sie ihrer Klassenkameradin einen Blick zu, beide zuckten die Achseln, und Charlotte nahm ihren Koffer und trat in den kleinen Raum, an dem an jeder Längswand drei Betten standen. Ein Bett, das in der linken Ecke, war ein Doppelbett, eins über dem anderen, und ihm gegenüber stand ein großer Kachelofen. An einer Schmalseite war die Tür, an der gegenüberliegenden zwei Fenster. Neben jedem Bett stand ein Küchenschemel, und jedes Bett war adrett mit blau und weiß karierten Überzügen gemacht.
»Hast du das andere Mädchen gekannt?«, fragte die Rothaarige und verkündete gleich: »Ick heiße Hertha.«
»Ja. Wir sind in eine Klasse gegangen.«
»Oberschule?«
»Ja. Turnabitur haben wir schon gemacht.«
»Na, dann ist ja alles klar. Oberschülerinnen werden immer getrennt. Du wirst schon noch sehen.«
Die beiden Neuen standen unschlüssig zwischen den Bettenreihen.
»Was ist hier denn noch frei?«, fragte Charlotte. Hertha zeigte auf zwei von den ordentlichen Betten und erklärte: »Natürlich die mit den dünnsten Strohsäcken. Aber keine Sorge, in den nächsten Tagen sollen wir frisches Stroh kriegen.«
»Wieso?«
»Na, die hier sind noch von der vorigen Belegschaft, und wenn man ein halbes Jahr lang auf einem Strohsack geschlafen hat, dann ist da nur noch Häcksel drin.«
»Und wo schläfst du?«
Hertha kicherte und zeigte auf das Bett neben dem Kachelofen. »Da. In der Hoffnung, dass wir mal ‘ne Kohlenzuteilung für den Ofen bekommen und das Ding geheizt werden kann.«
»Hier wird nie geheizt?«, flüsterte die Dünne mit entsetzter Piepsstimme. »Dann geh’ ich ein!«
»Ach was«, sagte Charlotte, gelernte Kaltschläferin, und wollte sich probeweise auf ihr Bett, das mittlere, neben Hertha, niederlassen. Da schrie Hertha: »Mensch, pass doch auf!«
Charlotte schnellte erschrocken wieder hoch und fragte: »Was ist denn?«
»Also erstens«, sagte Hertha, »ist sonst die ganze Schönheit hin. Und zweitens: Guck erst mal nach, ob du auch genug Holzlatten hast.«
»Wo?«
»Unterm Strohsack natürlich! Also ick weiß wirklich nicht, was ihr ohne mich machen würdet! Das ist doch ganz klar, dass man zuerst mal nach den Latten guckt.«
Charlotte schaute das andere Mädchen an, das das Bett neben ihr, am Fenster, belegt hatte, und beide brachen in hysterisches Gelächter aus. Dann griff Charlotte Laken und Strohsack mit beiden Händen und hob sie hoch. Hertha und das andere Mädchen stellten sich neben sie. Schweigend betrachteten sie die rohen Holzlatten, die dicht nebeneinander quer im Bettgestell lagen.
»Da haste ja Glück gehabt«, stellte Hertha fest.
»Wieso Glück?«
»Weil sie einem immer die Holzlatten klauen. Wenn du nämlich Küchendienst hast, dann musst du sehen, wie du das Feuer in Gang kriegst, damit der Kaffee oder die Suppe rechtzeitig fertig ist, und Holz gibt’s hier im Lager nicht, deshalb organisiert man sich die Latten als Anmachholz.«
Schweigend ließ Charlotte Strohsack, Laken und Decke wieder fallen und ging mit den anderen zum Bett am Fenster.
»Bei mir fehlen sicher zwei. Oder drei? Was meinst du?«, jammerte das dünne Mädchen.
»Drei«, stellte Hertha fest. »Wie heißt ihr eigentlich?«
»Ich heiße Charlotte«, sagte Charlotte.
»Und ich Ingrid.«
»Na gut, Ingrid, wein man nich, ick beschaff’ dir schon deine Latten.« Sie nahm Charlotte und Ingrid gleich mit, um ihnen den Raum mit den Spinden zu zeigen. »Und die Kleiderkammer ist ganz unten. Macht schnell, sonst müsst ihr Schlange stehen!«
Charlotte und Ingrid trappelten nach unten in den Keller, und Hertha hatte recht gehabt: Die anderen Mädchen standen schon vor ihnen und warteten.
»Seit 1939 hat’s hier keine Neuanschaffungen gegeben«, murmelte eins der Mädchen. »Wenn wir Pech haben, erwischen wir nur abgetragenes Zeug!«
»Ach, nun unk man nicht immer«, sagte ihre Nachbarin, »dafür ist alles frisch gewaschen und gereinigt.«
»Und geflickt«, sagte das erste Mädchen, und dann waren die beiden an der Reihe.
Die Einkleidung ging schnell. Eine große, dicke Führerin, die Charlotte noch nicht gesehen hatte, stand in der Kleiderkammer hinter einer langen Theke, eine bereits eingekleidete Maid half ihr, und dann bekam Charlotte, ebenso wie die anderen, ein sandbraunes Kostüm, einen sandbraunen langen Wollmantel, einen Hut, eine Bluse mit langen Ärmeln, eine Bluse mit kurzen Ärmeln, ein rotes Kopftuch, Stiefel mit Metallnägeln auf der Sohle, Halbschuhe, Holzpantinen, eine Strickjacke, braun mit rot-grünem Rand, eine Umhängetasche, ein blaues Kleid, das mit Weiß und Schwarz sehr stark geflickt war, eine Schürze, eine Windjacke, zwei lange braune Unterhosen, so weit, dass Charlotte sie sich zweimal um den Bauch hätte wickeln können, außen glatt und kunstseidig, innen aufgeraut – »Stukas«, sagte Hertha später. »Sturzkampfflieger: gehen ganz bis nach unten!« –, dazu zwei Unterröcke, einen Trainingsanzug von ebensolchen Ausmaßen wie die Unterhosen, zwei Paar Wollstrümpfe, ein Paar Rechts-Links-Strümpfe (Ackerfurchenstrümpfe, wie sie in Charlottes Schule hießen), Hemden und ein wollenes Unterziehjäckchen. Das Nachthemd, kleinste Militärnummer, wurde Charlotte wieder vom Stapel genommen, weil es ganz zerschlissen war.
»Wird morgen nachgeliefert«, sagte die Dicke, »muss ich vom Ersatz holen.« Sie hatte Charlotte genau wie die anderen mit einem Blick gemustert, dann nach den Kleidern gegriffen und »Passt!« und »Die Nächste!« gesagt, und wer fertig war, stolperte mit seinem Stapel vorwärts.
»Gleich in die Spinde einräumen!«, sagte die Führerin, und die andere Maid setzte hinzu: »Erst anprobieren: Wenn’s nicht passt, gleich wiederkommen und umtauschen!«
Die Mädchen schwankten nach oben, packten die Hälfte in die Spinde und probierten die anderen Sachen zwischen den Schränken an. Charlotte passte alles bis auf das Kostüm, das zu weit war. Sie rannte wieder hinunter, und als sie ein anderes Kostüm auf dem Arm hatte, fragte sie: »Kann ich vielleicht noch eine Wolldecke haben?«
Die Führerin warf ihr einen prüfenden Blick zu.
»Sind oben zu wenig?«
Charlotte nickte. »Nur zwei in jedem Bezug.«
»Wollen die anderen auch noch welche?«
»Ich glaube schon.«
»Na ja«, seufzte die Führerin, »die Sache ist nur die, wir haben die Wintersachen noch nicht. Da muss was dazwischengekommen sein. Oder der Transport ist bombardiert worden, was weiß ich. Wir haben auch keinen Bindennachschub gekriegt. Und keine Marmelade.«
Charlotte blieb abwartend stehen. Die andere Maid hatte das zu weite Kostüm wieder weggeräumt und schaute die Führerin ebenfalls an.
»Ich weiß auch nicht«, sagte die Dicke wie zur Verteidigung, und dann rappelte sie herunter: »Es ist unsere Pflicht, in Treue zu unserem Führer Opfer zu bringen.« Sie stieß die Luft aus und setzte hinzu: »Also, wir haben keine Decken.«
»Ja«, antwortete Charlotte, »danke schön.«
Die beiden hinter der Theke schauten ihr nach, wie sie aus der Kleiderkammer lief, und die Dicke seufzte. »Und die Fleischrationen sind auch noch nicht da.«
Im ersten Stock waren die Mädchen noch dabei, ihre Sachen zu probieren und einzuräumen. Charlotte hängte das Kostüm auf den Bügel und fragte: »Muss man die Stukas eigentlich auch anziehen?«
»Ich behalte meine eigenen Unterhosen drunter«, sagte Ingrid, »aber die Stukas finde ich gut. Die halten einem wenigstens den Podex warm.«
Charlotte faltete ihre blaue Strickhose ordentlich zusammen und legte sie auf den Stapel mit der Unterwäsche. Zur Not, dachte sie, kann ich die nachts anziehen. Wenn sie nur nicht so kratzen würde.
Als Ingrid und sie mit Waschsachen und Nachthemden wieder in ihre Kameradschaft kamen, stand Hertha mit drei Latten unterm Arm da.
»Woher hast du die denn so schnell?«, fragte Ingrid und baute die Bretter sofort ein.
»Organisiert«, erwiderte Hertha.
»Was heißt das?«, fragte Charlotte.
Ingrid kicherte. »Ist doch klar: Aus einem Bett geklaut, in dem noch keiner schläft. Nicht?«
»Genau«, sagte Hertha.
»Aber …«, begann Charlotte, »das ist doch …«
»Halt bloß keine Moralpredigten!«, warnte Hertha. »Besonders du nicht!«
»Was hat das mit mir zu tun?«, fragte Charlotte aufgebracht. »Geklaut ist geklaut.«
»Ach, misch dich da doch nicht ein«, sagte Ingrid.
»Und was das mit dir zu tun hat, wirst du schon noch merken«, erwiderte Hertha freundlich, »und außerdem: Organisieren ist nicht klauen. Alles ist hier für alle da. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Bloß: Es reicht nicht für alle, und da haben wir selber dran schuld, sagt mein Vater, aber nun wär’s nicht mehr zu ändern, und du musst nur schnell sein, wenn’s ans Verteilen geht. Und außerdem: Wo kommst du denn eigentlich her, dass du nicht weißt, was organisieren ist?«
»Ich –«, antwortete Charlotte, »also: Bei uns, da war so was nicht nötig.«
»Na, dann kommst du wohl aus dem Paradies! Hat’s denn bei euch immer alles gegeben?«, fragte Hertha ungläubig.
Charlotte dachte nach. Alles gegeben? Nein, alles gegeben hatte es nicht. Die Großmutter schnitt jedes Mal, wenn sie ein frisches Brot gekauft hatte, Kerben in die Rinde, etwa zwei Finger breit für jeden Tag. Sie kochte Marmelade aus Hagebutten und Schlehen. Sie stampfte fein gewiegte Küchenkräuter mit Salz und Selleriekraut und Lauch und Salbei als Fleischwürzenersatz ein. Sie kochte zu Weihnachten steifen Grießbrei, würzte ihn mit Bittermandelaroma und rollte kleine Kugeln daraus – »Wie Marzipan! Man schmeckt den Unterschied fast gar nicht!« – Nein, schon im letzten Sommer vor dem Krieg hatte es keine Schokolade mehr gegeben, daran konnte sich Charlotte noch genau erinnern. Aber: Man hatte sich beholfen, hatte sich auch gegenseitig ausgeholfen, hatte gehungert und verzichtet, aber dieser Hunger und diese Verzichte waren nie bis an die Grenze des Unerträglichen gegangen. Sie hatten gehungert, aber nicht gedarbt. Und organisieren: Nichts hätte der Großvater verächtlicher gefunden. Er duldete es, dass sich die Großmutter plötzlich mit dem Kolonialwarenhändler gutstellte, damit er ihr die Haferflocken oder die Grütze auf die aufgerufenen Abschnitte der Lebensmittelkarten auch wirklich verkaufte. Er duldete es auch, dass sie einen alten kleinen Teppich bei ihrem ehemaligen Gemüsebauern gegen einen Sack Kartoffeln eintauschte. Aber er hätte keiner Unredlichkeit, keinem Organisieren zugestimmt, und wenn es ihn und seine Familie das Leben gekostet hätte.
»Bei uns war’s sicher besser als bei euch in der Großstadt«, sagte Charlotte schließlich, »aber wieso weißt du hier so gut Bescheid?«
»Ick war als Erste hier, und da wohnten noch die Letzten von der vorigen Belegschaft im Haus. Na, da hab’ ick schön die Ohren aufgeknöpft.«
In der offenen Tür zur Halle hatten sich ein paar andere Mädchen angesammelt. »Icke hält Volksreden«, stellte eins von ihnen fest.
»Aber wenn’s stimmt«, erwiderte Hertha kriegerisch.
»Icke?«, fragte Charlotte.
»Weil ick aus Berlin bin«, antwortete Hertha.
»Und weil sie immer sagt: icke, icke, icke! Immer weiß sie alles am besten, immer hat sie recht!«
Hertha zuckte die Schultern. »Lass man«, sagte sie friedlich, »also und: Icke geh’ jetzt essen!« Traudel, Charlottes Klassenkameradin, schob sich zwischen den anderen Mädchen durch und musterte Charlottes Bett.
»Du hast auch einen platten Sack erwischt«, sagte sie.
»Ja«, erwiderte Charlotte, »Pech mit den Zimmern. Icke behauptet, das wäre Absicht.«
»Die gibt an wie zehn nackte Neger. Essen wir erst mal.«
Unten ertönte ein Gong.
»Das heißt: futtern!«, schrie Hertha und stürmte davon. Die anderen Mädchen folgten ihr, und die Treppe erdröhnte vom allgemeinen Getrampel.
»Komm«, sagte Traudel schon in der Tür.
Charlotte schüttelte den Kopf. »Ich hab’ noch zwei belegte Brote. Das reicht mir.«
»Na gut«, sagte Traudel, »guten Appetit!«
Als die anderen fort waren, setzte sich Charlotte auf ihr Bett und holte das letzte Paket aus dem Brotbeutel. »Salami« stand in der ordentlichen Schrift auf dem Butterbrotpapier. Salami gab’s auch auf Zuteilung nur noch selten. Vielleicht war das der Rest von einer Urlauberwurst, von der die Großmutter ein Stück dafür bekommen hatte, dass sie jemandem aus der Nachbarschaft aus alten aufgetrennten Kleidern oder Gardinen etwas Neues genäht hatte. Die Großmutter konnte so gut nähen wie eine Schneiderin, und da die Kleiderpunkte, für die man Stoff oder Kleider bekam, niemals ausreichten, und die Kriegsstoffe außerdem immer schlechter geworden waren, wenn man überhaupt welche ergatterte, waren die meisten Familien dazu übergegangen, aus alt neu zu machen. Und wer selbst nicht nähen konnte, war gern bereit, etwas für das Nähen einzutauschen: echten Tee oder Kaffeebohnen aus den spärlich zugeteilten Rationen, Obst oder Gemüse aus dem eigenen Garten, einen Eimer Schafsmist für die Tomatenplantage, die die Großmutter mit Erfolg auf dem Balkon begonnen hatte.
Charlotte legte sich lang ausgestreckt auf das Bett und kaute langsam und genussvoll. Wie hier das Essen wohl sein würde? Kohl mit Kümmel zum Abendessen. Der Geruch zog durchs ganze Haus, und Charlotte stand auf und machte die Tür zu und das Fenster auf. Draußen war es fast dunkel. Sie konnte gerade noch erkennen, dass unter dem Fenster ein Teil des alten Gemüsegartens lag. Verunkrautete Beete, ein gemauerter Komposthaufen, um den sich offensichtlich seit Jahren niemand gekümmert hatte, zwei, drei niedrige Hütten oder Schuppen, dann ein Zaun und dahinter eine Zeile Katen, eine wie die andere, einstöckig, zwei Fenster, eine Tür, die in die kleinen Gärten führte, die musterhaft und bis an die Zaungrenzen ausgenutzt waren, dazu noch ein kleiner Stall. Dahinter streckte sich das Land endlos ins Grau, ganz fern am Horizont ein dunkler Streifen Wald.
Charlotte lehnte das Fenster etwas an. Es war kalt geworden, aber die frische Luft tat gut. Sie legte sich wieder auf ihr Bett und holte den letzten Apfel heraus. Er hatte ein paar Druckstellen bekommen, aber er duftete unverändert.
Charlotte rieb ihn mit einem Zipfel des Bettlakens und biss kräftig in das saftige Fleisch. Im Zimmer konnte man fast nichts mehr sehen, aber sie hatte keine Lust, die Verdunkelung herabzurollen und Licht anzumachen. Sie blieb im Dunkeln liegen und aß den Apfel samt Stumpf und Kernen langsam auf. Draußen auf der Treppe erklangen Schritte. Eine Tür nach der anderen wurde aufgerissen und wieder zugeklappt. Dann ging die Tür von Charlottes Kameradschaft auf. Charlotte sah nur die Silhouette im Türrahmen.
»Was ist denn hier los?«
Charlotte erkannte die Stimme der Führerin, die sie abgeholt hatte. »Gar nichts«, erwiderte sie.
»Es hat ja wohl laut und deutlich genug zum Abendessen gegongt«, sagte die Führerin.
»Ja, das hab’ ich gehört. Aber ich hatte noch einen Rest Brote von der Fahrt.«
»Hier gibt es keine Privatmätzchen«, sagte die Führerin eisig. »Wenn es gongt, versammeln sich immer sofort alle unten in der Halle.«
»Tut mir leid«, antwortete Charlotte, »das hast du uns aber nicht gesagt.«
»Im Reichsarbeitsdienst«, sagte die Führerin und wurde noch eisiger, »sagt man zu den Führerinnen Sie.«
»Oh«, murmelte Charlotte, »entschuldigen Sie, das hat uns auch noch niemand gesagt.«
»Machen Sie die Verdunklung zu und kommen Sie herunter«, befahl die Führerin, »allgemeine Begrüßung.«
Charlotte erhob sich steifbeinig, rollte die Verdunklung herunter, tappte im Dunkeln durch das Zimmer und ging nach unten. Die Halle schwirrte von Mädchen. Manche trugen schon die blauen Kleider, manche hatten noch ihre eigenen Sachen an. Die Mädchen vom Küchendienst schleppten Schüsseln und Tellerstapel in die Küche, der Kohlgeruch hing noch wie eine Wolke in der Luft, und alle redeten oder schrien durcheinander.
»Wo ist eigentlich das Klo?«, fragte Charlotte eins der Mädchen im blauen Kleid.
Die schaute sich flüchtig um und sagte: »Die Villa? Ach, du bist neu! Draußen, das erste Haus links um die Ecke. Aber pass auf! Da gibt’s kein Licht!«
Ehe Charlotte fragen konnte, um welche Ecke, war das Mädchen in der Küche verschwunden. Aber dann entdeckte Charlotte Traudel und zupfte sie am Ärmel. »Warst du schon auf dem Klo?«, flüsterte sie.
»Nee«, sagte Traudel, »ich wollte aber auch gerade hin.«
»Man hat mir gesagt: Das erste Haus links um die Ecke. Gibt’s denn hier im Lager keins?«
»Das ist, glaube ich, nicht für uns«, antwortete Traudel, »los, komm, wir suchen es einfach.«
Zwei andere Mädchen rannten auch die Treppe zum Hintereingang hinunter und meinten: »Sucht ihr die Villa?«
Charlotte und Traudel nickten.
»Dann kommt mit. Allein dürft ihr nach Einbruch der Dunkelheit sowieso nicht rüber.«
»Sollen wir’s durch die Rippen ausdünsten?«, fragte Charlotte.
Ein Mädchen lachte. »Ach Quatsch. Das ist wegen der Jungen aus dem Dorf und wegen der polnischen Arbeiter. Die lauern uns immer auf.«
»Die Kerle!«, sagte Hertha, die sich zu ihnen gesellte, verächtlich. »Die sollen das mal bei mir versuchen! Da kriegen sie eine von meinen Pantinen an den Kopf!«
Sie schlüpften durch die Tür, deren Glaseinsatz schwarz gestrichen war, und konnten zuerst gar nichts sehen, weil sie selbst von dem trüben Licht im Haus wie geblendet waren. Sie folgten dem Geräusch der Tritte, tappten durch nassen Lehm, prallten nach 20 Schritten fast gegen eine Wand, tasteten nach der Tür, und als sie sie aufklappten, schrien die Mädchen von drinnen: »Vorsicht! Wir haben Licht!«
Charlotte und Traudel schoben sich schnell durch die Tür. Der Raum war lang und schmal. Auf der einen Seite ein helles Holzbrett mit sieben oder acht kreisrunden Löchern. Die anderen drei Mädchen hatten sich einen Kerzenstummel auf den Fußboden geklebt und hockten auf dem Brett je über einem Loch. Charlotte und Traudel blieben unschlüssig stehen.
»Los«, sagte eins von den anderen Mädchen, »macht schnell. Ich kann meine Kerze nicht ewig brennen lassen.«
Schweigend schob Traudel die Hose runter und setzte sich neben die beiden.
Charlotte murmelte: »Ich komme später noch mal her.«
»Leer ist es hier nie«, stellte eins von den Mädchen fest, »daran musst du dich gewöhnen.«
»Ihr habt ja kein Papier!«, sagte Hertha. »Da, nimm ein Stück von mir!« Sie hielt Charlotte und Traudel ein Bündel mit zurechtgeschnittenem Zeitungspapier hin.
Anmachholz, Kerzen und Klopapier, dachte Charlotte, ob mir die Großeltern das schicken können? Aber was mach’ ich bis dahin?
Das erste Mädchen war fertig und sagte: »Los, los, die fangen gleich an!« Das Letzte pustete die Kerze aus, und gemeinsam tasteten sie sich durch die Dunkelheit zum Lager zurück.
Die Mädchen hatten sich schon fast vollzählig in dem großen Raum versammelt, der als Einziger durch eine Hängelampe aus hellem Holz etwas besser erleuchtet war. Auf dem Weg durch die Halle kam Charlotte an einem Zimmer vorbei, in dem offenbar eine der Führerinnen wohnte. Der Raum war ganz anders eingerichtet, als es Charlotte von zu Hause kannte: helle Möbel aus Naturholz, schafswollene Decken und Kissen auf dem schmalen Holzsofa, ein unglasierter Tonkrug mit einem Kiefernzweig auf einem Anbauregal. An den Wänden Holzschnitte und ein großes Bild aus gepressten Blumen.