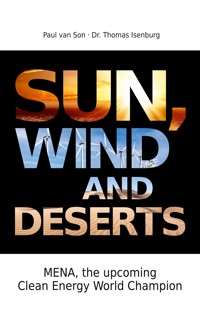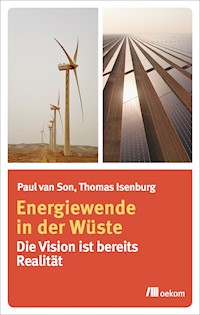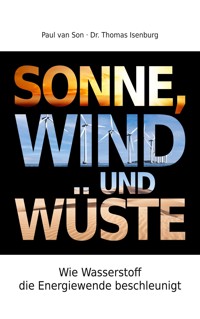
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Es gibt keinen Mangel an klimaneutraler Energie. Es gibt nur die weltumspannende Aufgabe, klimaneutrale Energiequellen sowohl lokal im Kleinen, als auch global im Großen zu erschliessen und mit den Verbrauchszentren zu verbinden. Im Mittelpunkt dieses Buches stehen die enormen Potenziale in Europas Nachbarschaft. Die riesige, sehr kostengünstige und sichere Sonnen- und Windenergie aus den Wüsten Nordafrikas und des Nahen Ostens (Middle East North Africa = MENA) wird in den nächsten Jahren in einem großen Tempo erschlossen werden. Gleichzeitig wird die Offshore-Windenergie in Europas Meeren zur tragenden Säule der Energieversorgung unserer Industrie werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die MENA-Region: Quelle erneuerbarer Energien in unserer Nachbarschaft
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Eine Welt im Umbruch
Deutschland – Energie-Importeur und Emissions-Meister
Emotionale Energiediskussionen haben in Deutschland Tradition
Ein Herz für Erneuerbare
Europas südlicher Nachbar, der grüne Lieferant der Zukunft
Dezentral oder zentral – Ist das wirklich die Frage?
Das große Umdenken
Versorgungssicherheit – nicht mehr selbstverständlich
Eine netto-emissionsfreie Energieversorgung ist machbar!
Smarte Lösungen für komplexe Herausforderungen
Kapitel 2
CO₂ ist das Problem – nicht der einzelne Energieträger
Existierende Infrastruktur maximal nutzen
Die entscheidenden Stellschrauben der Wertschöpfungskette
Nur internationales Denken kann zur Lösung führen
Kapitel 3
Klimaneutrale Energieversorgung – preiswert und sicher
Wie „die Erneuerbaren” den Markt übernehmen werden
Emissionsfreie Energie aus den Wüsten
Wurzeln der Desertec-Idee
Erneuerbare Energiequellen im Nahen Osten
Erwachendes Umweltbewusstsein
Die Ölkrisen der 70er- und 80er-Jahre
Dii Desert Energy: Initiative der Industrie zur Erschließung von Wüstenenergie
Desertec 1.0: Strom für Deutschland bzw. Europa
Desertec 2.0: Erneuerbare Energien für die MENA-Region
Desertec 3.0: Europas südlicher Nachbar wird zum Powerhouse
Kapitel 4
Middle East North Africa – Eine Region mit enormem Potenzial
Der Islam als verbindendes und teilendes Element
MENA – Ein Überblick
Marokko
Algerien
Tunesien
Drei Maghreb-Staaten – drei Wege
Ägypten
Jordanien
Die Golfstaaten (GCC)
Saudi-Arabien
Vereinigte Arabische Emirate
Oman
Erneuerbare Energien in der MENA-Region: Der Beginn exponentiellen Wachstums?
Kapitel 5
Wasserstoff, Wind und Sonne – die Treiber der Energietransition
Wasserstoff – der Gamechanger
Dem Markt auf die Sprünge helfen
Wind – eine Ressource mit unerschöpflichem Potenzial
Sonnenenergie – den Überfluss nutzbar machen
Kapitel 6
Nicht nur Energie ist entscheidend
Aufforstung – CO₂ natürlich binden?
Wasser, die blaue Herausforderung
Kapitel 7
Klimaneutralität: Schaffen wir das? Wir schaffen das!
Emissionshandel in Europa seit 2005
Emissionsfreie Energie als Geschäft
Auf dem Weg zur „Wasserstoffwirtschaft”
Partner der Dii
Literatur
Abkürzungsverzeichnis
Über die Autoren
Kapitel 1
Eine Welt im Umbruch
24. Februar 2022, die Invasion in die Ukraine dominiert weltweit die Medienberichterstattung. Ein Schock nicht nur für die Bürger in dem osteuropäischen Land. Ein geopolitischer Konflikt mit unabsehbaren Konsequenzen. Allerdings auch ein lauter Weckruf für eine eingeschlafene, auf Konsum aufgebaute Industriegesellschaft. Obwohl langjährige Kontrakte für die Lieferung von Öl und Gas unterzeichnet wurden, steigen in vielen Märkten die Öl- und Gaspreise schnell in Rekordhöhen. Im Laufe des Jahres 2022 wird auch die Zufuhr von Gas aus Russland gestoppt, russische Gasleitungen von Unbekannten unbrauchbar gemacht. Die Energiesicherheit Europas und die „Gasmangellage” beherrschen schlagartig die Diskussion und verdrängen zunächst das nicht weniger wichtige und existenzielle Thema „Klimawandel“.
Deutschland – Energie-Importeur und Emissions-Meister
Ist die Energiesicherheit bedroht, trifft das Energieimportländer wie Deutschland, eine der wichtigsten Industrienationen der Welt, am stärksten. Das „Land des Wirtschaftswunders“ ist für etwa 70 Prozent seines Energieverbrauchs auf Importe angewiesen, die noch fast ausschließlich aus fossilen Quellen stammen. Deutschland, das Land von Goethe und Schiller, und eben auch das Land der „Energiewende”; ein Vorreiter bei erneuerbaren Energien, ein Land der technischen Innovationen und tief verankerter Ingenieurskunst. Nicht zuletzt ist es das Land, das aus der Atomenergie ausgestiegen ist, andererseits aber durch den massiven Einsatz von Braun- und Steinkohle sowie Öl und Erdgas immer noch ein großer Emittent von Treibhausgasen ist. Deutschland gehört nach China, den Vereinigten Staaten, Indien, Russland und Japan zu den Top Sechs Emissionsländern der Welt. Im Jahr 2022 erreicht der CO₂-Ausstoß weltweit mit 37 Milliarden Tonnen CO₂ bzw. 58 Milliarden Tonnen Treibhausgasen einen neuen Rekordwert. Deutschland ist daran mit 666 Millionen Tonnen beteiligt.
Rund 69 Prozent der Primärenergie in Deutschland stammt im Jahr 2022 aus Importen. Quelle: AG Energiebilanzen e.V.
Die langjährige massive Verbrennung von fossilen Brennstoffen hat die CO₂-Konzentration in der Atmosphäre von 280 parts per million (ppm) Mitte des 18. Jahrhunderts auf 417 ppm im Jahr 2022 erhöht. Im „Pariser Abkommen” von 2015 haben sich fast alle Länder der Welt verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad und deutlich unter 2,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau von 1850 zu begrenzen. Es wurde jedoch nicht festgelegt, wie dieses Ziel konkret erreicht werden soll. In der Folge sind die Emissionen global weiterhin gestiegen.
Emotionale Energiediskussionen haben in Deutschland Tradition
Es gibt kaum ein Land auf der Erde, in dem das Thema Energie so intensiv, emotional und kontrovers diskutiert wird wie in Deutschland. Wird zum Beispiel in Frankreich, Griechenland, in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Marokko gefragt, wie die Menschen über Energie denken, dann ist eine sehr emotionale Antwort überraschend.
In Deutschland hingegen sind die Stichworte der Diskussion allgegenwärtig: fossile „Dreckschleudern“, Ausstieg aus der Kernenergie, radioaktiver Müll, Waldsterben, Hambacher Forst, Verspargelung durch Windturbinen, Elektrosmog durch Stromleitungen und die weit verbreitete Ablehnung jeglicher großtechnischen Anlage. Kernenergie wurde in Deutschland zum Tabuthema; nach langen kontroversen Ausstiegs-, Wiedereinstiegs- und Wiederausstiegsdiskussionen. Beim Nachbarn Frankreich ist das zum Beispiel ganz anders. Dort gehören Energieanlagen eher zur Normalität, insbesondere die enttäuschend leistenden Kernkraftwerke.
Ein Herz für Erneuerbare
Warum ist Energie so tief in der „Deutschen Seele“ verankert? Ein ganz wesentlicher Grund ist die deutsche Sehnsucht nach vorindustrieller Romantik. Viele schwärmen von Autonomie auf der Basis einer dezentralen, erneuerbaren Stromerzeugung mit grüner Energie. Dieses Schwärmen findet allerdings sofort sein Ende, wenn sich die notwendige Technik im eigenen Vorgarten bemerkbar macht. Obwohl die Möglichkeiten von Sonnen-, Wind-, Wasserkraft, Biomasse- und Geothermie noch lange nicht ausgeschöpft sind, gerät die Akzeptanz in der Bevölkerung jetzt schon an ihre Grenzen.
Auch hier werden die Diskussionen vorwiegend emotional geführt. Eine große Rolle spielt dabei, dass die naturwissenschaftliche Bildung spätestens seit den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Deutschland nicht mehr hoch im Kurs steht. Der öffentliche Diskurs wird deshalb vorwiegend von Politologen und Sozialwissenschaftlern geprägt, nicht von Ingenieuren und Technikern.
Die politischen Weichen sind dennoch gestellt: Die Stromerzeugung aus Braun- und Steinkohle soll stufenweise eingestellt werden, nachdem sie in der Ukraine-Krise wieder deutlich hochgefahren wurde. Der Traum von Kernenergie kommt hier und dort wieder auf, aber wer realistisch ist, weiß, dass sie in Deutschland in den nächsten zwei Jahrzehnten nicht wirklich etwas zur Lösung der Probleme beitragen kann. Die realen Nachteile und auch die Vorurteile, die damals zum Ausstieg geführt haben, werden prinzipiell bleiben.
Der Ukraine-Krieg hat drastisch vor Augen geführt, dass Öl und Erdgas, die sogenannten Brückenlösungen, keine wirklichen Alternativen für die Zukunft sind. Ihr Preis wird auch aufgrund der notwendigen Kompensation oder Speicherung von Emissionen deutlich steigen. Dann bleibt außer dem weiteren Ausbau solarer Dachanlagen als „autonome Lösung” wenig anderes übrig, als Großvorhaben wie Offshore-Windparks in den deutschen Teilen der Nord- und Ostsee zu realisieren. Vollständige Autarkie wird unter dem Strich für Deutschland mit seinen beschränkten Energiequellen aber wohl eine Illusion bleiben.
Deutschland ist Teil des EU-Binnenmarktes und wird ganz selbstverständlich Energie aus anderen Ländern der EU importieren (müssen). Die EU ist selbst aber wiederum zu etwa 60 Prozent auf Energie-Importe angewiesen. Energie, ob fossil oder grün, kann prinzipiell aus allen Ecken der Welt importiert werden. In großen Teilen der Erde ist sie reichlich vorhanden.
Heute sind die Energieträger in Deutschland noch hauptsächlich Steinkohle, Erdgas bzw. LNG (Flüssiggas) und Öl bzw. Ölprodukte. Stromimporte beziehungsweise Stromaustausch gibt es nur in bescheidenem Umfang. Weiterer Import von Energieträgern auf Basis fossilen Kohlenstoffs kann aber nicht die Lösung sein, weil das letztendlich zu weiteren Kohlendioxidemissionen führt.
Europas südlicher Nachbar, der grüne Lieferant der Zukunft
In Europas unmittelbarer Nachbarschaft, Nordafrika und Nahost (MENA – Middle East North Africa), entstehen gerade riesige Solar- und Windkraftwerke, die zunächst einmal in die lokalen Netze einspeisen werden. Hier wird bereits heute Solarstrom zu Kosten von unter 1 Eurocent pro Kilowattstunde produziert. Eine solche Kostendegression haben selbst die größten Optimisten noch vor zehn Jahren nicht für möglich gehalten.
Es ist bestimmt keine Fata Morgana, zu glauben, dass die Region auf Dauer große Mengen grüner Energie für die EU und insbesondere für den deutschen Markt bereitstellen kann. Die Infrastruktur dafür ist in Ansätzen bereits in Form von Stromleitungen und Pipelines vorhanden. Sie auszubauen, ist technisch kein Problem. Die politischen Rahmenbedingungen stellen sich auf den ersten Blick schwierig dar, stehen bei näherer Betrachtung jedoch der positiven Entwicklung nicht im Wege.
Sind die Länder der EU kulturell und wirtschaftlich schon ziemlich verschieden, so sind die Unterschiede in MENA noch sehr viel größer. Die Bandbreite von wohlhabend bis arm, stabil bis unruhig, investitionssicher bis hochriskant ist weitaus größer als in der EU. Die Arabische Liga mit ihren 22 Mitgliedern spielt als Dachverband kaum eine koordinierende Rolle. Nur in den Golfstaaten (GCC) kann von einer gewissen Koordinierung die Rede sein. Internationale Aktivitäten und Geschäfte finden aber auch hier hauptsächlich bilateral statt.
Die MENA-Region ist in der Branche als großer, verlässlicher Öl- und Gaslieferant bekannt; dem breiten Publikum aber eher als sonniges Urlaubsgebiet, als muslimische Region mit autokratischen Regimen oder als Krisengebiet voller Gewalt und Bürgerkriege.
Für Unternehmen aus Europa ist es nicht leicht, in der MENA-Region Geschäfte aufzubauen, aber viele Unternehmen, sowohl große als auch mittelständische, bestätigen, dass sich eine anfängliche Durststrecke lohnt, um langjährige Beziehungen mit arabischen Partnern aufzubauen. Europa macht heute außer Öl- und Gasimporten erstaunlich wenig Geschäfte mit seinem arabischen Nachbarn, dessen Menschen uns im persönlichen Bereich warme Gastfreundlichkeit entgegenbringen. Das wird sich wegen der großen potenziellen Synergien zwischen beiden Gebieten sicherlich ändern. In diesem Buch nehmen wir deshalb zum besseren Verständnis der Entwicklungschancen die wichtigsten MENA-Länder unter die Lupe.
Dezentral oder zentral – Ist das wirklich die Frage?
Eine Frage, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt, ist die nach dem grundsätzlichen Aufbau der Energiesysteme. Prinzipiell ist die autarke Energieversorgung einer Region oder eines Landes möglich. Es gibt aber gute Gründe, warum sie meistens regional vernetzt sind, mit einer Anbindung an die Weltenergiemärkte. Deshalb existiert heute eine ganze Palette von lokalen, regionalen, internationalen und interkontinentalen Lösungen zur Energieversorgung. In der emotional geführten Diskussion scheint es oft so, als ob es um ein Entweder-oder von „dezentral” (klein, vor Ort) gegenüber „zentral” (groß, entfernt) ginge. Das wird aber nicht der Lösungsweg sein, wenn die Energiewende Erfolg haben soll.
Selbstverständlich sollten zunächst einmal die dezentralen Konzepte ausgeschöpft werden, soweit sie wirtschaftlich nutzbar sind. Dabei können Großanlagen auf dem Land oder in Nord- und Ostsee sowie Importe aus dem EU-Binnenmarkt ihren Teil zur Energieversorgung beitragen. Das wird für ein Industrieland wie Deutschland aber nicht ausreichen. Dann bieten sich zusätzliche Importe aus dem Nachbargebiet MENA an. Schließlich kommen auch weiter entfernte Energiemärkte wie die USA, Australien oder Chile infrage.
Das große Umdenken
Bislang dominierte in Deutschland eine „Realpolitik“ mit dem Fokus auf der Absicherung durch fossile Energie aus Russland und vom Weltmarkt. Der Handel sollte den Frieden mit Russland stabilisieren. Diesem Traum folgte ein böses Erwachen. Anstelle von Gas aus Russland wird nun auf die Schnelle wesentlich teurer LNG aus den Vereinigten Staaten und anderen Ländern bezogen. Die Menschen sind durch den Preisschock aufgewacht und bemerken, dass sie einen sehr energieintensiven Lebensstil pflegen, begleitet von einem riesigen Energiehunger der Industrie. Die gute Nachricht ist, dass große Störungen im Energieangebot sehr schnell durch Verbrauchsreduzierung und Angebotsverschiebungen in den Energiemärkten aufgefangen werden konnten. Die Probleme des Klimawandels sind dadurch aber leider noch nicht gelöst.
Versorgungssicherheit – nicht mehr selbstverständlich
Hinzugekommen ist ein weiterer Aspekt: die Versorgungssicherheit. Importe fossiler Energieträger aus aller Welt waren bis zum 24. Februar 2022 ziemlich problemlos möglich. Obwohl das Preisniveau bereits 2021 kräftig angestiegen war, wurde dieser Aspekt noch nicht kritisch gesehen. Die Wirtschaftlichkeit, das Kostenniveau und die Risiken waren kein Grund für große Sorgen, gerade weil etwaige Umweltschäden bei Importen gut ignoriert werden können. Die traditionell großen fossilen und nuklearen Energie-Importe in Deutschland tragen selbstverständlich auch zu Umweltrisiken bei. Atomstrom aus Frankreich, Fracking-Gas aus den USA, Erdgasförderung in den unberührten Wäldern Sibiriens, all das war und ist quasi akzeptiert, da die Folgen in Deutschland nicht direkt sicht- und spürbar sind. Gleichzeitig wird hierzulande die Errichtung jeder Windkraftanlage von eingehenden Umweltverträglichkeitsprüfungen begleitet, müssen Landwirte darum kämpfen, auf ihren Feldern Solaranlagen errichten zu dürfen, und ist der Transport umweltfreundlichen Stroms mit Hochspannungsleitungen in den Augen vieler reines Teufelswerk.
Der Ukraine-Krieg hat für Bewegung gesorgt. Der internationalen Gesellschaft ist deutlich geworden, wie fragil das Energie-Gebäude ist. Neben den Notmaßnahmen zur aktuellen Krisenbewältigung wird in der EU im Rahmen des „REPower EU”-Programms (Beenden der Abhängigkeit von Russland) und des „Fit for 55”-Ziels (55 Prozent Treibhausgasreduzierung bis 2030) an einer langfristigen Perspektive gearbeitet – hin zum Fortbestand der Industriegesellschaft ohne klimaschädliche Emissionen. Auch die Bundesregierung reagierte auf die Situation, um sich von den Lieferungen fossiler Rohstoffe aus Russland zu befreien. Diese zielen auch auf einen umfassenderen Einsatz von erneuerbaren Energien und sollen diesen vorbereiten.
Eine netto-emissionsfreie Energieversorgung ist machbar!
Bei allen Problemen gibt es aber auch gute Nachrichten und sie kommen von vielen Seiten. Systemstudien und Pläne für die internationalen Märkte (unter anderem von Prof. Christian Breyer LUT, Prof. Ad van Wijk, TU Delft und Frank Wouters, Dii Desert Energy) zeigen, dass eine hundertprozentig emissionsfreie Energieversorgung gut möglich und sogar viel kosteneffektiver als das bisherige Vorgehen ist. Insbesondere die erneuerbaren Energien machen Klimaschutz bezahlbar, weil ihre Preise in den letzten Jahren erheblich gesunken sind. Kernenergie ist in vielen Ländern noch eine wichtige Energiequelle und teilweise auch eine Zukunftsoption, aber Wirtschaftlichkeit und Akzeptanz bleiben zweifelhaft. Der Einsatz fossiler Brennstoffe mit Speicherung oder Wiederverwendung der Emissionen ist ebenfalls eine Option, wobei auch hier die Wirtschaftlichkeit fragwürdig ist.
Das war schon deutlich anders. Vor fünfzehn Jahren waren Poseidon (Offshore Wind) und Desertec (Wüstenenergie) noch exotische Träume auf Papier und in Power-Point-Präsentationen. Berechnungen von namhaften Instituten in Deutschland und weltweit zeigten allerdings bereits damals überzeugend, dass die Quellen erneuerbarer Energie üppig vorhanden sind und die Energie über Stromleitungen, aber auch letztlich viel kostengünstiger durch Gas- und Flüssiggas-Infrastrukturen transportiert und gespeichert werden können. Es mussten dennoch zahlreiche Lernkurven durchlaufen werden. Inzwischen ist die Umsetzung von Jahr zu Jahr leichter geworden. Zwar sind immer noch zahlreiche Hürden zu überwinden, aber sie sind viel niedriger geworden. (van Son, Isenburg 2019 (3))
“We must fight emissions, not oil and gas.” (Energy Minister Al Mazrouei, UAE)
Die noch wirtschaftlich aktiven fossilen Quellen bewegen sich auf ausgetretenen Pfaden und lassen sich nicht einfach verdrängen. Das Volumen des globalen Öl- und Gasmarkts wurde für 2022 auf 7.330 Milliarden Dollar geschätzt. Die Interessen der fossilen Industrie sind also riesengroß. Es ist deshalb wichtig, dass die Energietransition von der fossilen Branche nicht als Feind, sondern als Perspektive für die Zukunft verstanden wird. Der Weg zur Klimaneutralität soll also nicht unbedingt kein Kohlenstoff, sondern keine Netto-Emissionen („Net Zero”) implizieren. Jede Industrie kann im Geflecht von fossilen Energien, erneuerbaren und Kernenergie ihren Weg zum Ziel gehen.
Smarte Lösungen für komplexe Herausforderungen
Zivilgesellschaft, Politik und Industrie in allen Ländern stehen vor schwierigen Dilemmata, müssen einen Balance-Akt voller Emotionen in der Bevölkerung vollziehen. Es ist die Wahl zwischen Pest und Cholera: Klimaschutz, Energiesicherheit, Bezahlbarkeit und Arbeitsplätze müssen miteinander austariert werden. Wie kann die Politik einen ausgewogenen, klimafreundlichen Weg vorgeben und Perspektiven bieten, wenn Zivilgesellschaft und Industrie unter erheblichem Preisdruck leiden? Nur die wenigsten würden letztlich für den Klimaschutz einen wirtschaftlichen Zusammenbruch mit dem Verlust zahlreicher Arbeitsplätze akzeptieren. Wie lässt sich Energiearmut dann vermeiden, wie kann die Industrie überleben?
Die Preisentwicklung geht heute sehr schnell dahin, dass die erneuerbaren Energien kostengünstiger sind als Kernenergie oder fossile Brennstoffe mit der notwendigen Speicherung der Emissionen. Größte Herausforderung beim Einsatz der erneuerbaren Energien sind also nicht mehr die Kosten, sondern ist die Volatilität. Nachts scheint keine Sonne, der Wind weht auch nicht immer. Das führt auf den Strommärkten manchmal zu extremen Preisschwankungen und erfordert eine größere Flexibilität auf der Angebotsseite durch regelbare Produktion (z.B. Wasserkraft), Speicherung und den Stromaustausch über Grenzen hinweg. Dieser Wandel muss aber unbedingt auch von einer Flexibilisierung des Verbrauchs, zum Beispiel durch Preissignale, begleitet werden.
Die Energiesysteme von heute basieren zu etwa 25 Prozent auf Strom (Elektronen). Davon stammen 2023 im Durchschnitt weniger als 30 Prozent aus erneuerbaren Quellen. Kohle, Öl und Erdgas werden künftig teilweise durch netto-emissionsfreien Wasserstoff oder damit hergestellte netto-emissionsfreie E-Fuels ersetzt werden. Man nennt Wasserstoff wohl deshalb auch das neue Öl. Die Energiewende lässt rein aus wirtschaftlichen Gründen kein Zögern mehr zu.
Wo sind die Wege für eine realistische Energiezukunft? Wie sichert Deutschland nachhaltig seine Versorgung? Werden zeitweise Engpässe und (dadurch) große Preisfluktuationen durch immer mehr erneuerbare Energien rapide zunehmen? Wie soll darauf reagiert werden? Liefern die Wüsten in der MENA-Region und die Meere wirklich einen signifikanten und verlässlichen Beitrag? Als Energielieferant oder Technologiekunde der deutschen Industrie oder als neuer Produktionsstandort? Können also in einer neuen Energiewelt energieintensive Industrien ihre Produktion teilweise dorthin verlagern, wo unter dem Strich das Kosten-Risiko-Verhältnis am günstigsten ist? Gibt es nach wie vor einen Markt für deutsche Technologie und Produkte? Die Liste von aktuellen Fragen zu diesen Themen ist fast unendlich. Die von brauchbaren Antworten ebenso. Dieses Buch soll helfen, einige Antworten zu finden und ihre Grundlagen zu verstehen.
Kapitel 2
CO₂ ist das Problem – nicht der einzelne Energieträger
Soll der Klimawandel gebremst werden, muss der Ausstoß von Treibhausgasen schnell und drastisch reduziert werden. Wie und wo das geschieht, ist Nebensache. Das gerät leider oft in Vergessenheit, wenn in der EU und besonders in Deutschland hitzig darüber diskutiert wird, ob diese oder jene Technologie auf der einen Seite gefördert oder andererseits verboten werden soll.
Dabei sind, wie bereits in der Einführung erwähnt wurde, die Aussichten, das Problem zu lösen, gar nicht schlecht. Studien von namhaften Universitäten und Institutionen zeigen, dass die Energiesysteme in Deutschland, Europa und weltweit locker innerhalb von einigen Jahrzehnten komplett auf erneuerbare Energien umgestellt werden könnten.
Die Rechenmodelle signalisieren außerdem, dass eine rasche Transition des Energiesystems unter dem Strich auch kostengünstiger ist, da erneuerbare Energien in vielen Ländern bereits ohne Subventionen wettbewerbsfähig sind. Der Trend in diese Richtung ist bereits überall auf der Welt sichtbar, wenn auch in sehr unterschiedlichem Tempo.
Dennoch ist damit nicht gesichert, dass erneuerbare Energien den Markt aus eigener Kraft innerhalb einiger Jahrzehnte erobern werden. Nach dem „Pariser Abkommen“ von 2015 wird in immer mehr Ländern eine starke Reduzierung von Emissionen angestrebt, sogar unter dem Strich null Emissionen („Net Zero”) bis 2050. Würde allerdings der Prozess nur dem freien Markt überlassen, ginge die Transition möglicherweise zu langsam.
Wie soll nun gesteuert werden? Sind Förderungen und Subventionen (Carots) oder Strafen (Sticks) nötig oder gibt es bessere Wege? Dazu müssen wir uns die aktuelle Ausgangssituation ansehen.
Existierende Infrastruktur maximal nutzen
Zunächst einmal gilt es, die existierende Infrastruktur maximal zu nutzen. Die Quellen, aus denen die Energiemärkte weltweit zapfen, sind im Wesentlichen fossile Brennstoffe, erneuerbare Energien und Kernkraft. Dabei haben unter den emissionsfreien die erneuerbaren Energien hervorragende Zukunftsaussichten. Kernenergie ist bestenfalls eine teure und „abfalllastige” Option.
Mehr als 80 Prozent der globalen Energie-Infrastruktur basiert heute auf fossilen Brennstoffen und wird von Unternehmen und Förderländern mit „fossiler DNA” beherrscht. Die finanziellen Interessen sind immens. Es wäre deshalb weltfremd, zu erwarten, dass die Energiesysteme der Welt auf einen Schlag und ohne erhebliche Umbrüche auf erneuerbare Energien umgestellt werden könnten.
Der zunehmende Druck auf Treibhausgase seit dem „Pariser Abkommen“ und die zunehmende Dramatik von Klimakatastrophen bleiben sicherlich nicht ohne Wirkung. Doch wo Emissionen noch erlaubt und bezahlbar sind, sind kaum große Initiativen zum Umstieg auf emissionsfreie Energie zu erwarten. Kernenergie könnte als emissionsfreie Alternative theoretisch eine größere Rolle spielen, allerdings nicht in Deutschland. Längere Laufzeiten bestehender Kernkraftwerke hätten kurzfristig zur CO₂-Reduzierung beigetragen, wurden aber von der Bundesregierung abgelehnt. Neubauten könnten hingegen kaum vor 2050 ans Netz gehen, selbst wenn es dafür eine politische Mehrheit gäbe. Also dann doch komplett auf erneuerbare Energien setzen? Das wird der Weg sein. Müssen und sollen aber erneuerbare Energien als „grüner Strom” oder „grüner Wasserstoff” als Sonderprodukt weltweit über eigene Transportwege transportiert werden? Das wäre eine offene Kampfansage an die fossilen Konkurrenten, die entsprechend reagieren würden. Das wäre nicht klug, sehr teuer und unnötig.
Die momentan noch fast ausschließlich für fossile Energieträger genutzte Infrastruktur sollte nach Möglichkeit auch und schließlich ganz für emissionsfrei produzierte Elektronen und Moleküle genutzt werden. Im Wesentlichen geht es darum, alle geeigneten Energiequellen, den Transport und die Speicherung von Energieträgern sowie den Verbrauch so zu strukturieren, dass der Markt so schnell wie möglich keine Kohlendioxidemissionen mehr produziert und klimaneutral wird.
Die entscheidenden Stellschrauben der Wertschöpfungskette
Das Bild einer Stromversorgung aus erneuerbaren Quellen setzt sich aus unterschiedlichen Komponenten zusammen. Für die Wertschöpfungskette sind aus unserer Sicht fünf Elemente wesentlich.
Flexibilität der Verbraucher
Energienachfrage wurde traditionell als „heilig” verstanden. Sie soll immer befriedigt werden, gleichgültig wie zweckmäßig, notwendig, potenziell verschiebbar oder vermeidbar ihr Verbrauch ist. An sich soll es die freie Entscheidung jedes zahlenden Abnehmers sein, wie er Strom, Öl, Gas oder Wasserstoff abnehmen möchte. In Zeiten von steigenden Energiekosten liegen Sparmaßnahmen wie bessere Isolierung von Gebäuden oder Optimierung von Prozessen auf der Hand. Der wachsende Einsatz von natürlichen Energiequellen führt allerdings zu immer größerer Volatilität im Energieangebot. Mehr Flexibilität auf der Verbrauchsseite wird das Abfedern ermöglichen und damit unnötige Systemkosten einsparen. Elektro-Auto, Geschirrspüler und Waschmaschine oder auch Wärmepumpen, die nach Bedarf Energie aus Luft oder Grundwasser nutzen, sind gute Beispiele.
Der Verbraucher muss also in den Markt einbezogen werden. Denn der ist nicht nur effizienz- sondern insbesondere verhaltensbestimmt. Der Verbraucher verwendet nach Bedarf und Laune Energie, aber ist schließlich sensitiv für Preissignale: Er lädt das Elektroauto gerne dann, wenn der Preis niedrig ist und so weiter. Preissignale müssen dafür ohne Verzerrungen in jedem Moment Angebot und Nachfrage reflektieren und bei Angebotsengpässen Verbraucher zur Reduzierung des Verbrauchs anspornen oder sogar zur Abgabe von Strom aus Batterien. Bei Angebotsüberschüssen führen Preissignale zu mehr Verbrauch.
Die Verbrauchsseite kann außerdem direkt oder indirekt eine Rolle bei der Emissionsreduzierung und/oder der Förderung von erneuerbaren Energien spielen. Die indirekte Förderung von erneuerbaren Energien wäre möglich durch den integrierten Kauf von Strom oder Wasserstoff mit Zertifikaten, die garantieren, dass der Strom oder Wasserstoff mittels erneuerbarer Energien erzeugt wurde. Wird außerdem der Strom mit einer Angabe der bei seiner Herstellung entstandenen Kohlendioxidemissionen versehen (g CO2/kWh), wird das System noch transparenter.
Es kann vom Verbraucher außerdem verlangt werden, dass er proportional zum Energieverbrauch eine Mindestanzahl von Grünzertifikaten oder Emissionsrechten kauft.
Dezentrale Erzeugung
Es lohnt sich fast überall, zunächst auf dezentrale erneuerbare Energien und eventuell Energiespeicherung zu setzen: auf den Dächern der Wohnhäuser, in Industriegebieten sowie auf Bürogebäuden. Die zentralen Energiesysteme werden damit weniger beansprucht, Kosten und Verluste nehmen dort ab. Tatsächlich erhöhen dezentrale erneuerbare Kapazitäten die Versorgungssicherheit und verringern die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Sonne und Wind wird es wohl immer irgendwo geben. Die Kosten für eine Kilowattstunde aus Photovoltaik oder kleinen Windanlagen beziehungsweise anderen kleinen erneuerbaren Quellen sind bereits sehr attraktiv. Oft liegen sie unter den Preisen von Strom, Gas oder Öl. Nettoüberschuss wird ans Netz geliefert und zum geltenden Preis im Markt vergütet. Zusätzlich sollte Überschuss aus erneuerbaren Energien pro gelieferte Kilowattstunde auch mit einer „Prämie” in Form handelbarer Zertifikate bezahlt werden.
Die günstigsten Quellen anzapfen
Wie in diesem Buch ausführlich beschrieben wird, warten die großen natürlichen Energiequellen in dünn besiedelten Gebieten der Erde darauf, zu niedrigsten Kosten und zum Nutzen der lokalen Wirtschaft erschlossen zu werden. Es sind Quellen wie die Sonne in den Wüsten, Wind auf dem Land sowie Meeren und Ozeanen, Wasserkraft in Gebirgen und ökologisch saubere Biomasse. Diese grüne Energie muss zunächst im lokalen Strommarkt fossile Brennstoffe verdrängen und damit den lokalen Energiemix vergrünen. Bei jeder grün erzeugten Kilowattstunde wird prinzipiell auch ein Grünzertifikat (Guarantee of Origin) produziert. Mit dem so erzeugten Strom kann (teils) Wasserstoff hergestellt werden, wodurch das Zertifikat auch auf Wasserstoff übertragen wird.
Beim Import aus entfernten Gebieten muss immer auch die Frage gestellt werden, ob das unter dem Strich wirklich zu niedrigeren Emissionen und Kosten führt. Das hängt unter anderem vom Energiemix im exportierenden Gebiet ab. Ist das noch vorwiegend „fossil“, wie in MENA, dann würde Export nicht unbedingt zur Emissionsreduzierung beitragen. Transporte in großem Stil werden erst dann sinnvoll, wenn das exportierende Gebiet vorwiegend emissionsfrei ist.
Um genau feststellen zu können, ob der Export über große Distanzen sinnvoll ist, ist deshalb die Transparenz der Kosten für Transport und Speicherung sowie des Energiemixes im exportierenden Gebiet absolut notwendig. Im Vergleich zum importierenden Gebiet müssen diese Faktoren eindeutig günstiger sein. Hier wird der erhoffte internationale, sogar globale Markt für Guarantees of Origin („Grünzertifikate”) beziehungsweise Emissionsrechte eine Hilfe sein. In MENA und in der EU gibt es bisher nur beschränkte Handelsmöglichkeiten für Emissionsrechte und nur in wenigen EU-Ländern einen freien Handel für Grünzertifikate. Eine weitere Harmonisierung würde die Energietransition einen großes Stück nach vorne bringen. Auf den Punkt gebracht: Solange MENA-Staaten Strom oder Wasserstoff mit Öl oder Gas erzeugen, ohne die Emissionen zu speichern, ist der gleichzeitige Export von Strom und Wasserstoff aus grünen Quellen reine Augenwischerei. Auch hilft es nicht viel, in Deutschland mit extremem Aufwand CO₂-Emissionen zu reduzieren, aber gleichzeitig dabei zuzusehen, wie der Rest der Welt lustig weiter Emissionen ausstößt.
CO₂-Reduzierung, egal wo und wie
Der Atmosphäre ist es egal, wie und wo CO₂ emittiert wird und wo Emissionen reduziert werden, Hauptsache, unter dem Strich bleiben keine Emissionen in der Luft zurück. Erneuerbare Energien und Kernkraft produzieren keine Emissionen und sind von diesem Blickwinkel aus betrachtet „gut”.
Der fossilen Industrie bietet diese Sichtweise eine Perspektive, wenn sie absolut gewährleisten kann, dass Emissionen zu hundert Prozent abgefangen und gespeichert (CCS, Carbon Capture and Storage) oder wiederverwendet (re-use bzw recycling) werden. Netto-emissionsfreie Energie aus fossilen Brennstoffen sollte im Markt dementsprechend einen höheren Wert haben als ihre fossile Basis.
Handelbare Zertifikate für grüne Energie
Energieträger, Elektronen oder Moleküle liefern, wenn sie einmal in die Transportinfrastruktur aufgenommen sind, keine Information über ihre Herkunft, wie zum Beispiel Rotwein aus Bordeaux oder Munster-Käse. Alle Elektronen oder Moleküle einer Energieträger-Kategorie (z.B. H₂, CH₄, NH₃) sind gleich. Die Herkunftsinformationen (erneuerbar, fossil mit oder ohne CO₂-Speicherung oder Kernkraft) sind aber für die Energietransition direkt oder indirekt entscheidend. Diese schon erwähnten „Grün- oder CO₂-Merkmale” sollten also erkennbar gemacht werden. Weltweit sind verschiedene Zertifi zierungen und Handelssysteme im Einsatz. Obwohl der getrennte Handel von Zertifi katen nicht immer erlaubt oder vorgesehen ist, basiert er generell auf Guarantees of Origin für erneuerbare Produkte und der Verknappung der Emissionsrechte für fossile Energien (z.B. Europäischer Emissionshandel, ETS-EU) sowie der Besteuerung von Emissionen.
Wie beim „grü nen Strom” schon erprobt, kann der Handel von physischen Energieträgern aus erneuerbaren Quellen durch handelbare Grü nzertifikate und ein System von „carbon content/ credits/penalties“ über existierende Infrastrukturen abgewickelt werden.
Standardisierung, Zertifi zierung und Handelbarkeit von Grünzertifi katen, d.h. Guarantees of Origin von Strom aus erneuerbarer Produktion, und ihre Anwendung auf die Handelbarkeit von grünem Wasserstoff sind in der EU noch ein heikler Punkt. In der neuen Regelung „RED II/III Delegated Acts for Renewable Hydrogen“ sind die Nutzung der existierenden Energietransport- und Speicherinfrastruktur und die Handelbarkeit von grünem Wasserstoff sehr eingeschränkt. Es wird unter anderem gefordert, dass grüner Wasserstoff praktisch nur direkt aus grünem Strom produziert werden soll. Wenn die Produktion von Wasserstoff indirekt über die Einspeisung von grünem Strom, z.B. aus Offshore-Wind mittels einer gemeinsamen Infrastruktur, vonstattengeht, dann soll die Produktion von Wasserstoff nahezu gleichzeitig mit der Produktion von grünem Strom stattfinden.
Auch ist Import z. B. aus MENA-Ländern in die EU nur bedingt möglich. Diese Einschränkungen sind die Folge von langen Verhandlungen in der EU. Sie gründen auf der generellen Befürchtung, dass ein offener Markt für Energie aus erneuerbaren Quellen die Tür öffnet für Energie aus fossilen Quellen oder den Missbrauch von Zertifizierungen. Es ist zu hoffen, dass sich die neuen Regelungen in Laufe der Jahre marktorientiert entwickeln werden, damit zügig die wirklichen Ziele (keine Emissionen, niedrigste Kosten und Energiesicherheit plus eine Marktprämie für erneuerbare Energien) realisiert werden.
Nur internationales Denken kann zur Lösung führen
Da sich weder die günstigsten erneuerbaren Energien noch die besten Möglichkeiten zur Emissionsreduzierung in Deutschland befinden, also Deutschland ein Großteil des Energiebedarfs importieren muss, sollte man noch einmal darüber nachdenken, wie und wodurch im internationalen Energiehandel die günstigsten erneuerbaren Energien zugebaut werden und Emissionen schnell und effizient reduziert werden können.
Kann das für Deutschland schädlich sein? Aus Klimasicht wohl kaum. Ebenso wenig, wenn man sich den Aspekt der Energiesicherheit anschaut. In Deutschland werden rein durch den Wettbewerb auf der Erzeugerseite sowieso erneuerbare Energien und Energiespeicher zugebaut. Energieintensive Indus