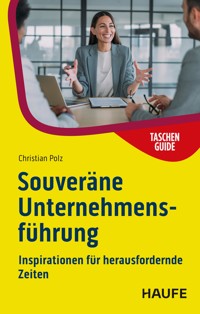17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH GmbH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Nichts ist, wie es mal war. Die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt erfordern es, Führung neu zu denken, neu zu justieren und neu auszurichten. Der Autor beschreibt in seinem praxisorientierten Ratgeber, wie Führung heute und zukünftig gelingt. Im Fokus steht das Collective Leadership: Jeder im Unternehmen, jeder in der Abteilung und jeder im Team übernimmt Verantwortung. Will, darf und soll Verantwortung übernehmen. "Wir sind alle Leader!", so das Leitmotiv.
Wer Collective Leadership etablieren will, durchläuft einen Entwicklungsprozess. Collective Leadership bedeutet Mitarbeiter, die sich selbst führen können und wollen, aber es gibt auch Mitarbeiter und Situationen, in denen die Führungskraft zum Beispiel direktiv oder transaktional agieren muss. Sie muss beides können und darum Führungssouveränität und Führungsstilsouveränität aufbauen. Dazu gehört auch das entsprechende Mindset. Zu diesem Mindset gehört, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Menschenbild, den Kompetenzen und Fähigkeiten (Stichwort Selbstreflexion).
Christian Polz stellt die Entwicklung zur souveränen Führungspersönlichkeit und zu Collective Leadership in drei Teilen dar: Der Beschreibung des Konzepts des souveränen Führens folgt die Erläuterung des dazu notwendigen Mindsets. Im dritten Teil steht die Umsetzung im Vordergrund. Neben der Darstellung des Konzeptes des souveränen Führens und des Mindsets der souveränen Führungspersönlichkeit bietet dieser Umsetzungsteil ein Highlight. Dort veranschaulicht Christian Polz die wichtigsten Führungsansätze und Führungsstile in einem fiktiven Dialog zwischen einem Coach und einer "lernenden" Führungskraft.
Der Autor nutzt seine Erfahrungen und zahlreichen Gespräche mit Unternehmern, Inhabern, Selbstständigen, Vorständen, Geschäftsführern, Managern und Führungskräften, um ein authentisches und realistisches Bild einer neuen Führung zu kreieren. Dazu arbeitet er mit vielen Beispielen aus seinem Erfahrungsschatz, den er als Berater, Coach, Trainer und Supervisor aufgebaut hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Alle Bücher von WILEY-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung
© 2023 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße 12, 69469 Weinheim, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Print ISBN: 978-3-527-51116-7ePub ISBN: 978-3-527-83978-0
Umschlaggestaltung: Susan Bauer
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Vorwort: Führung ganzheitlich und vereinend ausrichten
Einleitung: Collective Leadership und Führungssouveränität
Neue Mitarbeitende braucht das Land
Neue Führungskräfte braucht das Land
Vom Nutzen und Aufbau dieses Buches
Teil A: DAS KONZEPT DES SOUVERÄNEN FÜHRENS – SOUVERÄN IN FÜHRUNG GEHEN
1 Die neue Führungskultur – es geht nur mit Führungssouveränität
Collective Leadership: Ein einschneidendes Erlebnis
Die neue Herausforderung: Führungssouveränität
Vielfalt der Mitarbeitenden und Führungssituationen
2 Mit Führungsstilvielfalt zur Führungssouveränität
Den optimalen Führungsstil gibt es nicht!
Die Chamäleon-Führungspersönlichkeit
Teil B: DAS MINDSET DER SOUVERÄNEN FÜHRUNGSPERSÖNLICHKEIT
3 Mitarbeitende sind mehr als nur Mittel zum Zweck – das Menschenbild der souveränen Führungspersönlichkeit
Von der Bedeutung des Menschenbildes
Von der Einzigartigkeit eines jeden Menschen
4 Die zehn zentralen Souveränitätskompetenzen der Führungspersönlichkeit
Raus aus dem Kompetenz-Dschungel
Zehn zentrale Souveränitätskompetenzen
5 Reflexive Führung – raus aus der Box und Reflexionsenergie aufbauen
Raus aus der Box
Reflexionsenergie aufbauen: Techniken und Methoden
Teil C: DIE UMSETZUNG – FÜHRUNGSSOUVERÄNITÄT AUFBAUEN UND SOUVERÄN IN FÜHRUNG GEHEN
6 Führungspotenziale im Coachingdialog entfalten
Ab in die Umsetzung!
Wer richtig fragt, der führt
Das Setting: Alex Souverän und die Führungskraft im Dialog
7 Der hierarchische Führungsansatz – mit klaren Ansagen führen
Hierarchisch – aber nicht autoritär
Der Dialog: Ohne Wenn und Aber! Wenn es unumgänglich ist, Entscheidungen rasch zu treffen
Das hierarchische Führen trainieren
8 Der transaktionale Führungsansatz – Deal zwischen den Beteiligten
»Top, die Vereinbarung zur Zielvorgabe gilt!«
Der Dialog: Anerkennung für Leistung – »Wir haben einen Deal!«
Entwicklung zum Dealmaker: Das transaktionale Führen trainieren
9 Der situative Führungsansatz – das Individuum im Mittelpunkt
Ausgangspunkt: Individualität der Mitarbeitenden berücksichtigen
Der Dialog: Mit Menschenkenntnis und Empathie Mitarbeitende mitnehmen
Flexibilitätsbereitschaft erhöhen: Das situative Führen trainieren
10 Der transformationale Führungsansatz – die Mitarbeitenden werden zu Verantwortungstragenden
Führungskräfte als Vorbilder, Mitarbeitende als Verantwortungstragende
Der Dialog: Mitarbeitenden die Verantwortung überlassen
Beim Training des transformationalen Führens die drei V beachten
Notiz
11 Der agile Führungsansatz – Rollentausch im Netzwerk
Gleicher unter Gleichen im Netzwerk
Der Dialog: Bereit sein zum ständigen Rollenwechsel
Agiles Führen trainieren: Raus aus der Funktion, rein in die Rollen
12 Der coachende Führungsansatz – mit stärkenfokussiertem Coaching Hilfe zur Selbsthilfe leisten
Der Blick in den Spiegel
Der Dialog: »Sei einfach präsent!«
Das coachende Führen trainieren: Fragen, fragen und nochmals fragen
13 Der souveräne Führungsansatz – das virtuose Spiel mit den Führungsstilen
Von der Führungskraft zur Führungspersönlichkeit
Der Dialog: Von Kopf bis Fuß auf Souveränität eingestellt
Das souveräne Führen trainieren: Auf dem Weg zu neuen Ufern
14 Führungssouveränität leicht gemacht – typische Fehler vermeiden
Stolperstein 1: Die als richtig erkannte Führungshaltung verlassen
Stolperstein 2: Neues Tool, altes Mindset
Stolperstein 3: »Es muss doch schneller gehen!«
Stolperstein 4: »Aber ich kann doch führen!« als fatale Selbstgewissheit
Stolperstein 5: Der Angst vor Überforderung nachgeben
Stolperstein 6: Eine zu hohe Erwartungshaltung an den Tag legen
Stolperstein 7: »Was soll der ganze Hokuspokus!«
Stolperstein 8: Den Sinn und die Sinnorientierung vergessen
Stolperstein 9: Das übergeordnete Ziel aus den Augen verlieren
Stolperstein 10: Den Menschen nicht in den Mittelpunkt stellen
Ausblick: Der Dreiklang einer erfolgreichen Unternehmens- und Führungskultur im New Work – ME-Journey, WE-Journey und Orga-Journey
Ebene 1: Die ME-Journey
Ebene 2 und 3: Die WE-Journey und die Orga-Journey
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Der Autor
End User License Agreement
Orientierungspunkte
Cover
Titelseite
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Vorwort: Führung ganzheitlich und vereinend ausrichten
Einleitung: Collective Leadership und Führungssouveränität
Fangen Sie an zu lesen
Ausblick: Der Dreiklang einer erfolgreichen Unternehmens- und Führungskultur im New Work – ME-Journey, WE-Journey und Orga-Journey
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Der Autor
End User License Agreement
Seitenliste
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
115
116
117
118
119
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
259
260
261
Vorwort: Führung ganzheitlich und vereinend ausrichten
Nichts ist, wie es mal war – auch nicht in der Führung. Nicht nur wegen Corona. Die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt erfordern es, Führung neu zu denken, neu zu justieren und neu auszurichten. Kann das gelingen? Ja! Dieses Buch ist ein optimistisches Buch, auch wenn es die Augen vor den Problemen, die es im New Work gibt und die zum Teil erst durch New Work entstanden sind, nicht verschließt. Denn es ist meine Grundüberzeugung, dass alle – oder zumindest die meisten – Mitarbeitenden in der Lage sind, Verantwortung in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich zu übernehmen. Collective Leadership ist möglich und erlernbar. Jeder im Unternehmen, jeder in der Abteilung und jeder im Team kann Verantwortung übernehmen. Will Verantwortung übernehmen. Darf Verantwortung übernehmen. Und soll Verantwortung übernehmen. Um es in ein Bild zu fassen: Wie im Wald gibt es keinen Kommandobaum, der alles vorgibt und auf den alle zu hören haben. Denn wir sind alle Leader! Und zugleich bin ich sicher, dass Führungskräfte im New Work Führungssouveränität aufbauen und leben können.
Führungssouveränität war und ist selbstverständlich immer notwendig. Das ist keine Konsequenz des New Work. Aber die neue Arbeitswelt hat aufseiten der Mitarbeitenden und der Arbeitsprozesse zu einer Differenzierung geführt, die es notwendig macht, Führung in weiten Teilen neu auszurichten und Neujustierungen vorzunehmen, die den Entwicklungen in den Unternehmen und am Arbeitsplatz Rechnung tragen. In weiten Bereichen sind ein Kurswechsel, eine Richtungsänderung, ja, ein Strategiewechsel erforderlich. Und die bedeutsamste Veränderung besteht darin, Führung ganzheitlicher, größer und umfassender zu denken, als dies bisher der Fall war. Genau hier setzt dieses Buch an: Führungskräfte können dann souveräne Führungspersönlichkeiten sein, wenn sie in der Lage sind, ihre Führungsarbeit vereinend und ganzheitlich auszurichten, und ihr Führungsverhalten einer Transformation unterziehen, die alle Aspekte ihres Daseins umfasst, nicht nur Teilbereiche.
»Vereinend« und »ganzheitlich« – vielleicht erkennen Sie bereits an der Wortwahl, auf welche Impulsgeber ich mich damit beziehe. Zum einen sind Robert J. Anderson und William A. Adams zu nennen, die in ihrem Standardwerk Mastering Leadership (Anderson, Adams 2015) zeigen, wie wichtig Persönlichkeitsentwicklung für gute Führung ist. In einem evolutionären Prozess entwickeln sich Führungskräfte über die Stufen »Egocentric«, Reactive« und »Creative« zu ganzheitlich ausgerichteten »Integral Leadern« und schließlich zu vereinend ausgerichteten »Unitive Leadern«. Dieser ganzheitliche und vereinende Ansatz spiegelt sich in dem Konzept des souveränen Führens wider.
Führende bauen Führungsstilsouveränität auf, indem sie sich von Führungsstil zu Führungsstil weiterentwickeln und dabei die einzelnen Stile sukzessive in ihr Verhaltensrepertoire integrieren, bis sie sich zu einer souveränen Führungspersönlichkeit entwickelt haben.
Die ganzheitliche Ausrichtung des souveränen Führens lehnt sich zudem an der integralen Theorie des US-amerikanischen Managementvordenkers Ken Wilber (vgl. dazu Habecker, Ceming 2022 sowie Wilber 2017) an, der von einer individuellen inneren und äußeren sowie einer kollektiven inneren und äußeren Realität spricht, die bei ganzheitlichen systemischen Veränderungen gleichermaßen Berücksichtigung finden müssen. Dies gilt ebenso für den Entwicklungsweg einer Führungskraft zur souveränen Führungspersönlichkeit. Konkret: Bei diesem Entwicklungsweg geht es um
das Bewusstsein, die individuellen Werte und Überzeugungen sowie die Sinnprägungen der Führungskraft (individuelle innere Entwicklung),
die individuellen Fähigkeiten und Verhaltensweisen der Führungskraft (individuelle äußere Entwicklung),
die Unternehmens- und Führungskultur, zum Beispiel die Unternehmens- und Teamwerte und die Leitbilder (kollektiv-organisationale innere Entwicklung), und
die sozialen Strukturen und Prozesse, in denen eine Führungskraft und ihre Mitarbeitenden sich bewegen (kollektiv-organisationale äußere Entwicklung).
Des Weiteren verdanke ich Frédéric Laloux, den wohl wichtigsten Vordenker des New Work, wichtige Impulse. Laloux ist in seinen Büchern der Frage nachgegangen, wie in den Unternehmen eine neue Form sinnstiftender Zusammenarbeit aussehen kann. Er geht dabei von einer evolutionären Entwicklung der Unternehmen aus, bei der sich eine Organisationsform aus der anderen entwickelt (Laloux 2015, 2016). Diese evolutionäre Entwicklung werden Sie vor allem in den Kapiteln 7 bis 13 wiederfinden, in denen es um die Entwicklung von Führungssouveränität und insbesondere von Führungsstilsouveränität geht.
Sie sehen: Mein Buch, das Konzept des souveränen Führens und die Entwicklung zur souveränen Führungspersönlichkeit nehmen Bezug auf die Erkenntnisse von Robert J. Anderson und William A. Adams, Ken Wilber und Frédéric Laloux. Zudem bevorzuge ich bei der Beschreibung der Kompetenzen einer Führungskraft im Allgemeinen und einer souveränen Führungspersönlichkeit im Besonderen ein Entwicklungsmodell, das gleichfalls den ganzheitlichen Aspekt betont, nämlich das Leadership Circle Profile™. Dabei handelt es sich um ein 360-Grad-Feedbacksystem, das Rückschlüsse darauf zulässt, warum bestimmte Kompetenzen einer Führungskraft so und nicht anders ausgeprägt sind.
Nun kennen Sie meine Quellen und Vorbilder. Bevor es weitergeht, möchte ich einigen Menschen danken, ohne die dieses Buch nicht hätte entstehen können. Einen besonderen Dank spreche ich meinen Kundinnen und Kunden aus, die gemeinsam mit mir die mutigen Schritte im New Work gegangen sind und mir in unserer Zusammenarbeit vertraut haben, gemeinsam in interaktiven Prozessen zu Lösungen zu gelangen, die zur Zukunftssicherung führen.
Meinem Team bei 3P-Leadership danke ich für die kongeniale Unterstützung, auch über dieses Buch hinaus. Katrin Bochert hat die Korrekturlesearbeiten und einen großen Anteil an der Recherchearbeit für das Buch geleistet. Andrea Erhard hat das Marketing übernommen und war für die Transferarbeit der Inhalte des Buches in die Bildsprache der Illustrationen mitverantwortlich. Zudem danke ich Miriam Barton, die es verstanden hat, insbesondere die beschriebenen Führungsstile kreativ zu illustrieren und auf den Punkt zu bringen. Auch Jutta Hörnlein vom Wiley Verlag danke ich für die professionelle Unterstützung.
Ein besonders herzliches Dankeschön geht an meine Familie für den Zuspruch und die Ermutigung, meinem Buch zur agilen Teamarbeit nun ein Buch zur Führungssouveränität folgen zu lassen.
Und noch ein Hinweis: Für mich ist die Gleichberechtigung aller Geschlechter eine Selbstverständlichkeit. Wo immer möglich wechsle ich zwischen der weiblichen und männlichen Form – immer aber gilt, dass ich alle Leserinnen und Leser anspreche und meine. Immer wieder nutze ich neutrale Bezeichnungen und formuliere im Plural. Manchmal aber ist aus meiner Sicht die Verwendung des generischen Maskulinums aus Gründen des Leserkomforts die beste Alternative.
Ihr Christian Polz
Einleitung: Collective Leadership und Führungssouveränität
In meiner Arbeit als Berater, Trainer und Coach erlebe ich es immer wieder, dass Collective Leadership und Führungssouveränität die zwei Seiten ein und derselben Medaille sind.
Neue Mitarbeitende braucht das Land
Die Unternehmen brauchen Mitarbeitende, die bereit und willens sind, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. Die den Mut und die Entschlossenheit haben, unternehmerisch zu denken, die nicht in den eingefahrenen Bahnen des traditionellen und klassischen Führens verbleiben und die nicht länger darauf warten wollen, dass ihnen jemand vorgibt, was sie zu tun und zu lassen und wie sie zu agieren haben. Im Collective Leadership erwerben die Mitarbeitenden einen Reifegrad und bauen Kompetenzen auf, die sie befähigen, als Leader zu agieren, Verantwortung wahrzunehmen und die Konsequenzen zu tragen, die sich aus dieser Verantwortungsübernahme ergeben. Ich stelle fest, dass es immer mehr Mitarbeitende gibt, die genau das wollen! Der Wunsch nach mehr Freiheit, Eigenverantwortung und Flexibilität hat nicht zuletzt durch die Coronapandemie bei vielen Mitarbeitenden eine Verstärkung erfahren.
New Work stellt uns alle vor neue Herausforderungen (siehe dazu die Bücher von Breidenbach, Rollow 2019 und insbesondere Starker 2021 mit den zehn fundamentalen »Erkenntnissen« zum New Work) – auch die Mitarbeitenden, die wie die Führungskräfte in der Pflicht stehen, zusätzliche Kompetenzen zu erwerben, um in der neuen Arbeitswelt bestehen zu können. Dafür nur einige wenige Beispiele: Es ist zielführend, dass die Mitarbeitenden Digitalkompetenz aufbauen, denn jeden Tag begegnen wir neuen Kommunikationsformen. Diese sollen zwar die Zusammenarbeit erleichtern; oftmals müssen wir sie jedoch erst einmal erlernen und beherrschen, um sie so einzusetzen, dass sie tatsächlich eine Erleichterung bewirken.
Zudem bedeutet New Work das Ende des Silo-Denkens. Fach- und bereichsübergreifendes Arbeiten und Lernen gehören zu den neuen »Pflichten« des Mitarbeitenden, der von Projekt zu Projekt springt, also heute in diesem, morgen in jenem und übermorgen in einem dritten Team eingesetzt wird. Ein Mitarbeitender findet sich immer wieder in neue Teams und Projekte ein und schlüpft in neue Rollen und übernimmt neue Aufgaben. Darum versteht es sich fast von selbst, dass zu den neuen Kompetenzanforderungen eine enorme Lernbereitschaft zählt. Denn der Mitarbeitende nutzt zwar in jedem Team und bei jeder Projektarbeit seine Expertise, aber er sollte darüber hinaus in der Lage sein, zusätzlich diejenigen Fähigkeiten zu erwerben, die aufgrund der spezifischen Anforderungen in einem Team und bei einer Projektaufgabe unerlässlich sind.
Die unbestrittene Expertise eines Mitarbeitenden kann es unter Umständen erforderlich machen, für einen begrenzten Zeitraum im Team Führungsverantwortung zu übernehmen. Im New Work ist dann von Collective Leadership und einer hierarchieübergreifenden Partizipation die Rede: Es führt nicht derjenige, der im Organigramm an der Spitze steht, sondern derjenige, der über die notwendige Expertise verfügt.
Entscheidend ist die Expertise des Mitarbeitenden. Dieser kommt dort zum Einsatz, wo seine spezifische Expertise benötigt wird. Expertenwissen schlägt Hierarchie.
Neue Führungskräfte braucht das Land
Sehen wir uns die zweite Seite der Medaille an, die Führungssouveränität. Wenn in einem Team ein Mitarbeitender aufgrund seiner Expertise kurzeitig Führungsverantwortung übernimmt, ist es notwendig, dass der Teamleiter bereit und fähig ist, ins zweite Glied zurückzutreten. New Work braucht Führungskräfte, die loslassen und sich von ihrer bisherigen hierarchisch legitimierten Position verabschieden können und willens sind, ihre Mitarbeitenden zu befähigen, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. Und auch hier beobachte ich, dass es immer mehr Führungskräfte gibt, die genau das wünschen und wollen!
Im Verlauf dieses Buches werden Sie sehen, dass dies nicht bedeutet, sich vom hierarchischen Führen grundsätzlich zu verabschieden. Denn natürlich bewegen sich Führungskräfte immer wieder in Situationen, in denen es richtig und notwendig ist, hierarchisch zu führen. Und diese Führungssituationen wird es auch in Zukunft geben. Aber daneben wird eine Führungskraft immer wieder mit Situationen konfrontiert, in denen es eben nicht angemessen ist, sich auf die hierarchische Position zu berufen, und in denen es unerlässlich ist, anders zu führen – bis hin zur Abgabe jeglicher klassischer Führungsverantwortung, die dann zum Beispiel von einem sich selbst organisierenden Team übernommen wird. In solchen Teams ist der Ansatz »Führung ohne Führungskraft« verwirklicht: Die Teammitglieder bestimmen, wer in das Team übernommen wird, sie tragen die Budgetverantwortung und entscheiden über Gewinnausschüttungen, Boni und selbst bei disziplinarischen Fragen. Eine höhere Führungsinstanz greift nur ein, wenn es zum Beispiel bei einer wichtigen Entscheidung nicht zu einer Einigung kommt.
Es ist klar, dass eine Führungskraft im hierarchielosen Team eine andere Einstellung und Haltung sowie andere Kompetenzen benötigt, als dies bei einem Führen auf der Grundlage des hierarchischen Ansatzes erforderlich ist. Eine Frage, die in diesem Zusammenhang oft an mich gerichtet wird, lautet: »Kann eine Führungskraft es überhaupt leisten, in der einen Führungssituation hierarchisch zu führen und in der anderen nur mithilfe ihrer Persönlichkeit und Überzeugungskraft, aber ohne die Insignien der hierarchischen Macht und Position?« Meine Antwort fällt eindeutig aus: Ja, das ist möglich! Und genau das macht Führungssouveränität aus. Wobei die Führungskraft ein sich selbst organisierendes Team nicht mehr führt, sondern das Team und die Teammitglieder begleitet.
Zusammenhang zwischen Reifegrad und Kompetenzen beachten
Es ist an der Zeit, den entscheidenden Aspekt anzusprechen, der die Grundlage dieses Buches bildet: Es geht nicht darum, von einem grundsätzlich hierarchischen Führungsstil zu einem grundsätzlich agilen Führungsstil zu gelangen und den einen gegen den anderen auszutauschen. Vielmehr ist entscheidend, dass die Führungskraft, dass Sie BEIDES beherrschen. Dass Sie fluide und flexibel zwischen den Führungsstilen wechseln und die Kompetenz aufbauen, zu antizipieren, mit welchem Mitarbeitertyp Sie zu tun haben und welcher Führungsstil der angemessene ist. Je nach Situation und im Hinblick auf die Mitarbeitenden, mit denen Sie zu tun haben, aktivieren Sie genau den Führungsstil, der in der Situation und bezogen auf die Mitarbeitenden der richtige ist. Damit nicht genug: Es gibt sehr viel mehr Führungsstile als den hierarchischen und den agilen. Aus meiner Sicht kann von mindestes sechs Führungsansätzen gesprochen werden. Zudem gibt es einen siebten Führungsstil, den ich mit dem Begriff »Führungssouveränität« umschreibe. Ihre Aufgabe ist es, alle Führungsstile in Ihr Verhaltensrepertoire aufzunehmen und sich schließlich zu dem zu entwickeln, was Anderson und Adams eine »Unitive«, eine »vereinende« Führungspersönlichkeit nennen.
Sie werden diese Führungsstile noch in aller Ausführlichkeit kennenlernen. So viel sei bereits jetzt verraten:
Mein Ziel ist, dass Sie nach der Lektüre dieses Buches davon überzeugt sind, es sei richtig, alle Führungsstile zu beherrschen, den entsprechenden Reifegrad zu besitzen und die dafür notwendigen Kompetenzen aufzubauen.
Der Hintergrund ist: Es gibt einen konkreten Zusammenhang zwischen dem Reifegrad und den Kompetenzen einer Führungskraft. Wer lediglich hierarchisch, mithin klassisch-traditionell, zu führen versteht oder nur wenige Führungsstile einsetzen kann, verfügt über einen geringeren Reifegrad und benötigt weitaus weniger Kompetenzen als eine Führungskraft, die alle Führungsstile beherrscht. Solch eine Führungskraft bezeichne ich als »souveräne Führungspersönlichkeit«. Diese ist in der Lage, einerseits mit Vorgaben und Anweisungen zu führen, wenn es Mitarbeitende, Situation und Kontext erfordern, und andererseits Mitarbeitende zur ergebnisorientierten Selbstreflexion zu animieren und diese coachend und moderierend zu unterstützen.
Je höher der Reifegrad und je vielfältiger die Kompetenzen, desto eher kann sich eine Führungskraft als Führungspersönlichkeit etablieren, die souverän und virtuos mit den Führungsstilen jongliert.
Mindset statt Label
So manche Führungskraft glaubt, es genüge, ihr bisheriges Führungshandeln mit einem neuen Label zu versehen und an einigen wenigen Stellschrauben zu drehen, um im New Work Mitarbeitende zum Beispiel agil führen zu können. Das jedoch hat mit agiler Führung wenig bis nichts zu tun. Es geht um weitaus mehr: Es entsteht eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, bei der sich die starren Hierarchiegrenzen auflösen. Für moderne Führungskräfte ist es nicht wichtig – und meistens auch gar nicht mehr möglich –, ständig mehr Kompetenz und Fachwissen zu demonstrieren. Entscheidend ist vielmehr, über eine klare sinnstiftende Vision zu verfügen und diese vorzuleben, um den Mitarbeitenden Orientierung geben zu können. Damit dies gelingt, ist ein spezifisches Mindset notwendig.
New Work erfordert von allen Beteiligten Arbeit. Aufseiten der Führungskräfte ist ein Höchstmaß an Flexibilität und Antizipation erforderlich. Wer flexibel und antizipativ agiert und über das entsprechende Mindset verfügt, baut die Führungssouveränität einer Führungspersönlichkeit auf. Entscheidend ist: New Work bedeutet Differenzierung auf allen Ebenen. Denn jetzt hat die Führungskraft zunehmend mit Mitarbeitenden zu tun, die bereit sind, Eigenverantwortung zu übernehmen, selbstorganisiert zu agieren und permanent dazuzulernen. Zugleich hat sie mit Mitarbeitenden zu tun, die sich den neuen Herausforderungen gegenüber eher neutral oder reserviert verhalten, also ihre Arbeit zwar tun, aber nicht die Begeisterung und flammende Leidenschaft an den Tag legen wie die oben genannten Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich gibt es auch noch die Mitarbeitenden, die mit den neuen Bedingungen nicht zurechtkommen und mit den daher einhergehenden Veränderungen nicht einverstanden sind. Sie brauchen Hierarchien, direktives Führen, klare Vorgaben und Anweisungen und fürchten Orientierungslosigkeit. Die Führungskraft steht vor der Aufgabe, auch damit klarzukommen und entsprechende Führungsinstrumente einzusetzen. Eventuell ist zu prüfen, ob es nicht zielführender ist, die Stärken dieser Mitarbeitenden anderweitig einzusetzen.
Ohne Potenzialentwicklung geht es nicht
New Work führt zu weiteren Differenzierungen. Nehmen wir das Beispiel »Innovationen«. New Work erfordert eine stärkere Innovationsorientierung. Dies verlangt der Führungskraft die Fähigkeit ab, kreativer zu werden, ständig die Perspektive und die Sichtweise zu wechseln und überdies das kreative Potenzial der Mitarbeitenden zu heben und zu nutzen. Potenzialverschwendung war noch nie erstrebenswert, im New Work mit all seinen Herausforderungen jedoch stellt die Potenzialvergeudung den sicheren Weg in den unternehmerischen Untergang dar.
Zudem spielen in der neuen Arbeitswelt Networking und Kooperation im New Work eine bedeutsame Rolle. Viele Führungskräfte stehen vor dem Lernprozess, bei der Bewältigung von Aufgaben Menschen und Institutionen zusammenzubinden, die manchmal sogar in Konkurrenz zueinander stehen. In diesem Zusammenhang ist das »Collaborative Leadership« zu nennen. Katrin Glatzel und Tania Lieckweg beschreiben in ihrem gleichnamigen Buch ein Führungsmodell für die digitale Welt, in dem Begriffe wie Kooperation, gegenseitige Verständigung, genaue Abstimmung untereinander und Einbeziehung aller Beteiligten dominieren. Die Führungskraft steht vor der Bewältigung der Aufgabe, Collaborative Leadership zu erlernen und anzuwenden und zugleich die Mitarbeitenden zum kollaborativen Arbeiten zu befähigen (siehe Glatzel, Lieckweg 2020). Und über all diesen Aspekten der neuen Arbeitswelt – und ich habe hier längst nicht alle benannt – schwebt die Digitalisierung.
Ich möchte in Ergänzung dazu von der Herausforderung sprechen, eine Führungskultur zu etablieren, bei der die Bedürfnisse der Menschen, der Organisation und die technischen Erfordernisse gleichermaßen Berücksichtigung finden und mit der es gelingt, diese Aspekte zu harmonisieren.
New Work: Bullshit, Heilsbringer – oder beides?
Jedes Unternehmen steht mit seinen individuellen Aufgaben, Angeboten, Kundinnen und Kunden, Mitarbeitenden, Stakeholdern sowie Abläufen und Prozessen vor spezifischen New-Work-Herausforderungen. Zumal es hinsichtlich der Beurteilung, was »New Work« überhaupt ist und welche Erscheinungen der neuen Arbeitswelt tatsächlich »neu« und nicht vielmehr nur »Bullshit« sind, unterschiedliche Meinungen gibt. Stefanie Hornung zeichnet in ihrem Artikel »New Work wird erwachsen« (Hornung 2021) ein differenziertes Bild des Phänomens »New Work«. Sie zitiert Carlos Frischmuth, der den Hype rund ums selbstorganisierte, holokratische und hierarchiefreie Arbeiten als »Bullshit« bezeichnet und zu Recht zu bedenken gibt, dass es auch Mitarbeitende gibt, die ihre Tätigkeit als notwendiges Übel betrachten und lieber Dienst nach Vorschrift schieben, als sich eigenverantwortlich und selbstbestimmt in die Arbeitsabläufe einzubringen. Frischmuth hinterfragt die Annahmen des New Work kritisch (Frischmuth 2021), wobei ich der Meinung bin, dass sowohl die Befürworter der reinen New-Work-Lehre als auch Kritiker wie Frischmuth recht haben. Denn es gibt nun einmal beides: einerseits
die Erscheinungen des New Work, wie etwa den primären Wunsch der Menschen nach sinnstiftender Selbstverwirklichung am Arbeitsplatz unter gleichzeitiger Vernachlässigung materieller Erwartungen,
die Hoffnung der Menschen nach einer ausgewogenen Work-Life-Balance mit hohem Wohlfühlfaktor am Arbeitsplatz,
die disruptiven Entwicklungen der Geschäftsmodelle und die revolutionären Veränderungen in den Firmen und ihrem jeweiligen Umfeld,
die Forderung, die Unternehmen müssten sich den Erwartungen und Wünschen der Mitarbeiter anpassen, und
den Trend hin zu unternehmerisch denkenden Mitarbeitern.
Und andererseits
den Wunsch der Mitarbeitenden nach vorgegebener und wenig selbstbestimmter, aber Stabilität und Kontinuität garantierender Arbeit,
die Mentalität, der Chef werde einem schon genau vorgeben, was zu tun ist und was nicht,
die Einstellung, zu arbeiten, um sich in der Freizeit mehr leisten zu können,
die langsame und vorsichtige Anpassung der Unternehmen an geänderte Rahmenbedingungen und
die Haltung, die Mitarbeitenden hätten sich doch bitte schön den Erwartungen und Vorgaben der Firmen anzupassen.
Es ist die Gleichzeitigkeit dieser »New-Work«- und »Old-Work«-Phänomene, die zu einer extremen Ausdifferenzierung der Arbeitswelt und der Mitarbeitereinstellungen, -erwartungen und -wünsche führt.
Diese Ausdifferenzierung lässt sich meiner praktischen Erfahrung nach vor allem durch Führungssouveränität meistern. Souveräne Führung im New Work heißt, die Herausforderungen der neuen Arbeitswelt aufzugreifen und zu analysieren, um ihnen als souveräne Führungspersönlichkeit zu begegnen, ohne sie jedoch zu verabsolutieren. Die traditionell-klassischen Herausforderungen der alten Arbeitswelt sind beileibe nicht einfach verschwunden, sondern nach wie vor existent.
Mit anderen Worten: Es trifft nicht zu, dass – zum Beispiel – der hierarchische Führungsstil obsolet ist und ersetzt werden kann durch eine empathische Vertrauenskultur, mit der der gänzliche Verzicht auf Kontrollmechanismen einhergeht. Beides ist notwendig. Und es stimmt nicht, dass es in der Unternehmensrealität auf Mitarbeiterseite nur noch Vollblut-Intrapreneure mit dem leidenschaftlichen Schaffensdrang eines Unternehmers gibt und der »Nine-to-five«-Mitarbeitende, der um 17 Uhr fluchtartig Werkshalle und Büro verlässt, ausgestorben ist. Es gibt beide Phänomene. Und Führungssouveränität heißt, mit all diesen Herausforderungen zurechtzukommen. Wie Sie diese Führungssouveränität erlangen, ist Gegenstand dieses Buches.
Vom Nutzen und Aufbau dieses Buches
Führungssouveränität ist erlernbar. Souveräne Führung ist erlernbar. Ich möchte zeigen, wie Sie sich zur souveränen Führungspersönlichkeit entwickeln und souverän in Führung gehen können. Dabei gehe ich in drei Schritten vor. Der Beschreibung des Konzepts des souveränen Führens folgt die Erläuterung des dazu notwendigen Mindsets. In Teil C steht die Umsetzung im Vordergrund. Im Einzelnen:
Bei der Konzeptdarlegung (
Teil A
) fokussiere ich mich darauf, die wichtigsten Prinzipien des souveränen Führens zu veranschaulichen und Ihnen einen Eindruck zu vermitteln, welche Führungsstile Sie beherrschen sollten, um jeden Mitarbeitenden dort abzuholen, wo er steht. Ziel ist, jeden Mitarbeitenden individuell dazu zu bewegen, das Beste für sein Unternehmen zu leisten.
Im Mittelteil (
Teil B
) geht es um das Mindset der souveränen Führungspersönlichkeit, vor allem um ihr Menschenbild. Die Kunst der Führung beruht auf einem Menschenbild, durch das die Floskel »Der Mitarbeitende und Mensch mit all seinen Potenzialen steht im Mittelpunkt« mit Leben gefüllt wird. Ich entwickle Führungsleitlinien, bei denen vom Subjekt und Individuum her gedacht wird und die Sinnstiftung im Mittelpunkt steht. Zudem erfolgt die Darstellung der wichtigsten Kompetenzen, Fähigkeiten und Qualifikationen der Führungspersönlichkeit.
In
Teil C
, dem Umsetzungsteil, beschäftige ich mich mit dem konkreten Entwicklungsweg von der Führungskraft zur souveränen Führungspersönlichkeit. Die meisten Führungskräfte stehen vor der Herausforderung, sich mit dem Mindset des souveränen Führens vertraut zu machen und es sich anzueignen. Um dies praxisorientiert zu veranschaulichen, begleitet Sie in Teil C ein fiktives Duo, das aus einer Führungskraft und einem Coach namens Alex Souverän besteht und das die Bestandteile und Tools des Mindsets in spannend-informativen Dialogen reflektiert und diskutiert. Wie auch Sie, die Leserin und der Leser, lernt die Führungskraft jenes Mindset kennen und erfährt, wie es sich das Mindset sukzessive aneignen kann.
Am Ende der Dialoge sind Sie wie die fiktive Führungskraft in der Lage, in jeder Führungssituation genau denjenigen Führungsansatz aus dem Führungsköcher zu ziehen und zu aktivieren, mit dem sich jene Situation konstruktiv bewältigen lässt.
Der Coach begleitet die Führungskraft auf dem Entwicklungsweg zur Führungspersönlichkeit mit den Mitteln des reflexiven Coachings. Alex Souverän stellt der Führungskraft vor allem Fragen, um sie zu eigenen Antworten zu führen. Alex Souverän weiß, dass der Terminus »Coach« auf den Begriff »Kutsche« zurückgeht – im 19. Jahrhundert wurde der Begriff »die Coach« für eine vierrädrige Kutsche für vier Personen verwendet. Soll heißen: Der Kutscher oder Coach öffnet dem Fahrgast, dem Coachee oder Mitarbeitenden, die Tür der Kutsche, damit sich dieser als Fahrgast in den geschützten Innenraum des Gefährts begeben kann. Alex Souverän fungiert mithin als Türöffner – es ist aber der Mitarbeitende selbst, der die Tür durchschreiten muss. Auch wohin die Reise letztendlich geht, bestimmt der Coachee, der Fahrgast, in unserem Dialog also die Führungskraft. Zudem spricht das Duo aktuelle Führungsprobleme an, für die es im New Work noch keine Lösungen gibt. Denn klar ist: Die neue Arbeitswelt befindet sich im Fluss, es handelt sich um einen noch nicht abgeschlossenen Prozess, der die Führungspersönlichkeit morgen vor Herausforderungen stellt, die heute noch nicht erkennbar sind.
Und damit starten wir jetzt durch!
Teil ADAS KONZEPT DES SOUVERÄNEN FÜHRENS – SOUVERÄN IN FÜHRUNG GEHEN
Welche Leitlinien bestimmen das Konzept des souveränen Führens? Was konkret ist gemeint, wenn es von einer Führungspersönlichkeit heißt, sie sei in der Lage, mit Souveränität zu führen?
1Die neue Führungskultur – es geht nur mit Führungssouveränität
Kapitelcheck
Diese Fragen werden in diesem Kapitel diskutiert und beantwortet
Was verbirgt sich hinter dem Konzept der souveränen Führung? Welche Aspekte sind entscheidend? Was bedeutet es, wenn jeder im Team Verantwortung übernehmen kann und soll? Was konkret verbirgt sich hinter dem Begriff der »Führungssouveränität«?
Ihr Nutzen
Sie erfahren, welche Begriffe und Inhalte für die Kunst des souveränen Führens entscheidend sind. Sie überprüfen, ob und inwiefern das Collective Leadership in Ihrem Unternehmen verwirklicht ist und ob Sie über Führungssouveränität verfügen.
Collective Leadership: Ein einschneidendes Erlebnis
Als ich selbst noch als Angestellter tätig war, hatte ich ein prägendes Erlebnis, das mich letztendlich dazu bewogen hat, dieses Buch zu schreiben. Ich arbeitete damals als Teamleiter in einem Beratungsunternehmen, und es stand ein Gespräch mit meiner Führungskraft an. Durch einen Führungskräftewechsel war es das erste Gespräch, das ich mit dem neuen Chef führen sollte. Ich war seinerzeit beruflich in hierarchischen und transaktionalen Strukturen sozialisiert worden. Die starren hierarchischen Strukturen waren darauf ausgerichtet, dass die Mitarbeitenden bitte schön für Umsatz zu sorgen hatten, ihren Bonus kassieren sollten, aber auf keinen Fall eigene Entscheidungen treffen durften, wenn überhaupt, dann lediglich im Rahmen der operativen Umsetzung. Selbst die Bleistiftbestellung lief über den Schreibtisch meiner Vorgesetzten …
Das waren die Ausgangsvoraussetzungen vor dem Gespräch mit dem neuen Chef. Ich war daran gewöhnt, dass in solchen Gesprächen der Vorgesetzte die Führung übernahm und festlegte, in welche Richtung sich das Gespräch entwickeln würde. Ich war damals auf klare Ansagen und Vorgaben nicht nur vorbereitet, sondern ich erwartete schlicht und einfach, dass mein Chef sie glasklar und unmissverständlich formulieren würde. Immerhin war ich mit Argumenten und Gegenargumenten bewaffnet, weil alle selbst getroffenen Entscheidungen genau begründet und belegt werden mussten. Ich wusste: Mein Vorgesetzter würde als Kontrollfreak alles genau überprüfen.
Dann aber die große Überraschung: Das Gespräch lief dieses Mal ganz anders als erwartet ab. Als ich schon unruhig wurde, weil mein neuer Chef das Gespräch nicht wie erwartet eröffnete, stellte er eine ungewöhnliche Frage:
»Worüber möchten Sie heute mit mir sprechen, Herr Polz?«
Ich war nicht nur überrascht über diesen Gesprächseinstieg. Ich spürte Panik, was sollte das? Ich hatte erwartet, dass ich über die Zahlen und mein operatives Vorgehen abgefragt würde und ich mich zu rechtfertigen hätte. Auch mein neuer Chef würde doch sicherlich die Agenda vorgeben und mir mit klarer Ansage mitteilen, wie ich vorzugehen hätte: »Herr Polz, das sind Ihre wichtigen Punkte, so gehen Sie vor, diese Prioritäten sind von Ihnen selbstverständlich zu berücksichtigen, ich erwarte von Ihnen diesen Umsatz … bis spätestens …« Nichts davon trat ein. Vielmehr entwickelte sich der folgende Dialog:
»Äh, wollen Sie nichts über die Zahlen in meinem Bereich wissen?« (Bei meinem früheren Chef war das immer so abgelaufen!)
»Wenn Sie über diese Zahlen, Daten und Fakten berichten wollen, so ist das für mich in Ordnung, Herr Polz.«
»Gut, ich dachte, diese Zahlen, Daten und Fakten sind wichtig für Sie und das weitere Vorgehen.«
»Wieso machen Sie sich Gedanken, was für mich als Führungskraft wichtig ist? Ich nehme mir Zeit für Sie – Sie entscheiden, worüber Sie sprechen möchten. Es ist Ihre Zeit, Herr Polz.«
Ich stutzte einmal mehr, was sollte das denn?