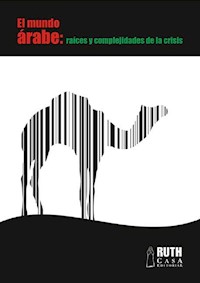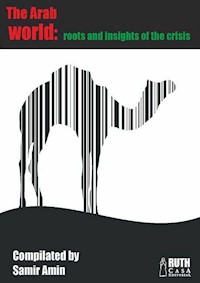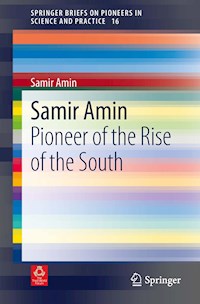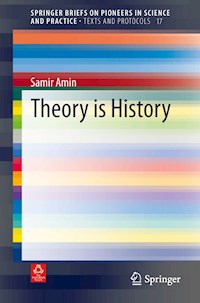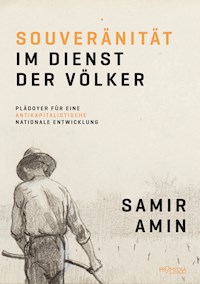
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Promedia Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nationale Souveränität ist in weiten Teilen des herrschenden Diskurses in Verruf geraten. Aber nicht, weil die Interessensvertreter der besitzenden Klassen den Nationalstaat auflösen wollen. Im Gegenteil: Dieser soll dem globalen Machtanspruch führender Kapitalgruppen entsprechend auf eine höhere, supranationale Ebene gehoben werden. Auf diese Weise bleibt die Funktion des Nationalstaats, nämlich die Durchsetzung von Klasseninteressen und die Aufrechterhaltung von Ausbeutungsstrukturen, nicht bloß erhalten, sondern wird erweitert. In den USA ist die "nationale Souveränität" längst zum Werkzeug großräumig agierender US-Konzerne mutiert, die sich mit Hilfe des militärisch-industriellen Komplexes über das Völkerrecht stellen. Die Europäische Union wiederum versucht, Souveränität aus dem nationalen Kontext ihrer Mitgliedsstaaten zu lösen und damit dem Verwertungsdruck großer Unternehmen gerecht zu werden. Angesichts des dominierenden Klassencharakters der Nation stellt Samir Amin die Frage, ob die antiimperialistische Linke sich vom Projekt einer nationalen Souveränität verabschieden sollte – und verneint dies. "Man darf die Verteidigung der Souveränität nicht dem bürgerlichen Nationalismus überlassen. Sie ist entscheidend für die Wahrung einer volksdemokratischen Alternative als Etappenziel auf dem Weg zum Sozialismus", schreibt er. Jahrzehntelange Erfahrungen der Völker in den Peripherien zeigen, dass es möglich ist, einen fortschrittlichen Nationalismus zu entwickeln, der die vom Kapital getriebene herrschende Weltordnung überwinden kann. In den drei Kapiteln seines Buches diskutiert Samir Amin die Volkssouveränität als Alternative zur liberalen Globalisierung sowie die Notwendigkeit einer bäuerlichen Landwirtschaft zur Herstellung von Ernährungssicherheit und analysiert die Blockaden für eine soziale Transformation im "globalen Norden", die es zu überwinden gilt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Samir AminSouveränität im Dienst der Völker
© 2019 Promedia Druck- und Verlagsgesellschaft m.b.H., Wien
Übersetzt aus dem Französischen von Birgit Althaler
ISBN: 978-3-85371-872-8 (ISBN der gedruckten Ausgabe: 978-3-85371-453-9)
Coverfoto: Drawing, Man with a Scythe, ca. 1865; Winslow Homer
Fordern Sie unsere Kataloge an:
Promedia Verlag Wickenburggasse 5/12 A-1080 Wien
E-Mail: [email protected] Internet: www.mediashop.atwww.verlag-promedia.de
Über den Autor
Samir Amin, geboren 1931 in Kairo, war Direktor des Dritte-Welt-Forums in Dakar/Senegal. Er gehörte zu den einflussreichsten Intellektuellen des »globalen Südens« und hat maßgeblich an dependenztheoretischen und weltsystemischen Ansätzen gearbeitet. Sein 1970 zuerst auf Französisch erschienenes Werk »L’accumulation à l’échelle mondiale« prägte eine ganze Generation entwicklungspolitischer DenkerInnen. Samir Amin starb am 12. August 2018 in Paris.
Einleitung
Dieses Buchprojekt ist das Ergebnis von Samir Amins letztem Besuch in Wien im Oktober 2017. Drei Tage lang diskutierte der renommierte Entwicklungstheoretiker seine Thesen zur Notwendigkeit einer sozialistischen Perspektive, seine Einschätzung der Russischen Revolution, der Sowjetunion und China sowie zum Potenzial globalisierungskritischer Kräfte weltweit mit StudentInnen und AktivistInnen aus sozialen Bewegungen. Daraufhin entstand die Idee einer neuen deutschsprachigen Publikation, basierend aufTexten, die kurz zuvor auf Französisch veröffentlicht worden waren. Amin ist in Frankreich und im nördlichen Afrika, seinen Lebensmittelpunkten, in der globalen entwicklungstheoretischen ForscherInnen-Community sowie unter antiimperialistischen AktivistInnen, die sich für eine andere, sozial gerechtere Welt einsetzen, gut bekannt. Im deutschen Sprachraum hingegen wird er nach wie vor als Geheimtipp gehandelt. Dieses Buch soll Abhilfe schaffen, zumal Amin angesichts aktueller Verunsicherungen nicht nur Klarheit in der Analyse schafft, sondern vor allem Handlungsperspektiven aufzeigt. Durch seinen Tod am 12. August 2018 konnte Amin das Erscheinen dieses Buches nicht mehr erleben.
Wer sich für die wissenschaftlichen Positionen Amins interessiert, hat dazu in den mehr als 30 Büchern, davon viele in andere Sprachen übersetzt, sowie in zahlreichen Fachartikeln Gelegenheit. Dieses Werk entstammt der zweiten Kategorie von Amins Werk, der politischen Kampfschrift. Sie basiert in der Analyse selbstredend auf wissenschaftlichen Grundlagen, geht in ihren Ansprüchen und Forderungen jedoch weit darüber hinaus. Es ist der Text eines ungeduldigen Militanten, wie auf Französisch PolitaktivistInnen genannt werden. Amin der Militante hält sich nicht mit historischen Erläuterungen und Forschungskontroversen auf, sondern steuert direkt auf die seiner Meinung nach brennendsten Fragen der Menschheit zu: das Überleben der Menschen auf dem Planeten in einer Weise, dass alle seine BewohnerInnen darin in angemessener und würdiger Weise teilhaben können. Die Basis dieses Überlebens ist die Produktion von und der Zugang zu Nahrungsmitteln.
Amin ist 85 Jahre alt, als er diese Texte schreibt. Er blickt auf ein außergewöhnliches Dasein zurück, das ihn Kolonialismus, Entkolonisierung, Aufbruchstimmung der postkolonialen Staaten und sozialistische Experimente ebenso wie eine Reihe von Rückschlägen erleben ließ. Die Einschätzung der aktuellen Lage ist widersprüchlich: Einerseits sind die Hoffnungen der postkolonialen Staaten auf eigenständige Entwicklung zerplatzt, nachdem die führenden kapitalistischen Mächte – allen voran die USA – ihre Hegemonie über den Süden im Zuge der jüngsten Globalisierungswelle erneut konsolidiert haben. Andererseits haben sie die Zügel nicht mehr so fest in der Hand wie im klassischen Imperialismus des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Sie sehen sich wie während der Dekolonisierung nach dem Zweiten Weltkrieg erneut Kräfteverschiebungen aus dem Süden gegenüber. Diesem fehle zwar eine gemeinsame Perspektive, aber immerhin: seit der erfolgreichen Konsolidierung der kapitalistischen Weltwirtschaft unter westlicher Dominanz nach dem Zusammenbruch des realen Sozialismus gibt es nicht nur Zeichen, sondern auch konkrete Anknüpfungspunkte für einen anderen Weg der Entwicklung. Amin will diesen Weg und diejenigen, die dafür eintreten, unterstützen. Dabei warnt er vor Illusionen in Reformen, vor einem Nachholen unter kapitalistischen Bedingungen und vor der Hoffnung auf nationale und regionale Alleingänge, die auf dem Rücken anderer Völker und Regionen erzielt werden. Kein Wunder, dass er ungeduldig ist, nachdem sein Lebensweg schon öfter mit Krisen und Aufbrüchen, aber auch mit Sackgassen und Enttäuschungen gepflastert war. Dabei mahnt er keineswegs Eile oder vorauseilenden Radikalismus ein, nein, es geht ihm darum, angesichts der verbreiteten Alternativlosigkeit und dem Trend zur Flucht in ethnische oder religiöse Identitätsvorstellungen die gesellschaftspolitischen Ziele einer gerechten Welt nicht aus dem Auge zu verlieren. Jetzt, wo Amin tot ist, ist diese Aufgabe auf die jüngere Generation übergegangen.
Der Text fasst, ohne auf Wissenschaftssprache Rekurs zu nehmen, die zentralen Positionen der Amin’schen Weltsystemanalyse zusammen. Der Fokus liegt dabei auf der Agrarfrage und auf der nationalen Frage, die er über den Begriff der Souveränität verknüpft: Volkssouveränität als Voraussetzung für Ernährungssouveränität. Aus Amins Perspektive – jene des globalen Südens, wo die Mehrheit der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig ist – müssen die vom Westen vorangetriebenen Agrarreformen zum Aufbau einer großbetrieblichen produktivitätsorientierten industriellen Landwirtschaft desaströs enden. Wir sind ja schon mitten drin im Desaster der Privatisierung der Böden, der Monopolisierung des Saatguts und dem Einsatz von Chemie und Schädlingsbekämpfung zur Produktivitätssteigerung. Der agro-industrielle Komplex kann sich als großer Gewinner dieser Entwicklung sehen, während die kleinbäuerliche Bevölkerung vom Land in die Städte und von den Slums in die Arbeitsmigration getrieben wird.
Es geht Amin darum, diesen Menschen ein angemessenes Auskommen am Land zu ermöglichen. Auch dies muss mit verbesserten Produktionsbedingungen und höheren Erträgen einhergehen, allerdings im Kontext einer Politik gestützter Preise, die das Überleben als bäuerlicher Haushalt ermöglicht, genossenschaftlicher oder staatlicher Vertriebsformen sowie einer Verknüpfung des Agrarsektors mit den anderen wirtschaftlichen Sektoren. An diesem Punkt gehen die agrarpolitischen Vorstellungen unmittelbar in eine volkswirtschaftliche Strategie über, die die Landwirtschaft mit der infrastrukturellen Erschließung der Regionen sowie der Maschinen- und der Lebensmittelindustrie verknüpft. Im regionalen Kontext bzw. auf dem Binnenmarkt, versteht sich, denn in der herrschenden Weltwirtschaftsordnung geht die großbetriebliche Agrarproduktion, die die Kleinbauern an den Rand drängt, in den Export und wird in den entwickelten Staaten verarbeitet. Sämtliche Inputs wie Saatgut, Maschinen, Dünger und Insektizide kommen ebenfalls von wenigen marktbeherrschenden Konzernen aus dem Westen. Und anstelle einheimischer Preispolitik, die den bäuerlichen Betrieben die Existenz ermöglicht, verordnet die Welthandelsorganisation Freihandel. Damit öffnet sich der Markt für Nahrungsmittelimporte aus den USA und europäischen Staaten, die – doppelten Standards sei dank – aufgrund von Agrarsubventionen an die dortigen Landwirte die lokalen Märkte noch weiter unter Druck setzen.
Amin ist hier ganz klar: Die grundlegenden Probleme der Mehrheitsbevölkerung dieser Welt, auch wenn sich die Sachlage aus der Perspektive der entwickelten Industriestaaten anders darstellt, muss von unten angegangen werden. Er führt im zweiten Kapitel sowohl die Verwerfungen der kolonialen Zeit, der »grünen Revolutionen« der 1960er- und 1970er-Jahre und der Bodenprivatisierung und Bodenmonopolisierung der letzten Jahrzehnte als auch althergebrachte örtliche Regelungen zur Beteiligung breiter Bevölkerungskreise an Bodennutzung und Konsum aus; dazu kommen die revolutionären Experimente kollektiver Landwirtschaft, die er im Fall der Sowjetunion aufgrund der Zwangskollektivierungen der 1930er-Jahre negativ einschätzt, während er gegenüber den Landkollektiven im Maoismus keine Kritik aufkommen lässt. Amin führt aber auch aus seiner eigenen Erfahrung als Berater verschiedener afrikanischer Regierungen für uns ZentraleuropäerInnen gänzlich unbekannte sozialistische Experimente an, etwa die in Mali von der Partei der Sudanesischen Union 1960 umgesetzten Formen kollektiver Landwirtschaft, die auf dem Familienbetrieb als zentraler wirtschaftlicher Einheit beruhten. So kann es nicht verwundern, dass Amin auch in den Ländern des Zentrums die bäuerliche Familienwirtschaft gegenüber der Durchsetzung eines monopolisierten agro-industriellen Komplexes schützen will, der die bäuerlichen Betriebe zu bloßen Handlagern bzw. Zulieferern des Agrobusiness macht oder die Produktion gänzlich übernimmt. Die Bauern- und Bäuerinnen-Bewegungen im Norden werden damit zu selbstverständlichen BündnispartnerInnen für den Kampf gegen die Diktate der WTO und für eine bäuerliche Agrarpolitik im Süden. Amin will über diese hinaus in der Linken, die in ihren Strategien stark auf die Industriearbeiterschaft fixiert ist, Verständnis für die Agrarfrage wecken.
Das zweite große Thema auf Amins Prioritätenliste in diesem Buch ist die nationale Souveränität. Amin ist sich dessen bewusst, dass er damit ein großes Dogma der Linken bis hin zum liberalen Mainstream im Norden berührt, demgemäß Nationalismus in jeder Form abzulehnen sei. Für Amin ist diese Haltung Ausdruck eines im Norden weithin verinnerlichten Eurozentrismus, der Nationalismus lediglich als Phänomen der europäischen Großmächte begreift. In dieser Lesart steht Nationalismus für die Expansion und das Machtstreben, das mit der innerimperialistischen Rivalität Leid über die gesamte Menschheit brachte. Völlig ausgeklammert wird dabei der Nationalismus des Südens, der den Weg zur Überwindung der kolonialen Abhängigkeit bereitete und den unabhängigen Staaten im globalen Süden den Aufbau und die Verteidigung ihrer eigenständigen Entwicklung ermöglichte.
Für Amin ist Befreiungsnationalismus immer mit einem internationalistischen Anspruch verbunden. Er will Volkssouveränität nicht als Kopie des bürgerlich-liberalen Nationalismus der Zentren verstehen, sondern als eine Strategie, die auf die enge Kooperation zwischen den Staaten des Südens setzt, damit diese gemeinsam die koloniale Abhängigkeit überwinden und die neokoloniale Abhängigkeit vermeiden. Damit distanziert er sich klar von Staatsführern, die ihren lokalen Machterhalt an die guten Dienste binden, die sie den imperialistischen Mächten beim Zugang zu Ressourcen bieten. Er nennt solche Machthaber, die als verlängerter Arm des Zentrums in der Peripherie wirken, »Kompradoren«. Sie können nur existieren, weil das globale Machtungleichgewicht im Interesse des Nordens nach ihnen verlangt. Daraus leitet er die Notwendigkeit für eine grundlegende Änderung der globalen Machtverhältnisse ab.
Wie aber das System verändern? Den Ausgangspunkt für politische Aktivität bilden die Staaten. Sie sind durch ihre wie auch immer unvollkommene Verfassung das Terrain, auf dem sich politische Auseinandersetzungen vollziehen. Ein Befreiungsnationalismus aus der Peripherie hat also immer eine antisystemische Komponente. Diesen Zusammenhang auszublenden, betrachtet Amin als fundamentalen Irrtum der Linken.
Amins Positionen werden besser verständlich, wenn wir sie im Lichte seines Werdegangs betrachten. Er wuchs als Sohn eines ägyptischen Vaters und einer französischen Mutter, beide Ärzte, in Kairo auf, absolvierte die Studien der Politikwissenschaft, der Statistik und der Ökonomie in Paris, wo er 1957 zum Thema Aux origines du sous-développement. L’accumulation capitaliste à l’échelle mondiale promovierte. In diesem Werk, das erst 1970 veröffentlicht wurde, legte er die Grundlagen für eine globale Analyse der Ungleichheit im Weltsystem. Er stellte einem metropolitanen Kapitalismus der Zentren, der diesen eine autozentrierte Entwicklung ermöglichte, einen peripheren Kapitalismus in den Kolonien und abhängigen Gebieten gegenüber, die aufgrund dieser Abhängigkeit zum deformierten Anhängsel der Zentren wurden. Diese Ausgangsposition ungleicher Entwicklung im Weltmaßstab, die in den Amerikas mit der von den Europäern so genannten »Entdeckung« begann, während ihr asiatische und afrikanische Länder und Reiche erst zu einem späteren Zeitpunkt unterworfen wurden, reproduzierte die Abhängigkeit der Peripherien in immer wieder neuer Form. Um diesen Mechanismus zu durchbrechen, brauche es eine Abkoppelung davon, ein Delinking, das zum Markenzeichen der Amin’schen entwicklungspolitischen Empfehlung wurde. Er meint damit nicht eine nationale Autarkie, sondern eine Abkehr von den Abhängigkeit produzierenden Mechanismen der kapitalistischen Weltwirtschaftsordnung. Und weil er dafür aufgrund der Funktionsweise des Kapitalismus, der als System auf Expansion und Ungleichheit angewiesen ist, keine Chance sah, war für ihn Delinking immer auch mit einer sozialistischen Orientierung verbunden.
Schon als Student in Paris war Amin politisch aktiv und das sollte sich Zeit seines Lebens nichts ändern. Sein beruflicher Werdegang war eine Gratwanderung zwischen wissenschaftlicher Forschung und Lehre an verschiedenen französischen Universitäten sowie entwicklungspolitischer Erfahrung, die er als Berater in der Entwicklungsplanung in Kairo (1957–60), Bamako (1960–63) und Dakar (1963–1980) sammelte. Er gewann praktische Einblicke in die Probleme des Staatsaufbaus in afrikanischen Staaten. In seiner Zeit am InstitutAfricaindeDéveloppementÉconomiqueetdePlanification (IDEP) in Dakar war er Wegbegleiter für rund 1000 junge afrikanische Intellektuelle, die die Entwicklungspolitik ihrer Staaten beeinflussen sollten. Amin skizzierte einen Analyse- und Handlungsrahmen, der bald als Theorie des peripheren Kapitalismus, Dependenztheorie oder Weltsystemanalyse in die kritische Entwicklungstheorie Eingang fand. Der deutsche Entwicklungsforscher Dieter Senghaas berichtet, wie er 1972 als junger Wissenschaftler an einer von Amins Dakar-Konferenzen teilnehmen durfte, wo einander die bekanntesten internationalen Entwicklungstheoretiker aus Nord und Süd begegneten. Für Senghaas war dies der Auftakt, deren Werke als Herausgeber in einer Reihe von Sammelbänden einem deutschsprachigen Publikum näherzubringen, die auch für meine eigene Orientierung unerlässlich waren. In der Folge entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit zwischen Samir Amin und Immanuel Wallerstein, Andre Gunder Frank und Giovanni Arrighi, die mitunter als die Viererbande (GangofFour) der Weltsystem-Forschung bezeichnet werden. Die vier publizierten viel gemeinsam (Dynamik der globalen Krise 1986; Transforming the Revolution 1990), bevor sich ihre Wege in den 1990er-Jahren trennten. Sie trugen ihre oft sehr grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten jedoch weiterhin untereinander aus.
Amin stellte als einziger afrikanischer Intellektueller eine Besonderheit unter den im anglo-amerikanischen Kontext agierenden Weltsystemforschern dar. Zusammen mit Andre Gunder Frank, der in der Amtszeit von Präsident Salvador Allende in Chile wirkte, gehörte er zu den Militanten unter den Forschern. Anders als Frank, dessen universitäre Karriere durch den Putsch in Chile einen Einbruch erlebte, war Amin in der afrikanischen Entwicklungsforschungs- und Planungslandschaft fest verankert. 1980 wurde er Direktor des Forum du Tiers Monde, einer in Dakar ansässigen Nichtregierungsorganisation, die sich als weltweites Forum für Entwicklungspolitik etablierte. Er war bis zu seinem Tod unaufhörlich als Lehrer, Planer, Organisator und Agitator aktiv. Im Gegensatz zu vielen Kollegen war Amin überzeugter Marxist und dafür berühmt, Marx im Sinne einer globalen Perspektive zu interpretieren und für antiimperialistische Befreiungskämpfe nützlich zu machen.
Der weltpolitisch prägendste Moment in Amins Lebenszeit war wohl die Konferenz von 23 asiatischen und sechs afrikanischen Staaten unter dem Präsidium von Jawaharlal Nehru, Gamal Abdel Nasser, Zhou Enlai, Josip Broz Tito und Sukarno, die im April 1955 im indonesischen Bandung stattfand. In Folgekonferenzen stieg die Zahl der Teilnehmer auf 60 an. Hier konstituierte sich der globale Süden (vorerst ohne Lateinamerika, wo der Kolonialismus formal bereits im 19. Jahrhundert endete) als Gruppe aufstrebender postkolonialer Staaten, die weder den westlich-kapitalistischen Weg anstrebten noch sich dem Sowjetblock anschließen wollten. Vielmehr bildeten sie einen dritten Weg, einen dritten Block, eine dritte Welt. Das war Wasser auf Amins Mühlen. Interessanterweise findet er die Teilnahme Jugoslawiens an der Konstituierung der »Dritten Welt« keiner besonderen Erwähnung wert und weist auch nicht darauf hin, dass die Bewegung der Blockfreien (NAM), die aus der Bandung-Konferenz hervorging, 1961 in Belgrad unter führender Beteiligung von Tito gegründet wurde und neben Jugoslawien (bis zu dessen Zerfall) auch die europäischen Staaten Malta und Zypern (bis zu deren EU-Beitritt) umfasste. Angesichts der großen Welle der Unabhängigkeitswerdung afrikanischer Staaten in diesen Jahren soll das aber auch nicht verwundern.
Amin gliedert die Jahre seit Bandung in die Bandung-Ära (1955–1975), die Zeit des »kollektiven Imperialismus der Triade« (1980–2000) und in eine Zeit seit den 2000er-Jahren, in der der globale Süden ein neues Selbstverständnis entwickelt. Während in den meisten Darstellungen die Zeit von 1945–1975 als Kalter Krieg und Bipolarität der Großmächte charakterisiert wird, verkörpert sie für Amin, der konsequent seine afrikanische Perspektive einbringt, eine multipolare Welt. Er weiß aus eigener Anschauung, wie es den frisch gebackenen Staatsmännern gelang, die Großmächte gegeneinander auszuspielen, um möglichst viel Unterstützung für ihre entwicklungspolitischen Projekte zu erlangen. Sie schufen damit genau jenen Freiraum, der für einen dritten Weg notwendig war. So sehr Amin diesem Aufbruch nachhing, so kritisch ging er mit den Illusionen der neuen Machthaber ins Gericht, dass eine nachholende Entwicklung nach dem Vorbild der kapitalistischen Zentren in Alleinregie möglich sei.
Der Grat zwischen Eigenständigkeit und »Kompradoren«-Rolle war schmal und bevor die Führer der »Dritten Welt« ihre entwicklungspolitischen Vorhaben realisieren konnten, hatte sich der Imperialismus bereits umorganisiert. Der Westen war bereit, die althergebrachte Arbeitsteilung zwischen Industrieländern und Agrarländern zugunsten einer nachholenden Industrialisierung der Entwicklungsländer aufzugeben, sofern letztere ihre niedrig entlohnten Arbeitskräfte für Verlagerung von billigen Industriestandorten anboten, wie dies als Antwort auf die Weltwirtschaftskrise der 1970er-Jahre verstärkt der Fall war. Für Amin änderte sich am Zentrum-Peripherie-Verhältnis nichts, solange die NewlyIndustrializingCountries keine ausgewogene Wirtschaft aufbauten, die örtlichen Arbeitskräfte keine angemessenen Löhne erhielten, mit denen diese wiederum auch als KonsumentInnen der Nahrungsmittel und Industrieprodukte auftreten konnten. Dass solche Strategien scheiterten, lastet er nicht nur den einheimischen Statthaltern des westlichen Kapitals an, sondern auch dem imperialistischen Rückschlag der Triade, wie Amin die Dreieinigkeit von USA, Westeuropa und Japan bezeichnet, der die entwicklungspolitischen Bemühungen im Geiste des Bandung’schen Multilateralismus beendete und eine »Apartheid auf Weltebene« einführte.
In der Beschreibung dieses globalen Rückschlags, der in den 1980er-Jahren begann und sich mit dem Zusammenbruch des realsozialistischen Blocks zuspitzte, nimmt sich Amin kein Blatt vor den Mund. Er wäre jedoch kein historischer Materialist, würde er nicht auch die Widersprüche sehen, die dem neoliberalen Umbau der Weltwirtschaft unter Führung der Triade innewohnten. Damit meint er einerseits die Zunahme der weltweiten Ungleichheit, bei der die Befriedigung der Grundbedürfnisse im globalen Süden, der nun auch auf Osteuropa ausgreift, nicht mehr gewährleistet ist, andererseits sieht er, wie sich neue Schwellenländer formieren, die die Herrschaft des »kollektiven Imperialismus« in Frage stellen. Diese sind sogar in der Lage, in jene Monopole vorzudringen, die bisher den westlichen Großmächten vorbehalten waren: Wissensproduktion, Rohstoffsicherung, Aufrüstung, Aufbau von Süd-Süd-Beziehungen.