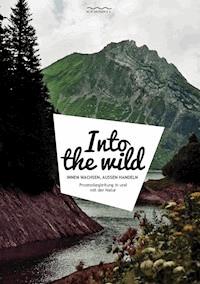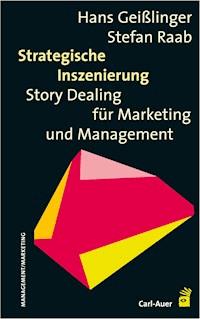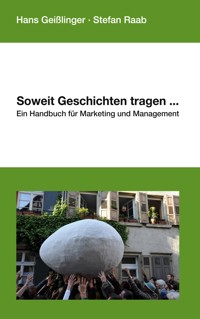
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie installiert man ein globales Logistiksystem, das Länder- und kulturübergreifend eine Vielzahl von Mitarbeitern erfolgreich integriert? Wie lässt sich die miserable Teilnahme von Männern an Programmen zur Krebsvorsorge verbessern? Wie gibt man Managern neue Impulse, um ihre Mitarbeiter auch in schwierigen Situationen mutig in die Zukunft zu führen? Wo andere versuchen Organisationen mit Methoden wie "Story Telling" erzählend zu verändern, inszenieren Hans Geißlinger, Stefan Raab und Kollegen gleich komplett neue Wirklichkeiten und machen so Visionen konkret erfahrbar. In diesem Buch erläutern die Autoren die Handlungskonzepte hinter den aufsehenerregenden und mehrfach ausgezeichneten Aktionen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Geschichten ziehen Realitäten nach sich,
die es ohne sie nicht gäbe.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Magie und Kommunikation
1.1 Über das Berührende, Ergreifende und Bewegende
1.1.1 Von der Magie zur Mathematik
1.1.2 Der Magier
1.1.3 Die Bannkräfte und ihre Wirkung
1.2. Über das Denkbare und das Machbare
2.1.1 Ein Ei, ein Drache und ein Flug durch den Luftraum von Österreich
2. Fünf Expeditionen in die Vorstellungskraft
2.1 Die Jagd auf das Menschenmögliche
2.1.1 Was tun?
2.1.2 Design, Organisation, Logistik
2.1.3 Der Wettkampf
2.2 Das blaue Licht – Eine Botschaft aus dem Innersten der Erde
2.2.1 Das Rätsel
2.2.2 Die Verzwergung
2.2.3 Die Kommission
2.2.4 Die Wirklichkeit
2.3 It´s up to you – Genesis einer strategischen Inszenierung
2.3.1 Die Ausgangssituation
2.3.2 Das Basiscamp
2.3.3 Die Schiffswerft
2.3.4 Das Casting
2.3.5 Das Training
2.3.6 Der Überfall auf die Macht des Faktischen
2.3.7 Das LAB
2.3.8 Die internen Kunden
2.3.9 Die Zielorganisation
2.3.10 Nach dem Spiel ist vor dem Spiel
2.4. Der Überfall auf die nationale Depression
2.4.1 Vorgedanken zum nationalen Fühlkörper
2.4.2 Der Überfall
2.5 Was, um Himmels Willen, ist ein Urolisk??!
2.5.1 Ausgangsbedingungen
2.5.2 Über die Kunst, einen Unterschied zu machen
2.5.3 Nur wer sich etwas vormacht, der hat auch etwas vor
2.5.4 Esse est percipi – Sein heißt wahrgenommen werden
2.6 Was war, was ist, was bleibt? – Interviews mit Auftraggebern
3. Magie und Methode
3.1 Die Renaissance des Imaginären
3.1.1 Über die Ökonomie und die Wünsche der Menschen
3.1.2 Die erlebnisorientierte Denk- und Fühlwelt
3.1.3 Der Markt und seine Lotsen
3.1.4 Die Unternehmen und ihre Lotsen
3.1.5 Die Koordinaten des Imaginären
3.1.5.1 Erster Quadrant: Die emotionale Aufladung von Produkten
3.1.5.2 Zweiter Quadrant: Das Erlebnis als Produkt
3.1.5.3 Dritter Quadrant: Das virtuelle Produkt
3.1.5.4 Vierter Quadrant: Die Wirklichkeit als Produkt
3.2 Die Tools: Inszenierung, Ereignis und Geschichte
3.2.1 Wer inszeniert was?
3.2.2 Was ist ein Ereignis?
3.2.3 Geschichten die das Leben schreibt
3.3 Von der Erfahrung zur Erkenntnis: Das STORY DEALING
3.4 Ordnung und Wirklichkeit: Die STRATEGISCHE INSZENIERUNG
3.4.1 Das Prinzip der Superkompensation - Wertposition
3.4.2 Das Prinzip der Variation
3.4.2.1 Die Aufmerksamkeitsebenen
3.4.2.2 Die Bedeutungsrahmen
3.4.2.3 Die Handlungsmodi: Einwirken, Wählen und Symbolisieren
3.4.3 Das Prinzip der Periodisierung
4. Ein archäologischer Bericht aus dem Grenzland zwischen Magie und Realität
Ein wunderschöner Morgen
Jenseits der Gemütlichkeit
Achtung, Achtung - hier spricht Radio Querenbach!
Vor zweihundertfünfundzwanzig Jahren
Dann mussten wir eine Prüfung überstehen
Im Bauch der Zeit
Von Wirklichkeit zu Wirklichkeit
Ich heiße Daniel, bin neun Jahre und Chefkriminaler
Im Gedächtnis
deshalb denke ich auch, dass Tassilo kommt!
Literaturverzeichnis
Über die Autoren
Einleitung
Am 8. Juni 2004, von 07:20 Uhr bis 13:23 Uhr, wurde uns ein astronomisches Schauspiel geboten: Hauptdarsteller waren die Sonne und unser Nachbarplanet Venus. Am Vormittag des 8. Juni zeigten sie die Variation einer Sonnenfinsternis. Zwar ist die Venus viel zu weit entfernt, um die Sonne wirklich zu verdecken. Aber man kann mit einer Sonnenfinsternisbrille die Augen schützen und beobachten, wie sie als kleiner schwarzer Punkt am unteren Rand der Sonnescheibe vorbei zieht. Dieser, mit bloßem Auge kaum wahrnehmbare Vorgang, wurde von den Massenmedien aufgegriffen und löste ein Ereignis aus, das sich zu einem globalen Event entwickelte. Wie war das möglich? Was trieb Millionen von Menschen dazu sich mit speziellen Verdunklungsbrillen auszurüsten, die öffentlichen Plätze dieser Welt zu bevölkern und dort zeitgleich ihren Blick in den Himmel zu richten? Was ließ sie einen visuell banalen Vorgang als Ereignis erleben – ein Ereignis, für das man sich ausrüstet, aufbricht und zusammenkommt?
Das Motiv, das uns Menschen dazu bewegt dem Gravitationsfeld des Alltags zu entfliehen, liegt offensichtlich nicht in dem, was wir beobachten, sondern darin, wie wir es tun. Das Geheimnis verbirgt sich hinter unseren Augen, in den Geschichten, die wir wahrnehmen, wenn wir etwas sehen. Dieser aus Geschichten gewebte Stoff ist es, der das Geschehen an sich erst zu einem Ereignis für uns werden lässt. Man kann diesen Stoff weder sehen noch riechen, weder tasten noch schmecken. Durch ihn wird nichts einfacher, effizienter oder komfortabler. Trotzdem ist er ein Träger nahezu aller sozialer, kultureller und technischer Entwicklungen, Veränderungen oder Innovationen. Er entstammt zwar der Welt unserer Vorstellung, choreographiert aber gleichzeitig auch die Form unseres tatsächlichen Erlebens. »Venus lässt die Herzen flimmern«, titelte eine deutsche Tageszeitung und schon sind wir bei den Liebes-, den Zeit- und Schicksalsgeschichten, mit denen wir den kleinen Punkt Wirklichkeit werden lassen und in den Fokus unserer Wahrnehmung stellen.
Geschichten lassen sich aber nicht nur finden, sondern auch er-finden, nicht nur erzählen, sondern auch erleben. Geschichten entfalten ihre stärksten Wirkkräfte nicht im Reich des Hören-Sagens, sondern dort, wo sie tatsächlich erlebt werden können -. Mit STORY DEALING bezeichnen wir den Prozess von der Entwicklung bis zur Realisierung einer Geschichte. Er schließt das Potential der Erzählung zwar mit ein, beschränkt sich jedoch nicht darauf. Wir betonen das deshalb, weil der hier vorgestellte Ansatz weit über das aktuell kursierende STORY TELLING hinausgreift.
Wenn es darum geht, eine Geschichte gemeinsam ins wirkliche Leben zu holen, rieselt nichts mehr von oben auf passive Zuhörer oder Zuschauer. Etwas Bewegendes ergreift und erzeugt einen Zustand der Erregung und Öffnung: Arrangieren, Verbinden, Unterlaufen, möglich machen… Wer den Aktionsraum einer Geschichte betritt, verankert ihre Zielsetzungen im eigenen Motiv. Und wer sich einsetzt, setzt sich auch aus, insbesondere, wenn Verlauf und Ausgang offen sind. Der Prozess des Handelns und Entscheidens, des Zögerns und In-Angriff-Nehmens beginnt. Mit ihm tritt die Geschichte in Erscheinung und damit ins Verhältnis zu ihrer Umwelt, d.h. zur Alltagswirklichkeit. Ein Kräftefeld struktureller Kopplungen, d.h. gegenseitiger Beeinflussung und Einflussnahme entsteht. Mit den Interdependenzen dieses Feldes, den Beziehungen zwischen unterschiedlichen Wirklichkeiten, beschäftigt sich die STRATEGISCHE INSZENIERUNG. Welcher Attraktoren bedarf es, um die Protagonisten in Austausch und Auseinandersetzung bringen? Die Kopplung und Entkopplung kultureller und dramaturgischer Mittel mit denen Wirklichkeiten erzeugt und Emotionen gebunden werden, sind der Spielraum und das Handlungsfeld der STRATEGISCHEN INSZENIERUNG.
Wie das konkret geschieht, zeigt das zweite Kapitel dieses Buches mit den Fünf Expeditionen in die Vorstellungskraft. Die entsprechenden theoretischen und die daraus abgeleiteten methodischen Überlegungen finden sich im nächsten Kapitel (3) über Magie und Methode. Dessen letzter Abschnitt Ordnung und Wirklichkeit zielt auf das, was es braucht, um aus strategischen Absichten Realität werden zu lassen. Er zeigt die Struktur und die Prozessvariablen eines Interventionsdesigns - aus dem Blickwinkel der Strategischen Inszenierung.
Man sollte allerdings ein Vorhaben wie dieses nicht vom Schwanz her aufzäumen. Wir beginnen selbstverständlich dort, wo alles anfängt, beim Kopf und seiner genialsten Kompetenz: der Fähigkeit sich etwas vorzustellen. Die Kraft zur Einbildung, Einfälle zu haben, Ideen zu entwickeln und andere damit in Berührung zu bringen, ist die conditio qua non, ohne die nichts in Bewegung gebracht und nichts in Beziehung gesetzt werden kann. Der Mensch wirkt, indem er handelt und er handelt, weil er ein Ziel vor Augen hat, ein Interesse - eine Motivation die ihn bewegt. Das Motiv, also das, was einer Motivation zugrunde liegt, entspringt stets der Welt unserer Vorstellungen. Damit sind wir bei der Einbildungskraft. Dem Versuch, dieser imaginären Kraft und ihrer Wirkungsweise auf die Spur zu kommen, ist das erste Kapitel dieses Buches Magie und Kommunikation gewidmet.
P.S.: Bleibt zu sagen, dass den Leser, am Ende, im vierten Kapitel, eine kleine Zeitreise erwartet - eine Entführung zurück in die Kindheit, dorthin, wo das Wünschen noch geholfen hat. Es war einmal: Ein archäologischer Bericht aus dem Grenzland zwischen Magie und Realität.
1. Magie und Kommunikation
1.1 Über das Berührende, Ergreifende und Bewegende
»Jede Veränderung entsteht in Kräften vor der Vorstellungskraft,
hauptsächlich aber und am wirkungsvollsten
durch die Vorstellungskraft selbst.«
Giordano Bruno1
Das Feld, das wir im Verlauf dieses Kapitels behandeln werden, skizziert den Ausgangspunkt für alles Folgende. Es ist die Fähigkeit des Menschen zur Einbildung. Damit meinen wir zunächst nicht mehr und nicht weniger, als die menschliche Eigenschaft, sich selbst und anderen etwas vormachen zu können. Zugegeben, dieser Ausdruck besitzt im alltäglichen Sprachgebrauch eine eher negative Konnotation. Wir verbinden ihn mit der Vorstellung der Lüge, des Vorgaukelns falscher Tatsachen. In unserem Zusammenhang aber zielt er auf etwas viel Fundamentaleres: auf das Vermögen, sich vermittels der Einbildungskraft, etwas vor das geistige Auge stellen zu können, Vor-Stellungen zu entwickeln, von Personen, Situationen und Vorhaben – egal ob diese nun in der Vergangenheit, der Gegenwart oder der Zukunft liegen. Wenn man so will, leben wir in dieser Welt unserer Vorstellungen; ihr entwachsen unsere Ziele und Vorhaben.
Taylor und Cohen, zwei amerikanische Soziologen, sind in ihrem Buch Ausbruchsversuche einer Frage nachgegangen, die wir alle mehr oder weniger kennen: Wie den Tag überstehen? Damit ist kein besonderer Tag gemeint, nichts Außergewöhnliches. Es geht um das Aushalten der Normalität, der Langeweile, der Eintönigkeit. Folglich setzt die Untersuchung dort an, wo die Tage sich gleichen, wie ein Ei dem anderen: im Gefängnis. Was bringt Gefangene dazu, morgens die Augen zu öffnen und mit irgendetwas zu beginnen? Was hält sie am Leben, am Teilhaben an der Welt? Cohen und Taylor fanden heraus, dass es die inneren Bilder waren, die sich die Insassen von der Zeit machten, d.h. die Vorhaben, die sie sich ausdachten, die Ereignisse, die sich daraus entwickeln würden, die Art, wie sie darauf reagieren sollten… Die Gefangenen schrieben sich unsichtbare, innere Drehbücher, d.h. Geschichten, in die sie sich verwickelten und mit denen sie die Zeiträume in ihrer Phantasie durchquerten. Sie erdachten gewissermaßen eine ganz persönliche imaginäre Welt, die sich, gleich einer zweiten Haut, über die Gesamtheit der realen Ereignisse legte und diesen einen Sinn verlieh.
Was hier der Monotonie eines Gefängnisalltags entwächst, findet sich bei näherer Betrachtung auch in der ganz normalen Welt wieder. Schließlich machen auch wir uns zuerst eine Vorstellung von etwas, d.h. wir machen uns etwas vor, bevor wir beginnen es umzusetzen – oder auch nicht. Die Fähigkeit zur Imagination eröffnet dem Menschen den Weg zu seinem Selbstverständnis, und sie ermöglicht es ihm sich mit anderen in Beziehung zu setzen – bis zum Moment der Überschreitung, wo das Eine in das Andere überzugehen beginnt, es berührt und ergreift. Schließlich kann niemand von etwas ergriffen werden, ohne zugleich eine Vorstellung davon in sich zu tragen. Die Fähigkeit sich etwas vorzustellen, setzt die Fähigkeit sich etwas vorzumachen voraus. Ob wir dafür den lateinischen Begriff der Imagination oder das deutsche Wort Einbildung verwenden, beides verweist auf den gleichen Vorgang, auf die Herstellung innerer Bilderwelten. Mit anderen Worten: Die Sprache der Vorstellung ist die Sprache der Bilder. Von etwas ergriffen zu werden heißt, ein Bild davon in sich zu tragen.
1.1.1 Von der Magie zur Mathematik
Zweifelsohne hat unsere Zeit in vielen Bereichen des Lebens einen gewaltigen Schub an Erkenntnissen hervorgebracht. Daraus resultiert aber nicht, dass sich unser gesamtes Wissen von dieser Welt im Laufe der Geschichte quasi immer weiter verfeinert, ausdifferenziert und damit verbessert hätte. Das mag auf die Entwicklung der Naturwissenschaften und der Technik in den letzten vier, fünf Jahrhunderten zutreffen, nicht aber auf das Feld unserer Untersuchung. Wenn wir uns heute rühmen, über wissenschaftliche Kenntnisse und Technik zu verfügen, so sollten wir gleichzeitig erkennen, dass unser Wissen über die Kraft der Imagination, ihr Stellenwert, ihre Bedeutung und Wirkungsweise eher ab- als zugenommen hat.
Wir stellen diese Überlegung vor dem Hintergrund des 16. Jahrhunderts, dem Zeitalter der Renaissance, einer Kultur, die sich der Erforschung der Imagination gewidmet hat, wie keine zuvor und keine danach. Ihre Wissenschaften (Eros, Magie und Gedächtniskunst) maßen den vom inneren Sinn erzeugten Vorstellungsbildern - den Phantasmen, wie sie zu der Zeit genannt wurden - eine unermessliche Bedeutung zu. Sie hatten die menschliche Fähigkeit, auf diese einzuwirken, bis zum Äußersten verfeinert. Wenn wir also das Feld der Imagination genauer unter die Lupe nehmen und den Versuch starten wollen in seine Prozesse einzutauchen, dann sollten wir dort beginnen, wo man am meisten darüber nachdachte: in der Zeit der Renaissance; genauer gesagt, an ihrem Ende, als ihre Wissenschaften die höchste Entwicklungsstufe erreichten - in den Werken Giordano Brunos, eines Dominikanermönchs aus einem neapolitanischen Kloster.
Philippo Bruno, wie er eigentlich hieß (später nannte er sich dann Giordano) wurde 1548 in Nola geboren. Mit siebzehn Jahren trat er in Neapel in den Dominikanerorden ein, erhielt 1572 die Priesterweihe und studierte Theologie. Wegen eines Konflikts mit der Klosterleitung verließ er den Orden und nahm eine Art philosophischer Wanderexistenz auf. Bruno reiste durch halb Europa, lehrte in Paris, London und Toulouse, um dann über Wittenberg und Prag nach Venedig zu gelangen – wo man ihn einkerkerte, nach Rom überstellte und schließlich, weil er sich weigerte, seine Lehren zu widerrufen, zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilte.2 Dabei war Bruno alles andere als ein Vorkämpfer der Moderne. Sein Weltverständnis gründete auf dem des abendländischen Mittelalters, also einer Zeit, die gerade dabei war, zu Ende zu gehen. In diesem magischen Kosmos suchte er die skurrilsten Plätze und entlegensten Regionen des Denkens auf, um das Wissen über die Techniken zur Herstellung und Wirkungsweise innerer Bilderwelten zusammenzutragen, zu systematisieren und weiterzuentwickeln. Auf diese Weise hauchte er dem Wissenschaftsgebäude der Renaissance noch einmal neues Leben ein. Dabei geriet er ins Visier der Inquisition.
Das Gewaltpotential, das die katholische wie auch die protestantische Seite im Rahmen des dreißigjährigen Krieges entwickelte, war, in seinen auf die Bevölkerung übergreifenden Zwängen, durchaus vergleichbar mit dem der späteren französischen bzw. sowjetischen Revolution. Mit der zeitlichen Dauer dieses Krieges ging auch eine Radikalisierung der jeweiligen theologischen Glaubenslehren einher. So machte sich die Reformation auf den Weg zurück - zurück zur ursprünglichen Reinheit der christlichen Botschaft und die lag im Wort, d.h. in den Texten der Bibel und nicht in Bildern. Also wurden die Bilder und Statuen aus den Kirchen entfernt und zerstört. Stattdessen rückte man die Kanzel des Predigers ins Zentrum des Geschehens. Das biblische Verbot der Bilderverehrung gerann zum Dogma. Die katholische Seite wiederum konterte mit der Inquisition, d.h. mit der Jagd auf die inneren Bilder des Menschen – auf die vom inneren Sinn erzeugten satanischen Götzen. So gesehen erweist sich die Hexenverfolgung als das katholische Gegenstück zur protestantischen Bilderzerstörung. Unter dem fundamentalistischen Bildersturm von Reformation und Gegenreformation wurden die Wissenschaften der Renaissance innerhalb eines Jahrhunderts restlos aufgelöst.3
Die Menschen lernten wieder sich vorsichtig auszudrücken. Mit der Zeit hatten sie es sich abgewöhnt, über Dinge nachzudenken, die in Widerspruch zu den offiziellen Aussagen der beiden Kirchen lagen. Das Feld der großen metaphysischen Gedankengebäude war über Jahrzehnte vermint. Also begann man sich einer anderen Seite zuzuwenden, dem Feld der Materie, das in der hierarchischen Ordnung der bisherigen Welt den untersten Platz einnahm. Hier entstanden die ersten Versuche der modernen, von Empirie und Mathematik geprägten Wissenschaft und mit ihr traten die zählbaren, messbaren, quantifizierbaren Eigenschaften in den Vordergrund der Betrachtung. Die strenge Beobachtung der Gegebenheiten und ihrer Bewegungsgesetze veränderte den menschlichen Blickwinkel auf die Welt grundlegend. Auf diese Weise haben Reformation und Gegenreformation den gesellschaftlichen Stellenwert und die Bedeutung der menschlichen Einbildungskraft tiefgreifend verändert.
1.1.2 Der Magier
Die zentrale Überlegung Giordano Brunos liegt in der Frage, wie die Welt in das Bewusstsein eindringt und andererseits das Bewusstsein in die Welt übergeht. Auf der tektonischen Kante dieses Austauschprozesses bewegt sich sein Denken. In diesem Zusammenhang ist die Magie für ihn nichts anderes, als die bewusste Beeinflussung des Individuums und seiner Einbildungskraft, der Imagination. Sie ist das zentrale Organ der menschlichen Wahrnehmung und die Aufgabe des Magiers ist es, dieses Organ zu verfeinern, um mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln das Individuum zu beeinflussen und seine Wirklichkeit zu verändern.
Die Untersuchung Brunos lässt sich mit Machiavellis Principe vergleichen. Während Letzterer das Feld der Politik durchpflügt, begibt sich Bruno auf das Feld der Seele. Was zieht die Seele in Bann, was fasziniert sie? Wodurch erzeugt die Seele ihre Vorstellungsbilder? Warum ziehen Seelen sich gegenseitig an? Wie erklärt sich ihr Wirken nach Innen und wie ihre Anziehungskraft auf andere, nach Außen?
Am Anfang der menschlichen Wahrnehmung stehen für Giordano Bruno die Sinne. Durch sie werden die Botschaften von außen nach innen geleitet, um im Herzen zusammen zu fließen. Hier lohnt sich ein kleiner Ausflug in die Argumentations- und Darstellungsweise. Bruno geht es nicht um das Herz als medizinisches Organ, sondern um das Herz als gefühltes, moralisches Organ. Diese Art und Weise, mit der er die Dinge in Beziehung setzt, gilt es für unsere Untersuchung fruchtbar zu machen:
»Jeder äußere Einsatz« schreibt Culianu zur Theorie Brunos, »wird von einem inneren Antrieb begleitet, der im Herzraum erlebt wird. Nun ist die erste Sprache ein körperlicher Ausdruck und die verbalen Schemata sind das Bezugssystem aller möglichen Gebärden der Gattung homo sapiens. Greifen wir einige verbale Schemata aufs Geradewohl heraus, die sich auf das Herz beziehen: Jemand, der unfähig ist, vom Kummer eines anderen gerührt zu werden, legt Hartherzigkeit an den Tag, hat ein Herz von Stein oder kein Herz im Leibe; im Gegensatz dazu hat jemand, der seinen Gefühlen freien Lauf lässt, ein weiches, zartes Herz, und wer bei seinem gesellschaftlichen Tun keinerlei böse Absichten hegt, weil er sich vorstellt, dass die anderen auch keine haben, besitzt ein reines Herz. Jener trägt das Herz auf der Zunge, hat ein Herz aus Gold, ist herzensgut, aber es kann vorkommen, dass ihm schwer ums Herz wird, dass er sich etwas zu sehr zu Herzen nimmt, etwas auf dem Herzen hat und aus seinem Herzen keine Mördergrube machen will. Man kann Dinge leichten Herzens tun und sogar von ganzem Herzen, aber dennoch nicht das Herz haben, herzlos zu sein. Wenn uns etwas am Herzen liegt, wünschen wir, dass es uns zu Herzen geht und wir hängen unser Herz daran. Die Beherzten bringen es nicht übers Herz, ihr Herz auszuschütten, wenn ihnen schwach ums Herz wird. Und die Angelegenheiten des Herzens führen dazu, dass wir unser Herz verlieren, schenken oder auch an gebrochenem Herzen sterben, uns in jemandes Herz stehlen, jemanden in unser Herz schließen, an Herzschmerz leiden oder dass uns alle Herzen zufliegen… In all diesen Ausdrücken muss eine Wahrheit außersprachlicher Art beschlossen sein, eine Wahrheit, die nahezulegen scheint, dass das Herz der Sitz der Empfindsamkeit, aller Gefühlsregungen und das moralische Organ schlechthin ist. Das Denken wird in seiner Gefühlsäußerung vom Herzen wahrgenommen und das ist so, weil wir es fühlen.«4
Vergleicht man diese Abhandlung mit der heutigen Sichtweise der Medizin, so ist an die Stelle des Herzens das Gehirn getreten, während der ehemalige Sitz aller großen menschlichen Gefühle zu einer Pumpe geworden ist, die das Blut am Zirkulieren hält. Diese unumstrittene medizinische Tatsache findet allerdings nur bedingten Zugang in die Welt der Sprache. Schließlich werden alle von Bruno erwähnten Metaphern heutzutage noch genauso verwandt, wie vor 400 Jahren. Man stirbt auch heute nicht an gebrochenem Gehirn und man verliert sein Gehirn auch nicht an einen anderen. Was also macht das Bild, das wir vom Herzen haben, so resistent gegen seine neue medizinische Bedeutung? Die Spur dieser Frage weist in die Welt des Nichtstofflichen, des Subjektiven, des Erfahrens und Empfindens.
Was hier als wahr oder falsch zu bewerten ist, leitet sich nicht aus dem ab, was wir wahrnehmen, sondern wie wir es tun. Bruno nimmt hier eine ähnliche Position ein, wie der spätere Goethe. Der wendet sich gegen die newtonsche Spektralanalyse des Lichts, weil sie, um beobachtet werden zu können, eine technische Manipulation voraussetzt – die Umleitung des Lichtes durch ein Prisma. Damit aber wird, laut Goethe, das von den Augen wahrgenommene Phänomen in Wirklichkeit verfälscht.5 Was die physikalischen Eigenschaften des Lichts betrifft, so ging Newton zweifellos als Sieger aus dieser Meinungsverschiedenheit hervor. Fragen wir aber danach, was die Wahrnehmung des Lichts für uns bedeutet, was sie in uns auslöst, dann überschreiten wir die Grenzen der physikalischen Welt und betreten mit Bruno den Erklärungskosmos der Magie. Womit wir wieder beim Imaginären wären, dem eigentlichen Gegenstand unserer Untersuchung.
Aufgabe der Imagination ist es, die mit Hilfe der Sinne erfassten Wahrnehmungen in eine für die Seele verständliche Sprache zu übersetzten. Die Imagination wandelt die Sprache der Sinne in eine der Seele um und der Terminus technicus dieser Seelen-Sprache heißt phantasmisch.6 Da die Seele nur ihre eigene Sprache versteht, gibt es für sie ohne Imagination auch kein Erkennen.7
Was aber veranlasst die Seele überhaupt dazu aktiv zu werden, d.h. Botschaften aufzunehmen oder zu senden? Wie erklären sich die Bewegungen zwischen den Seelen, die Wirkkräfte ihrer gegenseitigen Anziehung? Diese Kräfte der Bezauberung wie Bruno sie nennt, speisen sich aus einer einzigen Quelle, der Bannkraft der Liebe:
»Wir sagten«, schreibt er in seiner Abhandlung zur Magie (…), »dass alle Bannkräfte irgendwie teils sich auf die Bezauberung durch die Liebe beziehen, teils von der Bezauberung durch die Liebe abhängen, teils auf der Bezauberung durch die Liebe beruhen. Durch dreißig Arten von Knoten der Verlockung wird es leicht sein zu zeigen, dass sich die Liebe als die Grundlage aller Empfindungen erweist. Denn wer nichts liebt, hat keinen Grund sich zu fürchten, zu hoffen, sich zu rühmen, stolz zu sein, etwas zu wagen, zu verachten, anzuklagen, zu verzeihen, sich erniedrigt zu fühlen, eifersüchtig zu sein, zu zürnen oder durch anderes von dieser Art ergriffen zu werden. Weit erstreckt sich deshalb das Feld, und tief gründet die Betrachtung oder auch die Spekulation, der wir uns aus diesem Anlass unter dem Titel ´Die Bannkraft der Erotik´ widmen. Diese Betrachtung sollte deshalb nicht als allzu weit entfernt von den bürgerlichen Grundsätzen beurteilt werden, weil sie so erstaunlich weit reichender ist als diese«.8
Für Bruno ist der Eros die Grundlage aller Art von Anziehung. Abneigung und Hass stellen lediglich die negative Seite derselben universellen Anziehungskraft dar. Eros ist das Movens aller intersubjektiven Beziehungen, einschließlich der Massenphänomene. Nicht der abstrakte Mechanismus der Informationsübertragung zwischen einem Sender und einem Empfänger steht im Zentrum der Betrachtung, sondern die Erzeugung von Anziehungskräften. Schließlich folgt dem Eros das Verlangen und wenn es um Verlangen geht, geht es um dessen Befriedigung. Verlangen aber erweist sich als nichts anderes, als das Verfolgen einer Vorstellung, d.h. eines vom inneren Sinn erzeugten Phantasmas. Auch wenn dieses Vorstellungsbild auf etwas verweist, was außerhalb seiner selbst liegt, so bleibt es doch stets das Produkt eines inneren, geistigen Vorgangs und damit Teil einer imaginierten Welt. Eo ipso wirkt der Eros in einem durch und durch phantasmischen Umfeld. Damit erweist sich die Gesellschaft – laut Giordano Bruno – auf allen ihren kommunizierenden Ebenen als wirkende Magie. Ohne sich dessen bewusst zu sein, nimmt jedes Lebewesen durch seine Teilhabe am intersubjektiven Netz der Kommunikation an dieser Magie teil.9
Willkommen in der Tiefe der menschlichen Beweggründe. Hier hat sich auf unserer Reise in die Vergangenheit ein Rollenwechsel vollzogen. An die Stelle des menschlichen Verstandes, in der Position des zentralen Lotsen unseres Verhaltens, tritt die Kraft der Imagination. Sie öffnet den Weg zu den Innenwelten der Gefühle. Es gibt nichts in unserem Verstand, was nicht vorher von den Sinnen wahrgenommen wurde, und es gibt nichts, was ohne die Vermittlung der Phantasie von den Sinnen zur Vernunft gelangen könnte. Damit aber nimmt jede Veränderung ihren Weg durch die Vorstellungskraft.
Die willentliche Anwendung dieser Kraft, d.h. die bewusste Veränderung der eigenen Phantasie und ihrer Übertragung auf andere, charakterisiert den Beruf des Magiers. Spiegelte sich diese Fähigkeit früher im Dichter oder bildenden Künstler wider, so beschäftigt sich der Magier von heute mit Menschenführung, also mit allem, was damit zu tun hat, Verhalten zu beeinflussen und zu verändern. Da sich niemand dem Bereich der intersubjektiven Beziehungen zu entziehen vermag, ist aus Brunos Sicht auch alles beeinflussbar. Jedes Selbstverständnis menschlicher Gemeinschaften beruht auf einer durch magische Operationen hervorgegangenen Form der kollektiven Überzeugung.
1.1.3 Die Bannkräfte und ihre Wirkung
»Alles belebt es, mäßigt es, erfreut es,
lenkt es, zieht es an, entflammt es.
Alles bewegt es, öffnet es, erleuchtet es,
reinigt es, erfüllt es.
Allem gibt es«.
Giordano Bruno10
Allen Lebewesen, schreibt Bruno, wohnt eine Spiritualität inne, die auf den Erhalt des gegenwärtigen Zustandes zielt. Um das Gravitationsfeld dieser Verharrung aufzulösen, bedarf es einer Kraft, die in der Lage ist die Menschen zu bezaubern, zu ergreifen und sie in ihren Bann zu ziehen. Wie bereits erwähnt, werden wir weitaus heftiger und intensiver durch die Phantasie bezaubert, als durch den Verstand. Der Grund hierfür ist relativ banal, d.h. er besteht im Entstehen der Vorstellung, dass uns etwas im weitesten Sinne Befriedigung bereiten könnte. Es ist das Motiv der Lust, nach dem wir greifen und wir greifen zur Lust, weil wir durch sie ergriffen werden. Es bedarf keines weiteren Grundes als dem, unserem Verlangen zu entsprechen. Mit anderen Worten, es ist die Liebe zu uns selbst, die uns in Bewegung setzt und mit anderen Menschen in Verbindung bringt. Ohne diese Art von Eigenliebe wäre der Mensch unverführbar, aber damit auch unberührbar und ohne jede Ausstrahlung auf andere.
Es gibt visuelle Wahrnehmungen, die unmittelbar ein Gefühl entstehen lassen. So kann ein Gesicht, das Trauer oder Schmerz ausdrückt, ein Gefühl von Trauer oder Schmerz auch bei anderen hervorbringen. Dies funktioniert nur, wenn wir davon ausgehen, dass die wahrgenommene Trauer authentisch ist – allgemein gesagt, wenn wir daran glauben. Der Nährboden, auf dem dieser Glaube wächst, heißt Imagination. Denn die Bannkraft speist sich nicht aus dem Wirklichen, sie muss sich nicht auf Wirkliches gründen. Ihre Quelle liegt vielmehr im Anschein von Wirklichkeit, in der Tatsache also, dass geglaubt wird, es sei wirklich. Die Einbildung braucht keine Wirklichkeit, um zu bannen und den durch sie Gebannten tatsächlich zu binden. Sie ist auf eine ihr eigene phantastische Art wirklich. Sie wirkt, als würde es sie geben. Der Gebannte wird durch sie gefesselt, nicht weil das Gute oder Schöne ihn bezaubert, sondern sein Glaube, dass es gut oder schön sei.
Natürlich hängt die Bezauberung auch von einer gewissen Anpassung und Entsprechung ab. Um eine Emotion bei anderen auszulösen, muss sie sich zunächst in einem selbst entwickeln. Erst dann ist man in der Lage, sie auch auf andere zu übertragen. Wer also fesseln will, ist angehalten, dieselben Affekte zu entwickeln, wie derjenige, der gefesselt werden soll. Ein Redner löst Empfindungen nur durch Empfindungen aus. Dabei bedient er sich zweier Arten von Handlungen: des sprachlichen Ausdrucks und der Bewegung der Hand. Beides ermöglicht ihm, eine im Geist vorgestellte Sache in die Vorstellungswelt der anderen zu übertragen. Die Überredungskünste, die er entfaltet, bedienen sich magischer Mittel. Ihr Zweck ist, andere an sich zu binden. Streng genommen machen der Redner, der Verliebte und der Magier das Gleiche: Sie werfen ihre Netze aus.
Was nicht leicht zu erlangen ist, in das verlieben wir uns umso glühender. Eine Bezauberung sollte deshalb von Anfang an immer wieder eine weitere Versuchung nach sich ziehen.
»Eigentlich lieben wir kein uns fremdes Wesen – wir verlieben uns in ein unbewusstes Bild. Der Liebende prägt die Gestalt des Geliebten in seine Seele ein. Die Seele des Liebenden wird also zum Spiegel, der das Bild des Geliebten zurückstrahlt.«11
Da ein Spiegel die Eigenschaft besitzt, nur fremde Bilder in sich zu tragen und keine eigenen, tritt das Bild des anderen an die Stelle des eigenen. Damit tritt das Phantasma an die Stelle der Seele.
»Daraus folgt, dass das seiner Seele beraubte Subjekt kein Subjekt mehr ist: der phantasmische Vampir hat es von innen heraus verschlungen. (...) Metaphorisch ließe sich sagen, dass sich das Subjekt in das Objekt seiner Liebe umgewandelt hat.12
»Alles was gebannt wird« schreibt Bruno »nimmt dies auf irgendeine Weise wahr, d.h. im Wesen seiner Wahrnehmung ist eine bestimmte Art von Vorstellung oder ein bestimmtes Verlangen zu beobachten. Wer also etwas bannen will, muss irgendwie der Wahrnehmung des Bannfähigen etwas aufdrängen, denn die Bezauberung folgt der Wahrnehmung wie der Schatten dem Körper.«13
Hier transformiert sich die Psychosoziologie des Paares zu einer allgemeinen Psychosoziologie, einer interdisziplinären Wissenschaft über die Prozesse der Berührung; einer Wissenschaft, deren Tragweite zu erfassen und deren Gebrauchswert zu ermessen vor uns liegt. Da die Imagination, die Kraft der Ein-Bildung dem Menschen das Mögliche als Teil des Wirklichen vor Augen führt, ist sie die Voraussetzung und das Gestaltungselement von Kultur schlechthin. Die imaginäre Verwandlung von Visionen zu Tatsachen, das, was wir Wandel, Fortschritt oder Entwicklung nennen, setzt die Fähigkeit voraus, faktisch Gegebenes durch Vorstellungen zu überschreiten und damit in seiner Geltung aufzulösen oder zu verändern.
1.2. Über das Denkbare und das Machbare
Befassen wir uns jetzt mit der Fähigkeit, die es einem ermöglicht, bis zu dieser Stelle des Textes vorzudringen: dem Lesen. Sie haben ihre Zeit geöffnet und ihre Segel gesetzt, um den Wind der Sprache aufzunehmen. Warum? Weil sie den Inhalt interessant finden oder weil sie einfach nichts Besseres zu tun haben? Welche Beweggründe es auch immer gibt, sich mit einem Buch zu befassen, einer davon ist die Vorbedingung für alle anderen: die Lust am Lesen. Woher aber kommt sie, diese Lust? Sie werden vermutlich auf die Kindheit verweisen. Man sollte früh damit beginnen.