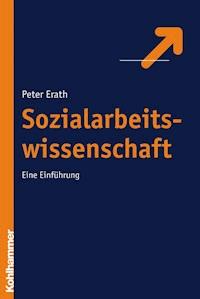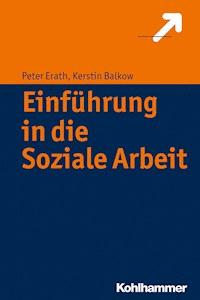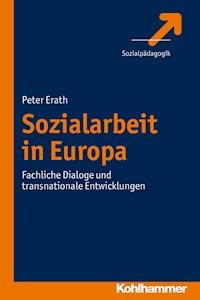
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In der deutschen Sozialarbeit war bislang die wissenschaftliche Reflexion eng national eingehegt. Ein Blick nach Europa über den deutschsprachigen Zaun hinweg fand kaum statt. Dabei bieten Theorien und Praxen aus anderen Ländern bei näherer Betrachtung überraschende Einsichten und zeigen alternative praktische Lösungen für die Probleme der Sozialarbeit auf. Die einzelnen nationalen Praxen lassen sich aufgrund ähnlicher Rahmenbedingungen (Modernisierung, Individualisierung, Ökonomisierung Europas, europäische Gemeinschaft) als gesellschaftliche Antworten auf ähnliche Fragen aufeinander beziehen, miteinander vergleichen und auf ihre Relevanz hin diskutieren. Im Mittelpunkt des Buches steht also die Frage, was die Sozialarbeit in Deutschland von Europa lernen kann. Das Buch liefert dafür nicht zuletzt einen Überblick über Beispiele von Best Practice, aber auch Bad Practice, über vorbildliche und weniger nachahmenswerte nationale Strategien und Praxen Sozialer Arbeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In der deutschen Sozialarbeit war bislang die wissenschaftliche Reflexion eng national eingehegt. Ein Blick nach Europa über den deutschsprachigen Zaun hinweg fand kaum statt. Dabei bieten Theorien und Praxen aus anderen Ländern bei näherer Betrachtung überraschende Einsichten und zeigen alternative praktische Lösungen für die Probleme der Sozialarbeit auf. Die einzelnen nationalen Praxen lassen sich aufgrund ähnlicher Rahmenbedingungen (Modernisierung, Individualisierung, Ökonomisierung Europas, europäische Gemeinschaft) als gesellschaftliche Antworten auf ähnliche Fragen aufeinander beziehen, miteinander vergleichen und auf ihre Relevanz hin diskutieren. Im Mittelpunkt des Buches steht also die Frage, was die Sozialarbeit in Deutschland von Europa lernen kann. Das Buch liefert dafür nicht zuletzt einen Überblick über Beispiele von Best Practice, aber auch Bad Practice, über vorbildliche und weniger nachahmenswerte nationale Strategien und Praxen der Sozialer Arbeit.
Prof. Dr. Peter Erath lehrt Theorien der Sozialen Arbeit an der Fakultät für Soziale Arbeit der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
Peter Erath
Sozialarbeit in Europa
Fachliche Dialoge und transnationale Entwicklungen
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikrofilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Rechte vorbehalten © 2012 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart Umschlag: Gestaltungskonzept Peter Horlacher Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG, Stuttgart Printed in Germany
ISBN 978-3-17-021814-7
E-Book-Formate
pdf:
978-3-17-022880-1
epub:
978-3-17-027864-6
mobi:
978-3-17-027865-3
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einführung
1 Sozialarbeit und Europa: Zur Geschichte eines komplizierten Verhältnisses
1.1 Internationale Öffnung von Anfang an: das unbefangene Interesse der Sozialarbeit der Gründerjahre (1900–1920) am Fremden
1.2 Zwischen 1945 und 1970: Die Überwindung des Unbehagens am Nationalen durch Hinwendung zu internationalen, interkulturellen und multikulturellen Fragestellungen
1.3 Sozialarbeit zwischen 1980 und 1995: Europa als problematische Dimension
1.3.1 Politische Bedenken
1.3.2 Methodische Bedenken
1.3.3 Identitätstheoretische Bedenken
1.4 Seit 1995: Curricularisierung und Pragmatisierung der europäischen Dimension
1.5 Zusammenfassung
2 Sozialarbeit in Europa: äquivalente Funktion, gemeinsame Herausforderungen
2.1 Die moderne Gesellschaft als funktionaler Bezugsrahmen der Sozialarbeit
2.1.1 Sozialarbeit als Strategie zur Vermeidung und Bearbeitung von Exklusionsprozessen
2.1.2 Sozialarbeit als autonomes Teilsystem
2.2 Europäischer Kontext der Sozialarbeit
2.2.1 Die Wohlfahrtsstaatsidee als gemeinsamer normativer Bezugsrahmen
2.2.2 Das „europäische Sozialmodell“ als gemeinsames politisches Projekt
2.2.3 Die Akzeptanz gemeinsamer Steuerungsinstrumente
2.3 Sozialarbeit im nationalen Kontext
2.3.1 Prägung durch unterschiedliche wohlfahrtsstaatliche Modelle
2.3.2 Der Welfare Mix als Gestaltungsspielraum
2.4 Aktuelle Herausforderungen der Sozialarbeit in Europa
2.5 Das gemeinsame Ziel der Sozialarbeit in Europa: Weiterentwicklung der Leistungsfähigkeit durch Konkurrenz und Vergleich
2.6 Zusammenfassung
3 Sozialarbeit in Europa als Forschungsprogramm
3.1 Wissenschaftstheoretische Fragen einer vergleichenden Sozialarbeitsforschung
3.1.1 Sozialarbeit als Wissenschaft und Praxis
3.1.2 Sozialarbeitswissenschaft als Handlungswissenschaft
3.2 Methodologische Fragen einer vergleichenden Sozialarbeitsforschung
3.2.1 Der Ausgangspunkt: Funktionale Äquivalenz
3.2.2 Vergleich und Interesse
3.3 Vergleich und Methode
3.4 Das europäische Forschungsprogramm: Aufweis fachlicher Dialoge und transnationaler Entwicklungen im intra- und intersystemischen Vergleich
3.5 Zusammenfassung
4 Sozialarbeit in Europa im intersystemischen Dialog: Sozialpolitik, Recht, Verwaltung, Wirtschaft
4.1 Sozialarbeit in Europa und Sozialpolitik
4.1.1 Sozialpolitische Einflussnahme durch europäischen Vergleich
4.1.2 Sozialpolitische Einflussnahme durch gemeinsame Herausforderungen
4.1.3 Sozialpolitische Einflussnahme durch ideologische Vorgaben: die Debatte um den Activating Welfare State
4.2 Sozialarbeit in Europa und Recht
4.2.1 Vereinheitlichungstendenzen durch die europäische Rechtssprechung
4.2.2 Stärkung der Klientenposition
4.2.3 Veränderung der Rechtsposition der Wohlfahrtsverbände
4.3 Sozialarbeit in Europa und Verwaltung
4.3.1 Steuerung durch New Public Management
4.3.2 Qualitätssicherung und Controlling
4.3.3 Zukunftsperspektiven
4.4 Sozialarbeit in Europa und Wirtschaft
4.4.1 Privatisierung der Sozialarbeit in Europa
4.4.2 Neue Formen des Wirtschaftens in der Sozialarbeit
4.4.3 Wirtschaftssozialarbeit oder alternative Sozialarbeit?
4.5 Zusammenfassung
5 Sozialarbeit in Europa im intrasystemischen Dialog: Wissenschaftsentwicklung
5.1 Metatheorien der Sozialarbeitswissenschaft in Europa
5.1.1 Sozialarbeit als transdisziplinärer Gegenstand
5.1.2 Sozialarbeitswissenschaft als disziplinäre Einheit
5.1.3 Sozialpädagogik als Theorie der Sozialarbeit
5.2 Theorien der Sozialarbeitswissenschaft in Europa
5.2.1 Erkenntnistheoretisch ausgerichtete Theorien
5.2.2 Holistische Theorien
5.3 Modelle der Sozialarbeitswissenschaft in Europa
5.3.1 Funktional-zielorientierte Modelle
5.3.2 Offen dialogische Modelle
5.3.3 Partizipatorisch-gestaltende Modelle
5.4 Sozialarbeitsforschung in Europa
5.4.1 Forschung und Wissenstransfer
5.4.2 Forschung im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Praxis
5.4.3 Schwierigkeiten mit dem Begriff „Praxisforschung“
5.4.4 Wichtige Methoden der Sozialarbeitsforschung
5.4.5 Erkenntnis und Interesse in der Sozialarbeitsforschung
5.5 Zusammenfassung
6 Sozialarbeit in Europa im intrasystemischen Dialog: Professionsentwicklung
6.1 Ausgewählte Professionstypen
6.1.1 Frankreich: die „verunsicherte“ Profession
6.1.2 England: die „ausführende“ Profession
6.1.3 Finnland: die „systemverbessernde“ Profession
6.1.4 Deutschland: die „unzeitgemäße“ Profession
6.1.5 Italien: die „formalisierte“ Profession
6.2 Zukunft der Ausbildung
6.3 Zusammenfassung
7 Sozialarbeit in Europa im intrasystemischen Dialog: Praxisentwicklung
7.1 Evidence-Based Practice
7.1.1 Grundlagen der Evidence-Based Practice
7.1.2 Evidence-Based Practice, Best Practice, What-works? Practice
7.1.3 Unterschiedliche Konzepte zur Umsetzung von EBP
7.1.4 Diskussion und Zusammenfassung
7.2 Case Management
7.2.1 Grundlagen
7.2.2 Case Management und Sozialarbeit
7.2.3 Case Management in ausgewählten Ländern
7.2.4 Zusammenfassung
7.3 Risikomanagement
7.3.1 Ausgangssituation
7.3.2 Methoden des Risikomanagements
7.3.3 Anforderungen an ein fachgerechtes Risikomanagement
7.3.4 Zusammenfassung
7.4 Bürokratisierung
7.4.1 Bürokratisierung und New Public Management
7.4.2 Situation in ausgewählten Ländern
7.4.3 Klientenorientierung zwischen Gleichbehandlung und Anerkennung
7.4.4 Folgerungen
7.4.5 Zusammenfassung
8 Transnationale Entwicklungen
8.1 Sozialarbeit in der Tschechischen Republik
8.1.1 Sozialarbeit in der Tschechoslowakei von 1918–1990
8.1.2 Sozialpolitik/Sozialarbeit seit Gründung der Tschechischen Republik
8.1.3 Transnationale Einflüsse
8.1.4 Zukünftige Herausforderungen
8.2 Sozialarbeit in Schweden
8.2.1 Entwicklung und Ausrichtung
8.2.2 Transnationale Einflüsse
8.2.3 Zukunftsperspektiven
8.3 Sozialarbeit in England
8.3.1 Die Entwicklung der Sozialarbeit bis zur Modernisierungsagenda
8.3.2 Zunehmende Zweifel am Konzept der Tough Love
8.3.3 Sozialarbeit als unbeliebte Profession
8.3.4 Transnationale Entwicklungen
8.4 Sozialarbeit in Deutschland
8.4.1 Zur Geschichte des Helfens in Deutschland
8.4.2 Unterlassene Akademisierung
8.4.3 Zögerliche Professionalisierung
8.4.4 Transnationale Entwicklungen
8.4.5 Zukünftige Herausforderungen
8.5 Zusammenfassung
9 Sozialarbeit in Europa – Europäische Sozialarbeit
Literaturverzeichnis
Vorwort
Dieses Buch ist vor dem Hintergrund zahlreicher europäischer Austauschprogramme, Forschungsvorhaben und Publikationsprojekte entstanden, die ich seit den 1990er Jahren durchgeführt habe. Es setzt sich zum Ziel, die Bedeutung der europäischen Dimension für die Sozialarbeit herauszuarbeiten und die wichtigsten derzeitig stattfindenden inter- und intrasystemischen Fachdialoge überblicksartig darzustellen. Auf diese Weise sollen Studierende und Lehrende der Sozialarbeit in Deutschland mit dem State of the Art der Sozialarbeitswissenschaft in Europa bekannt gemacht und zugleich zur aktiven Auseinandersetzung mit den aktuellen Themenstellungen der europäischen Sozialarbeit motiviert werden. Gerade die deutsche Sozialarbeit hat aufgrund ihrer jahrzehntelangen nationalen Selbstbezüglichkeit in vielen Punkten einen dringenden Aufholbedarf. Umso wichtiger ist es, programmatisch und praktisch an den bereits vorhandenen und kontinuierlich anwachsenden europäischen Wissensstand Anschluss zu finden.
Dieses Buch wäre nicht ohne langjährige Zusammenarbeit und kollegiale Partnerschaft mit den Mitgliedern des European Research Institute for Social Work (ERIS) möglich geworden. Insbesondere danke ich Oldrich Chytil (CZ), Brian Littlechild (UK), Emmanuel Jovelin (F), Miriam Sramata (SK), Davide Galesi (I) und Katazyna Pawelek (PL) für detaillierte Literaturhinweise und die Zurverfügungstellung von teilweise nicht veröffentlichten Manuskripten. Ein ganz besonderer Dank gilt meinem Mitarbeiter Markus Rossa für seine stete Bereitschaft zum Gespräch und seine konstruktive Kritik. Meinem studentischen Mitarbeiter Marcel Rossa danke ich für kontinuierliche Literaturrecherchen, meiner Tochter Devi für ihr überaus wertvolles Feedback. Schließlich danke ich meinem Kollegen Stefan Schieren für wichtige fachliche Hinweise bezüglich des zweiten Kapitels, meinem Arbeitgeber, der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, für die Gewährung eines Forschungsfreisemesters und dem Kohlhammer-Verlag für das mir entgegengebrachte Vertrauen.
Dieses Buch ist meiner Frau Beatrix gewidmet. Ohne ihre vorbehaltlose Bereitschaft, meine zahllosen europäischen Auslandsaufenthalte mit zu tragen, hätte ich weder meine Freude an der europäischen Dimension der Sozialarbeit entdecken, noch die vielen Erfahrungen und Gespräche machen können, die dieses Buch erst ermöglicht haben.
Einführung1
Sozialarbeit und Europa
Das Thema Europa ist nicht nur vielfältig und interessant, es ist auch geeignet, alle europäischen Bürger emotional anzusprechen und sie – zumindest derzeit – unmittelbar in eine Mehrzahl vehementer Gegner und eine Minderheit von Befürwortern zu spalten. Aber nicht nur die Bürger tun sich schwer mit Europa; auch den akademischen und berufsständischen Vertretern der Sozialarbeit ist es bis heute nicht gelungen, einen klaren Standpunkt zu entwickeln. Europa wird zwar einerseits als Chance für einen intensiven Austausch verstanden, der möglicherweise neue Erkenntnisse bietet, gleichzeitig aber auch als bedrohlich und besitzergreifend wahrgenommen.
Dies ist verwunderlich, denn schon die ersten Lehrenden und Praktiker der Sozialarbeit gingen relativ pragmatisch und methodisch sorglos bei der Wahrnehmung des Fremden, des Außergewöhnlichen und des Neuen vor. Während der Zeit des Nationalsozialismus kam dann jeder Austausch mit dem Ausland zum Erliegen, erst seit den 1960er Jahren wurde man sich der internationalen Dimension der Sozialarbeit wieder bewusst. Allerdings war man jetzt an Vergleichen nur mehr wenig interessiert. Die Vertreter der akademischen Sozialpädagogik waren davon überzeugt, dass die Sozialarbeit als kritisch-reflexive Profession je vor Ort – lokal, national, international – ihre eigene, einzigartige Gestalt kommunikativ entwickeln müsse. Die europäische Dimension wurde dann erst mit dem Vertrag von Bologna (1999) im Rahmen der Angleichung der Ausbildungssysteme, der Entwicklung von Mobilitätsprogrammen und der Finanzierung von gemeinsamen Forschungsprojekten verstärkt wahrgenommen. Allerdings wurde und wird sie teilweise bis heute als „aufgezwungen“ und „ungewollt“ empfunden. Zwei Argumente spielen dabei eine wichtige Rolle. Ein professionspolitisches Argument geht davon aus, dass bereits die vielen unterschiedlichen Berufsbezeichnungen deutlich machen, dass es kein gemeinsames Fundament im Bereich der Sozialarbeit gibt. Ein theoretisches Argument postuliert, dass sich Sozialarbeit transnational nicht mehr (wie bereits national geschehen) in eine sozialstaatliche Rolle drängen lassen dürfe (quasi als Sozialarbeit das Sozialstaates Europa), sondern sich im Rahmen einer Selbstzuschreibung als „Menschenrechtsprofession“ international aufstellen und damit auf Semi-Distanz zu den jeweiligen politischen Regimes und deren Politiken gehen müsse.
Eine solche Ablehnung der europäischen Dimension ist, und das ist eine der zentralen Thesen dieses Buches, deswegen bedauerlich, weil die deutsche Sozialarbeit2 sich dadurch nicht nur die Chance auf Selbstvergewisserung, sondern auch die Chance auf Optimierung ihrer Leistungen nimmt. Denn die Leistungsbilanz der Sozialarbeit fällt in allen Ländern Europas eher mäßig aus und das Image, das die Sozialarbeiter genießen, ist weitgehend abhängig vom Wohlwollen, das die Bürger gegenüber dem Sozialen aufbringen. Dabei bieten Theorien und Praxen aus anderen Ländern doch bei näherer Betrachtung teilweise überraschende Einsichten und zeigen oftmals elegante und schlüssige Lösungen für gleiche oder ähnliche Probleme auf. Seit 2000 wird dies zunehmend erkannt, allerdings bleibt die vergleichende Forschungs- und Publikationstätigkeit in Europa häufig auf solche fachlichen Dialoge und Kontroversen beschränkt, die politisch eine wichtige Rolle spielen: z.B. im Bereich des Kinderschutzes, im Bereich wichtiger Zielgruppen, wie z.B. alte Menschen, oder im Bereich des Managements. Eine um der Neugier willen und damit unabhängig von aktuellen Tagesthemen durchgeführte, alle akademischen und praktischen Bereiche umfassende europäische Diskussion findet erst in Ansätzen statt. Dabei muss sich doch die Sozialarbeit in allen Ländern Europas mit den gleichen fundamentalen Fragen auseinander setzen, die An Piessens so formuliert hat:
„(1) What is the role of social work in society, (2) how does social work position itself on the balance between emancipation and control, (3) how can social work match with the needs of clients, and (4) what is professional social work?“ (zitiert in: Roose/Choussée/Bradt 2010, S. 1)
Europa als Experimentierfeld
Betrachtet man die Theorien und Praxen der Sozialarbeit in Europa ausschließlich von einem phänomenologischen Standpunkt aus, dann lassen die scheinbar gravierenden länderspezifischen Unterschiede kaum Rückschluss auf Gemeinsames zu. Solche Unterschiede werden jedoch unwichtig, wenn man bereit ist, anzuerkennen, dass
die Sozialarbeit nicht als Profession, sondern als „Idee“ (Soydan 1999), als Funktion (Bommes/Scherr (1996) oder „Programm“ (Baecker 1994, S. 106) verstanden werden muss, unter dessen „Dach“ sich unterschiedliche Theorien und Praxen, geprägt jeweils von unterschiedlichen politischen und kulturellen Bedingungen, versammeln lassen;
Europa als normative und soziokulturelle „Einheit“ gedacht werden kann, die für einen Vergleich unterschiedlicher Theorien und Praxen der Sozialarbeit eine mögliche Basis bietet, ohne dass dadurch andere Einheiten, wie z. B. die Weltgesellschaft diskreditiert würden.
Nur vor einem solchen, als Einheit gedachten Hintergrund wird die „funktionale Äquivalenz“ (Schriewer 2000) der Sozialarbeit erkennbar, und kann somit eine Basis für Kommunikation und Vergleich entstehen. Dabei ist eine endgültige Entscheidung bezüglich einer genauen Definition dessen, was Sozialarbeit3 ist oder sein soll, nicht erforderlich, es reicht im Rahmen dieser Metaperspektive aus, dass man „Ähnliches“ meint. So schlagen z.B. Bommes/Scherr (1996) vor, Sozialarbeit als generalistische Praxis des Helfens dem Systems der Zweitsicherung zuzuordnen und ihm die Funktion der Inklusionsvermittlung, Exklusionsverwaltung und -vermeidung zu übertragen. Nach Hajuk Soydan, einem schwedischen Sozialarbeitswissenschafter, umfasst „the basic attitude (of social work as scientific idea) (...) three separate but connected elements: a theory of society and of man as a social being, a programme of how social problems can be handled, and a group of people who carry out the work of social change“ (Soydan 1999, S. 8). Und nach Sylvia Staub-Bernasconi (1995) wird Sozialarbeit dort tätig, wo Individuen den Problemen der Bedürfnisbefriedigung und Wunscherfüllung ohne ausreichende Ressourcen gegenüber stehen und lernen müssen, innerhalb der Struktur sozialer Systeme und in Kooperation oder Konflikt mit anderen Menschen Lösungen zu finden.
Erkennt man die Gemeinsamkeiten bei der begrifflichen Umschreibung der Zielsetzungen, so lassen sich die unterschiedlichen Praxen der Sozialarbeit in Europa als Varianten eines Schlüsselkonzepts begreifen und werden insbesondere folgende Arbeitsschritte möglich: Jetzt kann man erstens versuchen, die externen Aspekte dieses Konzepts zu benennen und deren Einfluss zu verorten, zweitens verschiedene Formen der Sozialarbeit als unterschiedliche Lösungen des gleichen Problems wahrzunehmen und drittens die verschiedenen nationalen Lösungen nebeneinander zu stellen, zu vergleichen und soweit möglich bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit zu bewerten. In einer vergleichenden Perspektive lassen sich möglicherweise die vorhandenen Lösungen als konkurrierend betrachten. Europa wird damit quasi zum Experimentierfeld unterschiedlicher sozialarbeiterischer Konzepte – bei permanent wechselnden soziokulturellen und ökonomischen Rahmenbedingungen. Dabei kann die Frage, ob Europa als eine politische Einheit betrachtet werden kann, ruhig der Politikwissenschaft überlassen bleiben. Hier wird lediglich unterstellt, dass die Länder Europas von verschiedenen Gesichtspunkten aus durchaus als einheitlich wahrgenommen werden können.4
Auf dem Weg zur vergleichenden Sozialarbeitsforschung
Ist man einmal bereit, Europa als begriffliche Einheit zu denken, dann lässt sich der mögliche Erkenntnisgewinn erahnen, der sich aus solchen Vergleichen ergeben kann. Man muss jetzt nur bereit sein, den eigenen Standpunkt und die damit verbundenen Denk- und Handlungsweisen zu relativieren und Unsicherheit zuzulassen. Indem man auf Abstand zu den eigenen Routinen geht, entsteht die Möglichkeit, die nationalen Denk- und Handlungsmuster als unterschiedliche und (von außen betrachtet) gleichwertige Interpretationen der „Idee“ bzw. des „Konzepts“ Sozialarbeit wahrzunehmen und differenztheoretisch zu diskutieren. Auf diese Weise eröffnet sich der Sozialarbeit nicht nur die Möglichkeit, Erkenntnisgewinne zu erzielen; zugleich kann sie so ihre eigenen Handlungsoptionen steigern und ihre Abhängigkeit von externen Systemen reduzieren. Best Practice erscheint dann als ein gelungenes Nebenprodukt einer vergleichenden Sozialarbeitsforschung, der es vor allem darum geht, die Vielfalt der Denkmöglichkeiten und Handlungsoptionen systematisch darzustellen, um die damit verbundenen möglichen Erkenntnisse und Handlungsoptionen offen zu legen, erkenntniskritisch zu diskutieren und der Praxis zur Verfügung zu stellen.
Zielsetzung des Buches
Niemand wird erwarten können oder wollen, dass sich die Sozialarbeit in Europa am Ende eines gemeinsamen Auseinandersetzungsprozesses theoretisch oder praktisch angleichen wird. Eine in Europa entstehende Wahrnehmungs- und Diskussionskultur wird aber – und dies ist die hier im Buch vertretene These – zu inter- und intrasystemischen Dialogen führen, die wiederum transnationale Entwicklungen befördern werden.
Unter intersystemischen Dialogen werden solche Kommunikationen verstanden, die sich zwischen der Sozialarbeit in Europa und anderen Teilsystemen der Gesellschaft, wie z. B. Politik, Ökonomie, Verwaltung, etc. abspielen.
Intrasystemische Dialoge behandeln Themen, die innerhalb der Sozialarbeit in Europa in den Bereichen Wissenschaftsentwicklung, Professionsentwicklung und Praxisentwicklung stattfinden.
Als transnationale Entwicklungen werden durch Vergleiche ausgelöste Prozesse bezeichnet, die zur Veränderung einer bestimmten, bislang rein national bestimmten Denkweise oder Praxis der Sozialarbeit in Europa geführt haben oder führen.
Natürlich können von einer einzelnen Person die vielfältigen, hoch differenzierten und elaborierten Dialoge und Entwicklungen nicht bis in jedes europäische Land hinein verfolgt werden. Dazu steht im Übrigen in vielen Ländern die fachliche Entwicklung noch zu sehr am Anfang und fehlt oftmals eine einschlägige Literaturbasis. Dies trifft nicht nur auf Länder wie z. B. Ungarn, Rumänien, die Türkei5, etc., sondern auch mit Einschränkungen auf Länder wie z.B. Spanien6, Portugal oder Italien7 zu, wo aus historischen, kulturellen und materiellen Gründen ein hoher Professionalisierungsgrad und damit verbunden eine eigenständige wissenschaftliche Debatte noch nicht in dem Maße entstehen konnte, wie wir sie z.B. in den nordischen Staaten8, England und Wales9, den Niederlanden oder in den deutschsprachigen Ländern vorfinden.10 Trotzdem werden, wo immer möglich und sinnvoll, inhaltliche Bezüge auch zu den Ländern hergestellt, die nicht intensiv an den jeweiligen Dialogen teilnehmen. Die Schreib- und Zitiersprache ist deutsch und englisch; nur teilweise finden sich für Interessierte einige wenige anderssprachige Quellenzitate in den Anmerkungen.
Insgesamt will das Buch den Lesern einen differenzierten Einblick in wichtige Dialoge und Entwicklungen der Sozialarbeit in Europa geben. Die dabei eingenommene Perspektive ist nicht nur (naturgemäß) deutsch, sondern auch wissenschaftstheoretisch eindeutig. Der Verfasser vertritt die Position, dass die Sozialarbeit in Deutschland nur dann zukunftsfähig ist, wenn sie europäisch anschlussfähig wird. Um dieses Ziel zu erreichen, muss sie eine klare Unterscheidung zwischen wissenschaftlichen, professionsspezifischen und praktischen Aussagen vornehmen und sich stärker als bisher an den jeweiligen Debatten beteiligen. Außerdem darf sie die dabei auftretenden, teilweise kontroversen Positionen nicht als Ausdruck von Uneinigkeit und Disharmonie interpretieren, sondern als Ausdruck von kultureller Vielfalt und als Aufforderung zu weiteren Forschungsanstrengungen und zu vertieftem Dialog (siehe dazu ausführlich Erath 2006).
Aufbau des Buches
Im ersten Kapitel werden die Gründe dargestellt, die dazu geführt haben, dass sich die deutsche Sozialarbeit aufgrund von politischen, methodischen und ideologischen Bedenken nur zögernd an der europäischen Debatte beteiligt hat. Sie sind darauf zurückzuführen, dass sich in Deutschland eine hermeneutisch-kritische Sozialpädagogik zur Leitdisziplin der Sozialarbeit entwickelt hat, die Europa weitgehend als sozialstaatlich-kapitalistische Bedrohung versteht. Ein unbefangenerer Umgang wurde erst mit der Relativierung dieses Paradigmas und durch die im Rahmen des Bologna-Prozess ausgelöste Pragmatisierung der europäischen Dimension möglich.
Im einem zweiten Kapitel wird dann gezeigt, wie ein konstruktives Verhältnis von Sozialarbeit und Europa entwickelt werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass Sozialarbeit als Teilsystem moderner Gesellschaften verstanden wird, dessen Funktion es ist, zur Beseitigung sozialer Probleme beizutragen. Nimmt die Sozialarbeit diese Position ein, dann sieht sie sich nicht nur in einen nationalen, sondern auch europäischen Kontext eingebunden. Im Rahmen dieses Kontextes können andere Reflexionen und Praxen als funktional „gleichwertig“ erkannt und verglichen werden. Unterschiedliche Ausprägungen müssen jetzt nicht mehr als nichtssagend oder unzutreffend diskreditiert, sondern können als intrasystemische Dialoge identifiziert und zur Anregung der eigenen Diskurse verwendet werden. Gleichzeitig kann sich Sozialarbeit auch mit den von anderen Teilsystemen der Gesellschaft, wie z.B. Sozialpolitik, Recht, Verwaltung, Wirtschaft ausgehenden Einflüssen im Rahmen intersystemischer Dialoge auseinander setzen.
Im dritten Kapitel werden dann die wissenschaftstheoretischen und methodischen Voraussetzungen für vergleichende Betrachtungen in der Sozialarbeit diskutiert und geschaffen. Dabei wird davon ausgegangen, dass Vergleiche nur dann möglich sind, wenn sich die Sozialarbeit als Wissenschaft, Profession und Praxis ausdifferenziert hat und wenn sie bereit ist, vergleichende Untersuchungen unter Einhaltung der methodisch einschlägigen Qualitätsstandards für solche Forschungen durchzuführen. Auf diese Weise lassen sich dann ein der Situation adäquates Forschungsprogramm und mögliche Desiderata bestimmen.
Im vierten Kapitel wird dargestellt, welche Auswirkungen verschiedene, von Europa ausgehende, politische, rechtliche, ökonomische, etc. Entwicklungen auf die Sozialarbeit in den einzelnen Ländern haben. Je stärker sich Europa von einer ökonomischen zu einer politisch-kulturellen und rechtlichen Einheit entwickelt, umso gravierender wirken sich gemeinschaftliche Überzeugungen, wie z.B. die Philosophie des Activating Welfare State, gesetzliche Grundlagen und Urteile der europäischen Rechtssprechung, die Strategie des New Public Management, etc. auf die Praxis in den verschiedenen Ländern aus. Systemtheoretisch gesehen ergeben sich hier konvergente und divergente Reaktionen der verschiedenen nationalen Sozialarbeitssysteme, je abhängig von ihrer jeweiligen Situation und den damit verbundenen Reaktionsmöglichkeiten.
In einem fünften Kapitel geht es darum, den Stand der wissenschaftlichen Auseinandersetzung im Bereich der Sozialarbeit in Europa überblicksartig und exemplarisch darzustellen. Dazu wird zum einen die theoretische Debatte in der Sozialarbeit ausgeführt und werden im europäischen Raum vorhandene „Metatheorien“ (d. h. Theorien über einen Gegenstand), „Theorien“ (d. h. Erklärungstheorien) und „Modelle“ (d. h. Handlungstheorien) vorgestellt. Zum anderen geht es darum zu zeigen, welche spezifischen Probleme sich im Rahmen der Sozialarbeitsforschung ergeben und wie diese überwunden werden können. Dazu werden anhand von ausgewählten Beispielen aus dem europäischen Raum typische und allseits anerkannte methodische Vorgehensweisen für den Bereich der empirischen Forschung vorgestellt.
In einem sechsten Kapitel wird die Situation der Profession Sozialarbeit in einigen Ländern vorgestellt und typisiert. Gleichzeitig werden einige Entwicklungen, die sich auf Probleme der Auswahl von Studierenden, der Studienanforderungen und derzeitigen Arbeitssituation der Sozialarbeiter beziehen, dargestellt und problematisiert.
In einem siebten Kapitel werden dann wichtige, für die Praxis der Sozialarbeit relevante Dialoge aufbereitet und diskutiert. Insbesondere vier Themen erhalten derzeit eine hohe Aufmerksamkeit in den europäischen Fachzeitschriften. Ein erstes Thema stellt die Diskussion um Evidence-Based Practice dar. Es geht dabei um die Frage, wie stark sich Sozialarbeiter in ihrem Handeln an Modellen, Methoden und Standards orientieren sollen, die sich wissenschaftlich bewährt haben. Ein zweites Thema handelt vom Case Management. Die Frage stellt sich dabei, welcher Stellenwert diesem Modell im Bereich der Sozialarbeit in Europa zukommt und welche Problematik damit verbunden ist. Ein drittes Thema bezieht sich auf das Modell des Risikomanagements, das die Sozialarbeiter dabei unterstützen will, die Folgen ihrer Entscheidungen und Handlungen einzuschätzen und die Klientel vor schädlichen Folgen zu bewahren. Ein vierter Dialog beschäftigt sich schließlich damit, wie die Auswirkungen einer zunehmenden Bürokratisierung und Regulierung der Sozialarbeit abgemildert werden können.
Das achte Kapitel stellt dann Entwicklungen der Sozialarbeit vor, die sich innerhalb ausgewählter europäischer Staaten vollzogen haben. Am Beispiel der Tschechischen Republik, von Schweden, England und Deutschland wird gezeigt, wie sich die nationalen Sozialarbeitssysteme aufgrund europäischer Einflüsse verändern und sich dadurch neue nationale Dialoge ergeben, die die Praxis beeinflussen und verändern.
In einem abschließenden neunten Kapitel wird die Entwicklung der Sozialarbeit in Europa thesenhaft diskutiert und bewertet. Sozialarbeit erscheint als ein Schlüsselkonzept moderner Gesellschaften zur Bearbeitung von Exklusionsrisiken. Aufgrund der in Europa ähnlichen Rahmenbedingungen und Umweltkonstellationen lassen sich die verschiedenen nationalen Muster sinnvoll aufeinander beziehen, miteinander vergleichen und auf ihre Relevanz hin diskutieren. Auf diese Weise entsteht ein europäisch geprägter Dialog, an dem sich alle Länder mit ihren Erfahrungen und Erkenntnissen gleichberechtigt beteiligen können. Dieser Dialog sollte als Chance verstanden werden, über den Vergleich zu Erkenntnisgewinn und darüber hinaus zur Weiterentwicklung von Qualität und Effektivität der Sozialarbeit in Europa zu gelangen.
1 Der Autor ist sich durchaus bewusst, dass die Mehrheit der im Bereich der Sozialarbeit Tätigen weiblichen Geschlechts ist. Die durchgehende Verwendung der männlichen Form bei Begriffen wie z.B. „Sozialarbeiter“, „Praktiker“, etc. (außer im Rahmen von Zitaten) ist allein stilistisch begründet.
2 Andere Länder stehen in einem viel intensiveren europäischen und internationalen Austausch und nehmen theoretische Entwicklungen und empirische Daten überaus schnell wahr, so vor allem die nordischen Länder, England, die Niederlande und zunehmend auch einige osteuropäischen Länder.
3 In diesem Buch wird durchgängig der Begriff „Sozialarbeit“ verwendet, da er anschlussfähiger an den Begriff Social Work erscheint, als der in Deutschland üblicherweise verwendete, sehr unspezifische Begriff „Soziale Arbeit“. Zum Begriff Sozialarbeit siehe auch Baecker (1994, S. 106).
4 So geht etwa Müller davon aus, dass die europäischen Wohlfahrtsstaaten, da sie „die Synthese kapitalistischer und sozialistischer Ideologien reflektieren“, sich vom US-amerikanischen Wohlfahrtsstaat, dessen Ziele „limitierter und an marktorientierte Prinzipien gebunden“ sind, deutlich unterscheiden lassen (Müller 2010, S. 43, vgl. auch: Reisch 2009, S. 226, Jewell 2007 S. 183 und Kronauer 2010, S. 217 f.).
5 Siehe dazu den ernüchternden Bericht von Süleyman Gögercin (2001).
6 Spanien verfügt über ein sehr stark von den 17 autonomen Regionen bestimmte Struktur der Sozialen Dienste und der Sozialarbeit. Ein wissenschaftlicher Diskurs befindet sich erst in den Anfängen (Anheier 2003, S. 357ff., Züchner 2007).
7 Auch in Italien ist die fachliche Debatte nur sehr wenig entwickelt. So werden in Lehrbüchern (z. B. Ponticelli 2005) unter dem Begriff „Servizio sociale“, wenn überhaupt, ausschließlich Theorien und Beispiele der Sozialarbeit dargestellt, die der europäischen oder internationalen Szene entnommen sind.
8 Wobei die Sozialarbeit in Dänemark und Litauen sehr stark durch schwedische Einflüsse gekennzeichnet ist (Campanini/Frost 2004).
9 Der Einfachheit halber wird zukünftig nur der Begriff „England“ verwendet.
10 Eine sehr aktuelle Darstellung der Situation der Sozialarbeit in den einzelnen europäischen Ländern bietet Erath/Littlechild 2010.
1 Sozialarbeit und Europa: Zur Geschichte eines komplizierten Verhältnisses
Die europäische Dimension im Bereich der Sozialarbeit in Deutschland ist bis heute im Verhältnis zu ihrer politischen Bedeutung und möglichen fachlichen Relevanz ein eher randständiges Thema gewesen. Nur wenige Wissenschaftler setzen sich mit ihr intensiv auseinander, die Mehrzahl von ihnen hält Sozialarbeit für eine vor allem national verortete professionelle Tätigkeit, deren identitärer Kern sich international formulieren, deren Praxis sich aber keinesfalls vergleichen lässt. Doch warum kann und soll Europa innerhalb dieses internationalen Kontextes der Sozialarbeit für Deutschland keine herausragende Rolle spielen? Dieser Frage soll in diesem ersten Kapitel nachgegangen werden.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!