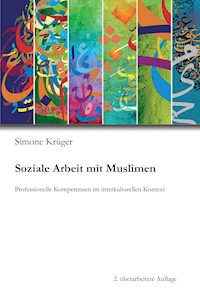
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Vor dem Hintergrund ihrer langjährigen Erfahrungen im interkulturellen und religiösen Kontext bringt Simone Krüger, selbst in der Sozialen Arbeit tätig, ein Werk auf den Markt, welches mit Präzision die wichtigsten Themen rund um die alltägliche interkulturelle Arbeit insbesondere mit Menschen aus Ländern des Orients anspricht. Der erste Teil des Buches ermöglicht Einblicke in interkulturelle Alltagswelten und Herausforderungen. Es werden verschiedene Aspekte beleuchtet, die in der Begegnung mit Menschen aus dem orientalischen Kulturkreis wichtig sein können. Fachkräfte bekommen Methoden an die Hand, die helfen können, mit Unsicherheiten und der Spannung in der Rolle des Professionellen umzugehen. Im zweiten Teil des Buches wird der Fokus auf die islamische Religion gerichtet. Wer von einem Islamverständnis lesen möchte, welches in vielen muslimischen Ländern noch vorherrscht und traditionell-orthodoxe Gruppen aus medial in Europa verbreiten, wird enttäuscht werden. Es werden vielmehr die Stimmen und Meinungen in den Vordergrund gerückt, die religiöse Texte und Quellen als Grundlage und Chance für die Integration betrachten und für eine freiheitlich-demokratische Gesellschaftsordnung stehen. Wer sich umfassend über unterschiedliche kulturelle und religiöse Aspekte, in der Begegnung mit Menschen aus dem orientalischen Kulturkreis informieren will, der wird in diesem Buch einen großen Reichtum an Impulsen für den interkulturellen Kontext finden. Ein "Must-have" für pädagogische Fachkräfte in sozialen Einrichtungen, Lehrkräften an Schulen und ehrenamtlich Tätige!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Simone Krüger
Soziale Arbeit mit Muslimen
Professionelle Kompetenzen im interkulturellen Kontext
2. überarbeitete Auflage
© 2021 Simone Krüger
Foto Buchcover: Mahmood Ahmad
https://www.etsy.com/uk/shop/abstractandbeyond
Verlag und Druck: tredition GmbH,
Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-14879-6
e-Book:
978-3-347-14880-2
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Vorwort zur Neuauflage 2021 von Dr. Sabine Aydt
Vorwort zur Auflage 2019 von Amin Rochdi
Teil 1Professionelle Kompetenzen in der Sozialen Arbeit mit Muslim*innen
Einleitung
1. Einwanderungsland Deutschland? Muslim*innen in unserer Gesellschaft
1.1 Interkulturelle Öffnung von Regeldiensten und Integrationslotsen in Moscheegemeinden
1.2 Gesellschaftliche Wahrnehmung von Muslim*innen und deren Auswirkung
1.3 Die Zuschreibung von Kollektiven
1.4 Unterschiede in der Verantwortungsübernahme bzw. -abgabe
1.5 Dürfen sich Muslim*innen überhaupt beraten lassen?
1.6 Verhalten sich Muslim*innen muslimisch?
1.7 Facetten der Identität
1.8 Kulturdimensionen von Geert Hofstede
1.9 Stolpersteine in der Aneignung kulturellen Hintergrundwissens
2. Herausforderungen aufseiten der Eltern im Kontext interkultureller Erziehung ihrer Kinder
2.1 Pluralität im Islam
2.2 Moderne versus Tradition
2.3 Die gefühlte Schwächung auf Elternebene
2.4 Der schnelle Rückzug ins Bekannte: die Re-Traditionalisierung
2.5 Die unterschiedlichen Wertehierarchien
3. Herausforderung aufseiten der Fachkräfte im Kontext interkultureller Jugendhilfe
3.1 Das Demokratieprinzip und das Modell Interkulturelle Kompetenz
3.2 Der neugierige Blick in die Welt des Klienten
3.3 Wie können wir einen Kulturschock und die Gefahr von Abwehr verringern?
3.4 Destruktive Kommunikationszirkel
3.5 Der neugierige Blick in die eigene Welt.
3.5.1 Die Subjektive Wirklichkeitskonstruktion
3.5.2 Das Werte- und Entwicklungsquadrat von Schulz von Thun
3.5.3 Fremdheitsfähig werden – die Umwendung zum Selbst
3.5.4 Die Selbstfürsorge – das Sokratische Prinzip
3.5.5 Focusing – eine Methode der Achtsamkeit
3.6 Interaktive Ausgrenzungsmechanismen von Seiten der Fachkräfte im interkulturellen Kontext
3.7 Windows oder Mac?
3.8 Interkulturelle Kompetenz – eine Zusammenfassung
3.9 Die Rolle der Fachkraft in der Unterstützung von muslimischen Kindern und Jugendlichen
3.10 Erziehungsrecht und elterliche Pflichten – die juristische Perspektive
4. Ansätze interkultureller Eltern- und Familienarbeit
4.1 Vom Unterschied zwischen Konsequenz und Orientierung in der Erziehung (von Michael Ströll)
4.2 Türöffner und Stolpersteine in der Elternarbeit
4.3 Kulturelle und religiöse Dolmetscher*innen
Teil 2Religiöse Quellen als Integrationsinstrument in der Interkulturellen Sozialen Arbeit mit Muslim*innen
Einleitung
1. Chancen religiöser Quellen in der interkulturellen Arbeit
1.1 Die Religion als lebensweltgestaltendes Element
1.2 Sind interkulturelle Schulungen ausreichend?
1.3 Die Falle des Nichtwissens: das Hauptproblem von Muslim*innen
2. Grundlagen des Islams und deren Schwierigkeiten
2.1 Die Problematik der Koranübersetzungen
2.2 Das islamische Recht und sein Interpretationsspielraum
2.3 Die Scharia
2.4 Pluralität im klassischen Islam
2.5 Trennung Staat und Religion
3. Grundzüge des Glaubens
3.1 Die drei Hauptquellen im Islam
3.2 Die sechs Glaubensgrundsätze
3.3 All inclusive? Die Propheten im Islam
3.4 Das rituelle Gebet der Muslim*innen
3.5 Barmherzigkeit im Islam
3.6 Karma und Islam?
3.7 Paradies und Hölle
3.8 Dschihad und seine Bedeutung
3.9 Der Islam eine Vernunftreligion?
3.10 Spiritualität und Regeln – geht das überhaupt?
3.11 Die 99 Wesenheiten Gottes
3.12 Engel im Islam
4. Christen, Juden und Andersgläubige
4.1 Menschen, die sich über den Propheten oder Gott selbst lustig machen
4.2 Allgemeine Verhaltensregeln gegenüber anderen Menschen
4.3 Kein Zwang im Glauben
4.4 Das Jesusbild
4.5 Die Ostergeschichte
4.6 Jüngster Tag und die Abrechnung
5. Islamische Feste
5.1 Der Ramadan und das Fasten
5.2 Das Opferfest/Abrahamfest
5.3 Kreative Ideen für sozialen Einrichtungen
6. Die Frau und die Sexualität im Islam
6.1 Frauenbild im Koran
6.2 Die koranische Schöpfungsgeschichte
6.3 Kleidung und Kopftuch im Islam
6.4 Islamischer Feminismus: Gender-Dschihad
6.5 Sexualität und Aufklärung
6.6 Schamgefühl, Intimsphäre und Weiblichkeit
6.7 Der lüsterne Blick und Ehebruch
6.8 Sexualkunde und Aufklärung an Schulen
6.9 Kopftuch und der Schwimm- und Sportunterricht
6.10 Homosexualität im Islam
7. Islamische Kindererziehung
7.1 Erziehungsinhalte
7.2 Der Sieben-Jahres-Rhythmus in der Erziehung
Schlussgedanken
Literaturverzeichnis
Danksagung
Über die Autorin
Zur Neuauflage 2021
Nachdem ich das Buch „Muslime in der Sozialen Arbeit. Religiöse Quellen als Integrationshelfer?“ (Krüger, 2019) veröffentlicht hatte, begann für mich ein weiterer Prozess der inhaltlichen Weiterentwicklung. Insbesondere durch die enge Zusammenarbeit mit Frau Prof. Dr. Kriegel-Schmidt, der Professorin und Studiendekanin der Euro FH sowie durch den Kontakt mit Frau Dr. Sabine Aydt, Lehrbeauftragte und Trainerin für interkulturelle Bildung in Wien, wurden Inhalte der ersten Ausgabe überarbeitet, verfeinert und mit neuen Aspekten ergänzt.
Die Tatsache, dass es in der Entwicklung interkultureller Kompetenzen nicht ausreicht, sich mit Hintergrundinformationen über kulturelle und religiöse Aspekte auszustatten, wurde dadurch noch stärker in den Vordergrund gerückt. Meine beiden Studienhefte „Religiöse Quellen als Integrationsinstrument in der Interkulturellen Sozialen Arbeit (2019)“ und „Professionelle Kompetenzen in der Interkulturellen Sozialen Arbeit mit Muslimen (2020), des BA-Studiengang Soziale Arbeit an der Euro FH, fungieren als Grundlage der zweiten Ausgabe des Buches. Die Neuauflage besteht aus zwei Teilen. Insbesondere der erste Teil, der den professionellen Anspruch der interkulturellen Kompetenz beleuchtet, wurde mit Aspekten erweitert, die sich mit der Notwendigkeit der eigenen Auseinandersetzung und unhinterfragten Wahrnehmungs-, Deutungs-, und Verhaltensmustern (vgl. Gaitanides 2004) als auch mit der Selbstfürsorge in der Entwicklung von Fremdheitsfähigkeit (vgl. Schellhammer 2019) beschäftigen. An verschiedenen Stellen des ersten und zweiten Teiles werden den Leser*innen Übungen finden, die beim Lesen zum Innehalten und zur Reflexion einladen.
Vorwort zur Auflage 2019
Ich erinnere mich, als wäre es gestern. Im Frühjahr 2015 fiel für mehrere Wochen der Islamische Religionsunterricht aus. Grund hierfür waren die Winterferien, aber auch zahlreiche Fortbildungen, die ich damals hielt, um bayernweit für den Islamischen Unterricht an Schulen zu werben und Lehrkräfte fortzubilden. In diese Zeit fielen die schrecklichen Anschläge in Paris, bei welchen viele Menschen ihr Leben verloren und deren Drahtzieher sich einer religiösen Verblendung hingaben, hier im Namen ihrer Religion etwas Wertvolles vollendet zu haben. Die Diskussionen in ganz Europa über einem restriktiveren Umgang mit Muslim*innen waren in vollem Gange. Mir war es wichtig, mit meinen Schüler*innen der zehnten Klasse darüber zu sprechen. Dies wollte ich anhand der beeindruckenden Kölner Rede des Islamwissenschaftlers und Schriftstellers Navid Kermani machen, die ich in ihrem Tiefgang für hervorragend geeignet für ein unterrichtliches Setting hielt. So begann ich die Stunde, indem ich „Paris“ an die Tafel schrieb. Nach meinem letzten Buchstaben ging ein Raunen durch die Klasse und ein Schüler sprang auf und rief: „Nicht auch noch Sie, Herr Rochdi!“ Ich war überrascht, da ich damit absolut nicht gerechnet hatte und bat, mich über den Missmut der Klasse aufzuklären. Man berichtete mir, dass bereits in der Woche nach den Anschlägen die Lehrkräfte – unabhängig vom Fach – sich diesem Ereignis angenommen hatten. Auf meinen Einwand, dass es Ausdruck eines guten Unterrichts sei, auch tagesaktuelle Geschehnisse v.a. mit einer Abschlussklasse einer Realschule zu besprechen und zu thematisieren, wurde von der Klasse entgegnet: „Nein, Herr Rochdi. Wir sprechen nicht über die Geschehnisse. Die anderen sprechen darüber und wir werden als Muslim*innen ständig gefragt, was wir davon halten. Was sollen wir davon halten? Da sind doch auch Muslim*innen gestorben! Wieso sollen wir uns für etwas rechtfertigen, dessen Opfer uns näherstehen als dessen Täter?“
Dieses Erlebnis im Islamischen Unterricht – ein Unterricht, den ich als Schlüssel für die Entwicklung der Theologie des Islams in Deutschland sehe – prägt mich und meine Arbeit bis heute. Was ist in den letzten Jahren schiefgelaufen, dass sich junge Menschen, deren Eltern oftmals bereits in Deutschland die Schulbank gedrückt haben und die das Herkunftsland der Großeltern nur aus dem Urlaub kennen, sich nach teilweise drei Generationen noch immer fremd und missverstanden fühlen? Ist es die Ignoranz der Lehrkräfte, welche die Bedürfnisse ihrer Schülerschaft nicht ernst nimmt? Ist es der gesellschaftliche Diskurs, der häufig von sog. Scharfmachern dominiert wird und nicht selten schnell die Motive der Täter gefunden zu haben scheint und mit einfachen Antworten auf komplexe Fragestellungen – bewusst oder unbewusst – dafür sorgen, dass sich junge, praktizierende Muslim*innen zunehmendem Rassismus ausgesetzt sehen? Oder sind es doch rückwärtsgewandte Agitatoren innerhalb der muslimischen Community, die ein Klima des Nichtangenommen-Seins verstärken?
Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint, ist der Islam, besser gesagt, sind die Muslim*innen und Muslime Deutschlands immer mehr auch ein gefühlter Teil der deutschen Gesellschaft. Noch vor gut 25 Jahren wussten die wenigsten, was der Islam ist und welche Rolle diese Religion für knapp vier Millionen Menschen bedeutet. An immer mehr Schulen genießen inzwischen Muslim*innen einen Islamunterricht – ganz selbstverständlich neben dem katholischen und evangelischen Religionsunterricht – und die Möglichkeiten für junge muslimische Abiturient*innen, sich in ihrem Studium aus der Binnenperspektive mit ihrer Religion zu beschäftigen und ein islamisch-theologisches Studium aufzunehmen, sind inzwischen beträchtlich. Knapp ein halbes Dutzend Hochschulen bieten inzwischen ein Studium der Islamischen Theologie oder Religionspädagogik an.
Selbst im Bereich der Medien – dank zahlloser oftmals internetbasierter Non-Profit-AV-Projekte – gibt es immer mehr deutschsprachige Programme mit einem Format für muslimische Konsument*innen. Es zeichnet sich ab, dass diese Veränderung der Gesellschaft weiter voranschreiten wird.
Zeitgleich mit all den positiven Entwicklungen rund um die Beheimatung der Muslim*innen in Deutschland, wird die Diskussion über Muslim*innen und die Rolle des Islams zunehmend von extremen Positionen bestimmt. Die zahllosen „Kopftuchdebatten“, die Frage, ob der Islam Teil Deutschlands sei, die Muslim*innen zu Deutschland gehören oder man historisch begründen könne, der Islam sei ein Teil der imaginären deutschen DNA, werden oft hitzig, wenig objektiv-faktengestützt, dafür umso subjektiv-emotionaler geführt. Die pauschale Vorverurteilung religiös begründeter Veränderungen in einer staatlich-öffentlichen Domäne wie der Schule haben in den letzten beiden Jahrzehnten immer wieder die Gemüter der Gesamtgesellschaft bewegt. So beispielsweise der Wunsch junger Menschen, einen Raum für ihr ritualisiertes Gebet zu nutzen oder die Rücksichtnahme auf religiöse Speisevorschriften in den Mensen der Schule. Oft verliefen die Diskussionen asynchron an den Bedürfnissen, Vorstellungen und Meinungen der in Deutschland lebenden Muslim*innen vorbei. Man sprach oft über die Betroffenen, aber selten mit ihnen. Viele dieser Punkte wurden vor Gerichten gelöst oder aufgeschoben, um wenige Jahre später in Tageszeitungen, Magazinen oder Polit-Talks erneut diskutiert zu werden. Die oben skizzierte Episode aus meiner schulischen Erfahrung zeigt, dass gerade im Bildungsbereich diese nicht selten oberflächlich geführten Diskussionen durchaus einen praktischen Nachhall und Auswirkungen auf das Zusammenleben sowie die Selbst- und Fremdwahrnehmung junger Heranwachsender haben.
Mit dem Zuzug Zuflucht suchender Menschen aus von Krieg und Misswirtschaft gebeutelten Staaten des Nahen Ostens und Afrikas hat sich die Sprache und der Umgang miteinander verschärft und teils unwürdige Züge angenommen. Diese Menschen werden immer häufiger als Kollektiv für Vergehen Einzelner rassistisch diskriminiert oder werden Opfer von Gewalt. Der anfangs noch offene Umgang mit den Geflohenen wurde zunehmend härter und mündet in manchen Teilen der Öffentlichkeit in blankem Hass. Gleichzeitig fehlt es an strukturellen Zielsetzungen und sicheren Bleibeperspektiven für neue MitbürgerInnen. Nicht selten fürchten Schülerinnen und Schüler bzw. deren Eltern eine Abschiebung oder jungen unbegleiteten Flüchtlingen ist es schwierig zu erklären, dass eine solide Schulbildung nachhaltiger ist als der direkte Eintritt ins Berufsleben als sog. „ungelernte(r)“ Arbeiter*in.
Ich als (muslimischer) Religionspädagoge und Berater für interkulturelle Schulentwicklungsprozesse an Schulen suche selbst in scheinbar ausweglosen Situationen immer noch einen Hoffnungsschimmer. Bildung – in diesem Fall Professionalisierung des Lehrpersonals – ist ein probates Mittel. Ich bin mir sicher, dass man durch professionelles Handeln vielen Problemen und Vorurteilen entgegenwirken kann. Das, was auf den ersten Blick als religiös begründet, fremd und wenig nachvollziehbar wirkt, kann mit einem anderen Blick auf das Gleiche durchaus zu einer Lösung führen. Delinquentes Verhalten kann in falschen Kontexten verortet werden und führt so zu Missverständnissen und nicht selten zu falschen Wahrnehmungen. Im schlechtesten Fall ziehen diese falschen Schlussforderungen folgenschwere Entscheidungen nach sich. In unzähligen Lehrer*innen-Fortbildungen hat sich ein solcher veränderter Blick bewährt und zu Bewusstseinsveränderungen bzw. einem sensibilisierteren Umgang in entsprechenden Situationen geführt.
Nicht selten stoßen gerade Betreuer*innen, Berater*innen, Coaches und Mitarbeiter*innen kommunaler, staatlicher oder freier Träger mit den bisherigen Instrumenten an ihre professionellen Grenzen. Viele der ursprünglich gelehrten und in den Ausbildungen dieser Berufsgruppen vermittelten Ansätze bedürfen einer Überarbeitung und eines geänderten Blicks auf das Individuum mit all seinen Bedürfnissen, einschließlich seiner Religiosität sowie einer rassismuskritischen Perspektive auf das tägliche Tun.
Das vorgelegte Handbuch schließt hier eine lang angemahnte Lücke. Aus einer professionellen Sichtweise einer routinierten Beraterin mit einem Erfahrungsschatz aus vielen Jahren der Beratungs- und Fortbildungstätigkeit gibt Simone Krüger Multiplikator*innen, Pädagog*innen und Berater*innen sowie auch Lehrkräften Werkzeuge an die Hand, um mit entsprechender Sensibilität und fundiertem Wissen auf die Situation der Klient*innen individuell einzugehen und bestmöglich zu beraten. Dabei unterstützt Simone Krüger die Leser*innen bei der inzwischen schier nicht mehr zu greifenden Bandbreite an Büchern über den Islam, indem sie die zentralen Konfliktfelder der Beratung multiperspektiv beleuchtet und so dem interessierten Publikum einen fundierten Zugang ermöglicht.
Ich beglückwünsche die Autorin zu diesem wichtigen Werk im Bereich der Sozialen Arbeit mit muslimischen Klient*innen, wünsche den Leser*innen dieses Handbuches eine spannende und zugleich lehrreiche Lektüre und hoffe, dass dieses Buch einen positiven Einfluss auf das Zusammenleben von Muslim*innen und der Mehrheitsgesellschaft hat.
Amin Rochdi, im April 2019.
Teil 1
Professionelle Kompetenzen in der Interkulturellen Sozialen Arbeit mit Muslim*innen
Einleitung
Die Inhalte des ersten Teils ermöglichen einen intensiven Einblick in fachliche Fragestellungen für die Arbeit im interkulturellen Kontext, insbesondere in der Sozialen Arbeit mit Menschen aus Ländern des Orients. Es wird der Schwerpunkt auf kulturelle Aspekte in der Begegnung mit Menschen gelegt und professionelle Handlungsmöglichkeiten im Kontext Sozialer Arbeit aufgezeigt. Durch Blitzlichter in die Lebenswelten orientalischer Familien werden Missverständnisse, beispielsweise infolge von Un- bzw. Halbwissen aufgelöst werden. Es wird der Fokus auf die selbstreflexive Auseinandersetzung mit eigenen kulturellen Brillen und blinden Flecken gelegt und Methoden aufgezeigt, die die eigenen gewohnten Denk- und Handlungsmuster unterbrechen können.
Im ersten Kapitel werden migrationsspezifische Phänomene beschrieben. Der Fokus liegt zunächst auf einigen religiösen Aspekten, um zu reflektieren, welche Faktoren einen Menschen prägen und welchen Stellenwert hierbei die Religion haben kann.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den Herausforderungen von Eltern aus Ländern des Orients, die hier in Deutschland leben. Es werden Themen beleuchtet, die in der Interkulturellen Sozialen Arbeit durchaus berücksichtigt werden sollten. Neben der Gefahr einer Re-Traditionalisierung und der Angst vor Freiheit aufseiten der Adressaten finden auch kulturelle Wissensordnungen, die beispielsweise in Wertehierarchien zum Ausdruck kommen, Beachtung.
Das dritte Kapitel richtet den Fokus auf uns Fachkräfte und unsere Herausforderungen und Chancen in der Interkulturellen Sozialen Arbeit. Es geht darum, welche professionelle Haltung wir in unserer Arbeit entwickeln und welche Rolle wir in der Arbeit mit muslimischen Kindern, Jugendlichen und Familien einnehmen sollten. Es werden das „Demokratieprinzip“, die „interkulturelle Kompetenz“ und die „Selbstfürsorge“ näher beleuchtet und auf mögliche destruktive Kommunikationsprozesse hingewiesen. Das Kapitel wird mit dem Blick auf Elternrechte in Deutschland abgerundet. Denn besonders in der Zusammenarbeit mit Eltern ist es für Fachkräfte wichtig zu wissen, welche Rechte und Pflichten Eltern im Grundgesetz haben und in welchem rechtlichen Rahmen die Soziale Arbeit in Deutschland agiert.
Das vierte Kapitel gibt pädagogische Impulse für den direkten Arbeitsalltag mit muslimischen Familien an die Hand. Neben pädagogisch sinnvollen Handlungsstrategien für die Arbeit mit muslimischen Familien, die genauso für die Arbeit mit allen anderen Familien, unabhängig von Herkunft, Kultur, Religion, Schichtzugehörigkeit, Bildungsstand etc. gelten, wird aufgezeigt, wie mögliche Stolpersteine und Irritationen in der direkten Arbeit mit orientalischen Familien zu Türöffnern umgewandelt werden können. Weiterhin werden Besonderheiten beim Hausbesuch sowie das Konzept der kulturellen und religiösen Dolmetscher*innen vorgestellt.
Als Koranübersetzung habe ich, soweit nicht anders angegeben, die Übersetzung der Azhar-Universität Ägypten des Obersten Rates für islamische Angelegenheiten, „Al-Muntakhab“, von Prof. Dr. Moustafa Maher aus dem Jahr 1999 verwendet. Die Überlieferungen habe ich, wenn nicht anders angegeben, aus den Sammlungen „Riyad us-Salihin – Gärten der Tugendhaften“ (1996 und 2002) von Abu Zakariya an-Nawawi übernommen.
1 Einwanderungsland Deutschland? Muslim*innen in unserer Gesellschaft
1.1 Interkulturelle Öffnung von Regeldiensten und Integrationslotsen in Moscheegemeinden
Spätestens seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 sind die Themen „Islam“ und „Muslime“ in den Medien. Seit dem Zuzug von vielen Familien mit Fluchthintergrund im Jahre 2015 wurde die mediale und gesellschaftliche Aufmerksamkeit noch einmal intensiviert und Schlagwörter wie „Muslime“ und „Islam“ wurden um das Schlagwort „Flüchtlinge“ erweitert. Zahlreiche Diskussionsrunden, Artikel und politische Statements beschäftigen sich seitdem mit Thematiken rund um diese Begrifflichkeiten. Auf kommunaler Ebene und in der freien Jugendhilfe gibt es allerdings nicht erst seit den Terroranschlägen im Jahre 2001 Überlegungen zur interkulturellen Öffnung sozialer Einrichtungen.
Schon Anfang der 1980er-Jahre setzte eine kritische Reflexion der Ausländerpädagogik und Ausländersozialarbeit sowie ihrer Institutionalisierung ein (Filsinger, 2002, S. 9 und 56). Bis zu diesem Zeitpunkt gab es im Einwanderungsland Deutschland sogenannte „Sondereinrichtungen“ für Migrationsgruppen, die nicht an Regeldienste angegliedert bzw. integriert waren.
Der Begriff der „interkulturellen Öffnung“ von Regeldiensten wurde Mitte der 1990erJahre eingeführt. Hier startete eine Debatte über die ethisch-moralische, aber auch gesellschaftspolitische Verantwortung gegenüber Migrantengruppen. Ab diesem Zeitpunkt wurden viele Ideen entwickelt, wie die sogenannte interkulturelle Öffnung der Regeldienste am besten gelingen kann.
Auch gesetzlich werden Akteure der Jugendhilfe bei der Ausgestaltung von Hilfen verpflichtet, kulturelle Besonderheiten und Eigenarten von Familien sowie deren pädagogische und religiöse Grundrichtung in der Erziehung zu berücksichtigen (§ 9 Sozialgesetzbuch [SGB] VIII, 1990).
SGB VIII §9
Bei der Ausgestaltung der Leistungen und Erfüllungen der Aufgaben sind
1. die von den Personensorgeberechtigten bestimmte Grundrichtung der Erziehung sowie die Rechte der Personenberechtigten und des Kindes oder des Jugendlichen bei der Bestimmung der religiösen Erzie hung zu beachten,
2. die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes oder des Jugendlichen zu selbständigem, verantwortungsbewusstem Handeln sowie die jeweiligen besonderen sozialen und kulturellen Bedürfnisse und Eigenarten junger Menschen und ihrer Familien zu berücksichtigen,
3. die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu fördern.
Auch wenn Friese in seinem 2019 erschienenen Buch „Kultur- und migrationssensible Beratung“ darauf hinweist, dass sich die interkulturelle Öffnung in der Fachwelt eher langsam durchsetzt (Friese, 2019, S. 39 f.), ist seit Mitte der 1990er-Jahre doch einiges passiert. Mittlerweile gibt es zahlreiche Bemühungen und viele Ansätze des „Aufeinanderzugehens“. Zahlreiche Ideen, Initiativen und Angebote sind in den letzten Jahren entstanden. Soziale Regeldienste entwickeln schon lange interkulturelle Ansätze und Konzepte. Was Friese damit meinen könnte, wenn er sagt, dass sich die interkulturelle Öffnung von Regeldiensten eher langsam entwickelt habe, wird im Kapitel 4 dieses Heftes deutlich werden. Hier werden wir uns mit der Frage auseinandersetzen, was interkulturelle Kompetenz eigentlich bedeutet und wie herausfordernd interkulturelles Lernen sein kann.
Auch Prof. Dr. Stefan Gaitanides, Professor für Soziale Arbeit in der Einwanderungsgesellschaft, und Migrationssoziologie an der Universität Frankfurt sieht die noch die im Jahre 2004 zu beobachtende Überrepräsentation von Migrant*innen in den sogenannten „Endstationen“ Sozialer Arbeit als ein Ergebnis des Versagens vorsorgender Maßnahmen in Bezug auf die interkulturelle Öffnung von Regeldiensten. (vgl.. Gaitanides 2004, S.10) Im Laufe der Jahre, in der sich Regeldienste immer mehr mit Aspekten von interkultureller Öffnung auseinandergesetzt haben, konnte gleichzeitig eine Zunahme der Inanspruchnahme der präventiven Kinder- und Jugendhilfe durch Familien mit Migrationshintergrund beobachtet werden (vgl. Gaitanides 2019, S.112).
Generell kann man Interkulturelle Kommunikation stets als einen beidseitigen Prozess beschreiben: Nicht nur aufseiten der Regeldienste gibt es viel Engagement bezüglich einer positiven Integration. Auch aufseiten muslimischer Mitbürger*innen gibt es eine große Anzahl engagierter Menschen, die sich für die Integration Neuzugewanderter einsetzen. Dieses Engagement basiert allerdings zu allermeist auf dem Ehrenamt, meist unkoordiniert und immer noch parallel zum Regelangebot der öffentlichen und freien Jugendhilfe.
Wenn man sich in Moscheegemeinden oder Kulturvereinen bewegt, ist sehr viel ehrenamtliches Engagement zu finden. In muslimischen Kreisen, innerhalb, aber auch außerhalb von Moscheegemeinden, hat sich insbesondere auch durch den Zuzug von Familien mit Fluchthintergrund eine Vielzahl von Beratungs- und Unterstützungsangeboten entwickelt. Hier ansässige, integrierte Familien mit Migrationshintergrund möchten ihre Erfahrungen und ihre Kompetenzen, die sie durch die eigenen Integrationsleistungen gesammelt haben, anderen Familien zur Verfügung stellen.
Hinweis
Ein kleiner Ausschnitt der zahlreichen Bemühungen in der Integrationsarbeit von muslimischer Seite ermöglicht die Broschüre „Hilfsbereite Partner: Muslimische Gemeinden und ihr Engagement für Geflüchtete“ von Julia Gerlach, die im März 2017 von der Bertelsmann Stiftung herausgegeben wurde (Gerlach, 2017).
Die Bertelsmann Stiftung ging im gleichen Jahr in ihrem Religionsmonitor der Frage nach der Rolle der Religion für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe nach und stellte fest, dass sich 44 Prozent der Muslim*innen ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagierten und unter den Muslim*innen 30 Prozent angaben, sich in verschiedenen Bereichen freiwillig zu engagieren. Das Engagement von Konfessionslosen in der Flüchtlingshilfe ist mit 16 Prozent deutlich geringer. Auch das der Christ*innen mit 21 Prozent ist im Vergleich halb so groß (Nagel & El-Menouar, 2017, S. 25).
Lokale muslimische Akteur*innen werden allerdings, wie oben schon erwähnt, in ihrem kommunalen Engagement von der lokalen Zivilgesellschaft bisher noch kaum wahrgenommen (Karakaya & Zinsmeister, 2018, S. 10). Diese Angebote sind professionellen Jugendhilfeeinrichtungen bzw. Bildungsträgern so gut wie nicht bekannt und können dadurch bei fachlichen Überlegungen und Projektentwicklungen nicht berücksichtigt werden. Vorhandene Ressourcen für den professionellen Rahmen bleiben somit leider weitgehend ungenutzt.
Neuere Entwicklungen zeigen, dass die Idee, die geleistete ehrenamtliche Arbeit auf professionelle Beine zu stellen, an unterschiedlichen Stellen aufgegriffen und verfolgt wird.
Hier können Sie sich über solche Projekte informieren:
https://www.paritaet-nrw.org/soziale-arbeit/projekte/qualifizierungmuslimischerund-alevitischer-wohlfahrtspflege/?L=0 (16.05.2020)
https://de.qantara.de/content/michael-kiefer-aufbau-muslimischerwohlfahrtspflege-braucht-zeit (16.05.2020)
http://www.islamiq.de/2016/08/26/neuer-studiengang-fuerislamische-sozialarbeit/ (16.05.2020)
https://www.evangelisch.de/inhalte/137831/30-08- 2016/sozialarbeiternetz-willmuslimische-wohlfahrtspflegevorantreiben (16.05.2020)
1.2 Gesellschaftliche Wahrnehmung von Muslim*innen und deren Auswirkung
Eine Vielzahl von Muslim*innen hat den Eindruck, von Teilen der Gesellschaft abgelehnt oder zumindest mit Misstrauen betrachtet zu werden. Die im Juli 2007 vom Innenministerium vorgelegte Studie von Karin Brettfeld und Peter Wetzels zum Thema „Integration und Integrationsbarrieren von Muslimen in Deutschland“ zeigte, dass sich jeder dritte Muslim von Nichtmuslimen pauschal abgelehnt fühlt (Brettfeld & Wetzels, 2017, S. 108). Dieses Gefühl aufseiten der Muslim*innen wird durch mehrere Studien über die Mehrheitsgesellschaft mit Fakten untermauert. Die Leipziger Autoritarismus-Studie aus dem Jahr 2018 kommt zu dem Ergebnis, dass eine sogenannte „Muslimfeindschaft“ weiter zugenommen hat. Von 43 Prozent im Jahre 2014 sind antimuslimische Ressentiments auf 55,8 Prozent, also um 10 Prozentpunkte gewachsen (Decker & Brähler, 2018, S. 102). Islamfeindlichkeit ist also keine gesellschaftliche Randerscheinung mehr. Islamfeindlichkeit wird in diesen Studien als salonfähiger Trend definiert, der eine Legitimation diskriminierender und ausgrenzender Verhaltensweisen gegenüber einer Minderheit zur Folge hat (Bertelsmann Stiftung, 2015).
Voneinander unabhängige Studien bestätigen, dass diese negative Grundhaltung einerseits darin begründet sei, dass der Diskurs um muslimische Bürger überwiegend negativ geprägt wäre und andererseits, dass lokale muslimische Akteure in ihrem kommunalen Engagement und damit in der jeweiligen lokalen Zivilgesellschaft kaum sichtbar sind. […] Dies führt dazu, dass Muslime oftmals als ein geschlossener Block wahrgenommen werden, die einer deutschen Gesellschaft gegenüberstehen (Karakaya & Zinsmeister, 2018, S. 10).
19 Prozent der nicht muslimischen Befragten in Deutschland geben sogar an, Muslim*innen nicht gerne als Nachbarn haben zu wollen (Halm & Sauer, 2017, S. 17).
Der Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2019 zeigt, dass viele Menschen in Deutschland den Islam nicht mehr (neutral) als Religion, sondern tendenziell als demokratiefeindliche und extremistische Ideologie wahrnehmen (Pickel, 2019, S. 12). Bei den unter 45-Jährigen fühlt sich jede/r Dritte durch den Islam bedroht, bei den 45-Jährigen und Älteren steigt der Wert auf bis zu über 60 Prozent (Karakaya & Zinsmeister, 2018, S. 13 f.).
In meiner interkulturellen Arbeit erlebe ich große Wissenslücken, schnelle Zuschreibungen und Pauschalisierungen auf beiden Seiten, sowohl aufseiten der Menschen, die Kinder, Jugendliche und Familien aus dem orientalischen Kontext im Erziehungs- und Integrationsprozess begleiten, als auch aufseiten der orientalischen Familien, die hier leben und zu wenig Zugänge zu der Aufnahmegesellschaft haben und diese auch manchmal zu wenig suchen.
In Situationen, in denen es um Bereiche der kulturell unterschiedlichen Werte- und Normvorstellungen in Erziehungsfragen geht, haben beide Seiten manchmal vollkommen konträre Meinungen. In der persönlichen Begegnung sollte Fachkräften der Einfluss von schnellen Zuschreibungen und Vorurteilen (auf beiden Seiten) stets bewusst sein. Fachkräfte auf der einen Seite haben manchmal das Gefühl, dass sich Eltern einer konstruktiven Zusammenarbeit verweigern und sie keine adäquaten Zugangswege zu deren Lebenswelten finden. Auf der anderen Seite haben orientalische Eltern oft das Gefühl, dass Fachkräfte gegen sie arbeiten bzw. es ihnen nicht gelingt, sich in ihre Situation hineinzuversetzen. Die Tatsache, dass sich viele Muslim*innen von Nichtmuslim*innen abgelehnt fühlen, sowie das Gefühl, nicht wirklich wahrgenommen und verstanden zu werden, kann ich durch meine Erfahrungen mit vielen orientalischen Familien bestätigen. Diese fühlen sich sehr schnell zurückgewiesen und haben Angst, dass ihre Kinder zu sehr von ihren Traditionen entwurzelt werden könnten.
1.3 Die Zuschreibung von Kollektiven
Das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe, z.B. zu einer Familie, einer Religionsgemeinschaft etc., ist für jeden Menschen sehr wichtig. Manchmal wird die Betonung der Zugehörigkeit allerdings als ein Abgrenzungsinstrument eingesetzt, welches bestehende Differenzen betont (El-Mafaalani & Toprak, 2011, S. 48). Vor diesem Hintergrund kann es in der Begegnung zwischen Menschen, insbesondere in der Interkulturellen Sozialen Arbeit, zu großen Herausforderungen kommen.
Viele orientalische Eltern wollen das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Familie, das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Nation oder einer konkreten Religionsgemeinschaft bei ihren Kindern fördern. „Dabei wird die Zugehörigkeit auf zwei Ebenen dargestellt: einmal in der Unterscheidung zwischen Familie und Nichtfamilie, zum anderen in der Unterscheidung zwischen ethnischer Community und den Anderen. Auch wenn ‚die Anderen‘ bzw. ‚die Deutschen‘ nicht negativ konnotiert werden, offenbart sich dadurch eine klare Differenzierung, die von den Kindern und Jugendlichen als manifeste Tatsache wahrgenommen wird, da sie eine analoge Unterscheidung von der Mehrheitsgesellschaft täglich erleben“ (El-Mafaalani & Toprak, 2011, S. 48). Allzu häufig wird in Diskussionen, Medien, Talkshows und auch in persönlichen Begegnungen zwischen „Die“ und „Wir“ unterschieden und immer noch viel zu wenig differenziert.
Durch die Verwendung religiöser Begrifflichkeiten und Zuschreibungen im Integrationsdiskurs wird eine sehr heterogene Gruppe von Personen mit Migrationshintergrund auf ein einzelnes Merkmal – ihr ‚Muslimsein‘ und damit auf ihre (z.T. auch nur angenommene) religiöse Zugehörigkeit – reduziert. Die Medien wirken bei dieser Entwicklung als Verstärker: Sie behandeln den Islam mit Blick auf den islamistisch motivierten Terrorismus vor allem als Sicherheitsthema und stellen immer wieder spezifische Integrationsprobleme Einzelner als Pars pro Toto für die gesamte Gruppe „der Muslime“ dar (Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration GmbH, 2013, S. 4).
Debatten über Zugehörigkeit(en), Anpassung und Teilnahme sind häufig negativ konnotiert […]. Oft wird der Islam‘ als Forschungsgegenstand essentialisiert. Dabei führt der Versuch starker Thesenbildung, also Annahmen über Muslime und muslimisches Leben, zu Vereinfachung und Komplexreduktion. Das führt letztlich dazu, dass sie als eine homogene Gruppe verklärt, wahrgenommen, stigmatisiert und häufig unter Generalverdacht gestellt, sowie als Gruppe mit einer feindseligen Grundhaltung abgewertet werden (Coşkun-Şahin, 2018, S. 52).
Kübra Gümüsay erläutert in ihrem Buch „Sprache und Sein“ die Bürde und den Druck der Repräsentation, die auf Menschen lasten, die von der klassischen Norm abweichen (Gümüsay, 2020, S. 66 und 87). Sie beschreibt in ihrem Buch sehr eindrücklich den Prozess der Entmenschlichung, den viele Menschen tagtäglich aufgrund von Marginalisierungsprozessen erfahren. Aspekte wie Individualität, Komplexität, Ambiguität, Makel und Fehler sollten keine Privilegien für einen Teil der Menschen darstellen, da gerade der Raum für Individualität, Freiheit und Fehlerhaftigkeit eines Menschen ja tatsächlich zum Menschsein dazugehört. Gümüsay zeigt auf, dass den Menschen, die von der klassischen Norm abweichen, diese Dinge oft nicht zugestanden würden (Gümüsay, 2020, S. 63 und 88).
Viele Menschen in unserer Gesellschaft können durch die Straßen gehen und dabei einfach sie selbst sein. Sie können unfreundlich sein, sich ärgern, ihren Emotionen freien Lauf lassen, ohne dass daraus ein allgemeiner Schluss gezogen würde über all jene, die so ähnlich aussehen wie sie oder die gleiche Religion praktizieren. Wenn ich, eine sichtbare Muslimin, bei Rot über die Straße gehe, gehen mit mir 1,9 Milliarden Muslim*innen bei Rot über die Straße. Eine ganze Weltreligion missachtet gemeinsam mit mir die Verkehrsregeln“ (Gümüsay, 2020, S. 64 f.). Die Anforderung, in jeder Situation vorbildlich zu handeln, makellos aufzutreten, durchdringt unseren Alltag und nimmt uns die Menschlichkeit. Denn erst unsere Makel und Eigenarten machen uns zu Menschen (Gümüsay, 2020, S. 89).
Allerdings ist auch ein Unterschied zwischen der Darstellung von Muslim*innen in den Medien und den Alltagserfahrungen und Einschätzungen des Zusammenlebens von muslimischen Zuwanderern und Mehrheitsbevölkerung erkennbar, der nicht unberücksichtigt bleiben soll: Rund 71 % der Bevölkerung bewertet die Darstellung von Muslim*innen in den Medien zu negativ. (vgl. Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) GmbH, 2013, S.4)
Es sind also sowohl orientalische Familien als auch Fachkräfte aufgefordert, stärker zu individualisieren, anstatt zu pauschalisieren. Doch was bedeutet dies konkret? Wir sollten vor dem Hintergrund unseres professionellen Anspruches in der Sozialen Arbeit immer darauf achten, dass wir durch unsere Assoziationen und schnellen Zuschreibungen bei uns bekannten Attributen einer bestimmten Gruppenzugehörigkeit den Blick für die Individualität jedes einzelnen Menschen nicht verlieren. Wir sollten den in uns oftmals äußerst automatisierten und schnell verlaufenden Zuschreibungsprozess wahrnehmen, und stets bewusst durchbrechen. An dieser Stelle sei auf Unterkapitel 3.2 „Der neugierige Blick in die Welt des Klienten“ verwiesen.
Individualisieren anstatt zu pauschalisieren bedeutet also,
dass wir einen Menschen nicht aufgrund von äußerlichen Merkmalen und Gruppenzugehörigkeiten auf eine Definition vorfestlegen, sondern ihn mit einem offenen Blick als Individuum mit seiner ganz eigenen individuellen Prägung, Geschichte und Entwicklung sehen und kennenlernen.
Die Tatsache, dass Eltern gegenüber ihren Kindern die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe betonen, ist ja erst einmal nicht per se negativ, sondern kann durchaus auch positiv und wichtig sein. Wenn die Betonung der Zugehörigkeit aber Barrieren gegenüber einer Begegnung und eines Austausches schafft und z. B. ein Hilfsangebot deswegen nicht angenommen wird, dann können wir Fachkräfte auf Seiten der Eltern im Moment einmal nichts ändern und müssen mit dieser Gegebenheit umgehen. Wir Fachkräfte müssen uns dann auf die Faktoren konzentrieren, die in unseren Händen liegen und die wir in einer Begegnung berücksichtigen und beeinflussen können. Wir sollten den Fokus auch auf diejenigen Dinge legen, die eine Reaktion von Widerstand und Abgrenzung verringern können. Und dies fängt stets mit den eigenen persönlichen gedanklichen Formaten und Konstrukten und der daraus resultierenden Haltung an. Denn schon Sprache und Begrifflichkeiten an sich lassen bestimmte Denkstrukturen und Wirklichkeiten entstehen, die Abgrenzungstendenzen verstärken und unterstützen können. Fachkräfte sollten besonders auch einem „unbekannten“ Gegenüber mit einer fachlichen professionellen Neutralität begegnen.
Nicht wenige bekennende Muslim*innen fühlen sich zu schnell mit Terrorist*innen und Fundamentalist*innen gleichgesetzt. In der oben erwähnten Studie des Innenministeriums äußerten über 90 % der Befragten ihre Betroffenheit angesichts eines pauschalisierten Terrorismusverdachts gegenüber Muslim*innen. (vgl. Brettfeld, K./Wetzels, P., 2017, S. 109) Muslim*innen berichten oft darüber, dass sie das Gefühl haben, dass von ihnen in den verschiedensten Kontexten zunächst einmal erwartet wird, sich von fundamentalistischen Strömungen und Gewalt zu distanzieren und sich zu erklären, dass sie durchaus friedvoll lebende Menschen seien. Muslimische Klienten haben diesbezüglich sehr häufig eine erhöhte Aufmerksamkeit und registrieren die ihnen entgegengebrachten Zuschreibungen.
Einem Kollektiv von außen zugeordnet zu werden, kann, wie oben erwähnt, sowohl als identitätsstiftende, aber auch als begrenzende und freiheitsraubende Erfahrung und sogar als Entmenschlichung erlebt werden.
Hinweis
An dieser Stelle möchte ich Ihnen das oben erwähnte, im Jahr 2020 erschienene Buch von Kübra Gümüsay „Sprache und Sein“ ans Herz legen. Das Buch beschreibt aus Sicht einer „Benannten“ die Grenzlinien, die unsere Sprache und Marginalisierungen beinhalten, und macht auf eindrückliche Art und Weise deutlich, wie ein Prozess der Entmenschlichung geschieht und Individuen unsichtbar werden, wenn sie einem Kollektiv zugeordnet werden. Individualisieren, anstatt zu pauschalisieren, bedeutet also, dass wir einen Menschen nicht aufgrund von äußerlichen Merkmalen und Gruppenzugehörigkeiten auf eine Definition vorfestlegen, sondern ihn mit einem offenen Blick als Individuum mit seiner ganz eigenen individuellen Prägung, Geschichte und Entwicklung sehen und kennenlernen.
In medialen Diskursen werden Muslim*innen oftmals als homogen religiös markiertes Kollektiv dargestellt. Dabei wird unterstellt, dass „Muslime“ eine homogene Gruppe von Menschen seien, die man mit pauschalen Zuschreibungen definieren könne. Wie inhomogen die Gruppe der Muslim*innen ist und welche vielfältigen Faktoren einen individuellen Menschen tatsächlich prägen, wird im Laufe des Buches noch an unterschiedlichen Stellen deutlich werden.
Übung
Vielleicht haben Sie Lust einmal selbst darüber nachzudenken, welchen verschiedenen Gruppen/Kollektiven Sie selbst angehören? Wann finden Sie sich in einem „Die/Wir-Denken“ wieder?
Von welchen Gruppierungen von Menschen grenzen Sie sich selbst bewusst ab?
1.4 Unterschiede in der Verantwortungsübernahme bzw. - abgabe
Gesprächsführung und Interventionen von Fachkräften basieren auf einem demokratischen, selbstverantwortlichen und freiheitlich-individuellen Selbstverständnis und Menschenbild (vgl. auch Kapitel 4.1. „Das Demokratieprinzip und das Modell Interkulturelle Kompetenz“). Treffen wir auf Menschen, die sich selbst als praktizierend religiös beschreiben, kann es durchaus sein, dass Konflikte und Problemlagen keineswegs beliebig und individuell lösbar scheinen, sondern der Einbeziehung religiöser Aspekte bedürfen (vgl. Laabdallaoui/Rüschoff, 2005, S. 17).
Unser Gegenüber könnte durchaus ein Verständnis von der Welt haben, in welchem Gott ihm Verhaltensvorschriften vorgibt und er oder sie selbst als Individuum nur einen begrenzten Raum an Eigenverantwortung erlebt. Die eigene Freiheit und Eigenverantwortung könnten dann nur in der Frage erlebt werden, ob man Gottes Gebote befolgt oder nicht. Fragen, welches Verhalten einen selbst zu einem guten oder schlechten Muslim*innen macht, spielen bei einigen Muslim*innen durchaus eine große Rolle. Die Lebenswelt praktizierender Muslim*innen ist häufig gekennzeichnet von einer klaren und einfachen Einteilung in „falsch und richtig“ bzw. „verboten und erlaubt“. Wer in solchen Denkstrukturen sein Leben gestaltet, dem wird nur sehr wenig bis gar kein mentaler Raum für die Erarbeitung individueller Lösungswege zwischen den Polen „verboten“ und „erlaubt" zur Verfügung stehen. Der einzelne Mensch würde ohne Berücksichtigung der göttlichen Vorschriften sich aus diesem Selbstverständnis heraus tatsächlich über Gottes Gebote stellen und vom Glauben „abfallen“.
Es kann daher hilfreich sein, dass wir Fachkräfte uns dessen bewusst sind, dass in unseren pädagogischen Begegnungen eventuell eine kulturellreligiöse Wissensordnung mitläuft, durch die Dinge unter dem oben genannten Aspekt beleuchtet werden, und die uns nicht (direkt) zugänglich ist. Wenn wir uns in der Begegnung mit gläubigen Menschen diese unterschiedlichen Welten nicht bewusst machen, kann es passieren, dass es uns in bestimmten Gesprächssituationen nicht möglich sein wird, eine gute Arbeitsbeziehung herzustellen, bzw. einen Beratungsprozess erfolgreich durchzuführen.
1.5 Dürfen sich Muslim*innen überhaupt beraten lassen?
Manche Muslim*innen stellen sich die Frage, ob das Aufsuchen einer Beratungsstelle aus religiöser Sicht verboten sei. Familiäre und intime Themen außerhalb der Familie zu besprechen, wird von ihnen als Überschreitung von Gottes Geboten angesehen. Es soll also der Frage nachgegangen werden, ob Beratung aus islamischer Perspektive überhaupt erlaubt ist.
Im Islam hat die Respektierung der eigenen Privatsphäre und der anderer einen hohen Stellenwert. Es ist nicht ohne weiteres erlaubt, familiäre bzw. intime Themen nach außen zu tragen. Dies gilt vor allem für die Beziehung zwischen Ehegatten. Man soll nicht schlecht über andere Menschen reden und schon gar nicht über seinen Ehepartner.
„Jedem, der die Mängel eines anderen in dieser Welt verdeckt, werden von Allah am Tage des Gerichts seine Mängel verdeckt werden“ (Hadith Nr. 240).
Ist also der Gang zu einer Beratungsstelle, in der man über seine Eheprobleme spricht, religiös verboten?
Generell stellen der soziale Gedanke und die Unterstützung eines Einzelnen in einer sozialen Gruppe „ein unabdingbarer Bestandteil des Islam dar“ (Laabdallaoui/Rüschoff, 2005, S. 22). Der Islam fordert Menschen auf, Gemeinschaft zu leben und zu praktizieren. Menschen sollen sich nicht nur um ihr eigenes Wohlbefinden kümmern, sondern auch um das ihrer Mitmenschen.
„Wer einem Bruder hilft, dem wird Allah helfen. Und wer einem Muslim bei der Beseitigung seiner Sorgen hilft, dem wird Allah bei seinen Sorgen am Tage des Gerichts helfen“ (Hadith Nr. 233).
„(…) die sich ihrem Herrn fügen, das Gebet verrichten, sich untereinander beraten (….) “ (Sure 42, Vers 38).
„Wenn ihr befürchtet, dass eine Ehe durch Zuspitzung der Differenzen auseinandergeht, dann setzt einen Schiedsrichter aus der Familie des Mannes und einen aus der Familie der Frau ein “ (Sure 4, Vers 35)!
Diese Aufforderungen in den islamischen Quellen haben notwendigerweise zur Voraussetzung, dass man sich mit seinen Schwierigkeiten an jemanden wendet.
Der Prophet Muhammad selbst fragte vertrauenswürdige und kompetente Nichtmuslime auch in wichtigen Angelegenheiten um Rat und Hilfe (vgl. Laabdallaoui/Rüschoff, 2005, S. 27). „So vertraute er sogar bei seiner Auswanderung nach Medina einem loyalen Polytheisten, den er als Führer wählte, sein Leben an.“ (ebd.) „Auch in der Sunna [Unter Sunna versteht man die Gesamtheit der überlieferten Aussprüche, Verhaltens- und Handlungsweisen des Propheten Muhammad als Richtschnur muslimischer Lebensweise. Anm. der Autorin] finden wir viele Überlieferungen, in denen der Prophet um seinen Rat in privaten Konfliktsituationen gefragt wurde, die häufig auch das eheliche Sexualleben berührten“ (ebd., S. 26).
Muslim*innen werden, wie aus den Quellen ersichtlich, aufgefordert, Angehörige bei Ehestreitigkeiten zu Schiedsrichtern zu machen oder auch einen Richter bei Scheidungsangelegenheiten anzurufen. „In Therapie und Beratung geht es um Krisen- und Notsituationen, also Ausnahmen. Es geht nicht darum, aus Gründen von Neid, Eifersucht oder Angeberei intime Dinge aus dem Ehe- und Familienleben in die Öffentlichkeit zu tragen. Ziel ist es, zu einer Lösung mit einer/m professionellen Berater*in zu kommen, der zu strenger Geheimhaltung verpflichtet ist“ (ebd., S. 28).





























