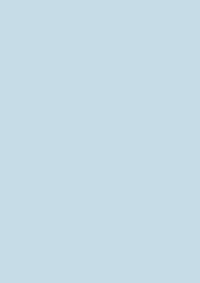
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die vorliegende Schrift befasst sich mit der sozialen Lage der Lehrkräfte im Zeitraum zwischen 1973 und 2009. Die inhaltliche Frage der Studie lautet: Wie hat sich die soziale Lage der Lehrkräfte im Laufe der Zeit und im Vergleich zu anderen Berufsgruppen verändert, wobei das Augenmerk der Analyse sich auf die Merkmale richtet über die alle erwerbstätigen Gesellschaftsmitglieder verfügen und miteinander verglichen werden können. Die Analyse der sozialen Lage bedeutet, dass die Lehrkräfte nicht auf deren berufliche Tätigkeit reduziert, sondern als gesellschaftliche Mitglieder begriffen werden, deren soziale Lage und Einbindung in soziale Milieus durch den Beruf entscheidend de-terminiert werden. Als Vergleichskategorien dienen sieben weitere Berufsgruppen, die ebenso wie die Lehrkräfte ein hohes Berufsprestige haben. Die Studie hat ein Trenddesign und verwendet Sekundärdaten des Mikrozensus Scienti-fic-Use-File aus den Jahren 1973, 1982, 1991 und 2009.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danksagung
Diese Habilitationsschrift entstand während meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Steuerung und Finanzierung des Bildungswesens am Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung in Frankfurt am Main. Ohne Hilfe und Unterstützung einiger Menschen wäre diese Arbeit nicht entstanden. Mein besonderer Dank gilt Herrn Prof. Horst Weishaupt für das Vertrauen, Betreuung und unermüdliche Unterstützung. Meinen Kollegen von der Abteilung Steuerung und Finanzierung des Bildungswesens danke ich für die zahlreichen konstruktiven Anregungen und bereichernde inhaltliche Diskussionen.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Theorie der Sozialen Lagen
2. Zur Lehrerforschung
2.1. Themen, Designs, Vergleichbarkeit
2.2. Soziale Milieus und Wertvorstellungen
2.3. Psychosoziale Aspekte des Lehrerberufs
2.4. Seiteneinsteiger und Weiterbildung
2.5. Berufsbiographien
2.6. Feminisierung
2.7. Fazit
3. Daten, Methoden, Untersuchungsdesign und Hypothesen
3.1. Untersuchungsdesign und Hypothesen
3.2. Daten
3.3. Stichprobe
3.4. Operationalisierung
4. Befunde zur sozialen Lage
4.1. Horizontale Ungleichheitsdimensionen
4.1.1. Alter
4.1.2. Geschlecht
4.1.3. Migrationshintergrund
4.2. Vertikale Ungleichheitsdimensionen
4.2.1. Arbeitsbedingungen
4.2.1.1. Arbeitsstunden
4.2.1.2. Nebentätigkeiten
4.2.2. Formale Entscheidungsmacht und soziale Sicherheit
4.2.2.1. Berufliche Stellung
4.2.2.2. Befristung der Arbeitsverträge
4.2.3. Berufseinstieg
4.2.4. Beendigung der Berufstätigkeit
4.2.5. Einkommen
4.2.6. Bildungsniveau
4.2.6.1. Formale Bildung
4.2.6.2. Weiterbildung
4.2.7. Soziale Beziehungen
4.2.7.1. Partnerschaft
4.2.7.2. Erwerbstätigkeit der Ehe-/Lebenspartner
4.2.7.3. Berufshomogamie
4.2.7.4. Partnerwahl und Berufe der Ehe-/Lebenspartner
4.2.7.5. Exkurs über Geistliche
4.2.8. Haushalts- und Äquivalenzeinkommen
4.2.8.1. Haushaltseinkommen
4.2.8.2. Einkommen der Ehe-/Lebenspartner
4.2.8.3. Äquivalenzeinkommen
4.3. Berufsprestige
4.4. Zusammenfassender Berufsgruppenvergleich
4.5. Potential des Mikrozensus
Tabellenanhang
Literaturverzeichnis
Rechtsvorschriftenverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Einleitung
Das Hauptanliegen der vorliegenden Schrift ist die Darstellung der sozialen Lage der Lehrkräfte seit den 1970er Jahren bis heute. Die Motivation für diese Arbeit ergibt sich aus der herausragenden Rolle der Lehrkräfte im Prozess der Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Das Augenmerk richtet sich dabei nicht auf die Kompetenzen der Lehrkräfte, sondern auf die Merkmale über die alle erwerbstätigen Gesellschaftsmitglieder miteinander verglichen werden können. Es ist zwar unbestritten, dass für den Lernerfolg der Schüler, die Professionalität und die Kompetenzen der Lehrkräfte mitentscheidend sind. Sie geben aber keinen Rückschluss auf die gesellschaftliche Verortung dieser Berufsgruppe. Insofern setzt sich diese Arbeit von den meisten Lehrerstudien ab, die in das Zentrum des Interesses berufsbezogene Fähigkeiten, Wissen und Handeln stellen. Die Lehrer-/innen werden in dieser Arbeit nicht bezogen auf deren berufliche Tätigkeit betrachtet, sondern als Gesellschaftsmitglieder begriffen, deren soziale Lage und Einbindung in soziale Milieus durch den Beruf entscheidend determiniert werden. Die soziale Lage und deren Einbindung in soziale Milieus steht dabei in Beziehung mit spezifischen Handlungsmustern und Wertvorstellungen, wie z.B. Erziehungsstilen. Neben den sich stets wandelnden Erziehungsstilen und Erwartungen gegenüber dem Bildungssystem unterliegt auch die Zusammensetzung der Schülerschaft hinsichtlich ihrer sozialen Merkmale (Migrationshintergrund, Einkommensverhältnisse der Eltern, Berufe der Eltern, familiäre Strukturen) einer steten Veränderung. Diese Entwicklung wirft die Frage auf, ob sich die objektive Lage der Lehrerschaft im Laufe der Zeit ebenfalls dauerhaft verändert. Die Lehrkräfte gehören zwar zu einer zahlenmäßig sehr starken Berufsgruppe, sie sind aber nur eine von mehreren Akademikerberufsgruppen, die ihrerseits ein vergleichbar hohes gesellschaftliches Ansehen genießen. Deshalb soll der Frage nachgegangen werden, ob sich die soziale Lage der Lehrerschaft innerhalb der letzten vierzig Jahre verändert hat und ob in dieser Hinsicht gewisse Unterschiede zwischen einzelnen Berufsgruppen festgestellt werden können. Mit Blick auf Gymnasiallehrkräfte und Lehrkräfte an anderen Lehrergruppen existierten in der Vergangenheit Unterschiede hinsichtlich der Anforderungen, Einkommen, dem Ansehen und sogar dem beruflichen Selbstverständnis. Die Unterschiede zwischen Lehrergruppe sollen ebenfalls in der Analyse berücksichtigt werden.
Mit dem Begriff soziale Lage wird die Verortung der Mitglieder einer sozialen Gruppe innerhalb der Gesellschaft anhand ausgewählter Merkmale bezeichnet. Analysiert man die soziale Lage einer Berufsgruppe – wie die der Lehrerschaft –, dann ist der ausgeübte Beruf das entscheidende Merkmal zur Festlegung der Analyseeinheit. Die möglichen Änderungen der Verortung in der Gesellschaft lassen sich am besten durch die Vergleiche in der Zeit und durch die Vergleiche mit anderen sozialen Gruppen erreichen. Eine solche Analyse erfordert eine entsprechende Datenbasis. Die vorliegende Untersuchung verwendet Sekundärdaten, wobei sowohl inhaltliche als auch methodische Fragen behandelt werden sollen. Die inhaltliche Frage lautet: Wie hat sich die soziale Lage der Lehrkräfte im Laufe der Zeit und im Vergleich zu anderen Berufsgruppen verändert? Die methodische hingegen lautet: Wie gut ist das Potenzial des Mikrozensus, der für diese Untersuchung verwendet wurde, derartige Fragen zu beantworten? Bildungsforschung, darunter Forschung über das Personal im Bildungswesen, erfordert eine differenzierte Datenbasis, die die Beobachtung von langfristigen Zeiträumen ermöglicht.
Die vorliegende Analyse hat mehrere Anknüpfungspunkte zu der Studie von Weishaupt und Huth (2012) zur sozialen Lage der Lehrkräfte, die anhand des Mikrozensus Scientific-Use-File 2005 durchgeführt wurde. Im Unterschied zur damaligen Studie handelt es sich hier um eine Trend- und nicht um eine Querschnittsanalyse. Zudem wurden die Vergleichsgruppen anders konzipiert. Im Vergleich zur eben genannten Studie dient die recht heterogene Gruppe der berufstätigen Akademiker nicht mehr als Vergleichskategorie, sondern die Berufsgruppen, die ein vergleichbar hohes berufliches Prestige genießen. Dieses Vorgehen hat zum Ziel, differenziertere Schlüsse über die Lage der Lehrerschaft zu ziehen als bei einem Vergleich mit der zahlenmäßig sehr starken Gruppe der sonstigen Akademiker, die eine Vielfalt von Berufen ausüben und unter unterschiedlichen Arbeitsbedingungen erwerbstätig sind.
Die theoretische Grundlage der vorliegenden Arbeit liefert das Konzept der sozialen Lagen von Hradil (1981; 1983; 1987; 2001). Für die Wahl dieses Konzepts sprechen vor allem dessen Betrachtung der modernen Gesellschaft als multidimensionales Gebilde, dessen Flexibilität in der Anwendung auf soziale Gruppen und dessen deskriptiver Charakter. Weil die vorliegende Studie einen Vergleich zwischen den Berufsgruppen zum Ziel hat, wurden aus der Vielzahl der möglichen Untersuchungsdimensionen im Rahmen des Hradil‘schen Konzeptes vor allem diejenigen ausgesucht, die das Arbeitsleben betreffen. Zu einer Vervollständigung des Bildes wurden zusätzlich Aspekte der familiären Situation untersucht. Die Entscheidung für den Mikrozensus als Datenbasis hat mehrere Gründe. Als Bevölkerungsumfrage mit dem Hauptgewicht auf der Arbeitsmarktsituation beinhaltet der Mikrozensus Fragen, die allen Befragten unabhängig von deren Beruf und aktueller beruflichen Situation in gleicher Form gestellt werden. Dies hat den Vorteil, dass alle Befragten sich weniger als Vertreter einer spezifischen Berufsgruppe denn als Bürger verstehen und damit das Antwortverhalten möglicherweise weniger stark durch berufsspezifische Einstellungen und Orientierungen geprägt ist. Zudem macht eine hohe Konsistenz der Fragen den Mikrozensus für Trendanalysen geeignet. Die Verpflichtung zur Teilnahme bewirkt, dass die Verweigerungsquote sehr niedrig ist. Zuletzt erlauben die Größe der Stichprobe und der Aufbau des Fragebogens eine recht hohe Flexibilität bei der Bildung von Untersuchungsgruppen.
1. Theorie der Sozialen Lagen
Im diesen Kapitel soll neben der Darstellung des Konzeptes sozialer Lagen erklärt werden, warum dieses Konzept besonders geeignet ist für die Darstellung der Situation einer Berufsgruppe, um sowohl berufliche als auch außerberufliche Elemente der sozialen Lage zu erfassen.
Hradil (1987, S.153) definiert soziale Lagen als „typische Kontexte von Handlungsbedingungen, die vergleichsweise gute oder schlechte Chancen zur Befriedigung allgemein anerkannter Bedürfnisse gewähren“. Der Begriff soziale Lagen bezieht sich demnach auf die Komplexität der Handlungsbedingungen, die typisch für einzelne Bevölkerungsgruppen sind. Hradil unterscheidet dabei insgesamt 13 Typologien sozialer Lagen, die anhand mehrerer Dimensionen ungleicher Lebensbedingungen erstellt wurde. Zu den von ihm gewählten Dimensionen gehören: formale Macht, Geld, formale Bildung, Risiken, Prestige, Arbeitsbedingungen, Freizeitbedingungen, Wohnbedingungen und soziale Absicherung. Die typischen sozialen Lagen reichen von Randgruppen, Armen über Normalverdiener bis hin zu Bildungseliten, Reichen und Machteliten (Hradil 1987, S. 154). Der Singular des Begriffes sozialer Lagen bezieht sich auf die Situation einer sozialen Gruppe, wobei die Bestimmung der Chancen auf die Realisierung der Lebensziele maßgeblich durch eine Determinante bestimmt wird. Eine mögliche Determinante kann der ausgeübte Beruf sein, so dass von der sozialen Lage der Lehrkräfte in Abgrenzung zu anderen Berufsgruppen gesprochen werden kann. In der vorliegenden Studie wird demnach der Begriff soziale Lage im Singular verwendet.
Im Konzept der sozialen Lagen wird unterstellt, dass die Artikulation von individuellen Lebenszielen immer auch schon an gesamtgesellschaftliche Prozesse der Klärung, Selektion und Abstraktion gekoppelt ist (Hradil 1987, S. 143). Da die Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedigung je nach Ressourcenausstattung unterschiedlich ausfallen, kommt es zur ungleichen Verteilung von Chancen zwischen sozialen Gruppen zur Erreichung der Lebensziele. Hradil (1987, S. 144) definiert soziale Ungleichheit als „gesellschaftlich hervorgebrachte und relativ dauerhafte Handlungsbedingungen [...], die bestimmten Gesellschaftsmitgliedern die Befriedigung allgemein akzeptierter Lebensziele besser als anderen erlauben“. Die Untersuchung der sozialen Lage einer sozialen Gruppe erfordert eine Klärung darüber, was allgemein akzeptierte Lebensziele, im Sinne von Zielvorstellungen bezüglich des „guten Lebens“, sind. Vereinfacht gesagt: Lebensziele gelten dann als allgemein akzeptiert, wenn sie sich im „[...] Prozeß der politischen Willensbildung relativ durchgesetzt haben und in Form von ‚offiziellen‘ oder ‚quasi-offiziellen‘ Verlautbarungen greifbar sind (z.B. in Gesetzestexten, Parteiprogrammen oder Verbandsdeklarationen)“ (Hradil 1987, S. 143). Die Allgemeinheit der Lebensziele schließt, aufgrund des Rechtes auf Selbstbestimmung jedes Einzelnen, sowohl subjektive Einschätzungen der individuellen Wünsche und Interessen als auch objektive Ziele mit ein. Da in der Hradil’schen Vorstellung die Lebensziele den Anspruch allgemeiner Anerkennung erfüllen müssen, erfährt nicht jeder individuelle Wunsch seine gesamtgesellschaftliche Legitimation. Die Annahme, dass die individuelle Artikulation eines Lebensziels immer auch schon an einen kollektiven Ermöglichungshorizont gekoppelt ist, kann dabei insofern kritisiert werden, weil dieser immer nur einen gesellschaftlichen und damit affirmativen Zuschnitt annehmen kann. Das potentiell spannungsreiche Verhältnis von Individualität und Kollektivität wird in der Hradil’schen Vorstellung also dadurch überwunden, dass sich die Artikulation von individuellen Handlungszielen und deren Verfolgung immer auch schon an kollektiven Handlungserwartungen orientiert und diesen untergeordnet ist. Offen bleibt in diesem Konzept somit die Frage nach der Übereinstimmung heterogener gesellschaftlicher Gruppen hinsichtlich der Bestimmung der gesellschaftlich akzeptierten Lebensziele und der damit verbundenen Lebensbedingungen. Die Bedürfnisse der einzelnen sozialen Gruppen müssen nicht nur artikuliert, sondern von anderen sozialen Gruppen akzeptiert und deren Legitimität durch Entscheidungsträger anerkannt werden.
Hinsichtlich der objektiven Lebensziele besteht ein minimaler gesellschaftlicher Konsens, der vor allem auf der Anerkennung der Grundbedürfnisse aller Menschen beruht. In Wohlfahrtsgesellschaften spielen nicht die Grundbedürfnisse, sondern eher wohlfahrtsstaatliche, soziale und ökonomische Bedürfnisse die zentrale Rolle im Diskurs um die allgemeine Anerkennung der Lebensziele. In Tabelle 1-1 sind die Bedürfnisse und die Dimensionen der ungleichen Lebensbedingungen in Hradils Konzept der sozialen Lagen dargestellt.
Neben den sogenannten vertikalen Ungleichheitsdimensionen wie Einkommen, Bildung oder Macht werden für die Bestimmung sozialer Lage auch horizontale Ungleichheitsdimensionen herangezogen. Diese sind vor allem Geschlecht, Region und Alter. Obwohl von diesen Merkmalen nicht a priori gesagt werden kann, dass sie für die Benachteiligung oder Privilegierung entscheidend sind, so haben sie dennoch einen indirekten Einfluss auf die Chancen zur Erreichung der Lebensziele. Sie entscheiden über die Chancen der Teilnahme auf dem Arbeitsmarkt und damit die Einkommenshöhe und da sie mit Stereotypen behaftet sind, wirken sie sich indirekt auf die Möglichkeiten der Erreichung der Lebensziele aus.
Tabelle 1-1: Dimensionen sozialer Ungleichheit
Quelle: Hradil 1987, S. 147; eigene Darstellung
Die Mehrdimensionalität des Konzeptes soziale Lagen bedeutet, dass die soziale Lage einer Berufsgruppe entlang diverser Dimensionen als „gut“, unter Berücksichtigung anderer Dimensionen als „schlecht“ bezeichnet werden kann. Durch diese Mehrdimensionalität können Statusinkonsistenzen erfasst werden (Burzan 2007, S.142). Ein typisches Beispiel für unterschiedliche Bewertungen von Lebensbedingungen ist der Konflikt zwischen Freizeit und Einkommen. Häufig wird die soziale Lage von Selbständigen hinsichtlich der Einkommenssituation als relativ „gut“ beurteilt. Zieht man jedoch zusätzlich die Dimension Freizeit bzw. Arbeitszeit heran, so ändert sich womöglich die Beurteilung der sozialen Lage zu Gunsten von Angestellten und Beamten.
In der empirischen Forschung nutzte u.a. Schwenk (1999) das Konzept der sozialen Lagen für die Untersuchung der Lebensbedingungen der West- und Ostdeutschen. In seiner Analyse hat Schwenk eine Reihe von objektiven Merkmalen (Bildung, Einkommen, Wohnbedingungen) und subjektiven Einschätzungen (Anomie, Soziale Integration) getrennt für die Analyse der beiden Teile Deutschlands verwendet. Durch die Analyse konnten neun typische Lebenslagen in Ostdeutschland und zehn in Westdeutschland identifiziert werden, wobei in dieser Typologie die gesamte Bevölkerung (nicht nur Berufstätige) einbezogen wurde. Der Begriff soziale Lagen wird explizit im Datenreport - Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland des Statistischen Bundesamtes verwendet (Statistisches Bundesamt 2002; Statistisches Bundesamt 2006; Statistisches Bundesamt & GESIS-ZUMA 2008; Statistisches Bundesamt, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 2011; Statistisches Bundesamt, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 2013). Es existieren aber auch andere Publikationen, die die Lebensbedingungen der Bevölkerung anhand ausgewählter Indikatoren im Sinne des Konzeptes sozialer Lagen darstellen. Zu den bekanntesten gehört der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung (BMAS 2001; BMAS 2005; BMAS 2008; BMAS 2012). Für den Datenreport 2002 des Statistischen Bundesamtes wurden insgesamt 16 idealtypische soziale Lagen gebildet und zusätzlich die regionale Zugehörigkeit (Ost/Westdeutschland), Geschlecht und zwei Altersgruppen (bis 60, 61 Jahre und älter) berücksichtigt (Statistisches Bundesamt 2002). Die Zuordnung der Gesamtbevölkerung zur jeweiligen sozialen Lage erfolgte primär anhand der Hauptbeschäftigung der Personen. Der Begriff Hauptbeschäftigung berücksichtigt dabei gleichermaßen nicht nur die berufliche Tätigkeit, die als zentral für die Bestimmung der Lebensbedingungen (Facharbeiter, Leitende Angestellte/Höhere Beamte, Meister/Vorarbeiter u.a.) gelten kann, sondern auch Personen, die nicht berufstätig sind (Arbeitslose, Hausfrauen, Studenten, Rentner u.a.) (Statistisches Bundesamt 2002; Statistisches Bundesamt 2006; Statistisches Bundesamt & GESIS-ZUMA 2008; Statistisches Bundesamt, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 2011; Statistisches Bundesamt, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 2013).
Das Konzept sozialer Lagen ist mit klassischen Konzepten und Vorstellungen über die Sozialstruktur einer Gesellschaft wie Klassen- oder Schichtkonzepten verwandt. Im Unterschied zum Konzept sozialer Lagen betonen Klassen- und Schichtkonzepte vor allem die Machtkonstellationen, Konfliktlinien innerhalb der Gesellschaft und sozio-ökonomische Positionen. Sie versuchen die unterschiedlichen Lebensbedingungen der sozialen Gruppen entlang der vertikalen Ungleichheitsdimensionen zu erklären (u.a. Nollmann 2004; Teckenberg 2004; Burzan 2007; Rössel 2005; Rössel 2009; Groß 2008). Soziale Klassen werden vereinfacht als Gruppen mit konträren Interessen definiert, wobei die Unterschiedlichkeit der Interessen in der Ungleichheit der Lebensbedingungen und Machtstellung begründet ist. Die Ungleichheit hinsichtlich der materiellen Lebensbedingungen und Machtverteilung beruht auf der unterschiedlichen Stellung im Produktionsprozess (Hradil 1987, S. 68). Neben den klassischen Klassenkonzepten wie die von Karl Marx (2011) oder Max Weber (1980) existieren weitere moderne Konzepte, die nach dem zweiten Weltkrieg entstanden sind, in denen Sozialforscher die Angleichung der Lebensbedingungen aller sozialen Gruppen als Folge des wachsenden, wirtschaftlichen Wohlstandes propagierten. Zu den prominentesten Vertretern der These der nivellierten Mittelstandsgesellschaft in Deutschland gehörte in den 1960er Jahren Schelsky (1965). In allen Klassenkonzepten ist die ungleiche Verteilung der Ressourcen das wichtigste Zuordnungsmerkmal zu einer bestimmten Klasse. So sind bei Wright und Goldthorpe Produktionsmittel und Qualifikationen die wichtigsten Ressourcen für die Klassenbestimmung einer Person (Rössel 2005, S. 201). Während Wright zusätzlich Organisationsressourcen heranzieht, erweitert Goldthorpe sein Klassenkonzept um die Kategorie der Hierarchiepositionen als eine der zentralen Ressourcen für die Zuordnung zu einer je spezifischen Klasse. Bourdieu unterteilt alle Ressourcen auf drei Arten: ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital. Kreckel hingegen spricht von Vermögen, symbolischem Wissen, Hierarchiepositionen und sozialen Beziehungen als Determinanten der Klassenzuordnung (Rössel 2005, S. 201). Alle modernen Klassenkonzepte vereint, dass sie sich vordergründig in ihren Analysen einer ungleichen Verteilung der Ressourcen widmen, die eine Auswirkung auf die Lebensstile der Menschen haben (Kreckel 2004; Goldthorpe 1987; Goldthorpe 1996; Wright 1985; Wright 1997; Bourdieu 1982).
Eine starke inhaltliche Verwandtschaft mit dem Begriff Klassen hat der Begriff soziale Schicht, mit dem man ebenfalls eine hierarchische vertikale Sozialstruktur bezeichnen kann (Hradil 1987, S.81). In der Ungleichheitsforschung wurde der Begriff Schicht in den 1930er Jahren von Geiger (1955, S. 186, Hervorhebung im Text) eingeführt und wie folgt definiert: „Jede Schicht besteht aus vielen Personen (Familien), die irgendein erkennbares Merkmal gemein haben und als Träger dieses Merkmals einen gewissen Status in der Gesellschaft und im Verhältnis zu anderen Schichten einnehmen. Der Begriff des Status umfasst Lebensstandard, Chancen und Risiken, Glücksmöglichkeiten, aber auch Privilegien und Diskriminationen, Rang und öffentliches Ansehen.“ Allen Schichtungsmodellen ist die zentrale Rolle des Berufes als Zuordnungsmerkmals zur jeweiligen Schicht gemeinsam (Geiger 1955; Geiger 1967; Parsons 1940, Geißler 2002; Bolte, Kappe & Neidhardt 1975; Dahrendorf 1965; Scheuch 1961). Außer dem ausgeübten Beruf werden je nach Modell weitere Faktoren zwecks Schichtzuordnung verwendet wie: Einkommen, Haustyp und Wohngegend (Warner 1963).
Ein alternatives Modell zur gängigen Praxis der Zuordnung der Befragten anhand ihrer sozioökonomischen Ressourcen stellt die Selbsteinstufung der Befragten zu einer Schicht dar, wobei in diesem Fall der Beruf die einzige Zuordnungsgröße zur Schicht ist. In der Studie von Kleining und Moore (1959; 1960; 1968) wurde zunächst eine Berufsprestigeskala durch Befragungen entwickelt, im nächsten Schritt sollten die Personen nur ihren Beruf aufgrund der Ähnlichkeit des eigenen Berufes zu den vorgegebenen Berufsgruppen angeben. Diese Methode nannten die Forscher zwar „Soziales Selbsteinstufungs-Instrument zur Messung sozialer Schichten“ aber letztlich sollten die Befragten nur ihren Beruf als einzigem Merkmal mit ähnlichen Berufen hinsichtlich deren Berufsprestige vergleichen (Kleining & Moore 1968). Auf diese Weise erhielt man nur die Aussagen von Personen über die Ausübung eines Berufes, mit dem ein bestimmtes Berufsprestige verbunden ist. Die Anteile der Personen, die jeweiligen Schichten angehören, ähnelten in diesem Verfahren den Befunden, die anhand anderer gängiger Schichtmodelle ermittelt wurden (z.B. Bolte, Kappe & Neidhardt (1975) und Geiger (1967)).
Ein bedeutender Unterschied zwischen Klassen- und Schichtkonzepten besteht darin, dass die Klassentheorien bzw. Modelle den Anspruch haben soziale Ungleichheit zu erklären (Burzan 2007, S.64). Die Schichttheorien und -Modelle dagegen haben eher ein deskriptives Ziel und suchen nach Zusammenhängen zwischen sozioökonomischen Ressourcen und dem Verhalten der Menschen, ohne sich mit den Ursachen der ungleichen Verteilung der Ressourcen vertiefend zu befassen. Diese Feststellung trifft auch auf das Konzept der sozialen Lagen zu. Es hat nicht zum Ziel, die soziale Ungleichheit zu erklären (Hradil 1987, S. 139). Die funktionalistische Schichtungstheorie sieht sogar die ungleiche Verteilung von Ressourcen als funktional notwendig für das Zusammenleben in der Gesellschaft an (Davis & Moore 1973; Parsons 1940). Die Klassentheorien und -Modelle betonen die Stellung im Produktionsprozess und den Besitz von Produktionsmitteln, was Auswirkungen auf das Bewusstsein der Klassenangehörigen haben soll und ein Konfliktpotential mit sich bringt. Dagegen müssen die Schichten nicht unbedingt in Interessenkonflikte verwickelt sein (Burzan 2007, S. 65). Gemeinsam ist allen Klassen- und Schichtkonzepten, dass sie die Gesellschaft in vertikal angeordnete Gruppen unterteilen, die ungleich mit Ressourcen (vor allem den sozioökonomischen) ausgestattet sind.
Als eine Erweiterung des Konzeptes sozialer Lagen kann das Konzept der sozialen Milieus begriffen werden. Unter dem Begriff soziales Milieu wird ein „Gruppe von Menschen verstanden, die solche äußeren Lebensbedingungen und/oder inneren Haltungen aufweisen, aus denen sich gemeinsame Lebensstile herausbilden“ (Hradil 1987, S. 165). In den klassischen Klassen- oder Schichttheorien wird angenommen, dass der Besitz an sozio-ökonomischen Ressourcen (Geld, Bildung, formale Macht, berufliche Stellung) einen einheitlichen Stellenwert hat und gleiche Effekte für Betroffene erzeugt. Es kann aber nachvollzogen werden, dass beispielsweise Bildungszertifikate einen unterschiedlichen Stellenwert in Abhängigkeit von horizontalen Ungleichheitsfaktoren (Geschlecht, Wohnort, Alter) haben und mit unterschiedlich hohen Chancen versehen sind. Die Bündelung von objektiven Faktoren bzw. sozioökonomischen Ressourcen, horizontalen Ungleichheitsfaktoren und subjektiven Einschätzungen der eigenen Lage führt zur Bildung eines Handlungskontextes. Die milieuspezifischen Haltungen (z.B.: Rolle der Frau, Einstellung gegenüber der Institution Ehe, Stellenwert der sozialen Sicherheit unter Aussteigern oder alternativen Gruppierungen, Stellenwert des Berufsprestiges unter Aufsteigern) wirken auf die Lebensstile der Menschen (Hradil 1987, S. 166f.). Lebensstile „stellen [...] die typischen Verhaltensmuster sozialer Gruppierungen dar, und sind erst durch Abstraktionen (von Seiten der Forscher und der Gesellschaftsmitglieder) vom konkreten Denken und Verhalten zu erschließen“ (Hradil 1987, S. 165). Lebensstile sind nicht nur von Ressourcen abhängig, sondern auch von Moden, Trends und der momentanen Lebensform des Individuums. Der Begriff der Lebensstile ist gewissermaßen eine Erweiterung des Begriffes soziales Milieu. Er umfasst eben nicht nur objektive und subjektive Einschätzungen der eigenen Lebenslage, sondern beschreibt zusätzlich alltagspraktisches Handeln und ein Set von typischen Verhaltensweisen eines Menschen. Mit dem Begriff Lebensstil wir einerseits die Freiheit in der Gestaltung des Alltags betont, andererseits wird aber ein starker Zusammenhang zwischen Lebensstilen und Klassen- bzw. Schichtzugehörigkeit postuliert (Hradil & Spellerberg 2011, S. 61).
Das Konzept der sozialen Milieus kann die klassischen Schicht- und Klassenkonzepte nicht ersetzen, sondern eher um weitere Aspekte der Sozialstruktur erweitern (Endruweit 2000; Eder 2001). Die klassischen Ressourcen wie Geld, Bildung und Beruf sind nach wie vor wichtige Determinanten der Milieuzugehörigkeit und werden in den meisten Milieuanalysen berücksichtigt (Vester 2001; Schulze 1995).
Soziale Milieus können grundsätzlich in zwei Typen unterschieden werden: Mikro- und Makromilieus. Das zentrale Unterscheidungskriterium beider Typen besteht in der Dimension räumlicher Nähe und Distanz. Ein Individuum kann einem Makromilieu angehören, so wie Millionen andere Individuen auch, ohne dabei direkten Kontakt zu anderen Mitgliedern seines Milieus aufzuweisen. Von einem Mikromilieu spricht man dagegen, wenn die Personen nicht nur einen ähnlichen Lebensstil aufweisen, sondern sie in einem unmittelbaren persönlichen Kontakt zueinander stehen (Herlyn 2000, S. 155). Entscheidungen der Individuen können unter der Perspektive des sozialen Raumes betrachtet werden. Nach Bourdieu bildet die soziale Position eine Handlungsstruktur, die sich über den Habitus auf den Lebensstil auswirkt, wobei der Habitus als eine Verinnerlichung der klassenspezifischen Dispositionen zu verstehen ist (Bourdieu 1982; 1983). Bourdieu verbindet in seiner Arbeit ein Klassenmodell mit einer Lebensstilanalyse, womit er eine Sonderstellung innerhalb der Klassentheoretiker einnimmt (Burzan 2007, S. 125; Rössel 2009, S. 315; Groß 2008, S.61). Der Habitus hat nicht nur Auswirkungen auf die Wertvorstellungen der Betroffenen, sondern er beeinflusst auch deren Wahrnehmungen, Denkweise und formt ihren Geschmack. Die im Konzept der sozialen Lage besprochenen Ungleichheitsdimensionen finden sich in Bourdieus Arbeit wieder. Sie werden zu drei Komplexen zusammengefasst: ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital, die insgesamt neben den objektiv feststellbaren Ressourcen (Einkommen, Bildungszertifikate) noch subjektive Einschätzungen der eigenen Lebenslage beinhalten (soziale Netzwerke, Wissen und Fähigkeiten, die in der Familie erworben wurden). Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse (herrschende Klasse, Mittelklasse oder Volksklasse) ist für die Bildung des entsprechenden Habitus bestimmend und der wiederum entscheidet über den Geschmack oder anders formuliert den Lebensstil.
Die Tatsache, dass Bourdieu sich in seinen Arbeiten vor allem auf Klassen, die er aufgrund des Besitzes von drei Kapitalarten bestimmt, konzentriert und mögliche Unterschiede zwischen einzelnen Berufsgruppen vernachlässigt, spricht gegen die Anwendung seiner Theorie in der vorliegender Analyse. Zudem ist die Untersuchung des kulturellen und sozialen Kapitals anhand des Mikrozensus nicht möglich.
Im Hinblick auf die vorliegende Analyse kann die familiäre Situation nicht nur als Merkmal der sozialen Lage, sondern auch als Merkmal der Milieuzugehörigkeit betrachtet werden. Da die vorliegende Untersuchung auf einem Datensatz beruht, in dem nur objektive Merkmale der sozialen Lage erfasst sind, können nur wenige Merkmale der Mikromilieus der Befragten analysiert werden. Zu den bekanntesten Milieu Modellen in Deutschland gehören heute die sozialen Milieus von Vester, SINUS-Modelle von Sociovision und SIGMA – Milieus (Vester 2001; Vester 2006; SINUS 2011; Ueltzhöffer 1999; Ascheberg 2006). Die zwei letztgenannten Modelle wurden von Marktforschungsinstituten konzipiert und in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Das vorrangige Ziel der Eingruppierung der gesamten Bevölkerung in soziale Milieus ist die Untersuchung des Konsumverhaltens, wobei vor allem Industrie- und Dienstleistungsunternehmer zu den wichtigsten Nachfragern der Milieuanalysen zählen. Allen drei Modellen gemein ist die auf zwei Dimensionen fußende Bildung von Gruppen. Auf der ersten Dimension wird die Bevölkerung hinsichtlich ihrer sozioökonomischen Lage, wie dies in den klassischen Schichtkonzepten der Fall ist, eingeteilt und auf der zweiten Dimension wird die Bevölkerung hinsichtlich ihrer Wertorientierungen eingeteilt, was die eigentliche Erweiterung der klassischen Konzepte der Sozialstruktur darstellt. Es wird dabei unterstellt, dass sowohl Werte, Einstellungen als auch Beruf, Bildung und Einkommen handlungsleitend sind. Die Zugehörigkeit zu einem Milieu soll darüber hinaus neben dem Konsumverhalten auch für die Parteipräferenzen, das Wahlverhalten, kulturelle bzw. Freizeitaktivitäten und sogar für Bildungsentscheidungen bestimmend sein. Zugleich können Konsumverhalten, Kleidungsstil und Wohnort als Ausdruck eines Lebensstils und als Distinktionsmittel aufgefasst werden (Felson 1978). In der Bildungsforschung werden die Milieu-Modelle praktisch nicht angewandt. Zu solchen seltenen Studien, gehört die Analyse der Zugehörigkeit der Grundschullehrkräfte zu sozialen Milieus mit Hilfe der SINUS-Milieus von Schumacher (1999; 2000).
Die Untersuchung der sozialen Lage der Lehrkräfte ist dann aussagekräftiger, wenn Vergleichskategorien existieren, mit denen sich die Qualität der Lebensbedingungen der Lehrer und Lehrerinnen mit anderen Gruppen vergleichen lässt. Eine Möglichkeit zur Kriterienbildung für Vergleichskategorien bildet das Berufsprestige. Das Prestige bestimmt über die Verteilung von Anerkennung der Gesellschaftsmitglieder (Esser 1999 S.104). Mit dem Berufsprestige ist die Wertschätzung einer Berufsgruppe gemeint. Es ist zugleich ein subjektives und ein objektives Ungleichheitsmerkmal. Einerseits wird das soziale Ansehen subjektiv erlebt und zugeschrieben, andererseits dient es zur Verortung von Berufsinhabern innerhalb der Gesellschaft und ist eng mit dem sozioökonomischen Status der Individuen verbunden (Wegener 1985). Das Berufsprestige, verstanden als Belohnung, lässt sich einerseits als Ursache für einige Determinanten der sozialen Lage wie z.B. Einkommen verstehen, andererseits kann es als Wirkung begriffen werden. Das Berufsprestige als abhängige Variable lässt sich dann modellieren, wenn das Einkommen mit seinem primären Belohnungscharakter als Ursache für unterschiedlich hohes Berufsprestige aufgefasst wird. Unabhängig davon ob das Berufsprestige als Ursache oder Wirkung modelliert wird, steht es immer in starkem Zusammenhang mit Einkommen und Bildung, so dass die Auswahl der Vergleichsgruppen mit ähnlichem Berufsprestige mit einem gleich hohen Bildungs- und Einkommensniveau einhergeht (Duncan 1961). Unabhängig von der Betrachtungsweise des Stellenwertes des Berufsprestiges für die Analyse der Sozialstruktur ist dieser Begriff von Klassen, Schichten, sozialen Lagen und Milieus schwer zu trennen (Coxon & Jones 1978; Laumann 1966; Matras 1975; Bottomore 1991; Hauser & Warren 1996; Barber 2007).
Neben den Versuchen zur Bestimmung des Berufsprestiges gibt es Versuche den sozialen Status einer Person über Skalen oder Indizes auszudrücken. Der soziale Status, der eine qualitative Bestimmung der Position einer Person anhand ausgewählter Dimensionen der sozialen Ungleichheit bzw. in dem Schichtgefüge einer Gesellschaft bedeutet, lässt sich ebenfalls wie das Berufsprestige einerseits als unabhängige Variable bzw. als Ursache für die soziale Lage ansehen und andererseits als vom ausgeübten Beruf abhängige Größe verstehen. Zwischen dem sozialen Status einer Person, Bildung und Einkommen bestehen ähnlich wie im Falle des Berufsprestiges starke Zusammenhänge (Ganzeboom & Treiman 1996; Ganzeboom, De Graaf & Treiman 1992; Treiman 1977). Der Versuch die Komplexität der sozialen Ungleichheit abzubilden ist dabei insofern problematisch, weil die Skalen und Indizes universalistisch konzipiert sind. Ein gleich hoher Punktewert auf einer Berufsprestigeskala oder auf einem sozioökonomischen Index kann nur schwer die Unterschiede zwischen Staaten oder den Geschlechtern1 abbilden (Magnusson 2009; Schimpl-Neimanns 2004; Hoffmeyer-Zlotnik & Geis 2003; Sawinski & Domański 1991). Das Berufsprestige als Merkmal der Angehörigen einer sozialen Gruppe kann jedoch zur Analyse der sozialen Schließung und Abgrenzung zwischen einzelnen Gruppen herangezogen werden. Da alle soziale Gruppen letztendlich nach Befriedigung der gleichen – vor allem der ökonomischen und wohlfahrtsstaatlichen – Bedürfnisse streben, aber die Ressourcen bzw. die Kontrolle über die Mittel zur Befriedigung zwischen den Gruppen ungleich verteilt sind, führt diese Ungleichheit zu Spannungen und Konflikten zwischen den Gruppen (Esser 1999, S.114). „Die auf diese Weise strukturell erzeugten Spannungen schaffen für typische Gruppen von Akteuren objektive Anreize für ein typisches Anpassungsverhalten zur Schließung der Diskrepanz zwischen dem Interesse an den kulturellen Zielen und der Kontrolle über die institutionalisierten Mittel, die es erlauben, diese Ziele zu verfolgen“ (Esser 1999, S.114, Hervorhebung im Originaltext). Weil in dieser Untersuchung die soziale Schließung nicht primär thematisiert werden soll und davon ausgegangen werden kann, dass die Berufsgruppen mit vergleichbarem Berufsprestige nicht bestrebt sind sich gegeneinander abzugrenzen und keine gravierenden Spannungen zwischen ihnen bestehen, wurde die Entscheidung getroffen, die Gruppen auszuwählen, die ein mit den Lehrkräften vergleichbar hohes Berufsprestige genießen. Als einziger möglicher Aspekt der sozialen Schließung kann das Heiratsverhalten innerhalb der eigenen sozialen Milieus interpretiert werden.
Das Konzept sozialer Lage hat für die Untersuchung der Situation der Berufsgruppen einige Vorteile vorzuweisen. Die Kombination aus mehreren Dimensionen, erlaubt das Zuschneiden der ausgewählten Bestandteile der sozialen Lage auf die jeweilige Fragestellung (Hradil 1987, S. 157). Je nach ausgewähltem Gegenstand der Untersuchung können die einzelnen Dimensionen entsprechend betont bzw. stärker berücksichtigt werden als andere. Im Falle einer Berufsgruppe sind vor allem diejenigen Dimensionen von Relevanz, die mit der Ausübung des Berufes zusammenhängen. Zudem sind die einzelnen Dimensionen und deren Bezug zu allgemein anerkannten Bedürfnissen nicht hierarchisch angeordnet. Die Wichtigkeit von einzelnen Bedürfnissen und Dimensionen wird immer im Zusammenhang mit der Fragestellung und den untersuchten sozialen Gruppen gesehen. Mit Hradil‘s Worten: „Soziale Lagen sind nicht in jedem Falle über- und untereinander anzuordnen. Man sollte sich deshalb von der Denkschablone der Vertikalität freimachen. Sie verstellt die Sicht auf einige Erscheinungsformen sozialer Ungleichheit, die gerade für moderne Gesellschaften bezeichnend sind“ (Hradil 1987, S. 157). Die Flexibilität bei der Auswahl von Dimensionen lässt die Untersuchungen der sozialen Lage an die realen gesellschaftlichen Bedingungen besser anpassen als dies bei der Klassen- und Schichtkonzepten mit ihren starren Kategorien der Zuordnung der Fall ist. „Das Modell sozialer Lagen ist kein lebensfremdes Ordnungsmodell, sondern beruht auf einer Rekonstruktion typischer, weitgehend homogener Handlungssituationen. Es eröffnet damit wesentlich bessere Möglichkeiten, benennbaren Lebenschancen von Personen nahezukommen, als die abstrakte Berücksichtigung von vorhandenen Ressourcen ohne Rücksicht darauf, wie diese zusammenwirken und genutzt werden können“ (Hradil, 1987, S. 157f.). Ähnlich wie die Klassen- und Schichtkonzepte erlaubt das Konzept der sozialen Lagen eine Bewertung der Lebensbedingungen und ein Vergleich zwischen besser und schlechter gestellten sozialen Gruppen. Die einzelnen Gruppen lassen sich ähnlich wie bei Klassen- und Schichtkonzepten in der vertikalen Struktur der Gesellschaft verorten. Im Vergleich zu Klassen-und Schichtkonzepten bleibt die Verortung – aufgrund der Auswahlflexibilität der Dimensionen – nicht starr.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine Trendanalyse zu Ungleichheiten hinsichtlich der Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedigung zwischen Berufsgruppen, sich am sinnvollsten durch den Rückgriff auf das Konzept sozialer Lagen durchführen lässt. Wegen der Betonung der Berufstätigkeit und der Rolle des Berufsprestiges für die Zugehörigkeit zu einer Schicht oder Klasse ist die Verwendung von Klassen oder Schichtkonzepten für einen Vergleich zwischen Berufsgruppen mit ähnlichem Berufsprestige nicht sinnvoll. Die starke Betonung der individuellen Lebensstile in den Konzepten sozialer Milieus, in den Lebensstilkonzepten aber auch in Bourdieus Klassenmodell lassen diese Konzepte für eine Analyse, in der die berufliche Situation im Vordergrund steht, ebenfalls eher nicht geeignet erscheinen. Da die soziale Lage sich immer auf individuelle Ressourcen und Chancen der Bedürfnisbefriedigung bezieht, müssen die familiäre Situation der Befragten, die Lebensform und die Berufstätigkeit der Ehe- bzw. Lebenspartner/-innen als Mittel zur Befriedigung sozialer Bedürfnisse aufgefasst werden. Die Merkmale der Ehe- bzw. Lebenspartner/-innen können aber auch unter dem Begriff der Eingebundenheit in soziale Mikromilieus aufgefasst werden.
1Die Untersuchung von Schimpl-Neimanns (2004) ergab, dass der sozioökonomische Status nicht in der Lage ist, die Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern angemessen abzubilden.
2. Zur Lehrerforschung
2.1. Themen, Designs, Vergleichbarkeit
Im folgenden Abschnitt soll einen Überblick über die Studien zum Lehrerberuf geben, die sich mit Aspekten der sozialen Lage der Lehrerschaft auseinandergesetzt haben. Es gibt in deutschsprachigem Raum eine Reihe von Studien, die sich mit objektiven wie auch subjektiven Aspekten des Lehrerberufes befassen, die aber durch zwei bedeutende Unterschiede zur vorgelegten Analyse gekennzeichnet sind. Zum einen besteht die Untersuchungspopulation in der Regel nur aus Lehrkräften – es existieren keine Vergleichsgruppen – und zum anderen handelt es sich fast ausschließlich um Querschnittsanalysen. Der dritte Unterschied liegt in der Auswahl der behandelten Themen. Die objektiven Aspekte des Lehrerberufes betreffen häufig nicht nur Arbeitsbedingungen, sondern konzentrieren sich auf Spezifika des Lehrerberufes, wie Weiterbildung, Zusammenarbeit im Kollegium oder Entscheidungsautonomie und schließen damit Vergleiche mit anderen Berufsgruppen aus. Die subjektiven Aspekte des Lehrerberufes wie Berufszufriedenheit, psycho-soziale Belastung, Motivation zum Ergreifen des Lehrerberufes besitzen zwar ein Vergleichspotential mit anderen Berufen, das aber in der Regel nicht genutzt wird. Zudem werden häufig die kritischen Aspekte des Berufes (vor allem psychische Belastungen) betont.
Es werden selten Studien durchgeführt, die die Lehrerschaft als Mitglieder von sozialen Milieus (unter dem Aspekt der vorherrschenden Wertehaltungen oder Schließung gegenüber anderen sozialen Gruppen) und deren soziale Lage (darunter Ausstattung mit sozioökonomischen Ressourcen) thematisieren. Die Lehrer und Lehrerinnen werden für die meisten Studien – die in der absoluten Mehrzahl auf Befragungen beruhen – gezielt anhand bestimmter Merkmale ausgesucht, was zur Folge hat, dass die Befunde nicht immer auf die gesamte Lehrerschaft übertragbar sind.
Die relative Homogenität2 hinsichtlich Arbeitsbedingungen der Lehrer und Lehrerinnen im Schulwesen ist eine mögliche Ursache für das Desinteresse an Studien zur sozialen Lage der Lehrkräfte. Eine höhere Heterogenität der Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte, die in der Weiter- und Erwachsenenbildung tätig sind, ist eine mögliche Ursache für größeres Interesse an Untersuchungen zur sozialen Lage dieser Berufsgruppe. Als Beispiel kann die Studie des Instituts zur Wirtschafts- und Sozialforschung (WSF) im Auftrag des BMBF aufgeführt werden, die sich explizit mit der sozialen Lage der Beschäftigten in der Weiter- und Erwachsenenbildung befasst (WSF 2005).
In der vorliegender Analyse wird das Berufsprestige als eine Konstante betrachtet, die sich im Laufe der Zeit nicht ändert. Das Berufsprestige kann somit als Hilfsmittel für die Auswahl von Vergleichsgruppen genutzt werden. Umgangssprachlich wird das Berufsprestige als Einstellung oder Meinung über einen Beruf aufgefasst, das sich im Laufe der Zeit ändern kann. Diese Definition des Berufsprestiges und ein Vergleich zwischen Lehrern und anderen Berufen hinsichtlich des sozialen Ansehens findet in der Studie von Trautwein (2012) seine Anwendung. Er untersucht einige Aspekte der Arbeitsbedingungen im Kontext der Schule, wobei hauptsächlich Meinungen der Lehrer und Eltern der Schulkinder zu den wichtigsten Herausforderungen des Schulsystems abgefragt wurden. Die Lehrer wurden u.a. zu folgenden Themen befragt: Berufszufriedenheit, Belastungen, Motiven der Berufswahl, Umgang mit Eltern der Schüler und zur Qualität der Lehrerausbildung. Die Eltern von Schulkindern gaben Auskunft über Unterrichtsausfälle, Einstellung zu Quereinsteigern, Einstellungen zu leistungsabhängiger Entlohnung und Problemfeldern an Schulen. Das soziale Ansehen des Lehrerberufes wurde anhand der Frage nach dem Beruf mit der meisten Achtung erfragt, wobei neben dem Beruf des Lehrers noch weitere 16 Berufe beurteilt wurden.
Eine Vielzahl der Lehreruntersuchungen wurde kritisch hinsichtlich der Inhalte und angewandten Methoden von Franzinger (1995) analysiert, mit dem Ergebnis: die Lehrerschaft kann in angemessener Weise nur im Rahmen interdisziplinärer und mehrdimensionaler Untersuchungskonzepte erforscht werden, wobei qualitative und quantitative Methoden ergänzend verwendet werden sollen.
In den folgenden Abschnitten sollen die – bezogen auf das Untersuchungsinteresse dieser Arbeit - zentralen Stränge der Lehrerforschung in fünf Gruppen zusammengefasst dargestellt werden. Die Zusammenfassung der einzelnen Forschungsthemen wurde mit dem Ziel einer klaren Abgrenzung bzw. Gemeinsamkeit zur Thematik sozialer Lage gewählt.
2.2. Soziale Milieus und Wertvorstellungen
Die relativ größte konzeptionelle Nähe zur sozialen Lage haben die sozialen Milieus. Wie im Kapitel 1 erläutert wurde, lassen sich die sozialen Milieus als eine Erweiterung des Konzeptes soziale Lage verstehen. In der Forschung werden zudem die Persönlichkeit, die Wertvorstellungen und Einstellungen als Auswirkungen der Eingebundenheit in soziale Milieus angesehen, so dass die Forschung zur Lehrerpersönlichkeit gemeinsam mit der Forschung zu sozialen Milieus behandelt werden kann. Der folgende Überblick über die Studien zu sozialen Milieus und Wertvorstellungen der Lehrkräfte verdeutlich einerseits die Bedeutung der Wertvorstellungen für die Arbeitsweise der Lehrkräfte, andererseits unterstreicht er den Zusammenhang zwischen der sozialen Lage, sozialen Milieus und Wertvorstellungen.
Mit Blick auf die bestehende Fachliteratur kann festgehalten werden, dass die Lehrkräfte viel seltener im Kontext der Einbindung in soziale Milieus und ihrer gesellschaftlichen Verortung untersucht werden, als deren individuelle Situation (Arbeitsbedingungen, Berufszufriedenheit, Gesundheit) im Kontext von Schule. Die Studien, die jedoch die soziale Verortung von Lehrern in den Fokus rücken, behandeln ein breites Spektrum an Themen. Zu diesen Themen gehören: Wertvorstellungen (Breyiuu98uvogel 1984), soziale Herkunft der Lehrer/-innen im Vergleich mit anderen Berufen (Kühne 2006) oder die besondere Situation der Lehrkräfte in der DDR, deren Karrieremöglichkeiten und Motive den Beruf aufzunehmen (Macha-Krau 1990). Wenngleich die Verwendung von Klassenmodellen oder des Konzepts der sozialen Milieus zur Untersuchung einer Berufsgruppe herausforderungsvoll ist, existieren einige Beispiele aus der Forschung. Beispielhaft hierfür sind die Untersuchungen zum Klassenbewusstsein von Lehrkräften (Thien 1976) und zum Zusammenhang zwischen Milieuzugehörigkeit und pädagogischer Orientierung (Schumacher 2002). Leider beschränken sich in vielen Studien die Stichproben auf eine ausgewählte Gruppe von Lehrkräften. Es werden beispielsweise ausschließlich Lehrkräfte an Grundschulen (Schumacher 2002) oder nur Lehrkräfte in den neuen Bundesländern befragt (Macha-Krau 1990).
Einige Studien betonen die Bedeutung der Lehrkräfte für den Lernerfolg der Schüler und haben zu ihrem Gegenstand die Fähigkeiten des Lehrens und die Einstellungen gegenüber den Schülern.
In einer Untersuchung, die alleine wegen ihrer quantitativen Ausmaße beeindruckend ist, von 815 Metastudien, die sich auf über 50.000 einzelne Studien mit insgesamt über 200 Millionen Teilnehmern zusammensetzen, stellte sich Hattie die Frage nach der Bedeutung der einzelnen Faktoren für den Bildungserfolg der Schüler (Hattie 2009). Das Ergebnis der Studie bestand darin, dass der Lernerfolg eines Schülers zu 50 % von dessen Merkmalen, zu 30 % von den Merkmalen des Lehrers und zu 20% auf die restlichen Faktoren wie Peers, Schule oder Schulleitung zurückzuführen sind (Hattie 2003, S.3). Neben den konkreten Handlungsweisen der Lehrer/-innen wie direkte Instruktionen oder formative Evaluation (Beobachtung und Überprüfung des eigenen Handelns) oder Rückmeldungen seitens der Schüler an die Lehrer/-innen gibt es eine Reihe an Merkmalen, die als personale Merkmale zu bezeichnen sind. Diese sind z.B. die Fähigkeit zur ethischen Fürsorge sowie die Fähigkeit den Schülern die eigene Begeisterung am unterrichteten Fach zu vermitteln (Hattie 2009, S. 23f.). Die „Lehrtechnik“, das Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern sind demnach entscheidet für den Lehrerfolg der Schüler, wobei nur ein gewisser Teil der Kompetenzen im Rahmen des Lehramtsstudiums erlernbar sind. Demgemäß besitzen die Lehrerausbildung und das Fachwissen nur einen niedrigen Einfluss auf den Lernerfolg der Schüler. Eine weitaus höhere Bedeutung hingegen erhalten Weiterbildungsmaßen mit dem Ziel der Verbesserung der Lehrqualität. Ein erfolgreicher Lehrer ist nach Hattie (2009, S. 243) eher ein „Aktivator“, der im Gegensatz zu einem Moderator neben einem aktiven Management des Unterrichts, einen großen Wert auf Feedbackschleifen legt, anspruchsvolle Ziele setzt und für Regelklarheit sorgt. Trotz der methodischen Einwände gegen die Hattie Studie, wie z.B. die unterschiedliche Qualität der einbezogenen Studien, die große Zeitspanne zwischen den Studien und der daraus resultierenden bzw. möglichen fehlenden Aktualität, die eingeschränkten Analysemöglichkeiten des Zusammenwirkens der einzelnen Einflussgrößen, kann festgehalten werden, dass der Lehrer und sein Können eine entscheidende Rolle für den Lernerfolg der Schüler haben und ein gewisser Teil der Fertigkeiten der Lehrer nur schwer im Rahmen der Ausbildung erlernbar sind.
Die Untersuchungen über die Verschiedenheit zwischen den Lehrkräften und den Schülern hinsichtlich der Wertvorstellungen sind insofern problematisch, da die Schülerschaft sich in heterogenen sozialen Lagen befindet, wohingegen die Lehrerschaft eine recht homogene Gruppe hinsichtlich der einzelnen Merkmale der sozialen Lage darstellen. Die These von der Mittelschichtsschule besagt, dass die Lehrpersonen, die der Mittelschicht angehören, durch die entsprechende Ausstattung mit kulturellem Kapital Schüler unter richten, die aus unterschiedlichen sozialen Klassen und Milieus stammen, wobei es insbesondere zwischen Lehrern und Angehörigen der unteren Klassen zu Missverständnissen und Konflikten kommt, die letztendlich zu Diskriminierung führen können (Rolff 1997). Zudem wird ein Zusammenhang zwischen Schicht- bzw. Milieuzugehörigkeit und Erziehungsstil gesehen. So haben Merkle, Wippermann und Henry-Huthmacher anhand der SINUS Typologie der sozialen Milieus unterschiedliche Erziehungsstile in den jeweiligen Milieus festgestellt (Merkle, Wippermann & Henry-Huthmacher 2008). Im Jahre 2008 konnten insgesamt 10 soziale Milieus identifiziert werden, die anhand zweier Dimensionen bestimmt wurden: die soziale Lage und die Grundorientierung. Für die zehn Milieus wurden idealtypisch vier Erziehungsstile bestimmt: autoritärer, überbehütender, vernachlässigender (laissez-faire) und permissiver Erziehungsstil. Sie wurden anhand zweier Dimensionen bestimmt: dem Einsatz elterlicher Autorität (hohe versus geringe Lenkung und Kontrolle) und der Berücksichtigung kindlicher Interessen (hohe versus geringe Bedürfnisberücksichtigung). Die Quintessenz der Studie lautet: Es lassen sich für die Milieus vorwiegend typische Erziehungsstile identifizieren.
Anhand der SINUS Milieus hat Schumacher die Grundschullehrkräfte, Referendare und Lehramtsstudierenden typisiert (Schumacher 2000). Sie stellt fest, dass die Grundschullehrkräfte zu zwei Dritteln dem liberal-intellektuellen Milieu zuzuordnen sind. Bei anderen Akademikern gehört etwa jeder vierte diesem Milieu an (Schumacher 2000, S.118f.). In der Gesamtbevölkerung beträgt der Anteil von liberal-intellektuellen in etwa 7 % (SINUS 2011, S. 13). Demnach können die Mitglieder dieses Milieus als aufgeklärte Bildungselite bezeichnet werden. Sie haben eine liberale Grundhaltung, postmaterielle Wurzeln, vielfältige intellektuelle Interessen und wünschen sich vor allem ein selbstbestimmtes Leben (SINUS 2011, S. 16). Die mit der Zugehörigkeit zum Milieu verbundenen Werte und Einstellungen läßt Frage aufkommen: Wie weit werden die eigenen Einstellungen zu Erziehungsstilen in die pädagogische Praxis an Schulen hineintransportiert? Folgt man dem Fazit aus der Studie von Schneider (1999, S. 40), lautet die Antwort auf diese Frage: die Lehrkräfte sind gezwungen mit den Widersprüchen zwischen den eigenen Wertvorstellungen und den Notwendigkeiten der Schulpraxis leben zu müssen. Schneider (1996, S. 39) zeigt weiter, dass gerade Grundschullehrer/-innen häufig in ihrer Praxis zu autoritären Erziehungsmethoden greifen und die pädagogische Arbeit auf eine reine Wissensvermittlung reduzieren, was konträr zu den liberalen Wertvorstellungen steht, zu denen sie sich bekennen. Der Befund, dass die Lehrer nicht das ihrem sozialen Milieu entsprechende





























