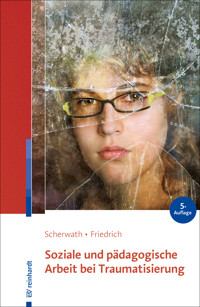
32,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ernst Reinhardt Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Thema "Traumatisierung" gehört in vielen sozialen und pädagogischen Arbeitsfeldern untrennbar zum Alltag. Nicht immer besteht dabei ausreichend Handlungssicherheit. Dieses Überblickswerk zeigt, wie pädagogische Fachkräfte stabilisierend und ressourcenorientiert mit traumatisierten Menschen arbeiten können. Erkenntnisse aus Trauma-, Hirn- und Bindungsforschung machen die Entstehung von Traumafolgen verständlich - sowohl nach Extremsituationen wie Gewalterfahrungen oder Flucht, als auch bei anhaltenden Bindungs- oder Entwicklungstraumatisierungen. Neben Symptomen, Risiko- und Schutzfaktoren, Handlungsleitlinien, Methoden und konkreten Verhaltenstipps behandelt das Buch auch das Thema Selbstschutz für Helfende.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Corinna Scherwath • Sibylle Friedrich
Soziale und pädagogische Arbeit bei Traumatisierung
Mit 5 Abbildungen und 7 Tabellen
5. überarbeitete Auflage
Ernst Reinhardt Verlag München
Corinna Scherwath, Dipl.-Sozialpädagogin, Kinder/Jugendsozialtherapeutin, Fachberaterin für Psychotraumatologie und Traumapädagogik, freiberuflich als Fortbildnerin tätig, leitet das Institut für verstehensorientierte Pädagogik (IversoPaed) in Hamburg: www.verstehensorientierte-paedagogik.de
Dr. Sibylle Friedrich, Dipl.-Psychologin, ist Psychologische Psychotherapeutin und psychologische Beraterin in eigener Praxis, unter anderem in Kooperation mit dem Jugendamt (Adoption und Pflegschaft). Als freiberufliche Dozentin für Traumapädagogik im Bildungsbereich tätig.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-497-03303-4 (Print)
ISBN 978-3-497-61957-3 (PDF-E-Book)
ISBN 978-3-497-61958-0 (EPUB)
5., überarbeitete Auflage
© 2025 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Verlag Ernst Reinhardt GmbH & Co KG behält sich eine Nutzung seiner Inhalte für Text- und Data-Mining i.S.v. § 44b UrhG einschließlich Einspeisung/Nutzung in KI-Systemen ausdrücklich vor.
Dieses Werk kann Hinweise/Links zu externen Websites Dritter enthalten, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Ohne konkrete Hinweise auf eine Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch entsprechende Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich entfernt.
Printed in EU
Cover unter Verwendung einer Fotografie von © fotofrank / Fotolia.com
Satz: ew print & medien service GmbH
Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, Kemnatenstr. 46, D-80639 München
Net: www.reinhardt-verlag.de E-Mail: [email protected]
Inhalt
Vorwort zur 5. Auflage
Einleitung
1Was ist ein Trauma?
1.1Psychobiologische Reaktionen auf ein Trauma
Die traumatische Zange
Traumatisierung aus der Perspektive des Nervensystems
1.2Symptombildung als Traumafolge
Posttraumatische Belastungsstörungen
Entwicklungsverzögerungen als Folge traumatischer Erschütterungen
Instabile Bindungsentwicklung als traumabasierte Folgeerscheinungen
Schuld- und Schamgefühle
Dissoziative Phänomene
1.3Traumaspezifisches Symptomverstehen
1.4Biografische Erkundungen
Traumatische Situationsfaktoren
Diskriminierungserfahrungen
1.5Risiko- und Schutzfaktoren
Risikofaktoren und Vulnerabilitäten
Schutzfaktoren
2Leitlinien traumabezogener Interventionen im sozialpädagogischen Alltag
2.1„Erst verstehen – dann handeln“ (P. Moor)
Das Konzept des guten Grundes
Traumapädagogische Navigation in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern
2.2Safety First – pädagogische Orte als sichere Orte
2.3Die Fachkraft als sicherer Hafen – Bindungsorientierung in der Traumapädagogik
Die Pädagogin als primäre Bindungsperson und fürsorgliches Introjekt
Personale Kompetenzen und Voraussetzungen für bindungsorientierte Pädagogik
2.4Stabilisierung und Ressourcenorientierung
Konsequente Ressourcenorientierung in der Praxis
Pädagogische Schatzsuche auf der Insel der Persönlichkeit
Die Schatzkarte des pädagogischen Alltags
2.5Arbeit mit dem Trauma
Psychoedukation
Enttabuisierung
Traumasensible Biografiearbeit
2.6Das multidimensionale Selbst – Ego-States und Innere Teams
Es ist normal, verschieden zu sein
Traumapädagogische Ego-State-Arbeit
2.7Traumabasierte Störungen der Affekt- und Impulskontrolle
Präventive Entschärfungsmaßnahmen
Stressbarometer / Stressskala
Katastrophenschutz – Strategien zur Distanzierung und Selbstberuhigung
Skills, Notfallliste und Notfallkoffer
KatastrophenhelferInnen – Unterstützung bei Reorientierung und Stressregulation (Handwerkszeug für Helfende)
2.8Erste Hilfe bei Akuttrauma
Schockphase
Stressmanagement in den ersten 4–6 Wochen
2.9Psychotherapeutische Hilfen
Trauma-fokussierte kognitiv-behaviorale Therapie (TF-KBT)
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Narrative Expositionstherapie für Kinder (KIDNET)
Traumazentrierte Spieltherapie
Psychodynamisch Imaginative Traumatherapie (PITT)
Die Evidenz (Wirksamkeit) der Verfahren
Neue Entwicklungen
Körper- und Bindungsorientierte Therapieverfahren
Pharmakotherapie und stationäre Traumabehandlung
3Stabilisierung und Selbstfürsorge im Helfersystem als Schutz vor Sekundärer Traumatisierung
3.1Das Vorkommen Sekundärer Traumatisierung in der Kinder- und Jugendhilfe
3.2Selbstfürsorge als Schutzfaktor
Übungen zum Schutz vor überflutenden Emotionen
Übungen zur Genussfähigkeit
Übungen zur Selbstannahme
Übungen zum Selbstwirksamkeitserleben
3.3Psychohygiene im Team
Schlussbetrachtungen
Anhang
Literatur
Sachregister
Hinweise zur Verwendung der Icons
Informationsquellen print und online
Beispiel
Übung
Vorwort zur 5. Auflage
Zwölf Jahre sind seit der Veröffentlichung der ersten Ausgabe unseres Buches vergangen. Seitdem hat sich viel bewegt. Das Thema Traumapädagogik hat in der pädagogischen Fachwelt in diesen Jahren zunehmend an Aufmerksamkeit gewonnen. Mehr pädagogische Fachkräfte haben sich im Bereich Psychotraumatologie weitergebildet und immer wieder hören wir, wie sehr der traumasensible Blick ihnen geholfen hat, Interaktion und Hilfeprozesse zufriedenstellender zu gestalten. Traumapädagogisches Handeln ist vor allem am Verstehen orientiert. Es geht in der Hilfeplanung nicht darum, Verhalten von Menschen in den Griff zu bekommen und gegen Symptome zu arbeiten. Vielmehr möchte Traumapädagogik Beziehungen gestalten, in denen Menschen sich wertgeschätzt, angenommen und unterstützt fühlen. Dieser Zugang hat sich in der Arbeit mit betroffenen Menschen als sehr effektiv erwiesen. Vielfach beschreiben Fachkräfte, wie viele positive Entwicklungen sie gerade auch in Fallkonstellationen wahrnehmen, die zuvor von ihnen als „schwierig“ erlebt wurden.
Trotz der großen Erfolge und einer daraus resultierenden höheren Arbeitszufriedenheit, die traumapädagogisch geschulte Fachkräften zum Ausdruck bringen, tut sich das pädagogische Arbeitsfeld insgesamt schwer, sich von traditionellen pädagogischen Sichtweisen und Handlungsroutinen zu lösen. Besorgniserregend ist, dass allen fortschrittlichen Erkenntnissen aus Fachtheorie und Praxis zum Trotz, gegenwärtig in vielen Institutionen autoritäre Formen der Beziehungsgestaltung wieder Aufwind erhalten. In vielen Kitas und Schulen dominieren in zunehmendem Maße wieder Straf- und Manipulationssysteme (Time-out, Kollektivstrafen für Gruppen bei vermeintlichem Fehlverhalten eines Kindes, systematische Strafarbeiten wie Abschreiben von Hausregeln, Entzug von Vergünstigungen, Klassifizierungssysteme wie Verhaltensampeln etc.). Und auch in der Jugendhilfe wird der Ruf nach disziplinarischen Maßnahmen und verengten Regelwerken wieder stärker. Eine fordernde Haltung statt bedingungsloser Unterstützung dominiert oftmals die Atmosphäre im gesamten Helfersystem. Wie oft in ihrer Geschichte stellt sich Pädagogik damit in den Wind gesellschaftspolitscher Tendenzen, statt ihnen – aus professionellem Sachverstand heraus – etwas entgegenzusetzen. Der Zusammenbruch vom Liberalismus in der Welt, wie wir ihn gegenwärtig überall erleben, das Erstarken von autoritär agierenden politischen Führungspersönlichkeiten und das Konzept einer Leistungsgesellschaft, in der es nicht um das Individuum, sondern um seine Funktionalität geht, scheint sich – teils unreflektiert, teils gewollt – im pädagogischen Anspruch und in Umgangsformen oft Bahn zu brechen. Traumapädagogisch arbeitende Fachkräfte erhalten für ihre konsequent reformpädagogischen und humanistischen Zugänge dadurch wieder viel Gegenwind. Während sich die Interaktion zwischen Fachkräften und den von Ihnen begleiteten Menschen spürbar verbessert, wird der pädagogische Diskurs vielerorts intensiver. Viele KollegInnen beschreiben, wie viel Kraft es sie kostet, Kurs zu halten, und betrauern, dass es so wenig gemeinsames professionelles Selbstverständnis gibt. In dieser Darstellung verdeutlicht sich, dass Traumapädagogik mehr ist, als ein paar zusätzliche Methoden, die sich in einer alten Tradition zurecht finden können. Traumapädagogik findet statt in dem Bewusstsein, dass ein Großteil aller Traumatisierungen im Kontext von Macht und Machtmissbrauch entstanden sind. Traumatisierte Menschen haben die Erfahrung gemacht, dass sie zum Objekt von Menschen und Umständen wurden. Ihre Bedürfnisse und Grenzen wurden darin nicht gewahrt, sondern verletzt. Sie waren ihrer Würde und Handlungsfähigkeit beraubt. Davon ausgehend, dass eben diese Erfahrungen dem traumabasierten Verhalten zugrunde liegen, versteht sich Traumapädagogik als ein kompensatorischer Erfahrungsraum, in dem betroffene Menschen gegenteilige Erfahrungen machen können. Somit verbieten sich alle Maßnahmen, die den anderen dazu zwingen, seine persönliche Integrität unterzuordnen. Traditionelle pädagogische Maßnahmen versuchen über Angst oder Belohnung das Gegenüber an ein System anzupassen. In diesem Konzept wird das Privileg des Stärkeren in asymmetrischen Beziehungen – wie sie zwischen Erwachsenen und Kindern ebenso wie zwischen Fachkräften und Hilfeempfängern zwangsläufig existieren – ausgenutzt. Für biografisch traumatisierte Menschen bestätigen sich dadurch ihre Erfahrungen, dass sie in dieser Welt unterworfen sind. Gleichfalls werden sie darin bestärkt, dass es richtig ist, Macht auszuüben, um Kontrolle zu gewinnen. Auf diese Weise unterstützt Pädagogik die transgenerative Weitergabe von Traumamustern. Die durch derartige Maßnahmen erlittene Ohnmacht wird danach streben, selbst auf der Seite der Mächtigen zu stehen. Die unterdrückte Wut, die in Menschen entsteht, wenn sie nicht gehört und nicht beteiligt werden, macht diese krank oder feindselig. Das darin wirkende mangelnde Mitgefühl sorgt für emotionale Taubheit sich selbst und anderen gegenüber.
Traumapädagogisches Handeln ist also mehr als ein individueller Handlungsansatz und bezieht sich nicht nur auf die „Vorgeschichten“ der Menschen. Es fordert hingegen dazu auf, sich mit struktureller Gewalt und Machtmissbrauch auch im eigenen Feld auseinanderzusetzen. Das Bürgerliche Gesetzbuch sieht seit Januar 2001 in § 1631 Abs. 2 BGB vor, dass Kinder ein Recht auf gewaltfreie Erziehung haben. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Behandlungen sind danach unzulässig. Ein zentrales Anliegen traumasensibler Pädagogik ist es, dieses Recht für Kinder sicherzustellen und (sozial-)pädagogische Maßnahmen grundsätzlich dahingehend zu überprüfen, ob die Würde eines Menschen (Art. 1 GG) – ganz gleich wie alt er ist, welchen Hintergrund er mitbringt und welches Verhalten er zeigt – darin berücksichtigt wird.
Diese Auseinandersetzung ist unbequem, weil sie die Akteure im Feld auffordert, Traumatisierung im Sinne einer gravierenden Verletzung der Menschenwürde nicht außerhalb des eigenen Handlungsrahmens zu betrachten, sondern sich mitverantwortlich zu fühlen – dafür dass pädagogische Orte wirklich „sichere Orte“ sind, an denen Kinder, Jugendliche und Erwachsene geschützt vor Machtmissbrauch und jedweder Form von Gewalt sind, Erfahrungsräume also, in denen sie die Integrität ihrer Persönlichkeit gewahrt fühlen, bedingungslose Teilhabe und eine gleichwürdige Behandlung erleben. Dieses ist die Voraussetzung dafür, dass Pädagogik nicht selbst zum Verursacher von Traumatisierung wird bzw. bestehende biografische Verwundungen nicht weiter vertieft und die Folgen verschärft werden.
Pädagogik wird mit darüber entscheiden, wie sich Gesellschaften entwickeln. Wenn es gelingt, durch gute Beziehungen das Menschliche im Menschen zu bewahren oder zu regenerieren, dann ist dieses ein wichtiger Beitrag für eine friedvollere Welt. „Die Kindheit ist politisch“ heißt das Werk von Sven Fuchs (2019), in dem er ebenso wie Herbert Renz Polster in seinem Buch „Erziehung prägt Gesinnung“ (2019) deutlich macht, wie pädagogisches Handeln Einfluss auf das soziale Miteinander in der Welt nimmt.
Wir hoffen, dass dieses Buch weiterhin dazu beitragen kann, dass all die vielen praktisch Tätigen, denen eine humanistisch ausgerichtete Pädagogik am Herzen liegt, sich bestätigt und ermutigt fühlen, diesen Weg – auch gegen Widerstände – weiterzugehen.
Februar 2025 Corinna Scherwath und Sibylle Friedrich
Einleitung
Noch ein Buch zum Thema Trauma! Fast inflationär erscheinen seit Mitte 2000 Veröffentlichungen und Berichterstattungen, die sich dem Verständnis von Trauma und seinen Folgen widmen. Ist Trauma also ein Modethema? Eine moderne Diagnose? Ein neues Label für längst bekannte Phänomene?
Aus unserer Perspektive hat die erhöhte Aufmerksamkeit, die dieses Thema erlangt hat, vielfältige Ursachen, die wir an dieser Stelle nur ausschnittsweise beleuchten werden. Eine davon ist sicher, dass wissenschaftliche Erkenntnisse aus den Bereichen der Neurobiologie, der Bindungsforschung und der Psychotraumatologie einen neuen Blick auf alte Phänomene ermöglicht haben. Parallel dazu kam es im klinischen Bereich Anfang der 1990er Jahre – ausgelöst durch die Nervenärztin und Psychoanalytikerin Luise Reddemann – zu einer Aufbruchsbewegung einiger PsychiaterInnen und PsychotherapeutInnen, die zunehmend bereit waren, real erlebten Traumata eine zentrale Bedeutung bei der Entstehung schwerer Störungsbilder einzuräumen. Diesbezüglich kam es auch zu einer kritischen Auseinandersetzung mit etablierten Therapiekonzepten. Diese verdeutlichte, dass viele herkömmliche psychotherapeutische Behandlungsmethoden bei traumatisierten Menschen eher kontraindiziert denn hilfreich waren. Hieraus entwickelte sich ein Paradigmenwechsel in der Arbeit mit Menschen, die unter komplexen psychischen und psychosomatischen Symptomen litten, der seinerseits für vielfältige Veränderungen in einigen Bereichen medizinisch-therapeutischen Denkens und Handelns sorgte: Auf den Handlungsebenen rückten stabilisierende und ressourcenorientierte psychotherapeutische Ansätze in den Vordergrund. Sie stellten bisherige Vorgehensweisen, die zum Beispiel das konfrontative Durcharbeiten eines Traumas zur Bedingung für Heilungsprozesse machten, fortan in einen kritischen Diskurs.
Zum anderen kam es zu einem neuen Symptomverständnis: Psychische Störungsbilder wie Ängste, Depressionen oder Anpassungs- und Bindungsstörungen wurden neu ausgewertet und nicht länger ausschließlich als Ausdruck und Folge neurotischer Fehlentwicklung interpretiert, sondern real traumatischen Hintergrunderfahrungen zugeordnet. Dies löste einen wichtigen Haltungswechsel gegenüber Mensch und Symptomatik aus. „Traumatisiert worden zu sein ist keine Störung oder Krankheit“, schreibt Michaela Huber in ihrem Standardwerk ‚Trauma und die Folgen‘ (2009, 111).
Neurobiologische Erkenntnisse über neuronale Prozesse und Veränderungen in den Hirnstrukturen während und nach einem Trauma verdeutlichten, dass Symptome nicht pathologisch zu interpretieren sind, sondern im Sinne dessen, wie der Mensch konstruiert ist, eine ganz normale Reaktion – auf ein unnormales Ereignis – abbilden.
In diesem Sinne wäre die Begrifflichkeit traumatisiert zwar tatsächlich ein neues Label. Dies impliziert aber in der Interpretation eines modernen Traumaverständnisses eine Pathologisierung des Ereignisses und nicht des Menschen. Dennoch ist es sicher notwendig, den Prozess aufmerksam zu verfolgen und in achtsamer Haltung zu bleiben, damit die Zuschreibung traumatisiert nicht zur Stigmatisierung und Etikettierung von Menschen beiträgt. Gerade die sozialpädagogische Arbeit mit ihrer historisch-kritischen Haltung gegenüber Schubladendenken und Diagnostik als Herrschaftsinstrument ist sicher aufgefordert, sich kritisch mit der Begrifflichkeit auseinanderzusetzen und sich gegen jede Form der Vereinfachung und Typisierung aufzulehnen. Bei aller modernen Erkenntnis: Den traumatisierten Menschen gibt es nicht. Es bleibt die grundlegende Aufgabe, in respektvoller Haltung der Einmaligkeit jeder Biografie gegenüber zu bleiben und zu überprüfen, ob und welche der definierten traumaorientierten Handlungsansätze für einen Menschen hilfreich sind.
Es stellt sich dennoch noch einmal die Frage, warum überhaupt speziell ein Buch über Trauma für den sozialpädagogischen Bereich gebraucht wird. Effektiv wurde das Trauma-Thema lange in pädagogischen Arbeitsfeldern ausgeklammert und zum „Hoheitsgebiet psychologisch-therapeutischer Wirkungsfelder“ (Scherwath 2011, 47) erklärt. Die Zahlen dazu, wie viele Menschen im Laufe ihres Lebens im Sinne eines erweiterten Traumaverständnisses (→Kap. 2) von Traumatisierungen betroffen sind, schwanken zwischen 30% und 60%. Nur ca. ein Drittel dieser Betroffenen entwickelt langfristige und komplexe Folgestörungen (Huber 2009). Neben der hohen Verletzlichkeit, die der Mensch gegenüber traumatischen Ereignissen mitbringt, ist er offensichtlich zugleich mit guten Selbstheilungs- und Selbstaktualisierungspotenzialen ausgestattet. Die Frage jedoch, ob diese sich gegen die Wucht der Belastung aufrichten können, steht in Abhängigkeit zu den jeweiligen persönlichen und sozialen Schutzfaktoren und resilienten Kräften, die ihm zur Verfügung stehen.
Ob ein Trauma überwunden werden kann, ist abhängig von vielfältigen Risiko- und Schutzfaktoren und ihren Wechselwirkungen. Gerade Adressaten sozialpädagogischer Hilfen weisen häufig lebensgeschichtlich ein hohes Maß an Risikofaktoren bei vergleichsweise geringen schützenden Einflüssen auf. Somit kann die Anzahl traumatisierter Menschen in sozialpädagogischen und therapeutischen Kontexten deutlich höher eingeschätzt werden als im Bevölkerungsdurchschnitt. Vielfältige Auffälligkeiten, Symptome und Hilfeanlässe im Arbeitsfeld können entsprechend als traumabasiert interpretiert werden.
Traumatisierung macht also nicht Halt vor der Tür pädagogischer Arbeitsfelder. Ihre Folgen sind allgegenwärtig und gehören zum biografischen Gepäck der jeweiligen Menschen. Trauma als Thema aus sozialpädagogischer Zuständigkeit auszuklammern, erscheint entsprechend paradox. Traumatisierungen sind Teil von Lebensgeschichten, ihre Folgesymptomatiken an sich nicht krank. Sie bedeuten zunächst vor allem für die betroffene Person eine massive Einschränkung ihrer emotionalen Lebensqualität und bringen gleichermaßen eine Menge Folgeschwierigkeiten für das soziale Miteinander mit sich. Die sozialpädagogische Praxis kann hier also ihre Kernkompetenz wahrnehmen und dafür sorgen, dass auch aus und unter schwierigen Bedingungen stabile Entwicklungen möglich werden. Es geht dabei nicht um eine Therapeutisierung von Sozialpädagogik, ebenso wenig wie um Heilung in heilkundlichem Sinne. Sozialpädagogik hat ihr Wirkungsfeld häufig dort, wo es zunächst um Begleitung von Entwicklungen und Verbesserung von Lebensumständen geht. Beides kann heilsame Prozesse auslösen. Schützende, stabilisierende, nährende und stärkende Ansätze, wie sie allen sozialpädagogischen Interventionsformen zugrunde liegen, können dabei zur Linderung von biografischem Schmerz und zu persönlichem Wachstum beitragen. Nährböden zu schaffen, von denen gute Entwicklungen ausgehen können, ist seit jeher eine wichtige Aufgabe der Pädagogik. Menschen in ihrer Selbstbemächtigung und Selbstkompetenz zu stärken, ist Auftrag einer lebensweltorientierten Sozialen Arbeit.
„Umgang mit Traumatisierung an der Schnittstelle zwischen Psychologie, Pädagogik und Sozialer Arbeit“ hieß die 3. Sommeruni in Hamburg im Sommer 2010. Eines der zentralen Anliegen dieser Veranstaltung und des daraus erwachsenen Sammelbandes (Friedrich 2011) war es aufzuzeigen, wie wichtig es ist, dass jede Profession ihre jeweils spezifischen Kompetenzen zur Linderung traumainduzierter Not und zur Verbesserung von Bedingungen beiträgt. Für die Betroffenen kann dieser Prozess nur dann hilfreich gestaltet werden, wenn sich die verschiedenen Fachdisziplinen nicht gegeneinander abgrenzen, sondern ihre Erkenntnisse, Ansätze und Ressourcen füreinander nutzbar machen. So kann sozialpädagogische Arbeit durch sichere Orte und ressourcenvolle Stabilisierungsarbeit dazu beitragen, dass Grundlagen für weiterführende psychotherapeutische Behandlungsprozesse geschafft werden.
Auch kann sie gerade dort wirksam werden, wo aufgrund der bestehenden gegenwärtigen Mangellage nicht ausreichend ambulante und stationäre Plätze für traumaspezifische Therapien zur Verfügung stehen. Zudem befinden sich in den sozialpädagogischen Hilfen, aber auch in den Betreuungseinrichtungen viele Menschen mit frühen und komplexen Traumatisierungen, die auch aktuell noch unter irreversiblen belastenden psychischen, körperlichen oder sozialen Bedingungen zu leiden haben. Hier ist meist eine psychotherapeutische Behandlung im Sinne konfrontierender Interventionen nicht sinnvoll, da keine ausreichende äußere Sicherheit hergestellt ist und die Belastung somit zu hoch sein könnte. Erschwerend kommt hinzu, dass Kliniken und TherapeutInnen auf die Multidimensionalität der Problematik (zum Beispiel körperliche und geistige Formen der Behinderung) meist nicht ausreichend eingestellt sind. Eben hier kann und muss die sozialpädagogische Praxis ihre Verantwortung wahrnehmen. Sie braucht dazu aber ihrerseits die beratende oder medizinische Unterstützung von psychiatrisch versierten und psychotherapeutisch geschulten FachkollegInnen. Es geht also darum, Brücken zwischen den Professionen aufzubauen (Friedrich 2011), ohne sie in ihrer jeweiligen Souveränität zu beschränken.
Traumapädagogik ist ohne diesen fließenden interdisziplinären Übergang letztlich nicht denkbar. Die Grundlagen traumapädagogischer Ansätze beziehen einen Teil ihres Wissens aus psychologisch-psychiatrischen Handlungsfeldern. Aufgabe der Traumapädagogik bleibt es dabei, den Teil zu adaptieren, der hilfreiche Erkenntnisse auch für das eigene Arbeitsfeld bietet und dort zu modifizieren und eigene Positionen zu entwickeln, wo Ausgangslagen und professionelles Selbstverständnis eigenes Handeln erfordern.
Analog zu den klinisch-therapeutischen Erfahrungen erleben auch pädagogische Fachkräfte vielfältige Hilfe- und/oder Betreuungsprozesse, in denen bewährtes pädagogisches Handwerkszeug nicht ausreichend erscheint, um zur Verbesserung prekärer Ausgangslagen beizutragen: Hilfepläne scheitern, Menschen werden im Hilfesystem hin- und hergereicht, häufige Beziehungsabbrüche und zunehmende Verschlechterungen von Symptomatiken können Hinweise darauf sein, dass andere Zugänge notwendig sind. Praktische Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass für Menschen mit traumabasierten Symptomatiken nicht nur veränderte psychotherapeutische Zugänge notwendig waren, sondern auch ebenso neue pädagogische Pfade eingeschlagen werden mussten, um eben diejenigen zu erreichen, die allzu oft durch die Maschen des Hilfesystems fallen, weil sie scheinbar nicht tragbar oder hilferesistent sind. „Wenn etwas nicht geht, tue etwas anderes“ ist ein systemischer Grundsatz. In diesem Sinne sollte die sozialpädagogische Arbeit zunächst ihre Konzepte überprüfen und in ihnen ein Maß an Flexibilität herstellen, das dem jeweiligen Subjekt gerecht wird.
Traumapädagogik bemüht sich um subjektorientierte Zugänge in radikaler Akzeptanz individueller Entwicklungslogiken. Sie arbeitet im transparenten Dialog mit den betroffenen Menschen. Gerade im Zusammenhang mit Traumatisierungen gewinnt das Verständnis von Sozialer Arbeit als Menschenrechtsprofession (Staub-Bernasconi 2003) an besonderer Bedeutung. Das Wiederherstellen von Würde durch Wertschätzung, Verständnis und Wahrung von Rechten ist dabei ein zentrales Ziel. Wenn wir traumapädagogische Seminare geben, äußern sich KollegInnen häufig, in dem sie sagen: „Das, was wir hier lernen, müsste das nicht im Grunde Orientierung und Grundlage aller sozialpädagogischen Arbeit sein?“ Was stimmt, ist, dass alle Ansätze und Haltungen der Traumapädagogik letztlich im Kern geeignet sind, um gute Beziehungen zu Menschen zu gestalten und damit tragfähige Grundlagen für Entwicklungs- und Veränderungsprozesse zu schaffen. So gesehen können zwar einige herkömmliche pädagogische Konzepte schädlich auf Menschen mit Traumatisierungen wirken; traumapädagogische Konzepte hingegen bringen Impulse mit sich, die auch Anregung für die sozialpädagogische Basisarbeit beinhalten.
In dem vorliegenden Buch wollen wir zum einen den Fachstand aus dem Bereich der Psychotraumatologie in komprimierter und für pädagogische Arbeitsfelder angemessener Art und Weise zusammenfassen. Zum anderen reflektiert und beschreibt es dialogische Praxiserfahrungen aus der traumapädagogischen Beratungsarbeit sowie der supervisorischen und lehrenden Tätigkeit von Corinna Scherwath. Hieraus erklären sich – trotz grundsätzlicher Doppelautorinnenschaft – die zeitweiligen Ich-Formulierungen im Buch. Mit ihnen versuchen wir auch kenntlich zu machen, dass Wissen nur bedingt objektivierbar ist und dass das Sich-in-Beziehung-zu-Menschen-und-Prozessen-Setzen eine wichtige Grundhaltung traumaorientierter Arbeit ist. Alle dargelegten Praxisbeispiele enthalten persönliche Momente, sind dabei aber insoweit verändert, als damit die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen bewahrt bleiben. Sibylle Friedrich hat die Entstehung des gesamten Buches als Co-Autorin eng begleitet. Darüber hinaus hat sie es durch ihre wissenschaftlichen Forschungen und spezifischen Fachkompetenzen um die Kapitel zu den Themenkomplexen Selbstfürsorge und Psychotherapeutische Hilfen ergänzt und bereichert.
Sozialpädagogische Arbeit findet immer in einem hoch sensiblen Feld statt. Menschen können durch sie ebenso geschützt wie verletzt werden. Es braucht ein Bewusstsein dafür, dass auch pädagogische Fachkräfte zum Risikofaktor werden können, wenn ihr Handeln nicht ausreichend reflektiert und fachlich fundiert gesteuert wird. Gerade in der Auseinandersetzung mit dem Thema Traumatisierung ist es Teil einer unangenehmen Wahrheit, dass auch innerhalb des Arbeitsfeldes Menschen von direkten Traumatisierungen, und Retraumatisierungen betroffen sind. Die Hintergründe hierfür sind vielfältig: Sie entstehen aus persönlich unverarbeitetem lebensgeschichtlichen Material von Helfenden, struktureller und persönlicher Hilflosigkeit, aber auch aus Unwissenheit und unangemessenen Deutungsmustern. Sich der Verantwortung diesbezüglich bewusst zu sein, impliziert, die eigene Arbeit als einen stetigen professionellen Reflexionsprozess zu betrachten.
Burkhardt Müller beschreibt Professionalität in sozialpädagogischen Handlungsfeldern als Dreiklang, bestehend aus Fachwissen, Handlungsgeschick und Selbstreflexion (Müller 2010). Diesen Aspekten versuchen wir in der Aufteilung des Buches gerecht zu werden und somit einen Beitrag zur Professionalisierung unter traumapädagogischen Gesichtspunkten zu leisten. Das erste Kapitel dient der Erweiterung von Fachwissen und soll einen Einblick ins Traumaverstehen geben. Der größte Teil des Buches sind die Leitlinien des Kapitels 2, deren Anliegen es ist, das Handlungsgeschick im Umgang mit traumatisierten Menschen zu erhöhen. Im Kapitel 3 geht es um den Selbstfürsorgeaspekt, der zugleich auch noch einmal auf die Bedeutung selbstreflektorischer Aspekte in der traumapädagogischen Arbeit hinweist. Im abschließenden Teil des Buches werden neben den vorab dargestellten Handlungsleitlinien einige gesellschaftspolitische Aspekte zum Thema benannt und notwendige Voraussetzungen formuliert, die grundlegend sind, um die in diesem Buch formulierten Leitlinien umzusetzen.
Eine besondere Herausforderung beim Schreiben dieses Buches war es, dem breiten Spektrum des sozialpädagogischen Arbeitsfeldes gerecht zu werden. Während viele Erstveröffentlichungen zu Traumapädagogik sich vor allem auf Kinder- und Jugendliche konzentrierten, war es uns ein Anliegen, ein Buch zu schreiben, das letztlich allen pädagogischen Fachleuten aus Kita, Schule, Jugendwohnungen, ambulanten Hilfen, Beratungsstellen, ebenso wie aus der Behindertenhilfe, der Arbeit mit Geflüchteten, mit psychisch erkrankten Menschen und Pflegefamilien gleichfalls Anregungen gibt. Entsprechend steht der Ausdruck sozialpädagogisches Arbeitsfeld ebenso wie pädagogische Fachkraft synonym für die gesamte Bandbreite pädagogischer und sozialer Handlungsfelder. Wir haben uns bemüht, dieser Vielschichtigkeit durch verschiedene Beispiele und der Darstellung unterschiedlicher Zugänge und Bedeutungen gerecht zu werden. Es bleibt dennoch die Aufgabe der einzelnen Fachkraft, ggf. Anschlüsse, Brücken und Übersetzungen der verschiedenen Aspekte für ihr spezifisches Feld zu finden, denn: Manches lässt sich übertragen und vieles muss entlang der Spezifika von Mensch und Umstand noch weiterentwickelt werden.
Nicht zuletzt möchten wir noch auf einen Aspekt besonderer sozialpädagogischer Verantwortung aufmerksam machen. Viele der heutigen Erwachsenen, die unter schweren Traumafolgesymptomen leiden, haben diese Traumata während ihrer Kindheit durchlebt. Fast alle waren während dieser Zeit in Kindergärten und Schulen betreut. Sich mit dem Thema Trauma vertraut zu machen, bedeutet somit nicht nur, sich um die Folgen biografischer Verwundungen zu kümmern, sondern auch in unbequemer Aufmerksamkeit zu bleiben, wann Verhaltensweisen von Kindern ein Signal dafür sind, dass sie akut von emotionaler, körperlicher, sexueller oder gar ritueller Gewalt betroffen sind. Die Zahl von Menschen, die diesem Leid in ihrer Kindheit ausgesetzt werden, ist erschreckend hoch. Jede Person, die im sozial(-pädagogischen) Kontext arbeitet, wird im Laufe ihrer Berufstätigkeit Kindern begegnen, die unter traumatischen Bedingungen leben.
Die Bereitschaft hinzuschauen, das Unmögliche als möglich mit zu bedenken, den Mut es auszusprechen, sich kollegiale Hilfe zu holen und konsequent an der Aufdeckung und Beendigung von Gewalt im Leben von Kindern zu arbeiten – auch und gerade das ist ein wichtiger Bestandteil traumasensibler Pädagogik!
1Was ist ein Trauma?
Nicht nur in der gegenwärtigen Fachsprache der Pädagogik und Psychologie ist Trauma ein zunehmend häufig verwendeter Begriff. Auch alltagssprachlich wird er oft inflationär genutzt. Sätze wie „Das Fussballspiel gestern war voll das Trauma!“ oder „Unser letzter Urlaub war wirklich traumatisch!“ werden zum Ausdruck gebracht, um dem Gegenüber die Dramatik oder Schwere einer Situation zu verdeutlichen. Hierbei handelt es sich jedoch normalerweise um Situationen, die vom Erzählenden zwar als besonders konflikthaft, ärgerlich oder belastend wahrgenommen wurden, jedoch weder im Ereignis noch in seinen Folgen dem fachlichen Verständnis des Traumabegriffs entsprechen.
Problematisch bei dieser umgangssprachlichen Begriffsverwendung ist gerade aus Sicht traumatisierter Menschen die Bagatellisierung dessen, was in ihrem eigenen Leben in höchstem Maße zu Zerrüttung mit häufig langfristigen bis lebenslangen Folgen geführt hat.
Ursprünglich kommt der Traumabegriff aus dem Altgriechischen und bedeutet Verletzung oder Wunde. Während sich diese Verwundung im medizinischen Feld zunächst auf eine Schädigung des Körpers bezieht, bezeichnet sie in der Psychologie die Verletzung der menschlichen Psyche, das sogenannte Psychotrauma.
Im klinischen Kontext wird das Traumaverständnis aktuell durch die ICD 10/ICD 11 (Internationale Klassifikation von Erkrankungen der WHO) und das DSM-5 (US-amerikanisches – international genutztes – diagnostisches Handbuch für psychische Krankheiten) geprägt.
In der bisher gültigen 10. Revision der ICD wurde ein Trauma beschrieben als „belastendes Ereignis von außergewöhnlicher Bedrohung oder mit katastrophalem Ausmaß, das bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde“. Die am 01.01.2022 eingeführte 11. Überarbeitung der ICD 11 (WHO, 2021) definiert ein Trauma kurz gefasst als ein „extrem bedrohliches oder schreckliches Ereignis“. Dabei kann es sich sowohl um ein einzelnes Ereignis, als auch um eine Abfolge von Ereignissen handeln (DIMDI, zit. n. Knefel 2021).
In der im Mai 2019 verabschiedeteten 5. Auflage des DSM (DSM-5)wird ein Trauma gekennzeichnet als: „eine Konfrontation mit tatsächlichem oder drohendem Tod, ernsthafter Verletzung oder sexueller Gewalt auf eine (oder mehrere) Arten“. Diese Arten werden im DSM-5 dann nachfolgend detailliert aufgeführt (American Psychiatric Association, zit. n. Knefel 2021).
Diesen Definitionen gemein ist, dass das Traumaverständnis vorrangig auf das Ereignis bezogen wird, während die Begriffsbestimmung des Traumas als Wunde ursprünglich deutlicher auf die Bedeutung und Folgen für die Betroffenen hinweist.
In der modernen Trauma-Literatur werden diese der Diagnostik zugrunde gelegten Definitionen zwar oftmals als leitend aufgegriffen, gleichfalls jedoch, entlang aktueller Forschungen und Erfahrungen auf dem Gebiet der Psychotraumatologie, von FachexpertInnen erweitert und modifiziert betrachtet.
Ein besonderes Anliegen der erweiterten Definitionen ist es, dem subjektiven Erleben des Menschen in der Konfrontation mit traumatischen Erfahrungen eine höhere Bedeutung zu schenken. Im Vordergrund steht die Frage, wie jemand das Geschehen subjektiv erlebt hat, und nicht ausschließlich der Aspekt, womit jemand konfrontiert war.
Die folgende Erläuterung von Fischer und Riedesser in ihrem Lehrbuch der Psychotraumatologie greift diese Konnotation stellvertretend gut auf. Sie beschreiben Trauma als ein „vitales Diskrepanzerleben zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt“ (Fischer/Riedesser 2020, 88).
Eine traumatische Erfahrung ist demnach – im Gegensatz zu belastenden Ereignissen – dadurch gekennzeichnet, dass Menschen keine Möglichkeiten haben, diese aus eigener Kraft zu lösen. Ihre individuellen Fähigkeiten reichen zur Bewältigung nicht aus. In diesem Zustand der eigenen Macht- und Hilflosigkeit sind Betroffene auf Schutz und Unterstützung angewiesen. Steht dies nicht zur Verfügung, erlebt der Mensch sich als „verloren“, was Fischer und Riedesser als „schutzlose Preisgabe“ (Fischer/Riedesser 2020, 88) bezeichnen. Die Situation ist somit in alle Richtungen auswegslos.
Kennzeichnend für traumatische Erfahrungen ist somit ein vollständiger Zusammenbruch des eigenen Sicherheitsgefühls, verbunden mit überwältigender Angst und existenziellem Bedrohungsempfinden, ausgelöst durch:
Fassungslosigkeit: Die Dimension des Erlebten übersteigt die Fähigkeit der Einordnung: Was passiert da? Warum passiert das? Die Geschehnisse sind unvorstellbar/unfassbar.
Schutzlosigkeit: Es ist niemand da, der:die bewahren, schützen, beruhigen, sichern, retten kann. Ich bin menschenseelenallein.
Ohnmacht: Die eigenen Handlungskompetenzen sind überschritten. Es gibt keine Möglichkeit, wirksam zu handeln, um für Sicherheit zu sorgen. Ich bin ausgeliefert.
„Traumata sind ihrem Wesen nach unerträglich.“ (van der Kolk 2024, 10)
Mit diesen Worten beschreibt Bessel van der Kolk, einer der führenden Traumaforscher, diese spezifische Dimension der Erfahrung.
Welche Ereignisse, Situationen, Erfahrungen und Empfindungen in diesem Sinne als „unerträglich“ empfunden werden und wann traumatischer Stress ausgelöst wird, kann nicht eindeutig bestimmt werden. Wie ein Mensch erlebt, was auf ihn einwirkt, was in seinem Körper passiert und wie das Erlebte im Nachhinein verarbeitet wird, bleibt subjektiv. Entsprechend sind Traumatisierungen und ihre Folgen zwar konzeptionell beschreibbar. In der pädagogischen und sozialpädagogischen Arbeit ist es jedoch entscheidend, sich über die fachspezifischen Kategorien hinaus immer für die Selbstsicht, die autobiografischen Erzählungen und die Symptomsprache des einzelnen Menschen zu interessieren (→Kap. 2.1).
Diesem Buch liegt entsprechend ein erweitertes Traumaverständnis zugrunde, das über die klinisch-diagnostische Deskription hinausgeht. Die folgende Devise des kanadischen Arztes und Traumaexperten Gabor Maté leitet uns in unseren Ausführungen und unserem fachlichen Verständnis, wenn es darum geht, Menschen mit einem traumasensiblen Blick zu begegnen:
„Trauma is not what happens to you, but what happens inside you“
(Maté 2021).
1.1Psychobiologische Reaktionen auf ein Trauma
Insbesondere die Neurowissenschaften haben seit den 1990er Jahren viel dazu beigetragen, dass die Facette des „inside you“ im obigen Zitat von Maté heute weitreichender und vor allem ganzheitlicher verstanden werden kann. Entlang der These, dass das menschliche Gehirn im Wesentlichen erfahrungsabhängig geprägt wird, wurden seitdem vielfältige forschungsbasierte Annahmen dazu formuliert, was unter traumatischen Bedingungen in Gehirn und Körper geschieht, und wie sich entsprechend traumabasierte Folgesymptomatiken erklären lassen.
Die traumatische Zange
Um die spezifische Dynamik, die traumatischem Erleben und seinen Folgen zugrunde liegt, fassbar zu machen, wird als Erklärungsmodell häufig die traumatische Zange genutzt. Sie veranschaulicht diejenigen Prozesse, die ablaufen, wenn die Handlungskompetenzen und Verarbeitungsfähigkeiten, die einem Menschen üblicherweise zur Verfügung stehen, an ihre Grenzen geraten.
Grundsätzlich steht für derartige Situationen allen Menschen ein genetisch determiniertes Notfallprogramm zur Verfügung. Dieses wird unwillkürlich aktiviert, wenn das Gehirn einen Umstand als stark verunsichernd, hochgradig beängstigend oder existenziell bedrohlich einstuft. Nimmt das Gehirn – seiner Interpretation nach – derartige Gefahrensignale wahr, führt dies „zur Ausschüttung starker Stresshormone, unter anderem von Kortisol und Adrenalin, was den Herzschlag beschleunigt, den Blutdruck erhöht und die Atemfrequenz ansteigen lässt – erforderliche physiologische Vorbereitungen auf eine Kampf- oder Fluchtreaktion“ (van der Kolk 2024, 98). Das Stress- und Nervensystem wird also aktiviert. Gleichermaßen werden Funktionen der Großhirnrinde (Frontalhirn, Sprachzentrum, Hippocampus), die normalerweise unser Denken und Handeln steuern und ordnen, in ihrer Funktionalität stark eingeschränkt oder außer Betrieb gesetzt. Energie und Fokus des Organismus sind zunächst ausgerichtet auf die Aktivierung der archaisch angelegten Überlebensprogramme:
Flüchten – der Situation entkommen oder
Kämpfen – die Gefahr aus eigener Kraft heraus durch Gegenwehr abwenden.
Gelingt dies und kann dadurch zur Bewältigung der Situation beigetragen werden, so wird im Normalfall eine Traumatisierung verhindert. Können diese Handlungsoptionen jedoch nicht zur Lösung der Situation genutzt werden, gerät der betroffene Mensch in die sogenannte traumatische Zange (Huber 2009). Die reflexartig aufgerufenen Handlungsimpulse werden im Ansatz unterdrückt und können nicht vollzogen werden. Es entsteht die ein Trauma kennzeichnende Situation No flight, no fight, die jetzt diejenigen Maßnahmen des Gehirns aufruft, die notwendig sind, um in der aktuellen Situation psychisch überleben zu können, die jedoch zugleich die Grundlage vielfältiger traumabasierter Symptombildung darstellen.
Gelingt es also innerhalb der traumatischen Situation nicht, durch reales Handeln der Situation zu entkommen, kann das Gehirn dieses Entkommen nur durch eine Veränderung seiner Wahrnehmungsleistungen herstellen. Dieses geschieht zunächst durch die sogenannte Freeze-Reaktion. Freeze bedeutet einfrieren und kann als eine Art Lähmung verstanden werden, die bewirkt, dass der Mensch sich vom Geschehen innerlich distanzieren kann und in den Zustand einer Unterwerfungsreaktion (Submission) wechselt. Ausgelöst durch eine Flut von Endorphinen sind Gefühle und Körperzustände im Freeze-Zustand wie betäubt (Huber 2009). Zudem kommt es zu „Notwehrmaßnahmen“ des Bewusstseins in Form von Abspaltung und Fragmentierung (Frick-Baer/Baer 2023, 16). Dissoziative Phänomene wie Derealisation (die Umgebung wird als fremd und unwirklich wahrgenommen) und Depersonalisation (die eigene Person oder den eigenen Körper nicht spüren und sich unbeteiligt fühlen) werden eingeleitet (Huber 2009). Während dieses Prozesses werden die einzelnen Wahrnehmungsdetails (sensorisches, emotionales, körperliches, kognitives Erleben) fragmentiert.
„[Die] räumlich-zeitliche Einordnung (Hippocampus) und die assoziativen Fähigkeiten des Bewusstseins (Frontalhirnfunktionen), die normalerweise den sensorischen Input zu einem zusammenhängenden Erlebnis und einer später abrufbaren Erinnerung verknüpfen, [werden] außer Kraft gesetzt.“ (Hüther et al. 2010, 22)
Lutz Besser vergleicht diesen fragmentarischen Wahrnehmungs- und Speicherungsprozess mit der Zersplitterung eines Spiegels, dessen Einzelteile unverbunden im Vorhof des Gedächtnisses abgelegt, aber von diesem nicht verarbeit und integriert werden (Besser 2013) können.
In dem bekannten Werk ‚Das Attentat‘ beschreibt Harry Mulisch in eindrucksvoller Weise diesen Fragmentierungsprozess aus der Perspektive des kleinen Antons, als dieser miterleben muss, wie seine Familie gewaltvoll von Nazioffizieren bedroht wird:
„Anton sah und hörte alles, war aber irgendwie abwesend, ein Teil von ihm war bereits irgendwo anders, oder nirgends mehr. Er war unterernährt und nun auch steif vor Kälte, aber das allein war es nicht. Dieser Augenblick – der Vater am Tisch als schwarzer Schatten im Schnee, die Mutter draußen auf der Terrasse im Licht der Sterne – blieb auf ewig stehen, machte sich frei von allem, was vorangegangen war und was folgen würde, kapselte sich ab und begann eine Reise durch Antons zukünftiges Leben“ (Mulisch 2008, 27).
Traumatisierung aus der Perspektive des Nervensystems
Die dem Extremfall angemessenen und wirksamen Notfallreaktionen des Organismus beginnen – wie Mulisch es ausdrückt – tatsächlich eine „Reise durch das zukünftige Leben“ (Mulisch 2008) anzutreten, da Traumata zu physiologischen Veränderungen (van der Kolk 2020) führen. Diese Veränderungen beziehen sich auf die Funktionsweise von Hirnstruktur und Nervensystem.
„Nach einem traumatischen Ereignis erleben Menschen die Welt mit einem veränderten Nervensystem.“ (van der Kolk, 2024, 86)
Unser „Dreieiniges Gehirn“
In einer vereinfachten Darstellung wird das Gehirn oftmals als „Dreieiniges Gehirn“ beschrieben. Darin besteht das Gehirn aus drei Teilen, die jeweils unterschiedliche Aufgaben übernehmen, um Leben und Überleben des Menschen zu sichern:
Stammhirn: Das Stammhirn wird häufig auch als Reptiliengehirn bezeichnet, weil es in seiner Funktionsweise dem Gehirn von Reptilien ähnelt. Es ist der älteste Teil unseres Gehirns, der in erster Linie unser Überleben sichert, indem er die Vitalfunktionen Atmung, Herzschlag und Blutdruck steuert. Ebenfalls obliegt ihm die Verantwortung, in bedrohlichen Situationen die Notfallprogramme Kampf, Flucht und/oder Erstarrung einzuleiten.
Limbisches System: Über dem Stammhirn liegt das Limbische System. In ihm findet die emotionale Einordnung und Verarbeitung von Erfahrungen statt. Jede Erfahrung, die Menschen machen, wird mit einem Gefühl codiert abgelegt. Entsprechend wird das Limbische System auch als emotionales Gedächtnis angesehen. Wenn eine Erfahrung mit Unbehagen, Unsicherheit, Beängstigung einhergeht, wird das Limbische System auch in Zukunft bei jeder Assoziation, die dem ursprünglichen Erleben ähnelt, das alte Gefühl unwillkürlich abrufen. Bei entsprechend negativen Empfindungen und/oder Erinnerungen wird im Organismus eine aversive Stressreaktion ausgelöst. Der Organismus will sich vor einer Wiederholung der Erfahrung schützen.
Neocortex/Präfrontaler Cortex: Dieser Teil des Gehirns reift in der Entwicklung des Menschen am langsamsten. Er kann als „Managementabteilung“ des Gehirns angesehen werden. In sicherer Lage und unter normalen Bedingungen ermöglicht diese dem Menschen, mit „klarem Kopf“ zu denken, zu planen und zu handeln. Zugleich ist der Neocortex der Hort der sogenannten Mentalisierungsfähigkeiten – also derjenigen Kompetenzen, die es Menschen ermöglicht, sich selbst und andere durch Reflexion zu verstehen. Zudem ist er für die sogenannte Impulskontrolle zuständig. Der Neocortex spielt somit eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Bereitstellung von Selbstbildern und sozialen Kompetenzen.
Bei günstigen Entwicklungsvoraussetzungen und in sicherer Lage arbeiten alle drei Instanzen, gut aufeinander abgestimmt, zusammen. Anders sieht es in Situationen aus, die vom Limbischen System als unsicher eingestuft werden. Da es die Hauptaufgabe des Gehirns ist, auch unter schwierigsten Bedingungen für Überleben zu sorgen (vgl. van der Kolk 2024, 88.), verlegt es seine Tätigkeit in den „Katastrophenschutz“. Dieser wird eingeleitet durch die Amygdala (Mandelkern). Bildlich gesprochen wird sie manchmal als „Rauchmelder“ im Gehirn bezeichnet. Die Amygdala ist Teil des Limbischen Gehirns. Sie scannt Erfahrungen danach, ob sie für den Menschen existenziell bedrohlich sein könnten. Ist dies der Fall, wird die Amygdala in Übererregung versetzt und löst Alarm aus. Im Gehirn wird der Notfallmodus in Gang gesetzt.
Er zeichnet sich – wie bereits in den Erläuterungen zur Traumatischen Zange beschrieben – dadurch aus, dass die Funktionen des Präfrontalen Cortex blockiert werden und das Reptiliengehirn die Verantwortung und Kontrolle in der akuten Situation übernimmt.
Das Nervensystem – ein Balanceakt
Im Reptiliengehirn verortet ist das sogenannte Autonome Nervensystem. Das Autonome Nervensystem überwacht, steuert und versorgt die überlebenswichtigen Funktionen unseres Organismus wie Blutdruck, Atemfrequenz, Körpertemperatur, Verdauung und Stoffwechsel. Es heißt autonom, weil seine Impulse nicht willentlich gesteuert werden können.
Es besteht aus zwei Teilen, dem Sympathischen und dem Parasympathischen System. Das Sympathische System sorgt unter normalen Umständen für unsere Mobilisierung, Aktivität, Wachheit und Leistungsfähigkeit. In einer Bedrohungssituation sorgt der Sympaticus für die Mobilisierung der Kampf- und Fluchtimpulse, indem er Höchstleistungen erbringt, um Menschen die Kräfte und Fähigkeiten zu verleihen, die sie brauchen, um sich einer (drohenden) Gefahr zu widersetzen.
Das Parasympathische System kann als Gegenspieler angesehen werden, dessen Aufgabe darin besteht, für den Ausgleich zu sorgen. In sicherer Lage reguliert es den Organismus herunter, sorgt für Entspannung, Beruhigung und Schlaf. In traumatischen Situationen gerät es ebenfalls in Übererregung und verursacht einen Shut-Down im System. Dieses ist die letzte unwillkürliche Notfallmaßnahme bzw. Überlebensstrategie des Organismus, der auf diese Weise versucht, der für den Körper lebensbedrohlichen inneren Übererregung durch Energieentzug etwas entgegenzusetzen. Menschen empfinden sich in diesem Zustand abwesend, emotional betäubt, resigniert und völlig kraftlos. Der Körper verliert alle Spannung. Er erschlafft bis hin zu faktischen Ohnmachtsanfällen.
In sicherer Lage arbeiten Sympaticus und Parasympaticus normalerweise gut aufeinander abgestimmt zusammen. Das Nervensystem weist dann gute selbstregulatorische Fähigkeiten und eine damit verbundene breite Stresstoleranz auf.
„Ein gesundes autonomes Nervensystem zeichnet sich vor allem durch Flexibilität aus. Es ist fähig, in beide Richtungen zu schwingen und sich den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen.“ (Charf 2018, 38)
Menschen in gut reguliertem Zustand erleben sich als ausgeglichen, lernbereit, offen und motiviert. Nach traumatischen Erfahrungen finden Gehirn und Nervensystem jedoch schwer oder gar nicht in ihre Balance zurück. Die traumatische Erfahrung manifestiert sich als permanentes Bedrohungserleben, das den Organismus weiterhin in Anspannung und Alarmbereitschaft hält. So beschreibt Charf eine Traumatisierung als Zustand, in welchem der Körper nach einem bestimmten Ereignis nicht mehr aus seiner Schreckreaktion herausfindet, sondern darin verharrt (Charf 2018).
Die Amygdala bleibt hoch sensitiv eingestellt, so dass bereits kleinste Stressoren als Vorboten einer Katastrophe eingestuft werden und somit dafür sorgen können, dass der Präfrontale Cortex die Kontrolle verliert und die Notfallreaktionen eingeleitet werden.
Insbesonderen bei frühen, sequentiellen bzw. komplexen Traumatisierungen (→ Kap. 1.2 Entwicklungstrauma) wird der „Katastrophenschutz“ zum Normalprogramm. Die höheren Hirnfunktionen reifen verlangsamt bzw. sind dauerhaft blockiert, solange das innere und äußere Sicherheitserleben des Menschen nicht (wieder) hergestellt werden konnte.
Auch das Nervensystem kann seine selbstregulatorischen Fähigkeiten nicht ausbilden bzw. wahrnehmen. Es befindet sich dauerhaft in einem dysregulierten Zustand – und somit in einer für den Organismus höchst anstrengenden ständigen Berg-und-Tal-Fahrt, bei der gleichsam Gaspedal (Sympaticus) und Bremse (Parasympaticus) abwechselnd oder gar gleichzeitig durchgetreten werden.
Viele Menschen befinden sich nach traumatischen Erfahrungen demnach permanent auf einem extrem hohen Erregungspegel mit Überaktivität, Unruhe und Impulsivitätssymptomen. Versucht gleichzeitig das parasympathische System für Bewältigung zu sorgen, wird wiederum Immobilisierung erzeugt, die sich u.a. in Symptomen von Erschöpfung, Antriebslosigkeit, Müdigkeit, Depressionen zeigen kann. Umgangssprachlich bezeichnen wir diese Zustände oft als „hoch- oder runtergefahren“.
Manche Menschen sind dabei größtenteils im Bereich starker Mobilisierung und Übererregung verhaftet, andere befinden sich überwiegend im Zustand der Immobilisierung. Bei vielen Menschen sind jedoch „Gaspedal und Bremse“ gleichermaßen hoch aktiv, so dass die inneren Zustände und damit einhergehende Symptomatiken extremen Wechseln unterzogen sind. Dies geht für die betroffenen Menschen mit ungeheuerem inneren Energieaufwand und großer Anstrengung einher.
Aus heutiger Sicht lässt sich zusammenfassend ein Großteil der im nachfolgenden benannten typischen traumabasierten Symptomatiken über entsprechende Dysbalancen und neurobiologische Spezifika in Hirnfunktion und Nervensystem erklären.
„Traumafolgen, Angststörungen, Depressionen, Schmerzen, die meisten anderen ‚Störungs- und Symptombilder‘ sind der Ausdruck einer Selbstregulationsstörung. Statt in Begriffen von Symptomen und Diagnosen zu denken, sollten wir eher von Regulation und Dysregulation sprechen.“ (Charf 2018, 41)
Trauma wird in diesem Verständnis als eine Verwundung des Nervensystems interpretiert. Traumabasierte Symptomatiken können dementsprechend aufgrund ihrer neurologischen Relevanz dem Spektrum erfahrungsbedingter Neurodiversität zugeordnet werden (Schwarzhoff 2023).
1.2Symptombildung als Traumafolge
Sowohl im DSM-5, wie auch in der ICD, die sich seit 2022 im Umstellungsprozess von der zehnten auf die elfte Revision befindet, werden Traumafolgesymptomatiken explizit beschrieben. Da mit einer mehrjährigen Übergangsphase der ICD 10 auf die ICD 11 in der Praxis gerechnet wird, in der beide Revisionen gleichberechtigt zur Diagnosestellung genutzt werden, beziehen wir uns in unseren weiteren Ausführungen auf beide Grundlagen.
Ähnlich wie bei der Traumadefinition finden sich in den jeweiligen Ausführungen hilfreiche Diagnosekriterien bzgl. der Symptombeschreibungen. Einig sind sich jedoch auch hier viele der aktiven Traumafachleute, dass diese Klassifizierungen längst nicht die Spannbreite der durch Traumatisierungen verursachten Symptome und Phänomene erfassen. Van der Kolk, einer der renommiertesten Traumaforscher, sagt dazu:
„Obwohl sie bemüht ist, die grundlegenden Reaktionen der Betroffenen auf Traumatisierung zu erfassen, ist die Diagnose PTBS weit davon entfernt, die ganze Komplexität dessen zu beschreiben, wie Menschen auf überwältigende Erfahrungen reagieren.“ (van der Kolk et. al 2000, 40)
Entsprechend werden in den folgenden Abschnitten neben der Darstellung der Symptomatiken einer klassischen Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) auch weitere mögliche Folgeerscheinungen aufgezeigt, die unseres Erachtens für ein umfassendes Verständnis der Traumafolgephänomene notwendig sind.
Posttraumatische Belastungsstörungen
Grundsätzlich wird diagnostisch zwischen einer akuten Belastungsreaktion, die während des traumatischen Ereignisses eintritt und nach wenigen Stunden oder Tagen wieder verschwindet, und einer ausgeprägten sogenannten Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), im Amerikanischen auch





























