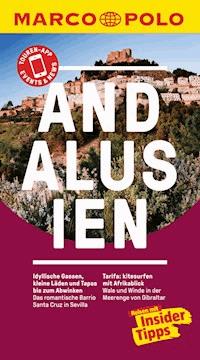9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ch. Links Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Länderporträts
- Sprache: Deutsch
Jenseits der Strände gibt es ein Spanien zu entdecken, das mehr zu bieten hat als Flamenco und Stierkampf, Fiesta und Siesta.
Martin Dahms, der seit mehr als 20 Jahren dort lebt, wirft einen Blick auf Kultur, Politik und Wirtschaft des Landes. Ihn interessiert vor allem, wie es zu dem wurde, was es ist, was die Spanier beschäftigt und worüber sie diskutieren: über den Umgang mit der Franco-Zeit und ihr Verhältnis zur königlichen Familie, über grassierende Arbeitslosigkeit vor allem unter Jugendlichen, über neue Fußballhelden und regionalen Separatismus – und natürlich, mit Leidenschaft, über Essen und Trinken.
Dahms' Nähe zum Alltag der Spanier macht sein Buch zu einer Fundgrube für alle, die verstehen wollen, was das Land ausmacht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Martin Dahms
Spanien
Martin Dahms
Spanien
Ein Länderporträt
Para Rosa, que ya lo ha leído.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
2. Auflage als E-Book, Dezember 2018
entspricht der 2., aktualisierten Druckauflage vom Dezember 2018
© Christoph Links Verlag GmbH, 2011
Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0
www.christoph-links-verlag.de; [email protected]
Abb.-Nachweis: Almudena-Kathedrale von Madrid, 2015; © iStock/SeanPavonePhoto
Reihengestaltung: Stephanie Raubach, Berlin
Lektorat: Günther Wessel, Berlin
Karte: Christopher Volle, Freiburg
eISBN 978-3-86284-440-1
Inhalt
Vorwort
Der Umweg nach Europa
Ankunft
Mission: Impossible – über den Kampf der Spanier mit dem Englischen
Kommunikationswunder und -weh – wie Spanier miteinander reden
Quadratköpfe – was Spanier über die Deutschen wissen
Nicht erziehungsberechtigt – über den Umgang der Spanier mit fehlender Zivilisiertheit
Zu spanischer Stunde – über die Siesta und das spanische Essen
Küsschen Küsschen – über spanische Sitten
Spanien zum Vergnügen
»Die Spuren ihrer Bildung und die Wohltat ihres Reichtums« – über den Tourismus
Granadinische Träume – über Al Andalus und das spanische Weltreich
Wunderbare Geschöpfe – über die schönen Künste
Die tollkühnen Männer in ihren seidenen Strümpfen – über Spaniens kulturelle Wahrzeichen
Neue Helden – über den Sport
Die offene Wunde Bürgerkrieg
Die Geschichte im Straßengraben
Francos langer Schatten
Die mächtige und die ohnmächtige Kirche
Links und rechts
Laute und leise Medien
Der geliebte und der ungeliebte König
Baltasar Garzón und die schreckliche Justiz
Im Schnellzug auf holprigen Gleisen
Aufschwung, Krise und Aufschwung
Cayucos, Pateras, Touristenvisa
Und nun zum Wetter
Zersplitterndes Spanien
Anhang
Ein paar historische Daten, die es sich zu merken lohnt
Basisdaten
Karte
Literatur
Dank
Über den Autor
Vorwort
»Neu an einem Ort, möchte man nach einer Woche ein Buch schreiben. Nach einem Monat einen Artikel. Nach einem Jahr nichts mehr.« (Journalistenerfahrung)
»Und? Gefällt dir Spanien?«, bin ich tausend Mal von Spaniern mit weit aufgerissenen Augen gefragt worden, die nur eine Antwort zuließen: Na klar! Und wie! Früher habe ich ohne Zweifel geantwortet: Na klar! Und wie! Deswegen war ich ja nach Spanien gekommen: weil es mir gefiel, und deswegen beschloss ich zu bleiben und nahm mir eine Wohnung mitten in Madrid. Den ganzen September über renovierte ich in Papierhut und Unterhose, denn es war so heiß in Madrid, wie man sich das vorstellt. Ich bekam Besuch von deutschen Freunden, die mich nicht wegen der Wohnung beneideten, die etwas dunkel war, sondern wegen der Hitze und wegen Madrid, der Stadt, die sie für so ungefähr die coolste Stadt Europas hielten. Und erst die Spanierinnen! – Was auch immer geschähe, ein Jahr würde ich mindestens bleiben, und wenn es die Umstände gut mit mir meinten, vier oder fünf. Und dann zurück nach Deutschland. Ich rechnete nicht damit, in Spanien auf Dauer heimisch zu werden. Um hier Wurzeln zu schlagen, glaubte ich, müsste ich zum Spanier werden, und zum Spanier würde ich nicht werden, ob ich wollte oder nicht.
Über Weihnachten flog ich zum ersten Mal für ein paar Tage nach Deutschland. Kurz vor Silvester, spät abends, landete ich wieder in Madrid. Ich nahm mir ein Taxi, das mich vom Flughafen Barajas zu meiner Wohnung bringen sollte. Als wir die Puerta de Alcalá umrundet hatten, sah ich vor mir den festlich beleuchteten Cibeles-Brunnen und ein paar Meter dahinter, auf der Ecke zur Gran Vía, die ebenso festlich beleuchtete Fassade des Metrópolis-Gebäudes. Mir dehnte sich der Brustkorb vor Glück. Es war das Glück, nach Hause zu kommen.
Das war 1994, und ich lebe immer noch in Madrid. Die Umstände meinten es gut mit mir. Nach drei Jahren kaufte ich mir eine Wohnung (Wohnungen waren damals noch billig in Spanien) und dachte nicht mehr daran, nach Deutschland zurückzukehren. Offenbar musste ich nicht zum Spanier werden, um hier Wurzeln zu schlagen. Ich begann mich als Deutscher unter Spaniern heimisch zu fühlen. Madrid ist eine gastfreundliche Stadt, die meisten Madrider sind selbst Zugezogene oder Kinder von Zugezogenen. Auswärtige sind willkommen, und falls irgendjemand gegen mich als Deutschen Vorurteile gehegt haben sollte, hat er es mich nicht spüren lassen. Im Gegenteil empfand ich einen gewissen Exotenbonus, der mir das Leben leicht machte.
Doch natürlich geschah etwas mit mir. Ich blieb nicht der Deutsche, der ich war. Auf einmal fielen mir merkwürdige Verhaltensweisen an anderen Leuten auf: Frauen reichten mir die Hand, statt mir die Wange zum Kuss entgegenzuhalten; fremde Leute setzten sich im Restaurant an meinen Tisch; Gesprächspartner zuckten zusammen, wenn ich sie am Arm berührte. Deutsche! – Vielleicht sollte ich ein Buch über Deutschland schreiben. Mir ist Spanien so vertraut, dass ich die Muster immer schwerer erkenne, die Spanien von anderen Ländern unterscheiden. Für jede offenbare nationale Eigenart fällt mir ein Gegenbeispiel ein. Die Spanier reden laut und schnell? Alba redet leise und bedächtig. Die Spanier gehen gern bis in den frühen Morgen aus? Carlos ist das zu teuer. Die Spanier sind katholisch, lieben den Stierkampf und hören den ganzen Tag Flamenco? Bestimmt gibt es den Klischeespanier. Ich bin ihm aber noch nicht begegnet.
Heute fragt mich kaum noch ein Spanier, ob mir Spanien gefällt. Heute sagen sie: »So lange lebst du schon in Spanien? Na dann gefällt es dir aber!« Ich kann darauf nicht mehr so unbefangen antworten wie früher. Ist es denn möglich, dass einem ein ganzes Land gefällt? Das wäre ja die reinste Liebesgeschichte. Aber Liebesgeschichten mit ganzen Ländern kann ich mir nicht vorstellen, so wenig wie Gustav Heinemann, der auf die Frage, ob er denn diesen Staat, diese Bundesrepublik Deutschland, liebe, etwas unwirsch antwortete: »Ach was, ich liebe keine Staaten, ich liebe meine Frau; fertig!« Wenn ich heute gefragt werde, ob mir Spanien gefalle, antworte ich: Mir gefällt mein Leben in Spanien – mein Leben an der Seite einer Spanierin, mein Leben nahe der Altstadt von Madrid, mein Leben unter spanischen und ausländischen Freunden, mein Leben als Journalist, der von Berufs wegen häufiger Beobachter als Teilnehmer ist. Nur aus dem Blickwinkel dieses Lebens kann ich Ihnen etwas über Spanien erzählen. Ich werde versuchen, das einzige Spanien zu beschreiben, das ich kenne: mein Spanien. Sollten Sie bei einem Besuch auf ein anderes Spanien stoßen, würde mich das nicht wundern.
Der Umweg nach Europa
»Spanien ist das Problem, Europa die Lösung.« (José Ortega y Gasset)
Hinter den Pyrenäen beginnt Afrika, soll Alexandre Dumas der Ältere gesagt haben.
Wahrscheinlich hat er es nie gesagt. Als Dumas schon gestorben war, erklärte sein Sohn, Alexandre Dumas der Jüngere, einem spanischen Freund: »Der berühmte Satz, der meinem Vater zugeschrieben wird und in dem er nach seinem Gutdünken die Geografie verändert, ist apokryph. Sie werden ihn in keinem seiner Texte finden. Sowohl mein Vater als auch ich waren leidenschaftliche Bewunderer Spaniens, obwohl wir in der Provinz Granada von der gesamten Einwohnerschaft eines Dorfes, an dessen Namen ich mich nicht erinnern möchte, mit Steinen beworfen wurden.«
Trotz ungeklärter Urheberschaft hat der Satz vom Afrika hinter den Pyrenäen Furore gemacht. Ich hörte ihn in abgewandelter Form zum ersten Mal 1995 von einer spanischen Kollegin während eines Kongresses auf Lanzarote. Sie sagte: »Spanien ist das nördlichste Land Afrikas«, weil Spanien im Vergleich zu Europa etwas zurückgeblieben sei und weil fast 800 Jahre arabischer Herrschaft ihre Spuren in der Mentalität der Spanier hinterlassen hätten. Ich glaubte der Kollegin kein Wort. Wir waren auf Lanzarote, also geografisch in Afrika, aber alle schwarzwilde Natur konnte nicht das europäische Gepräge der Insel überdecken. In Madrid fühlte ich mich sowieso zu Hause: zu Hause in Europa. Nur die Spanier selbst hatten ihre Zweifel. Damals verreisten sie noch wenig ins Ausland, und wenn das Gespräch auf London oder Rom oder die griechischen Inseln kam, sagten sie: »Ich bin noch nie in Europa gewesen.« Sie meinten den Kontinent jenseits der Pyrenäen. Und in der Madrider Zeitung El Mundo erschien eine Karikatur, die eine Europa-Flagge zeigte, auf der ein Stern durch zwei Pobacken ersetzt worden war. Die Botschaft: Spanien ist der Arsch Europas.
Spanien war mal das mächtigste Land der Welt. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts herrschte Philipp II. über ein Reich, in dem die Sonne niemals unterging. Doch alles Gold und Silber aus den amerikanischen Kolonien verhinderte nicht Spaniens wirtschaftlichen und politischen Abstieg. »Gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts war fast überall in Westeuropa das Mittelalter ausgetilgt. Auf der Iberischen Halbinsel, die auf drei Seiten vom Meer, auf der vierten von Bergen abgeschlossen ist, dauerte es fort,« schreibt Lion Feuchtwanger in Goya oder der arge Weg der Erkenntnis. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts verlor Spanien die meisten seiner Kolonien, und während im Rest Europas die Ideen von Demokratie und Kapitalismus zu keimen begannen, blieb Spanien zurück. Weder ideell noch materiell hatte das Land etwas zur Entwicklung Europas beizutragen.
Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert fanden es die klügeren Spanier an der Zeit, dass Spanien endlich seine mentalen Pyrenäen überwinde. Während eines Vortrages in Bilbao im März 1910 forderte der damals gerade 26 Jahre alte Philosoph José Ortega y Gasset die Erneuerung Spaniens: »Erneuerung ist untrennbar von Europäisierung. Erneuerung ist der Wunsch – Europäisierung ist das Mittel, ihn zu befriedigen. Es war von Anfang an klar zu sehen, dass Spanien das Problem war und Europa die Lösung.«
In seiner zugespitzten Form – Spanien ist das Problem, Europa die Lösung – wurde Ortegas Bemerkung zum geflügelten Wort. Wollte Spanien aus seiner Misere herausfinden, müsste es sich dem Rest Europas nähern und ihm ähnlicher werden. Doch daraus wurde vorerst nichts. Den späten Frühling der Demokratie, die 1931 ausgerufene Zweite Republik, zertrampelte General Francisco Franco. Der im Spanischen Bürgerkrieg (1936 – 1939) siegreiche Diktator verordnete seinem Land Autarkie und traditionelle Werte: Die Armen blieben arm, die Frauen am Herd und die Jungen ohne Illusionen. Franco hielt nichts von einer Annäherung an Europa, schließlich lauerten in Europa die Kommunisten. Die spanischen Kinder lernten in der Grundschule wieder, dass – Gott sei Dank! – hinter den Pyrenäen Afrika beginne. Wenn überhaupt, dann sollte sich Europa Spanien nähern, Heimstatt von Christentum und katholischer Moral.
Weil aber das Fressen vor der Moral kommt und die Spanier schon viel zu lange hungerten, leitete das Franco-Regime 1959 die wirtschaftliche Kehrtwende ein und gab seine fatale Autarkiepolitik auf. In den 1960er Jahren kamen die europäischen Touristen ins Land und legten sich im Bikini an die spanischen Strände. Die Spanier staunten: So frei war Europa! Und Hunderttausende spanische Emigranten in Frankreich, der Schweiz oder in Deutschland staunten auch: So frei war Europa, und so reich!
Doch erst mit dem Tod des Diktators Ende 1975 öffnete sich Spanien aus vollem Herzen dem Rest des Kontinents: Europa war die Lösung! Und der Kontinent öffnete sich Spanien. Nachdem das Land den Übergang zur Demokratie gewagt und geschafft hatte, wurde es 1986 zur Belohung in die damalige Europäische Gemeinschaft aufgenommen. Erst feierten die Spanier. Und dann schimpften sie, weil Zugehörigkeit zu Europa auch Konkurrenz aus Europa bedeutete. Überall nur deutsche, französische, holländische Waren! Weinstöcke mussten ausgerissen, Milchquoten eingehalten, der Fischfang reduziert werden. Spanien war wirklich der Arsch Europas. Dass gleichzeitig die Exporte von Apfelsinen, Zitronen und sonstigem Obst und Gemüse sprunghaft anstiegen, machte weniger Schlagzeilen. Darum merkten es die Leute anfangs kaum, dass Spanien ab Mitte der 1990er Jahre zum Wirtschaftswunderland aufstieg. Das Inlandsprodukt wuchs stärker als im Rest Europas und die Beschäftigung auch. Und weil die Regierung noch dazu den Staatshaushalt in den Griff bekam, durfte Spanien, was vorher viele nicht für möglich gehalten hätten, von Anfang an beim Euro mitmachen. Grund für neu erwachten europäischen Stolz: Wir sind immer noch arm, aber richtige Europäer.
Die relative Armut – das spanische Prokopfeinkommen lag Ende der 1990er Jahre bei 80 Prozent des EU-Durchschnitts – war keine Schande, sondern eine Herausforderung: für die anderen. Schon der Sozialist Felipe González, Regierungschef von 1984 bis 1996, besaß keine Hemmungen, die Partnerländer mit seinen Forderungen nach Solidarität zu nerven. Er hatte Erfolg damit. Das reichere Europa gab sich großzügig und trug mit Kohäsions- und Regionalfonds jahrelang mehr als 1,5 Prozent zur spanischen Wirtschaftsleistung bei. Auch der konservative González-Nachfolger José María Aznar, Regierungschef von 1996 bis 2004, wollte nicht als europäischer Subventionsversager dastehen. Noch im Frühjahr 2001 pochte er darauf, dass Spanien wegen des Beitritts ärmerer osteuropäischer Länder zur EU zwar verhältnismäßig reicher aussehe als früher, aber wegen dieses »statistischen Effektes« keinesfalls benachteiligt werden dürfe. Europa war gut. Aber am besten war Europa, wenn es Geld brachte.
Irgendetwas geschah dann. Für Mentalitätswandel gibt es keinen Stichtag, er vollzieht sich unmerklich, und erst im Rückblick wird er augenfällig. Kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt als Regierungschef Anfang 2004 sagte José María Aznar in Brüssel: »Wir haben immer gesagt: Unser Ehrgeiz ist es, kein Kohäsionsland mehr zu sein, sondern wie ein wohlhabendes Land zu denken. Und wir sind kurz davor, dieses Ziel zu erreichen. Spanien muss diese Tatsache akzeptieren und eine entsprechende Mentalität annehmen.« Was Spanien vor allem akzeptieren musste: dass der Geldfluss aus der EU-Hauptstadt spärlicher rinnen würde. Unwahr an Aznars Behauptung war nur, dass er das schon immer gesagt habe. Aber er hatte Recht in der Hauptsache: Spanien war nicht mehr der arme Verwandte hinter den Pyrenäen, sondern eine der am kräftigsten wachsenden Wirtschaften der Europäischen Union. Das Preußen des Südens: verlässlich, ernsthaft, zielstrebig. Vorbei die Zeiten der Bettelei in Brüssel. Aznars sozialistischer Nachfolger José Luis Rodríguez Zapatero, Regierungschef von 2004 bis 2011, forderte keine Geschenke mehr. Er forderte seinen Platz am Tisch der Großen: im Kreis der G-20. Spanien war erwachsen geworden. Es war kein Problemkind mehr. Spanien war endlich Europa – also ein Teil der Lösung.
»Als junger Mann«, sagt der Soziologe Emilio Lamo de Espinosa, Jahrgang 1946, »bin ich mit einem unbezwingbaren Minderwertigkeitskomplex durch Europa gereist und – warum soll ich’s nicht sagen – fast beschämt, ein Spanier zu sein. Wenn meine Kinder reisen, tun sie es nicht komplexbeladen, sondern stolz. Es gibt nichts, wessen sie sich schämen müssten. Ganz im Gegenteil.«
Spanien, eine Erfolgsgeschichte. Aber sie ist hier noch nicht ganz zu Ende.
Am Telefon. Ich verabrede mich mit einem Spanier zum Interview: »Damit Sie mich erkennen, ich sehe so aus, wie Sie sich einen Deutschen vorstellen, groß, blond, Brille …« – »Und ich bin der typische Spanier, dunkelhaarig, klein, hässlich …« Großes Gelächter am anderen Ende der Leitung.
Gewöhnlich zeichnen sich Spanier nicht durch den Hang zur Selbstironie aus, aber wenn sie »groß und blond« hören, fällt ihnen zur Selbstbeschreibung sofort »klein und hässlich« ein. Antonio Banderas hin oder her. Meinen sie das ernst? Ja, ein bisschen. Im Juni 2008 hatte es die spanische Fußballnationalmannschaft ins Viertelfinale der Europameisterschaft geschafft. Der Gegner würde Italien sein. Am Vorabend zeigte der Fernsehunterhalter Andreu Buenafuente in seinem Nachtprogramm erst ein Bild des gut aussehenden italienischen Nationaltrainers Roberto Donadoni und dann eines des spanischen Trainers Luis Aragonés mit seinem verknautschten Arbeitergesicht. Das Publikum lachte, und Buenafuente grinste: Seien wir ehrlich – können wir die besiegen?
Irgendwo sitzt da noch ein Zweifel. Können wir das? Sind wir so schön wie die anderen? Seit 44 Jahren hatte das spanische Nationalteam kein wichtiges Turnier mehr gewonnen, obwohl der spanische Fußball doch Weltruhm besaß. Alle zerbrachen sich den Kopf über das Rätsel des fußballerischen Missgeschicks der Nationalmannschaft. War da ein kollektives Unterlegenheitsgefühl im Spiel – der unbezwingbare Minderwertigkeitskomplex von Lamo de Espinosa? Oder lag es doch am unvollständig entwickelten Nationalstolz, weil baskische und katalanische Spieler lieber für ihre regionale statt für die spanische Fahne gespielt hätten? Beides gab es und gibt es: Mangelndes Vertrauen in die eigenen Leistungen und ein zersplittertes Nationalgefühl. Beides vergaßen die spanischen Spieler bei der EM 2008. Sie besiegten die Italiener, dann die Russen, dann die Deutschen. Spanien wurde Europameister, zwei Jahre später Weltmeister und dann nochmal Europameister.
Viele Spanier sind immer noch verwundert über die eigenen Erfolge. Sie glauben es kaum, dass die spanischen Züge pünktlicher sind als die deutschen, dass der Madrider Flughafen, der in den 1980er Jahren noch ein Provinzflughafen war, fast so viel Verkehr bewältigt wie der Frankfurter und dass sie in der ganzen Welt bei Zara einkaufen können. Nur dass der berühmteste Koch der Welt, Ferran Adrià, ein Spanier ist, das wundert sie nicht. Auf ihre Küche haben sie immer große Stücke gehalten. An Heimatstolz fehlt es den Spaniern nicht. »Como aquí no se vive en ninguna parte« – »so (gut) wie hier lebt man nirgends«, ist ihre felsenfeste Überzeugung. Sie halten sich für Weltmeister in der Kunst, das Leben zu genießen, und da ist was dran. Allerdings ist mit dem »hier« meistens nicht das ganze Land gemeint, sondern der kleine Zipfel Land, auf den einen die Geburt verschlagen hat: das eigene Dorf, die Stadt, die Region. Die patria chica – das kleine Vaterland. Wenn außerhalb Spaniens vor allem vom katalanischen und baskischen Nationalismus zu hören ist, dann deshalb, weil dort die militantesten Separatisten zu Hause sind, nicht, weil Spanien ansonsten ein homogenes Ganzes wäre, eine unverbrüchliche Einheit. Asturianer behaupten, dass sie sich in Andalusien wie im Ausland fühlten, Valencianer wollen nichts mit ihren nördlichen Nachbarn, den Katalanen, zu schaffen haben, und die Kanaren stehen mit ihren Füßen sowieso in Afrika. Spanien ist zerbrechlicher als man außerhalb Spaniens ahnt.
Am Tag nach dem EM-Sieg ihrer Fußballnationalmannschaft über die italienische erfuhren die Spanier von einem fast noch schöneren Sieg: Spanien habe Italien beim Prokopfeinkommen um ein paar weitere Punkte abgehängt. Spanien vor Italien, dem Gründungsmitglied der Europäischen Gemeinschaft! – Ein paar Wochen später gab die Banco de España bekannt, dass die spanische Wirtschaft im zweiten Quartal 2008 zum ersten Mal nach vierzehn unglaublichen Boomjahren nicht mehr gewachsen sei. Das war der Anfang vom Absturz. Spanien erlitt einen Schwächeanfall, von dem es sich nicht so schnell erholen sollte. Die sozialistische Regierung entschuldigte sich damit, dass die Krise aus den USA nach Spanien herübergeschwappt sei, was die konservative Opposition nicht gelten ließ: Die Unfähigkeit der Sozialisten sei für den Schlamassel verantwortlich. Es war alles wie üblich: Regierung und Opposition schlugen sich gegenseitig die Köpfe ein. Aber keine von beiden ließ einen Zweifel daran, dass es mit Spanien demnächst wieder aufwärts gehen werde. Die Krise: nur eine Panne, die bald behoben sei.
Es dauerte dann doch etwas länger. Lang genug, um die Selbstzweifel wieder hochkommen zu lassen. Abends beim Rotwein hörte ich die alte Litanei: Wir haben’s einfach nicht raus. Wir sind eben keine Deutschen. Hier wollen alle bloß schnelles Geld verdienen. Fehlte nur noch, dass jemand Spanien zum nördlichsten Land Afrikas erklärt hätte. Das tat aber keiner. Das wissen meine Freunde auch: Spanien ist in Europa angekommen. Beinahe jedenfalls.
Ankunft
Mission: Impossible – über den Kampf der Spanier mit dem Englischen
»Spanisch zu sprechen ist eine Frage des Überlebens.« (Rosa)
Es ist leicht, sich mit Spaniern zu verstehen. Wenn man sie versteht. Leider sprechen sie kein Englisch. Als Tom Cruise im Juli 2000 zur Spanien-Premiere von »Mission: Imposible II« nach Madrid reiste, ließ er sich im Kino von einem spanischen Fernsehreporter interviewen. Ein Dolmetscher musste die Fragen ins Englische und die Antworten ins Spanische bringen. Weder war es dem Sender eingefallen, einen Englisch sprechenden Kollegen auf den Termin zu schicken, noch war es dem Reporter peinlich, auf die Dienste eines Dolmetschers angewiesen zu sein. Schlechte oder gar keine Englischkenntnisse sind keine Schande, sondern der Normalfall. Während einer Debatte auf dem Weltwirtschaftsforum 2010 in Davos saß Spaniens damaliger Regierungschef José Luis Rodríguez Zapatero zehn Minuten lang hilflos auf dem Podium, weil er die anderen, Englisch sprechenden Redner nicht verstand und der Übersetzungsdienst versagte. Zapateros Vorgänger José María Aznar gab sich Mühe und hielt als Ex-Premier Vorträge an der Washingtoner Georgetown-Universität – in solch exotischem Englisch, dass es nur der Gutwilligkeit seiner Zuhörer zu danken war, dass sie ihn nicht auslachten. Das tun seitdem die Spanier, wenn sie den Youtube-Hit »Aznar en Georgetown« anklicken.
Nun gut, das klingt nach mutwilliger Verallgemeinerung. Pedro Sánchez, der 2018 ins Amt gewählte Ministerpräsident, spricht ein flüssiges Englisch. Aber er bleibt eine Ausnahme. Als die Europäische Kommission Anfang 2012 die Europäer nach ihren Fremdsprachenkenntnissen befragte, sagten 46 Prozent der Spanier, dass sie außer ihrer Muttersprache mindestens noch eine andere Sprache gut genug beherrschten, um sich darin zu unterhalten. Das war einer der niedrigsten Werte in der EU. Näher betrachtet, sah das Ergebnis noch unbefriedigender aus: Da es in Spanien auch katalanische, baskische und galicische Muttersprachler gibt, gehörten zu den meistgesprochenen Fremdsprachen einerseits Spanisch (mit 16 Prozent) und andererseits Katalanisch (mit 11 Prozent), was dem ausländischen Besucher nicht weiterhilft. Halbwegs flüssiges Englisch sprachen nach eigenem Bekunden nur 22 Prozent der Befragten (in Deutschland waren es 56 Prozent). Wobei Ex-Premier Aznar nicht der einzige Spanier ist, der ein eher unorthodoxes Englisch spricht. Da wären noch die Flugbegleiter. Im Zug geht ein herzliches »Ssenkju foa trewelling wis Deutsche Bahn« noch durch, aber im Flugzeug möchte man im Fall der Fälle gerne die Anweisungen zur Benutzung der Notrutsche verstehen. Als meine spanische Frau Rosa und ich einmal nach Mallorca flogen und fasziniert dem vollkommen unverständlichen Begrüßungsenglisch der Iberia-Stewardess lauschten, meinte Rosa plötzlich: »Siehst du, Spanisch zu sprechen ist eine Frage des Überlebens.« Es gibt natürlich Ausnahmen. Manche Spanier beherrschen Englisch wie ihre Muttersprache.
Den Wert von Fremdsprachen erkennen die Spanier durchaus an. In der oben erwähnten Umfrage sagten mehr als die Hälfte der Spanier, dass jedermann in der Europäischen Union mindestens zwei Fremdsprachen beherrschen sollte (von den Deutschen fand das nur ein gutes Viertel). Der Wille ist da. Schon 1900, als sich Spanien auf seinen langen Weg nach Europa machte, bemerkten die Autoren eines königlichen Dekretes zur Reform der Sekundarschule: »Um die unheilvolle Isolierung, in der wir gelebt haben, hinter uns zu lassen, ist die Kenntnis der lebenden Sprachen unvermeidlich.« Viele Jahrzehnte war Französisch die meistgelehrte Fremdsprache, seit den 1970er Jahren ist das Englische auf dem Vormarsch. Heute wird selbst in der Vorschule Englisch unterrichtet. Aber gute Ergebnisse lassen auf sich warten. Eine deutsche Freundin, die in Madrid einige Jahre jungen Erwachsenen Englisch-Unterricht gab, stöhnte: »Sie können he und she nicht unterscheiden!« (Was daran liegen mag, dass es im Spanischen weder den H- noch den SCH-Laut gibt.) Die Spanier sind selbst etwas verzweifelt. »Wissenschaftlich gesichert ist, dass kein fehlendes Chromosom es dem Spanier unmöglich macht, korrektes Englisch zu sprechen«, schrieb eine El País-Autorin 2008 in ihrem Artikel: »Warum kostet es uns solche Mühe, Englisch zu sprechen?« Klare Antworten auf ihre Frage hatte die Autorin auch nicht. Lange machten die Spanier das schlechte franquistische Bildungssystem verantwortlich, aber Franco ist nun auch schon lange tot. Wahrscheinlicher ist, dass das Bildungssystem immer noch nicht auf der Höhe der Zeit ist. Mitschreiben statt mitreden ist an Schule und Uni die Regel. Die Spanier lernen Englisch schreiben und Englisch lesen, aber nicht Englisch sprechen. Kino und Fernsehen in Originalversion würden helfen, das Angebot ist auch da, aber wie die Deutschen schauen sich die meisten Spanier Filme und Serien lieber in synchronisierter Fassung an. Stattdessen geben sie viel Geld aus, um ihre Kinder zum Englischkurs nach Großbritannien oder Irland zu schicken. Das hilft, aber es hilft nicht immer. Dem Lernerfolg steht die Sehnsucht nach Landsleuten im Wege: Spanier sind im Ausland gerne unter sich. Sie finden sich selbst unterhaltsamer als ihre Gastgeber, und ihr eigenes Essen schmeckt ihnen auch besser. Sie lassen es sich gut gehen, aber sie lernen kein Englisch.
Zum Glück für die Spanier ist Spanisch eine weit verbreitete Sprache. Die Römer brachten das Lateinische auf die Iberische Halbinsel, woraus sich im Laufe der Jahrhunderte das Spanische und Portugiesische entwickelten (und das Katalanische und Galicische). Die Spanier brachten ihre Sprache nach Amerika, nachdem Kolumbus ihnen vor 500 Jahren die Neue Welt entdeckt hatte. Und die Lateinamerikaner sind gerade dabei, das Spanische in die USA zu bringen, diesmal nicht als Eroberer, sondern als Küchenhilfen. Das Instituto Cervantes (das spanische Gegenstück zum deutschen Goethe-Institut) berichtete 2008, dass in den USA bereits 45 Millionen Spanischsprecher lebten, mehr als in Spanien selbst; nur in Mexiko mit seinen gut 120 Millionen Einwohnern gibt es mehr spanische Muttersprachler. Der US-Erfolg ihrer Sprache gefällt den Spaniern und hat ihren Filmstars – Antonio Banderas, Penélope Cruz oder Javier Bardem – den Weg nach Hollywood geebnet. Würden sich das Arabische oder das Rumänische ähnlich schnell in Spanien ausbreiten, gefiele das den Spaniern wahrscheinlich weniger. Außerhalb Spaniens und an Spaniens Rändern nennen die Menschen ihre spanische Muttersprache castellano, also Kastilisch, weil das Spanische in Spaniens Herzregion Kastilien entstand. Heute ist es den meisten Studien zufolge die nach Chinesisch am weitesten verbreitete Sprache der Welt.
Der Rang als Weltsprache hat das Spanischlernen populär gemacht, auch in Deutschland, wo Spanisch (mit einigem Abstand) nach Englisch und Französisch die meistgelehrte Sprache ist. Spanien profitiert von der Beliebtheit seiner Sprache, gut 150 000 Ausländer kommen im Jahr, um Spanisch in Spanien zu lernen. Wer vorher schon eine andere romanische Sprache gelernt hat, dem wird Spanisch nicht allzu schwerfallen. Und zum Glück für den Spanischlernenden kommt er mit seinem spanischen Spanisch in der ganzen spanischsprachigen Welt durch. Man wird die Herkunft seiner Spanischkenntnisse an seinem spanisch gelispelten Z und an der geringen Melodiosität seiner Aussprache erkennen, aber man wird ihn verstehen. Und umgekehrt wird er sich nach wenigen Tagen in andere Akzente des Spanischen eingehört haben.
Wer sich mit seinem ersten unbeholfenen Spanisch unter die Spanier begibt, wird schnell belohnt: »¡Qué bien hablas!«, bekommt er zu hören, wie gut du sprichst! Wer, wie die meisten Spanier, im Kampf mit fremden Sprachen regelmäßig der Unterlegene ist, der hat großen Respekt vor jedem, der sich ins Abenteuer stürzt, die seine zu lernen. Zum Glück ist es leicht, sich mit Spaniern zu verstehen.
Kommunikationswunder und -weh – wie Spanier miteinander reden
»Du musst laut sprechen. Wie soll man dich sonst verstehen, wenn alle gleichzeitig reden?« (Piedi)
Einer Vorstellung spanischer Gesprächskunst wohnte ich zum ersten Mal im Sommer 1990 bei. Wir saßen mit einer Gruppe von Freunden in einer Berliner Küche und hatten zwei Spanierinnen zu Besuch. Die eine war ein Jahr lang als Erasmus-Studentin in Berlin gewesen und sprach flüssiges Deutsch, die andere, mit ein paar Deutschkursen im Gepäck, hatte nach einem weinseligen Abend ihre Hemmungen abgeworfen und redete drauflos, als sei sie in Deutschland geboren. Die beiden erzählten Fluganekdoten. Uns Deutschen gingen die Ohren über. Wir saßen da, hörten zu und konnten nicht mithalten. Wir fühlten uns wie Rollstuhlfahrer, die Kubanern beim Salsatanzen zuschauen. Die Spanierinnen erzählten ihre Geschichten mit Witz, Begeisterung und Spielfreude. Eine versuchte die andere zu übertreffen. Mit Gefühl für Tempo und Rhythmus. Mal graziös, mal derb. Voller Stegreifmetaphern: »Auf dem Flughafen war es so voll wie … in Japan.« Was zählte, war die Lust, den Moment zu leben. Nichts anderes im Kopf, als sich zu unterhalten und uns zu unterhalten.
Wenn Spanier einen schönen Abend unter Freunden verbracht haben, werden sie wahrscheinlich am nächsten Tag erzählen: »¡Qué risas!« – »was haben wir gelacht!« Und sie erstrahlen in Erinnerung an ihr eigenes Gelächter. Ein Deutscher kann sich einen schönen Abend vorstellen, bei dem nicht gelacht wurde. Eine anregende Unterhaltung muss nicht zum Lachen sein. Für einen Spanier gehört es jedoch dazu. Er lernt, andere zum Lachen zu bringen. Er beherrscht die Kunst der Anekdote. Und er hat ein paar Witze auf Lager. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass auf einem Fest jemand anfängt, Witze zu erzählen. Andere lassen sich animieren und erzählen etwas aus ihrem Repertoire. Das kann sich lange hinziehen. Und ziemlich wahrscheinlich werden die Witze bald schmutziger. Die Spanier lieben schmutzige Witze. Und sie lieben es zu fluchen.
Es gibt diese Theorie, dass sich an den Flüchen eines Landes der Nationalcharakter ablesen lasse. Das ist wahrscheinlich Unsinn, aber doch unterhaltsam. Im Deutschen wird vor allem fäkal und anal gezetert, im Rest der Welt dagegen hauptsächlich sexuell. Die Spanier können beides. Sie sind die Weltmeister der Vulgärsprache, sie führen ständig die Möse (»¡coño!«) und das Vögeln (»¡joder!«) im Mund, erfreuen sich aber genauso am Kacken. Wenn der Spanier auf was scheißt, will er die beschriebene Sache entweihen. Statt »Verdammt!« ruft er »¡Me cago en la leche!«: Ich kacke in die Milch. Das ist ziemlich seltsam und bedeutet, dass er in die Muttermilch kackt, die sein Gegenüber oder ihn selbst aufgezogen hat. Womit er symbolisch die ganze Menschheit in den Dreck zieht.
Das Milchkacken hört man in Spanien so oft, dass sich niemand mehr dran stört. Erst verschärftere Versionen (»¡Me cago en Dios!« – also auf Gott) gelten als ordinär oder ehrlos (»¡Me cago en tus muertos!« – auf deine toten Vorfahren). Damit ihnen nicht aus Versehen ein allzu böser Fluch herausrutscht, haben sich viele Spanier eine offene Version ihrer Verwünschung angewöhnt: Sie rufen nur noch »¡Me cago en!« Sollen sich die anderen selber denken, was da angeschissen wird. Obwohl ich diese ständigen Ausbrüche seit Jahren höre, habe ich mich immer noch nicht ganz an sie gewöhnt. Vor einiger Zeit ging ich mit einem befreundeten Ehepaar spazieren, während der kleine Sohn ständig an der Bordsteinkante herumturnte. Bis es Paz, der Mutter, zu viel wurde. »¡Me cago en la madre que te parió!«, rief sie entnervt: Ich kacke auf die Mutter, die dich geboren hat. Sie verstand gar nicht, warum ich so lachen musste.
Wer zum ersten Mal nach Spanien kommt und kein Spanisch versteht, der glaubt, in einem Land des ewigen Streits gelandet zu sein. Nicht wegen der Kraftausdrücke, die er noch nicht versteht, sondern wegen der Lautstärke. Als ich vor vielen Jahren meine spanische Freundin Marián im Wagen vom Flughafen in Frankfurt abholte, machten wir unterwegs Halt an einer Autobahnraststätte. Wir setzten uns in die Cafeteria und erzählten uns was. Da merkte Marián plötzlich auf und fragte mich: »Hörst du was?« Ich hörte nichts. »Eben,« sagte sie, »man hört hier nichts.« In der Cafeteria saßen lauter Deutsche und unterhielten sich, und man hörte sie nicht. Spanier hört man. Vom Weltraum aus kann man die Chinesische Mauer sehen und die Lichter von Las Vegas, und Spanien hört man. Spanier brüllen sich an. Öffentlich. Sie treffen sich lieber in der Kneipe als zu Hause, meistens in größeren Gruppen. Es fängt damit an, dass einer was zu erzählen hat und alle es hören sollen. Ein anderer hat aber auch was zu erzählen und quatscht dem ersten dazwischen, der deswegen noch lange nicht aufhört zu reden, sondern nur etwas lauter spricht, der andere aber auch, und der dritte, der sich einmischt, noch lauter. So geht das.
Zum Bedürfnis, den anderen zu übertönen, kommt die Lust an der Inszenierung. Spanier spielen mit Worten gerne ganze Szenen aus dem Leben nach. Statt der Kunst der Reduzierung üben sie die Kunst der Ausschmückung. Dialoge werden nicht zusammengefasst, sondern vorgeführt: »Él dice … yo digo … él dice … yo digo …« – »er sagt … ich sage … er sagt … ich sage …« Ein nacherzählter Streit wird in der Erzählung wahrscheinlich viel heftiger ausgefochten, als er stattgefunden hat. Für einen ahnungslosen Deutschen kann das sehr böse klingen. Zumal die Spanier zum Verzweifeln schnell reden und ihre Sprache nicht besonders melodiös ist. Sie schießen ihre Worte heraus wie Maschinengewehrsalven. Kein Wunder, dass sich der Neuankömmling erschreckt. Bald wird er feststellen, dass alles Theater ist. Dass die Spanier lachen und sich gern haben.
Geborene Schauspieler. Vor einer Kamera blühen sie auf. Auf der Bühne werden sie so theatralisch, als sei das 19. Jahrhundert noch nicht zu Ende gegangen, woran aber die Regisseure schuld sind. Fernsehjournalisten sind dann am besten, wenn sie live vor der Kamera stehen. Als am 11. September 2001 der Terror über New York hereinbrach, musste die Präsentatorin Ana Blanco im ersten Programm des Staatssenders TVE durch eine Sendung führen, in der nichts vorgeplant war und die sich statt über 45 Minuten über mehr als sieben Stunden hinzog. Nie fehlten ihr die Worte, nie verhaspelte sie sich. Seit ich mich an spanische Live-Übertragungen von Fußballspielen (oder vom Eurovisions-Wettbewerb) gewöhnt habe, klingen mir die deutschen fad. Und erst im Radio: Da überkommen einen die Fußballreportagen wie Amazonasgewitter. »¡Gol gol gol gol gol goooooooooool!«
Die Redekunst stößt an ihre Grenzen, wenn bei einem Gespräch etwas herauskommen soll. Sagen wir: bei einer Hausversammlung. Ich habe wunderbare Nachbarn. Wenn sich zwei im Treppenhaus über den Weg laufen, bleiben sie für einen Moment stehen und tauschen die wichtigsten Neuigkeiten aus. Mindestens das Wetter gibt verlässlich zu reden, weil die Madrider immer finden, dass es gerade zu kalt oder zu heiß ist. Soweit alles prima – bis wir uns im neonbeleuchteten Keller unserer Hausverwaltung treffen, um die Jahresendabrechnung abzusegnen, den Einbau eines Fahrstuhls zu erwägen oder notwendige Renovierungsarbeiten auf den Weg zu bringen. Die Hausversammlungen haben die geheime Funktion einer Gruppentherapie. Jeder entledigt sich der Gewichte, die ihm auf der Seele liegen. Es gibt eine Tagesordnung, aber niemand hält sich daran. Zwecklos, seine Hand zu heben, um so ums Wort zu bitten: Es reden sowieso alle gleichzeitig. In diesem Moment fühle ich mich unsichtbar. (So wie ich mich lange an Kneipentresen unsichtbar fühlte, weil ich dumm darauf wartete, dass mir der Barmann mit einem Blick zu verstehen gäbe, dass ich an der Reihe sei. Hier muss man rufen wie alle anderen auch: »¡¡Oye!!, ¡¡ponme una caña!!« – »hör mal, stell mir ein Bier hin!«) Einmal kam die Idee auf, die alte Hausmeisterwohnung, die wir über etliche Jahre vermietet hatten, zu verkaufen, doch zwei der Nachbarn stellten sich quer. Statt über das Für und Wider eines möglichen Verkaufs zu debattieren, begannen alle gleichzeitig lautstark ihr Herz zu entlasten. »Die im vierten Stock rechts wollen eine ihrer Terrassen in ein Zimmer umwandeln, das ist illegal!«, »Dieser Mieter in der Hausmeisterwohnung hat ein paar Monate seine Miete nicht bezahlt, was für ein dreister Kerl!«, »Es sieht ganz so aus, als ob bei uns jeder Rollläden in der Farbe anbringt, die ihm gerade passt!«, »Als ich Präsident der Hausgemeinschaft war, habe ich drei paar Schuhe verschlissen, um Kostenvoranschläge für eine Grundrenovierung unseres Hauses zu besorgen!«, »Und was ist mit den Subventionen, die uns die Stadtverwaltung versprochen hat?« Viele Jahre später geschah ein Wunder. Alle Hausbewohner einigten sich, und die Hausmeisterwohnung wurde verkauft.
Auf solchen Versammlungen herrscht wirklich keine gute Stimmung. Einige der Nachbarn beschimpfen sich ernsthaft. Verblüffenderweise ist beim Bier danach alle schlechte Laune verflogen. Luisa, Rentnerin und die redseligste von allen, beschreibt ihre letzte Blasenoperation als komisches Abenteuer, und schon lacht der ganze Haufen. Die Spanier sind nicht nachtragend, scheint mir. Oder vielleicht sind sie doch nachtragend, aber sie lassen sich davon nicht den Abend verderben. Deswegen halten auch spanische Familien besser zusammen als deutsche. Nicht dass Eltern und Kinder keine Konflikte durchmachten. Aber sie ignorieren die Konflikte. »Warum soll ich mich mit meinem Vater streiten? Er wird sich doch nicht ändern«, sagen sie. Wir Deutschen diskutieren die Dinge gerne aus. Die Spanier nicht so gerne. Das ist sympathisch. Und manchmal fatal.
Die Spanier beherrschen die Kunst der Unterhaltung, aber ihre Gesprächskultur ist ein Desaster. Hemos discutido – wir haben diskutiert – bedeutet: Wir haben uns gestritten. Unterschiedlicher Meinung zu sein, ist ein Anlass für Streit, nicht für eine fruchtbare Diskussion. »No te quiero convencer«, sagt einer zum anderen, »ich will dich nicht überzeugen.« Dass aus These und Antithese eine Synthese erwachsen könnte, hält ein Spanier für ganz unmöglich. Eine deutsche Erasmus-Studentin in Madrid erzählte mir, wie sie während eines Seminars ihrem Professor widersprach. Der antwortete: »Du siehst, wir sind nicht derselben Meinung.« Womit der Widerspruch erledigt war.
Die Unlust, abweichenden Überzeugungen mit Argumenten zu begegnen, führt im Privaten dazu, dass die meisten Spanier Diskussionen aus dem Wege gehen. Über Politik wird so lange geredet, wie sich alle einig sind. Kommen ernsthafte Meinungsverschiedenheiten auf, ist der beliebteste Ausweg der Themenwechsel. Ist die Debatte öffentlich, wird gnaden- und fruchtlos weitergeredet. Fernsehen und Radio füllen ihre Sendezeit mit tertulias, stundenlangen Gesprächsrunden, in der die Teilnehmer von nichts eine Ahnung, aber zu allem eine Meinung haben. (Ja, das ist böse zugespitzt. Aber weniger, als Sie denken.) Weil sich die tertulianos gewöhnlich gegenseitig ins Wort fallen, erfand TVE ein Format, das den Diskutanten Fesseln anlegte: In der wöchentlichen Debattensendung 59 segundos durften die Teilnehmer nicht länger als 59 Sekunden am Stück sprechen, dann versank das Mikrofon vor ihnen im Pult. So redeten immerhin nicht alle gleichzeitig, ansonsten verbesserte es die Qualität der Debatte kaum. Die wenigsten der tertulianos haben ein Interesse, ihre Zuhörer von irgendetwas zu überzeugen. Sie hauen sich bloß ihre Meinungen um die Ohren. Den Spaniern fällt dazu ein Goya-Bild ein: Im »Duelo a garrotazos« schlagen zwei Gestalten mit Knüppeln gegenseitig aufeinander ein, während sie bis zu den Knien im Dreck stecken. Leider hat sich Spaniens Streitkultur in den vergangenen 200 Jahren wenig fortentwickelt.
Das beunruhigt auch die klügeren Spanier. Fernando Savater, einer der einflussreichsten Philosophen Spaniens, schrieb 1997 in seinem Essay El valor de educar (deutsch: Darum Erziehung