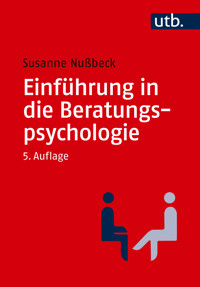Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sprachbeherrschung ist eine unerlässliche Voraussetzung für eine qualifizierte Bildung und Ausbildung. Unterschiede in der Verfügbarkeit von Sprache machen sich bereits im Kindergarten bemerkbar und führen zu eingeschränkten Voraussetzungen für schulisches Lernen. Im Erwachsenenalter können erworbene Sprachstörungen (Aphasien) die bisherige persönliche, berufliche und soziale Situation schlagartig verändern. Dieser Band gibt einen differenzierten Überblick über Laut- und Schriftsprachentwicklung, mögliche Störungen im Kindes- und Erwachsenenalter sowie Interventionsmöglichkeiten einschließlich alternativer Kommunikationsmittel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2007
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Module angewandter Psychologie Herausgegeben von Johanna Hartung
Sprachbeherrschung ist eine unerlässliche Voraussetzung für eine qualifizierte Bildung und Ausbildung. Unterschiede in der Verfügbarkeit von Sprache machen sich bereits im Kindergarten bemerkbar und führen zu eingeschränkten Voraussetzungen für schulisches Lernen. Im Erwachsenenalter können erworbene Sprachstörungen (Aphasien) die bisherige persönliche, berufliche und soziale Situation schlagartig verändern. Dieser Band gibt einen differenzierten Überblick über Laut- und Schriftsprachentwicklung, mögliche Störungen im Kindes- und Erwachsenenalter sowie Interventionsmöglichkeiten einschließlich alternativer Kommunikationsmittel.
Susanne Nußbeck
Sprache - Entwicklung, Störungen und Intervention
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikrofilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
1. Auflage 2007 Alle Rechte vorbehalten © 2007 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart Umschlag: Gestaltungskonzept Peter Horlacher Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG, Stuttgart Printed in Germany
Print: 978-3-17-019292-8
E-Book-Formate
pdf:
978-3-17-022787-3
epub:
978-3-17-028056-4
Inhaltsverzeichnis
Einführung
1 Aspekte der Sprache und theoretische Zugänge
1.1 Komponenten der Sprache
1.2 Das Sprachlernproblem
2 Sprachentwicklung
2.1 Spracherwerb im Säuglings- und Kleinkindalter
2.1.1 Prosodie und Phonologie
2.1.2 Konzeptbildung und Lexikon
2.1.3 Syntax und Grammatik
2.1.4 Pragmatik
2.2 Sprachentwicklung und -verarbeitung über die Lebensspanne
2.3 Schriftspracherwerb
2.4 Spracherwerb bei Zweisprachigkeit
3 Ansprüche an die Wirksamkeit von Interventionen
4 Beeinträchtigungen des Spracherwerbs und Interventionen
4.1 Sprachentwicklung bei kognitiver Beeinträchtigung und Interventionen
4.1.1 Sprachentwicklungsverzögerung
4.1.2 Sprachentwicklung bei geistiger Behinderung und genetischen Syndromen
4.2 Sprachentwicklung bei Störungen aus dem Autismusspektrum und Interventionen
4.3 Sprachentwicklung bei Hörstörung und Interventionen
4.4 Spezifische Sprachentwicklungsstörung und Interventionen
4.5 Aussprachestörungen und Interventionen
4.6 Störungen des Redeflusses und Interventionen
4.6.1 Stottern
4.6.2 Poltern
4.7 Kindliche Aphasie und Interventionen
4.8 Elektiver Mutismus und Interventionen
4.9 Störungen des Schriftspracherwerbs und Interventionen
5 Erworbene Sprachstörungen bei Erwachsenen
6 Alternative Sprachsysteme
6.1 Gebärdensprache
6.2 Unterstützte Kommunikation
Glossar
Literatur
Stichwortverzeichnis
Einführung
„Du bist meine Mama, Fridtjof hat keine Mama“, sagte mein mittlerer Sohn im Alter von knapp zwei Jahren über seinen älteren Bruder und offenbarte mit diesem kurzen Satz zweierlei: Er hatte in seinem jungen Alter bereits wesentliche Sprachstrukturen erfasst, er konnte Personal- und Possessivpronomen richtig verwenden, Substantive verneinen und Verben konjugieren, während seine kognitiven Fähigkeiten nicht ausreichten, zu sehen, dass eine Mutter mehrere Kinder haben kann, ganz abgesehen von den tiefenpsychologisch möglichen Deutungen! Spracherwerb geschieht unbemerkt – wie von selbst. Eltern erwarten zwar sehnsüchtig das erste Wort ihres Kindes, machen sich aber zumeist keine Gedanken darüber, welche großartigen Leistungen es damit erbracht hat. Wenn Sprachentwicklung unvollkommen ist oder ganz ausbleibt, erworbene Sprache verloren geht, wird deutlich, welche besondere Rolle der Sprache im menschlichen Zusammenleben zukommt.
Wenn man Menschen begegnet, entscheidet oft der erste Eindruck über Sympathie und Antipathie, aber ob man einen Menschen „kennt“, „weiß“, was er denkt, wie er ist, offenbart sich erst, wenn er sich sprachlich äußert, wenn er seine Gedanken mitteilt, wenn er argumentiert oder streitet. Menschen, die nicht sprechen, sich nicht mündlich oder schriftlich angemessen ausdrücken können, die nicht verstehen, werden schnell als „dumm“ angesehen, wie auch der Ausdruck „doof“ seinen Ursprung mit dem Wort „taub“ teilt. Nicht nur der gesprochenen Sprache, auch der Schriftsprache kommt in unserer Kultur eine große Bedeutung zu. Sprache, Sprachbeherrschung in Wort und Schrift, sind unerlässliche Voraussetzungen einer qualifizierten Bildung und Ausbildung. Kinder und Erwachsene, die sprachlich eingeschränkt sind, haben einen erschwerten Zugang zur Teilhabe am sozialen Leben und zum allgemeinen Weltwissen. Unterschiede in der Verfügbarkeit von Sprache machen sich bereits im Kindergarten bemerkbar und führen zu eingeschränkten Voraussetzungen für schulisches Lernen. Besondere Risikogruppen für Sprachentwicklungsverzögerungen und -störungen sind Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund, aus sozioökonomisch schwachen Familien und Kinder mit individuellen Entwicklungsbesonderheiten wie Spezifischen Sprachentwicklungsstörungen, Hörstörungen, genetischen Syndromen oder Lernbeeinträchtigungen. Der Früherkennung und der frühen Intervention kommt daher eine besondere Rolle zu.
Sprache ist ein komplexes Geschehen, das mehrere Teilfähigkeiten und -fertigkeiten beinhaltet, die sie konstituieren und die das Kind erwerben muss. Dabei reicht Imitation der Erwachsenensprache als Erklärung für den Spracherwerb nicht aus, denn das Kind versteht Sätze, die es nie vorher gehört hat, und produziert selbst neue. Es muss also die Strukturen und Regeln der Sprache suchen, erkennen, abstrahieren, speichern und anwenden. Wie es das in diesem frühen Alter kann und welche Voraussetzungen es mitbringt, ist nach einer Klärung einiger grundlegender Begriffe Gegenstand des zweiten Kapitels. Die meisten Kinder erwerben die nötigen Fähigkeiten und Fertigkeiten scheinbar mühelos, einige jedoch haben aus unterschiedlichen Gründen Schwierigkeiten, die manchmal bis ins Erwachsenenalter andauern und gezielte Interventionen erfordern. Welche Ansprüche an Interventionen gestellt werden müssen, wird im dritten Kapitel geklärt, bevor im vierten die verschiedenen Sprachentwicklungsstörungen mit grundlegenden Informationen zu den Ursachen und Interventionsmöglichkeiten beschrieben werden.
Im Erwachsenenalter können durch beispielsweise Schlaganfälle, Tumore, andere hirnorganische Erkrankungen oder Unfälle erworbene Sprachstörungen (Aphasien) als kritisches Lebensereignis die bisherige persönliche, berufliche und soziale Situation schlagartig verändern, so dass spezifische Interventionen in Bezug auf die Wiedererlangung von Sprachkompetenzen und/oder die Unterstützung bei der Bewältigung des Verlustes nötig sind. Das ist Gegenstand des fünften Kapitels.
Manche Menschen werden nie die volle Lautsprachkompetenz erreichen. Eine besondere Gruppe sind gehörlose Menschen, die über Generationen hinweg ein Sprachsystem in einer anderen Modalität entwickelt haben, die Gebärdensprachen. Gebärdensprachen sind nicht nur für den naiven Betrachter faszinierend, sie sind in den letzten Jahrzehnten auch in den Blick psycholinguistischer und neuropsychologischer Forschung gerückt, weil sie lautsprachorientierte, als sicher angenommene Erkenntnisse über Sprachaufbau und -verarbeitung teilweise relativieren, teilweise aber auch auf einer modalitätsunabhängigen Ebene bestätigen.
Personen, die nie Sprache entwickelt oder entwickelte Sprache unwiederbringlich verloren haben, werden mit den Mitteln der Unterstützten Kommunikation (UK) alternative Möglichkeiten angeboten, ihre soziale Teilhabe zu erhalten oder zu erweitern. Die vielfältigen Angebote werden mit ihren Voraussetzungen und Zielen in einem abschließenden Kapitel beschrieben.
Es gibt inzwischen eine Fülle von Studien aus unterschiedlichen Disziplinen zu allen mit Sprache, Spracherwerb und Sprachstörungen zusammenhängenden Themen. Jedes einzelne könnte mehr als ein Buch füllen, so dass eine Auswahl immer unvollkommen bleiben muss. Wenn mit diesem Buch ein differenzierter Überblick gegeben werden kann und bei manchem Leser das Interesse an vertiefenden Studien geweckt wird, ist sein Ziel erreicht.
1 Aspekte der Sprache und theoretische Zugänge
1.1 Komponenten der Sprache
Wenn wir sprechen, machen wir uns meist keine Gedanken darüber, welch komplizierter Vorgang das ist, der im Allgemeinen automatisch und unbewusst abläuft. Die Worte „entstehen in unserem Kopf“ und „kommen aus unserem Mund“. Sprache, die wir produzieren oder die wir hören, kann dabei unter verschiedenen Aspekten betrachtet werden, die alle zusammen Sprache konstituieren. Gesprochene Sprache besteht zunächst aus Lauten. Im Mund-Nasen-Rachenraum, dem Ansatzrohr, wird mit der Zunge, den Lippen oder den Zähnen der im Kehlkopf erzeugte Ton so verändert, dass einige Dutzend Konsonanten und Vokale entstehen. Die so gebildeten Laute werden in den verschiedenen Sprachen nach unterschiedlichen Regeln kombiniert, die zu Wörtern verbunden werden (Liberman & Liberman, 1992). Individuelle Sprachen nutzen dabei nur einen Bruchteil der möglichen Sprachlaute und Kombinationen (Barret, 1999). In diesen Sprachlauten und ihren Kombinationen wird Bedeutung kodiert. Phoneme, also Laute, sind die kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten. Sie haben für sich noch keine Bedeutung, lassen aber beispielsweise aus „Tanne“ „Kanne“ werden.
Die Phonetik als Teil der Lehre von den Lauten, betrifft ihre physikalische Struktur und beschreibt, wie sie mit den menschlichen Sprechwerkzeugen hervorgebracht werden. Unter artikulatorischer Perspektive wird in der Phonetik die Produktion der Laute betrachtet. Wenn im Kehlkopf ein Ton erzeugt und der Luftstrom nicht blockiert wird, entstehen Vokale, die ihren Klang durch die unterschiedliche Öffnung des Mundraumes erhalten. Wenn der Luftstrom auf unterschiedliche Weise bei der Passage durch den Rachen-Mund-Raum blockiert wird, entstehen Konsonanten. Man kann drei Gruppen von phonetischen Merkmalen unterscheiden, nach denen sich alle Laute klassifizieren lassen, die Sonorität (stimmlos/stimmhaft), die Artikulationsstelle (die Stellen, an denen der Luftstrom blockiert wird) und die Artikulationsart (welcher Laut entsteht), z. B. Plosive wie /p/, /b/, /t/, /d/, /k/ oder /g/, bei denen der Luftstrom zunächst vollkommen blockiert und dann „explosionsartig“ freigesetzt wird, Frikative (Reibelaute) wie /f/, /v/ oder die verschiedenen s- und Zisch-Laute, Nasale wie /n/ und /m/, bei denen die Luft durch die Nase entweicht, Laterale wie /l/, bei denen der Luftstrom seitlich austritt, und den Vibranten /r/ und Kombinationen, wie beispielsweise Affrikative, bei denen ein eigentlicher Plosivlaut nicht vollständig aufgelöst wird, sondern in einen Reibelaut übergeht, wie bei /pf/. Unter der akustischen Perspektive werden die Merkmale der Schallsignale als Muster von Frequenzen und Intensitäten im zeitlichen Verlauf betrachtet. Sie lassen sich in einem Schallspektrogramm darstellen.
Abb. 1.1: Schallspektrogramm einzeln und deutlich gesprochener Wörter (aus Goldstein, E. B. (1997). Sensation and Perception. Washington: Itps Thomson Learning)
Unter auditiver Perspektive werden die psychischen Vorgänge bei der zentralen Verarbeitung der Sprachlaute betrachtet. Dabei gibt es keine Eins-zu-eins-Zuordnung zwischen den physikalischen Merkmalen und den wahrgenommenen Lauten. Sprachsignale sind flüchtig, müssen schnell erfasst und trotz unterschiedlicher Sprecher, nicht „hörbarer“ Wortgrenzen im Sprachstrom und anderer Variationen als Einheiten erkannt werden.
Abbildung 1.2 zeigt, wie sich das Schallspektrogramm verändert, wenn der Satz „What are you doing?“ in der Alltagssprache gesprochen wird. Pro Sekunde müssen bei durchschnittlicher Sprechgeschwindigkeit ca. 30 Phoneme erkannt werden, während man gleichzeitig Wortbedeutungen, Satzstrukturen und Satzbedeutungen analysiert (Penner, 2000). Allein die phonetischen Kompetenzen und der Erwerb des Lautbestandes der Sprache und der in der Umgebungssprache erlaubten Kombinationsmöglichkeiten sind Leistungen, die ein Kind in seinen ersten Lebensjahren vollbringt, deren Komplexität dem naiven Betrachter kaum präsent ist. Die Phonologie betrachtet die Lautsysteme einer Sprache, ihre Repräsentationen, also die Zuordnung der bei verschiedenen Personen unterschiedlich gebildeten Laute zu einem Phonem als abstrakter Lauteinheit.
Laute und ihre Kombinationen werden zu Wörtern verbunden und repräsentieren Bedeutungen, dies betrifft die Semantik. Wörter stehen für Begriffe, Konzepte und Beziehungen und verbinden damit sprachliche mit kognitiven Fähigkeiten. Die kleinsten bedeutungstragenden Einheiten sind die Morpheme, die frei sein können, wie „jung“, „Haus“ oder „Spiel“ oder gebunden wie „heit“, „keit“, „un“ oder „ver“. Wenn sie an ein freies Morphem geheftet werden, machen sie beispielsweise aus einem Verb ein Adjektiv (vergessen – vergesslich) und daraus ein Substantiv (vergesslich – Vergesslichkeit). Wie Morpheme in einer Sprache kombiniert werden dürfen, beschreibt die Morphologie. Morpheme können derivativ (Ableitungsmorpheme) sein, wenn sie die Wortklassen verändern (heiter – Heiter-keit), oder flexiv (Beugungsmorphem), wenn sie Wörter beugen (ich spring-e – du spring-st). Die Syntax beschreibt die Kombinationsregeln von Wörtern in einem Satz, durch die Sätze, die aus den gleichen Wörtern bestehen, unterschiedliche Bedeutungen erhalten können. Beispielsweise bedeutet „Hans liebt Grete“ tragischerweise nicht dasselbe wie „Grete liebt Hans“. Allerdings bedeutet „Grete wird von Hans geliebt“ dasselbe wie „Hans liebt Grete“, ein Ausdruck grammatischer Regeln, die angeben, wie Wörter und Morpheme in einer bestimmten Sprache kombiniert, organisiert und in eine Reihenfolge gebracht werden dürfen.
Abb. 1.2: In Alltagssprache gesprochener Satz (aus Goldstein, E. B. (1997). Sensation and Perception. Washington: Itps Thomson Learning)
Schließlich muss das Kind noch lernen, wie Sprache in unterschiedlichen Kontexten gebraucht (kommunikative Funktionen), wie Rede und Gegenrede gestaltet wird (Konversation) und wie man seine Rede zusammenhängend aufbaut und auf den Informationsstand und die Perspektive des Partners abstimmt (Diskurs). Alle drei Funktionen gehören in den Bereich der Pragmatik. Inder Pragmatik werden damit die linguistischen Kompetenzen mit sozialen Fähigkeiten verbunden.
Als weitere, suprasegmentale, also über den untergliederbaren Einheiten liegende Komponente, gilt die Prosodie. Damit wird die Betonung und Gliederung der Sprache bezeichnet, die sich durch Tonhöhe, Lautheit, Länge der Sprachlaute und Pausengebung darstellt (Grimm, 1999; Grimm & Weinert, 2002). Durch die typischen Betonungsmuster können Sprachen voneinander unterschieden werden, auch wenn man sie nicht beherrscht. Wir „hören“, ob es sich um eine slawische, eine romanische, eine arabische oder eine asiatische Sprache handelt. Innerhalb einer Sprache gibt die Prosodie Hinweise, wie eine Äußerung zu verstehen ist. „Ich will den Ball“ (und keinen anderen), „Ich will den Ball“ (und nichts anderes), „Ich will den Ball“ (du musst ihn mir geben!), „Ich will den Ball“ (du kriegst ihn nicht!) wird je nach Betonung anders verstanden.
Abb. 1.3: Komponenten der Sprache (nach Barret, 1999, S. 8)
1.2 Das Sprachlernproblem
Lange hat man den Beginn der Sprachentwicklung mit dem Auftauchen des ersten Wortes gegen Ende des ersten Lebensjahres gleichgesetzt. Heute weiß man, dass Sprachentwicklung bereits vor der Geburt des Kindes beginnt und Einjährige schon wichtige Schritte auf dem Weg in die Sprache unbemerkt vollzogen haben. Wie sie das tun, warum sie das im Allgemeinen so perfekt schaffen, welche Lernmechanismen sie zur Verfügung haben, beschäftigt Psychologen, Psycholinguisten und Linguisten seit Jahren, ohne dass sie bisher zu einem allgemein akzeptierten Ergebnis gekommen wären. Zwar wird niemand bestreiten, dass „normale Kinder in normaler Umgebung Sprache erlernen“ (Hoff-Ginsberg, 2000, S. 463), genauso wenig wie die Tatsache, dass es bei „normalen Kindern in normaler Umgebung“ erhebliche Unterschiede in der Geschwindigkeit und im Verlauf der Sprachentwicklung gibt. Welche sprachspezifischen und/oder welche allgemeinen Fähigkeiten das Kind benötigt, erlernt oder mitbringt und welche Rolle der sprachliche Input dabei spielt, wird je nach der Theorie zugrundeliegender Annahme unterschiedlich gesehen.
Grundsätzlich kann man drei große Gruppen von Spracherwerbstheorien unterscheiden, die als inside-out, outside-in und die radikale Mitte gekennzeichnet werden können (Hennon, Hirsh-Pasek & Golinkoff, 2000; Hirsh-Pasek & Golinkoff, 1996).
Inside-out-Theorien
beschreiben den Spracherwerb überwiegend als Ausdruck einer angeborenen, bereichsspezifischen Prädisposition. Ein Minimum an sprachlichem Input, der nicht einmal vollkommen sein muss, triggert das bereits vorhandene Sprachlernprogramm (Chomsky, 1965, 1981; Pinker, 1996, 2003). Sprache wird gedacht als ein Modul oder eine Gruppe von Modulen. Module sind voneinander unabhängige Einheiten (encapsulation), die einen bestimmten Input mit nur diesem Modul eigenen Prozessen verarbeiten (domain specific). Sie werden nicht oder kaum von anderen Modulen und Prozessen beeinflusst und sind zur unwillkürlichen Verarbeitung des Inputs zwingend nötig (mandatory) (Fodor, 1983; Temple, 1 997). Inside-out-Vertreter gehen also von angeborenen, sprachspezifischen Mechanismen aus, die die Teilprozesse der Sprache verarbeiten.
Outside-in-Theorien
dagegen sehen den Hauptmotor der Sprachentwicklung in den sozialen Interaktionen in der sprechenden Umgebung (Bruner, 1983; Tomasello, 2003a). Das Kind abstrahiert nach dieser Grundannahme die sprachlichen Regeln seiner Umwelt und folgt dabei allgemeinen kognitiven Mechanismen. Es kommt zur Sprache, indem es im Gebrauch (usage-based) Intentionen erkennt und Muster anhand der Auftretenshäufigkeiten herausfiltert (L. Bloom, 1998; Nelson, 1996, 1999; Tomasello, 2003a, 2003b).
Beide Auffassungen können als Extreme eines Kontinuums angesehen werden (Hirsh-Pasek & Golinkoff, 1996) und beide Auffassungen können die Frage, wie Sprache gelernt wird, nicht vollständig erklären. Outside-in-Vertreter können nicht ausreichend erklären, warum Kinder auf dem Weg in die Sprache viele mögliche induktive Schlüsse nicht ziehen, sondern relativ zielsicher die „richtigen“, während Inside-out-Vertreter, die von einer sprachspezifischen Vorausstattung ausgehen, zunächst erklären müssen, wie das Kind die relevanten Einheiten aus dem Strom der gesprochenen Sprache erkennen kann (Tracy, 2000). Die Theorie muss auch erklären können, wie die abstrakte, als angeboren angenommene, universelle Grammatik an die verschiedenen Zielsprachen gebunden wird (linking problem), und warum sich auf der Welt so viele sehr unterschiedliche Sprachen gebildet haben, wenn alle Menschen mit derselben sprachspezifischen Ausstattung geboren werden. Im Verlauf der Sprachentwicklung eines Kindes lassen sich qualitative Veränderungen feststellen, die erklärt werden müssen, wenn die universelle Grammatik immer dieselbe ist (continuity problem) (Tomasello, 2003a).
Die
rational-konstruktivistische
oder
„radikale Mitte“
(Grimm, 1999; Grimm & Weinert, 2002; Hennon et al., 2000; Hirsh-Pasek & Golinkoff, 1996) vereint beide Auffassungen. Das Kind bringt Voreinstellungen zum Erwerb der Sprache mit und konstruiert sie in Wechselwirkung mit den Angeboten seiner Umgebung.
Die Geschwindigkeit und der frühe Zeitpunkt, zu dem ein Kind Sprache erwirbt, sprechen dafür, dass es eine biologisch determinierte Bereitschaft auf Sprache zu achten, sprachrelevante Reize bevorzugt zu verarbeiten und sprachliche Regeln zu erkennen, mitbringt. In sozialen Interaktionen, in der Ausbildung von Routinen und Mustern und in kommunikativen Anforderungen, kann das Kind das sprachliche Angebot der Bezugspersonen nutzen, um aus den relevanten Informationen sein Sprachwissen zu konstruieren. Die Bezugspersonen zeigen intuitiv ein sprachliches und kommunikatives Verhalten, das dem Kind den „Einstieg“ in die Sprache erleichtert, indem sie zum Kind in kurzen, grammatikalisch korrekten Sätzen sprechen und dabei die sinntragenden Wörter besonders betonen. Aber selbst dieses, oft als universell angenommene Verhalten der Eltern, die kindgerichtete Sprache (Ammensprache, Babytalk) gilt nicht für alle Kulturen (Lieven, 1994; Rüter, 2004; Schieffelin, 1985). Je nach Einstellung zum Kind als ein grundsätzlich verstehendes oder grundsätzlich (noch nicht) verstehendes Wesen unterscheidet sich der sprachliche Umgang mit den Kindern, so dass zwei verschiedene Lernstrategien zu beobachten sind. Während in manchen Kulturen, die davon ausgehen, dass Kinder eine gewisse Reife erwerben müssen, um dann „von selbst“ zu sprechen, ein „Sprich erst und analysiere dann!“ gilt, nehmen Eltern unserer westlichen Kulturen an, dass Kinder Sprache von Anfang an aufnehmen. Sie verhelfen ihnen mit ihrer kindgerichteten Sprache dazu, zunächst einzelne Einheiten und Komponenten der Sprache zu analysieren, um sich auf dieser Grundlage die Sprache konstruktiv anzueignen, also mit der Strategie „Analysiere erst und sprich dann!“ vorgehen zu können (Hoff-Ginsberg, 2000).
Das Sprachlernproblem ist vermutlich am ehesten unter einer entwicklungspsychologischen Perspektive zu verstehen, bei der weder die Anlage noch die Umwelt als entscheidender Faktor zu sehen sind, sondern das Zusammenspiel beider (L. Bloom, 1998; Gopnik & Nazzi, 2003; Grimm & Wilde, 1998; Hennon et al., 2000; Hirsh-Pasek & Golinkoff, 1996). Die inneren Voraussetzungen des Kindes und die lernbegünstigende Umgebung müssen passen (Grimm & Weinert, 2002). Wörter und Grammatik sind nicht von Anfang an vorhanden, sondern entstehen dann, wenn die biologischen Voreinstellungen mit der sozialen Umwelt interagieren.
Übungsfragen zu Kapitel 1
Wie können Sprachlaute klassifiziert werden?Welche Komponenten konstituieren die menschliche Sprache?Was spricht für Outside-in-Theorien?Was spricht für Inside-out-Theorien?Was spricht für die „radikale Mitte“?2 Sprachentwicklung
2.1 Spracherwerb im Säuglings- und Kleinkindalter
2.1.1 Prosodie und Phonologie
Bevor das Kind sein erstes Wort spricht, hat es schon sehr viel über Sprache gelernt. Die Methoden der Säuglingsforschung sind in den letzten Jahrzehnten sehr verfeinert worden und erlauben, Wahrnehmungs- und Denkleistungen des Säuglings zu erkennen, auch wenn er sich noch nicht äußern und motorisch noch kaum gezielt reagieren kann. Durch moderne und einfallsreiche Projektions- und Computertechniken ist es möglich, die Erfassung der kognitiven Leistungen von den motorischen abzukoppeln, so dass bereits für Neugeborene differenzierte Wahrnehmungsleistungen nachgewiesen werden können (zusammenfassend s. z. B. Goswami, 1998; Jusczyk, Housten & Goodman, 1998; Mandler, 1998).
Drei Untersuchungsparadigmen, die prinzipiell auf dem Wechselspiel von Habituierung, also Gewöhnung, und Dishabituierung, also Orientierungsreaktion, beruhen, können unterschieden werden. Im Habituierungsparadigma wird einem Baby so lange ein bestimmter Reiz, ein Bild, eine Stimme, eine Lautfolge, dargeboten, bis keine Reaktionen auf den Reiz mehr zu beobachten sind, es sich abwendet, eindöst, missmutig wird oder andere Anzeichen von Desinteresse zeigt. Wenn man dann die Reizkonfiguration ändert und das Baby wieder aufmerksam schaut oder hört, also eine Dishabituierung ausgelöst wird, ist damit deutlich, dass es einen Unterschied erkannt hat. Durch Manipulation des Untersuchungsmaterials kann man herausfinden, welche perzeptuellen Unterschiede das Baby bereits erkennen kann. Habituierung und Dishabituierung lässt sich auch „objektiver“ anhand der Veränderung der Herzschlagfrequenz schon beim Ungeborenen oder der Saugrate beim Säugling feststellen.
Beim Präferenzparadigma werden dem Baby zwei Reize geboten, beispielsweise zwei Stimmen, zwei Gesichter, zwei Gegenstände. Wenn das Baby eins davon intensiver, d. h. länger (Fixationsrate) betrachtet als das andere, wird das als Bevorzugung interpretiert. Dabei kommt es natürlich darauf an, dass die Versuchsbedingungen so variiert werden, dass keine Reihenfolgeeffekte auftreten. Präferenzen können auch festgestellt werden, wenn speziell präparierte Sauger mit Dia-, Tonband- oder Videogeräten gekoppelt werden, so dass der Säugling mit seiner Nuckelfrequenz die Geräte einschalten und sich so das bevorzugte „Programm“ selbst verschaffen kann. Mithilfe des Präferenzparadigmas kann auch die Kopplung zweier Modalitäten untersucht werden. Wenn einem vier Monate alten Baby zwei Videoclips gleichzeitig gezeigt werden, wobei auf dem einen eine Frau „Kuckuck – da“ (ihr Gesicht mit den Worten „Kuckuck“ verdeckt und bei „da“ freudig wieder hervorkommt) spielt und auf dem anderen mit einem Stock auf einen Holzblock geschlagen wird, schaut das Baby bevorzugt zu dem Clip, der mit der Tonspur übereinstimmt (Spelke, 1976).
Beim Überraschungsparadigma wird dem Kind ein „unmögliches Ereignis“ gezeigt. Beispielsweise wird es darauf habituiert, dass ein Hase hinter einem Schirm verschwindet und am anderen Ende wieder herauskommt. In der Dishabituierungsphase wird im Schirm ein Rechteck ausgeschnitten, so dass ein großer Hase im Ausschnitt zu sehen sein müsste, wenn er hinter dem Schirm vorbeigeht, ein kleiner jedoch nicht. Babys im Alter von fünf Monaten reagieren irritiert, wenn der große Hase im Ausschnitt nicht zu sehen ist, aber nicht, wenn der kleine hinter dem Schirm verschwindet (Baillargeon & Graber, 1987). Gerade Experimente mit Überraschungen, unmöglichen Ereignissen, die sich meist nur mit Tricktechniken herstellen lassen, erlauben Schlüsse auf kognitive Prozesse des jungen Säuglings, da derartige Ereignisse in der physikalischen Welt nicht vorkommen, sie also nicht einfach nur wiedererkannt sein können.
Bei der Untersuchung der Sprachwahrnehmung von Säuglingen werden als Abwandlungen dieser Paradigmen hauptsächlich die konditionierte Kopfhinwendung (conditioned headturn, CHT), die visuelle Habituation (VH) und die erhöhte Saugfrequenz (high-amplitude sucking, HAS) eingesetzt (Werker et al., 1998).
Bei der konditionierten Kopfhinwendung (CHT) wird das Baby darauf trainiert, dass sofort nach jedem neuen Stimulus seitlich vom Kind ein lustiges, buntes Spielzeug (z. B. ein – lautlos – trommelnder Stoffaffe) in Gang gesetzt wird. Beispielsweise hört das Baby über einen gewissen Zeitraum den Laut /ba/, der dann in /da/ gewechselt wird, während gleichzeitig der Affe zu trommeln beginnt, so dass das Baby den Zusammenhang zwischen Reizpräsentation und Bewegung des Spielzeugs lernt (erste Konditionierungsphase). In einer zweiten Konditionierungsphase wird eine immer längere Pause zwischen dem neuen Reiz und der Bewegung des Spielzeuges eingeführt, so dass das Baby bei der Präsentation des neuen Reizes bereits in Erwartung der Aktivierung des Spielzeuges seinen Kopf dreht. In der Versuchsphase werden neue Reize und gleichbleibende Kontrollreize in zufälliger Reihenfolge geboten. Wenn das Baby den Kopf dreht, obwohl kein neuer Reiz kam, bleibt der Affe ruhig. Ebenso sieht es ihn nicht, wenn es den Kopf nicht gedreht hat, obwohl ein neuer Reiz zu hören war. Das Hinwenden des Kopfes in der Erwartung, dass der Affe zu trommeln beginnt, zeigt an, dass das Baby die Reize diskriminiert hat. Natürlich müssen alle anderen Personen im Raum mit über Kopfhörer eingespielter Musik „vertäubt“ werden, um dem Kind nicht verdeckte Hinweise auf die Reaktion zu geben. Stimulus (Ton) und Verstärker (Spielzeug) sind voneinander unabhängig. Das Baby verschafft sich durch das Hinwenden des Kopfes den Verstärker aktiv selbst, so dass besser entschieden werden kann, ob es Unterschiede nicht wahrnimmt oder einfach nur desinteressiert oder unkooperativ ist.
Dies kann bei der visuellen Habituation (VH-Methode) ein Problem sein. Hier wird die Aufmerksamkeit des Babys auf einen Bildschirm gelenkt. Während es dort ein Bild betrachtet, ertönt ein Stimulus. Nach einer Weile hat es sich daran gewöhnt, es hat habituiert und betrachtet das Bild nicht mehr. Wenn dann der Stimulus geändert wird, schaut das Baby wieder hin. Allerdings sind nur positive Reaktionen interpretierbar. Wenn das Kind nicht reagiert, könnte es auch den Reiz nicht interessant genug finden, so dass es keine Reaktion zeigt, obwohl es den Unterschied erkannt hat.
Die Messung der erhöhten Saugrate (HAS-Methode) eignet sich für sehr junge Säuglinge bis zu vier Monaten. Mit entsprechend präparierten Schnullern kann die Saugrate des Babys aufgezeichnet werden und mit dem Wechsel von Reizen wie Bildern oder Videoclips verbunden werden, so dass beispielsweise ein neues Bild erscheint, wenn eine bestimmte Saugfrequenz erreicht ist. Neugeborene saugen zwar stärker, wenn ihnen neue Reize geboten werden. Sie erkennen aber vermutlich die Kontingenz zwischen Nuckeln und Auftauchen des Reizes noch nicht. Zwei bis vier Monate alte Kinder „erkennen“ den Zusammenhang und können sich durch eine erhöhte Saugrate ein bevorzugtes Bild aktiv verschaffen (Werker et al., 1998). Mit diesen Untersuchungsmethoden können vor allem die auditiven Wahrnehmungsleistungen des Säuglings festgestellt werden, die eine Grundvoraussetzung sind, „auf natürlichem Weg“ sprechen zu lernen.
Bereits ab der 27./28. Schwangerschaftswoche kann der Fötus hören (Hennon et al., 2000; Lecanuet, 1998). Er hört allerdings durch den dämpfenden Filter des Uterus hauptsächlich die prosodischen Merkmale, an denen er später die Stimme seiner Mutter erkennt (Fifer & Moon, 1989; Höhle, 2005). Er kann vertraute kurze „Geschichten“ wiedererkennen (DeCasper et al., 1994) und bevorzugt sie (DeCasper & Spence, 1986). Er kann die prosodischen Merkmale seiner Muttersprache wahrnehmen und nach der Geburt wiedererkennen (De-Casper et al., 1994). Er kann Sprachlaute von Geräuschen unterscheiden und sogar Abfolgen von Silben und Betonungsmuster differenzieren (Lecanuet, Granier-Deferre & Busnel, 1995). Das Neugeborene kann verschiedene Sprachen anhand prosodischer Merkmale voneinander unterscheiden und bevorzugt die Muttersprache (Moon, Cooper & Fifer, 1993). Bereits im Mutterleib beginnt also eine sprachliche Entwicklung, durch die das Neugeborene mit einer Ausstattung zur Welt kommt, die es besonders auf sprachliche Reize achten lässt (Lecanuet, 1998). Inwieweit es sich dabei um sprachspezifische Prädispositionen handelt (Jusczyk, 2001, 2003; Jusczyk et al., 1998) oder um allgemeine, kognitive Mechanismen, die besonders gut auf sprachliche Reize angewendet werden können, so dass sie sich schließlich immer sprachspezifischer entwickeln, ist bislang ungeklärt.
Gesprochene Sprache ist im ständigen Fluss, Wortgrenzen sind nicht hörbar. Pausen liegen häufiger zwischen Silben als zwischen Wörtern. Laute verändern sich, je nach ihrer Position im Wort. Vorausgehende Laute bereiten die folgenden in „Koartikulation“ vor und verändern damit ihre Bildung. Bei dem Wort „Boot“ wird das „B“ mit geschürzten Lippen gebildet, um das „o“ vorzubereiten, während bei „Bad“ die Lippen breit geschlossen bleiben für das folgende „a“. Wenn Wörter in Silben segmentiert gesprochen werden (Ma-ma), lassen sie sich immer noch als das gemeinte Wort identifizieren, nicht aber, wenn die Laute einzeln gesprochen werden (M-a-m-a). Oft wird daher nicht das Phonem als natürliche Einheit gesehen, sondern die Silbe (M. J. Adams, 1991; L. Bloom, 1998; Eimas, 1985; Gleitman et al., 1989; Goldstein, 1997; Goodman, 1984; Liberman & Liberman, 1992; Marcel, 1980; Penner, 2000; Segui, Frauenfelder & Hallé, 2001).
Um letztlich Sprache verstehen zu können, muss der Lautstrom in die für das Verständnis relevanten Einheiten zergliedert werden. Einen ersten Anhaltspunkt für diese Segmentierung bieten dem Säugling die prosodischen Merkmale seiner Umgebungssprache. Dabei bevorzugt er die natürlichen Muster seiner Muttersprache, die in der an das kleine Kind gerichteten Sprache, der „Ammensprache“ besonders betont werden (Grimm & Wilde, 1998; Hennon et al., 2000; Papoušek, 1994; Papoušek & Haekel, 1987). Erwachsene und auch ältere Kinder sprechen in einer hohen Stimmlage in kurzen, korrekten und grammatisch einfachen Sätzen zu Säuglingen und Kleinkindern, dehnen die betonten Wörter, modulieren ihre Stimme stärker und bieten ihnen damit genau die Merkmale deutlich, die sie zur Segmentierung nutzen. Allerdings ist zweifelhaft, ob die Erwachsenen das in lehrender Absicht tun oder nicht eher im Bemühen um Kommunikation mit einem nicht-kompetenten Sprecher, um sein Verständnis zu verbessern und seine Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten (Pine, 1994).
Ein neugeborenes Baby kann die meisten menschlichen Sprachlaute voneinander unterscheiden (Phonemdiskriminanz). Die auditiven Erfahrungen mit der Umgebungssprache spielen dabei offensichtlich noch eine untergeordnete Rolle (Höhle, 2004). Es ist als „Sprachgeneralist“ in der Lage, jede Sprache, die in seiner Umgebung gesprochen wird, zu lernen. Um seine Muttersprache zu erwerben, muss es jedoch eine weitere Anforderung erfüllen: Es muss Laute, die sich akustisch unterscheiden, als gleich auffassen können (Phonemkonstanz) (Bishop, 1997; Kuhl, 1985).
Menschliche Sprachlaute befinden sich auf einem Kontinuum, so dass eine unendliche Zahl von Sprachlauten möglich wäre, einzelne Sprachen verwenden jedoch nur einen begrenzten Teil davon. Die Laute werden, ob nun eine Frau, ein Kind oder ein Mann spricht und welche individuellen Unterschiede in den Sprechwerkzeugen bestehen, wegen der Koartikulation so unterschiedlich gebildet, dass sie im Schallspektrogramm nicht als gleich identifiziert werden können. Das Baby muss also lernen, die Konstanzen trotz dieser Variationen zu erkennen. Das gelingt, indem „Prototypen“ von Lauten gebildet werden, „beste“ phonologische Repräsentationen, an die alle gehörten Laute angeglichen werden (Gopnik, Kuhl & Meltzoff, 2001). Laute werden zu Kategorien zusammengefasst, wobei gewisse Abweichungen geduldet und der Lautstrom nicht mehr als sich kontinuierlich verändernd, sondern in diskreten Klassen von Lauten zusammengefasst, wahrgenommen wird.
Abb. 2.1: Kategoriale Lautwahrnehmung und phonetische Grenze
Stimmlose und stimmhafte Laute wie „d“ und „t“ beispielsweise unterscheiden sich durch den Zeitpunkt, zu dem die Stimme einsetzt (VOT, voice onset time). Wenn man nun durch technische Manipulation die Stimmeinsatzzeit auf einem Zeitstrang kontinuierlich ansteigen lässt, hören Versuchspersonen bis zu einer kritischen Zeit von 35 msec den Laut „d“ und danach den Laut „t“. Sie fassen also alles, was jenseits einer Grenze liegt, in eine Kategorie und hören keinen kontinuierlichen Übergang von stimmhaft zu stimmlos (Bishop, 1997; Goldstein, 1997). Geringfügige Zeitunterschiede im Bereich der phonetischen Grenze führen dazu, dass zwei verschiedene Laute gehört werden, während weitaus größere Zeitunterschiede diesseits oder jenseits der Grenze dennoch zu demselben Lauteindruck führen. Eimas, Siqueland, Jusczyk und Vigorito (1971) konnten für ein und vier Monate alte Babys nachweisen, dass sie nicht nur den minimalen Kontrast zwischen „ba“ und „pa“ hören konnten, sondern dass sie bereits zwei Lautkategorien dafür hatten.
In den verschiedenen Sprachen haben sich unterschiedliche Lautkategorien gebildet. Wenn ein Kind die Kontraste seiner Sprache, also die Lautkategorien der Umgebungssprache, erworben hat, erkennt es den Laut trotz der individuellen Variationen gut, wird aber „blind“ für die Nuancen. Mit dem Ausbilden von Phonemkonstanz im ersten Halbjahr spezialisiert das Baby sich auf die Laute seiner Muttersprache. Mit sechs Monaten kann es noch Lautkontraste erkennen, die in anderen als der eigenen Sprache vorkommen (Jusczyk et al., 1998), mit etwa zehn Monaten überwiegend nur noch die seiner Umgebungssprache (Werker & Tees, 1984). Allerdings ist der Zeitpunkt, zu dem sich die Unterscheidungsfähigkeit verliert, nicht für alle Kontraste gleich und der Verlust betrifft wohl auch nicht alle Lautkategorien (Jusczyk et al., 1998). Das Kind achtet immer mehr auf die Laute der es umgebenden Sprache und verliert dabei seine generellen Fähigkeiten zugunsten einer speziellen, die es für den Lautbestand seiner Muttersprache trotz der Abweichung bei der Lautproduktion in der Umgebungssprache sensibler macht.
Die Kinder legen „mentale Lautkarten“ an, durch die die Laute der Muttersprache besser kategorisiert werden können und zukünftiges Lernen so verändert wird, dass die Ziellaute der Muttersprache immer besser unterschieden werden können (Kuhl et al., 2005). Prototypische Laute der eigenen Sprache wirken wie ein Magnet, der schwache oder ungenaue Ausprägungen des Lautes anzieht, so dass letztlich das Lernen des Lautbestandes der Muttersprache durch die Ausbildung neuronaler Bahnen verstärkt wird, während der anderer Sprachen nicht mehr unterstützt wird (Native Language Magnet-Theorie, Kuhl et al., 2005). Die Unterscheidungsfähigkeit der Laute der Muttersprache und das Nachlassen der Unterscheidungsfähigkeit für nicht-muttersprachliche Laute ist ein guter Prädiktor für einen schnelleren Spracherwerb beim Kind (Kuhl et al., 2005). Erwachsene sind zwar nicht vollkommen unfähig, fremde Sprachlaute zu unterscheiden, die Wahrnehmungskategorien werden aber schon früh so bestimmt, dass die Sensibilität für fremde Laute verringert wird und sie eher den eigenen Kategorien angeglichen werden (Iverson et al., 2003). Frühe perzeptuelle Erfahrungen der Lautdiskrimination können darüber hinaus den späteren Wortschatzumfang und die Lesefähigkeiten vorhersagen (Werker & Yeung, 2005). Schon in diesem frühen Alter lassen sich also individuelle Unterschiede feststellen, die die weiteren Lernmöglichkeiten verändern und bestimmen. Säuglinge sind grundsätzlich bereit, bestimmte sprachliche Hinweisreize zu bemerken, Gehörtes aktiv zu analysieren und sich phonologisch von einer generellen Offenheit für alle Sprachen zu einer Spezialisierung für die Muttersprache zu entwickeln.
Im Vergleich zu den differenzierten auditiven Wahrnehmungsleistungen sind die Lautproduktionen im ersten Lebensjahr noch recht bescheiden. Das Schreien wird relativ schnell moduliert, Melodiebögen werden erkennbar. Im Alter von sechs bis acht Wochen beginnt das Baby zu gurren, zu quieken und zu brummen, mit der Stimme zu spielen und ihren Umfang auszudehnen (Papoušek, 1994). Vorgesprochene Vokale werden imitiert, nicht jedoch nichtsprachliche Laute, so dass angenommen wird, dass besonders sprachliche Laute Vokalisierungen beim Baby hervorrufen (Kuhl, 1987). Seine Laute expandieren mit vier bis fünf Monaten und werden den Sprachlauten ähnlicher (Grimm & Wilde, 1998). In dieser als „marginal babbling“ bezeichneten Vorphase kommen verschiedene Artikulationsarten und -orte vor. Die Übergänge von Vokalen zu Konsonanten sind lang und die silbenähnlichen Lautmuster sind noch instabil (Masataka, 2000). Mit ca. sechs Monaten beginnt das kanonische (der Normalform entsprechend), reduplizierende Lallen, bei dem Konsonant-Vokal-Verbindungen (CV, „bababa“, „dadada“, „mamama“) satzähnliche Intonationsmuster haben. Mit sieben bis zehn Monaten erscheinen auch alternierende Muster („daba“). Dabei bevorzugt das Kind die im Input vorkommenden Häufigkeiten der Laute. Die kanonischen Silben sind nicht universell, sondern an der Zielsprache orientiert. Es operiert also gezielt mit den Inputdaten seiner Umgebungssprache (Penner, 2000).
Jakobson (1969) hingegen geht von einer universellen, vorhersagbaren Hierarchie des Lauterwerbs aus. Das Kind lernt danach nicht einzelne Laute, sondern maximale Kontraste von Lautpaaren in den distinktiven Schallmerkmalen. Solche Kontraste sind Konsonant/Vokal, Stimmhaftigkeit/Stimmlosigkeit, Offenheit/Geschlossenheit, oral/nasal, vordere/hintere Konsonanten. „Papa“ beispielsweise zeigt maximale Kontraste in einigen dieser Merkmale (Geschlossenheit – Offenheit, stimmlos – stimmhaft, Konsonant – Vokal). Tatsächlich bestehen viele erste „Babywörter“ aus solchen kontrastreichen Reduplikationen (Mama, Papa, Dada, Baba, Tata), die in vielen Sprachen, aber mit teilweise unterschiedlichen Bedeutungen zu beobachten sind. So bedeutet „Dada“ im Englischen „Vater“ (Daddy), im Russischen „Großvater“ (Deduschka), „Baba“ im Deutschen: „Das ist schmutzig!“, im Russischen „Großmutter“ (Babuschka). Aus den Lallproduktionen kristallisieren sich wortähnliche Gebilde heraus, die aus Lautkombinationen und Betonungsmustern der Zielsprache bestehen, aber noch keine Bedeutung haben, und zwischen dem 10. und 14. Monat werden erste bedeutungsvolle Wörter produziert.
Während der ersten fünf Lebensjahre wird das phonologische System des Deutschen erworben. Das phonetische Inventar eines Kindes bezeichnet die Laute, die es isoliert korrekt bilden, also als Einzellaute richtig nachsprechen kann. Das muss vom phonemischen Inventar unterschieden werden. Dies meint die Laute, die in verschiedenen lautlichen Kontexten richtig gebildet werden können (A. V. Fox, 2003; A. V. Fox & Dodd, 1999). Ein Kind könnte also beispielsweise /k/ richtig nachsprechen und in „kein“ korrekt bilden, aber nicht in „klein“ oder „kraus“. Phoneme, die in der Umgebungssprache besonders häufig vorkommen, werden früher erworben. Dies bedeutet aber nicht, dass sie in jedem Wort richtig gebildet werden (A. V. Fox, 2003). Deutsch lernende Kinder erwerben zunächst Vokale, dann Plosive (/p/, /b/), Nasale (/m/, /n/), Frikative (/f/, /v/) und Affrikative (/ts/, /pf/). 90 % der Kinder beherrschen fast alle Laute und deren Verbindungen bis zum Alter von fünf Jahren. Allein die s- und Zischlaute werden von bis zu 40 % der Kinder noch bis zu Schulbeginn nicht korrekt gebildet (Jahn, 2001), auch ein Viertel der Achtjährigen kann die s-Laute noch nicht richtig artikulieren (Siegmüller & Bartels, 2006).
Phonologische Prozesse beschreiben lautliche Veränderungen, bei denen das Kind Laute oder Lautgruppen, die es noch nicht beherrscht, „vereinfacht“ und in bereits beherrschte Lautverbindungen umwandelt, die dem Ziel möglichst ähnlich sind (Schade, 2003). Phonologische Prozesse sind in der Sprachentwicklung physiologisch, also normal. Unter phonetischer Perspektive nimmt man an, dass Kinder die phonologisch bereits repräsentierten Laute vereinfachen, weil sie motorisch noch nicht in der Lage sind, sie korrekt zu produzieren. Ihre Vereinfachungen folgen dabei individuellen Regeln, die nicht bei allen Kindern gleich sind (Stampe, 1979). Unter phonologischer Perspektive lernt das Kind erst die Regeln der Lautbildung und -kombinationen, erkennt zunächst wenige Oppositionen (Unterschiede zu anderen Lauten) und mit zunehmendem Gebrauch mehr, so dass es von den konkreten Realisationen der Laute abstrahieren und einen prototypischen Laut repräsentiert. Das, was es phonologisch als bedeutsam erkannt hat und phonetisch umsetzen kann, setzt es zum Erreichen sprachlicher Ziele ein. Phonologische Prozesse bestehen in strukturellen Vereinfachungen, beispielsweise dem Auslassen unbetonter Silben („Nane“ – „Banane“) und Endkonsonanten („Gabe“ – „Gabel“), Reduktion von Mehrfachkonsonanten („Lüssel“ – „Schlüssel“), systematischen Vereinfachungen wie Assimilierungen („Gagegut“ – „Schlafanzug“), Vor- oder Rückverlagerung („tlein“ – „klein“) und Ersetzungen („Hade“ – „Hase“). Verschiedene Prozesse werden zu unterschiedlichen Zeiten wirksam, das Auslassen finaler Konsonanten wird früh überwunden. Alveolarisierung („demacht“ – „gemacht“) und Reduktion von Mehrfachkonsonanten („Stümpe“ – „Strümpfe“) erscheinen noch sehr spät (A. V. Fox, 2003; A. V. Fox & Dodd, 1999).
Zwischen vier und fünf Monaten beginnen Kinder, zwischen trochäischen (Betonung auf der ersten Silbe) Betonungsmustern, welche im Deutschen und im Englischen vorherrschen, und jambischen (Betonung auf der zweiten Silbe) zu unterscheiden (Höhle, 2005; C. Weber et al., 2004). Diese Sensibilität für Betonungsmuster verhilft dem etwa sechs Monate alten Baby, kurze, zweisilbige Wörter zu erkennen, indem es das Muster „betont – unbetont“, wie es in der deutschen oder englischen Umgebungssprache vorherrscht, als Einheit zusammenfasst (Cutler, 1996; Johnson et al., 2003; Weissenborn, 2000). Starke und schwache Betonungen und Vokaldehnungen dienen als „Steigbügel“, um Wortgrenzen im Input wahrzunehmen (Penner, 2000). Mit ca. neun Monaten kann es anhand der Pausen und Silbenlängen die syntaktischen Phrasengrenzen erkennen. Phrasen sind zusammengehörende Satzteile, die nur als Ganzes im Satz verschoben werden können (z. B. „die Frau“, „der große Baum“). Das Kind bevorzugt gesprochene Sätze, bei denen syntaktische und prosodische Einheiten übereinstimmen (Saffran, Aslin & Newport, 1996; Saffran & Thiessen, 2003; Thiessen & Saffran, 2003). Es zieht beispielsweise einen Satz wie „Die Frau # holt die Flasche“ dem Satz „Die Frau holt # die Flasche“ vor, erwartet aber bei dem unbetonten Personalpronomen „Sie holt die Flasche“ die Pause eher nach dem Verb (Jusczyk et al., 1998; Weissenborn, 2000). Auch unbetonte Funktionswörter kann ein sieben Monate altes Baby im Sprachfluss wiedererkennen, wenn es sie vorher isoliert gehört hat (Höhle & Weissenborn, 2003). Offenbar kann das Kind aus der Prosodie Informationen über die grammatische Organisation seiner Muttersprache gewinnen (Jusczyk et al., 1998). Diese Fähigkeit, das in einer Komponente (Prosodie) Beherrschte zu nutzen, um die Merkmale anderer Komponenten (Syntax) zu erlernen, wird Bootstrapping genannt, in diesem Falle „prosodisches Bootstrapping“.
Wörter zu erkennen und sie voneinander abzugrenzen, könnte ein Kind lernen, indem die Mutter ihm einzelne Wörter vorspricht. Das wird sie zuweilen tun, allerdings kleiden Mütter, wenn sie angewiesen werden, das Kind einzelne Wörter zu lehren, diese auch in einfache Sätze (Aslin et al., 1996; Morgan, 1996). Der Input an isolierten Wörtern, der dem Kind geboten wird, reicht daher bei weitem nicht aus, Wörter zu segmentieren. Das Kind muss also andere Anhaltspunkte nutzen, um diese Aufgabe zu meistern. Sensibilität für die Laute, die Prosodie und die phontaktischen Merkmale, also wie Laute in den Wörtern der Zielsprache angeordnet werden, helfen ihm dabei (Cutler, 1996; Friedrich & Friederici, 2005). Sprachen unterscheiden sich auch dadurch, welche Lautsequenzen häufig vorkommen und an welchen Positionen im Wort sie auftreten (Friederici & Wessels, 1993). So enden Verben im Deutschen in der Infinitivform meist auf „-en“. Anhand dieser häufigen Lautkombination kann ein Kind erkennen, dass danach im Allgemeinen ein neues Wort beginnt. Andere Lautkombinationen stehen nie am Anfang, können jedoch am Ende eines Wortes stehen (mit /lz/ fängt kein deutsches Wort an, „Holz“ z. B. endet jedoch so). Während neugeborene Babys ihre Muttersprache anhand der Prosodie erkennen, nutzen Babys mit frühestens neun Monaten auch nicht-prosodische wie phonotaktische Merkmale zur Spracherkennung (Friedrich & Friederici, 2005; Höhle, 2004, 2005; Jusczyk, 2001; Jusczyk et al., 1998; Kyte & Johnson, 2006; Werker & Yeung, 2005). Welche Merkmale genutzt werden, kann in den verschiedenen Sprachen unterschiedlich sein. Während Englisch lernende Kinder mehr die Betonung nutzen, scheinen Französisch lernende sich stärker auf die Silbensegmentation zu verlassen und japanische auf die Mora, also die zeitliche Struktur der Silben (Cutler, 1996; Mehler et al., 1996).
Mit ca. zwölf Monaten hat das Kind eine Vorstellung davon entwickelt, was in seiner Muttersprache eine Wortgestalt sein kann (possible word constraint, PWC), die es unabhängig von der möglichen Bedeutung aus dem Strom des Gesprochenen herausfiltern kann (Johnson et al., 2003). Es hat „erkannt“, dass jede Silbe einen Vokal enthält, der aus dem Sprachstrom herausragt. Danach gliedert es die gehörte Sprache in „Chunks“ auf, die mindestens einen Vokal enthalten. Jeder „Wortkandidat“, der keinen Vokal hat, wird zurückgewiesen, ebenso wie jeder nach der Chunkbildung bleibende „Rest“, der nicht selbst ein Wort sein könnte (Johnson et al., 2003). Beim Erkennen bekannter Wörter spielen auch phonologische Details, z. B. die Anfangslaute, und nicht allein die globale Wortgestalt eine Rolle (Swingley, 2005). Mit 19 Monaten werden phontaktisch regelhafte Wörter als Kandidaten für neue Wörter gesehen, nicht aber phonotaktisch irreguläre Nicht-Wörter, also Lautfolgen, die in der Zielsprache nicht zulässige Lautkombinationen enthalten (Friedrich & Friederici, 2005).
Erste Möglichkeiten, den Lautstrom zu segmentieren, finden sich also in der phonologischen Entwicklung und vor allem in der Prosodie, die bis zum letzten Drittel des ersten Lebensjahres die wichtigsten Informationen über Wortgrenzen und syntaktische Merkmale liefert. Lallmonologe eines einjährigen Kindes können sich hinsichtlich Prosodie und Phonologie wie eine „Rede“ anhören, ohne dass auch nur ein konventionelles Wort dabei ist.
Ausgehend von einer außerordentlich differenzierten Wahrnehmung der Sprachlaute über eigene, noch bedeutungslose Produktionen von Lauten und Segmentierungen des Lautstroms anhand der prosodischen und phonotaktischen Merkmale, hat das Baby gegen Ende des ersten Lebensjahres die Fähigkeit erworben, Wort- und Silbengrenzen zu erkennen und selbst wortähnliche Lautgebilde zu produzieren.
Übungsfragen zu Kapitel 2.1.1
Welcher Untersuchungstechniken bedient sich die Säuglingsforschung?Welche Fähigkeiten verhelfen dem Neugeborenen zum Einstieg in die Sprache?Warum ist es schwierig, sprachliche Einheiten zu erkennen?Was sind phonologische Prozesse?Wie kann das Kind Wörter aus dem Sprachfluss „heraushören“?2.1.2 Konzeptbildung und Lexikon
Wenn das Kind die Lautfolgen seiner Muttersprache differenzieren und produzieren kann, den Lautstrom segmentieren und Wort-, Phrasen- und Satzgrenzen wahrnimmt, braucht es noch kognitive Fähigkeiten der Kategorisierung und des Symbolverständnisses, um zu erkennen, dass die Lautgebilde, die es hört, etwas bedeuten (Inhaltswörter) und dass einige „nichts“ bedeuten, aber dennoch wichtig sind, um Beziehungen der Symbole zueinander zu verstehen (Funktionswörter). Wörter als Symbole stehen für etwas auf einer abstrakten Ebene, sie meinen etwas und sind nicht einfach nur mit einem Gegenstand assoziiert. Sie sind arbiträr (zufällig), konventionell festgelegt und haben – mit Ausnahme von einigen lautmalerischen Worten – keinen inhärenten Zusammenhang, keine Ähnlichkeit zum Gemeinten. Junge Kinder akzeptieren auch nichtsprachliche Symbole wie Pfeifen, Brummen, eine Gebärde oder ein Piktogramm als Namen für Gegenstände (DeLoache, 2004), bevor sie mit etwa 20 Monaten die sprachliche Modalität bevorzugen.
Wissen über Wörter und ihren Gebrauch, das Lexikon, beinhaltet neben Aussprache und Bedeutung auch syntaktisches Wissen über korrekte Ableitungen und erlaubte Kombinationen im Satz (Kuczaj, 1999). Wortlernen geschieht – im Gegensatz zum Erwerb der übrigen sprachlichen Komponenten – ein Leben lang. Im Alter von etwa zehn Monaten versteht das Kind im Allgemeinen bereits mehr als 60 Wörter (Bates, Dale & Thal, 1995; Weinert, 2004). Mit zwei Jahren kennt es etwa 300, ca. zehn neue Wörter pro Tag führen zu einem Wortschatz von ca. 14 000, wenn das Kind mit sechs Jahren in die Schule kommt (Kuczaj, 1999). Dort wird es mit 10 000 neuen Wörtern pro Jahr konfrontiert und nimmt davon etwa 3 000 in seinen aktiven Wortschatz auf. Wenn es die Schule verlässt, kennt es etwa 50 000 und hat als Erwachsener bis zu 100 000 Wörter in seinem mentalen Lexikon gespeichert (Kuczaj, 1999). Anfangs lernt es ein Wort pro Woche, dann eins am Tag, dann ein bis zwei pro Wachstunde (P. Bloom, 2000; Tomasello, 2003a). Nicht alle Wörter werden gleich gut beherrscht, und der Unterschied zwischen verschiedenen Personen ist groß. Häufig vorkommende Wörter des täglichen Lebens werden von den meisten Personen einer Sprachgemeinschaft gleich gut und genau verstanden, bei selteneren Wörtern ist der Bedeutungsumfang weniger genau, und manche werden nur im Kontext verstanden (Kuczaj, 1999).
Mit ca. sechs Monaten assoziieren Kinder häufig vorkommende Wörter wie „Mama“ zu ihren Referenten. Schon acht Monate alte Kinder können neue Wörter zu neuen, bewegten Gegenständen ordnen und brauchen nur wenige Wiederholungen, allerdings müssen Wort und Bewegung des Gegenstandes synchron sein (Werker & Yeung, 2005). Um die zwölf Monate herum ist Wortlernen noch stark an wahrnehmungsmäßige und soziale Hinweise gebunden. Kinder in dem Alter denken, ein attraktiver Gegenstand wird benannt, auch wenn der Untersucher zu einem anderen Objekt schaut (Werker & Yeung, 2005). 14 Monate alte Kinder ordneten in der Untersuchung von Werker und Yeung (2005) Wörter mit stärkeren Kontrasten (Lif/neem) verschiedenen Objekten zu, nicht aber schwache wie „bin“ und „pin“, obwohl sie die Lautfolgen ohne gleichzeitig dargebotenen Referenten unterscheiden konnten. Wahrnehmungsentwicklung erleichtert die Worterkennung und dient damit im Sinne des Bootstrapping der Bedeutungsentwicklung.
Oft wird angegeben, dass erste Wörter überwiegend Nomen sind (noun-bias), bei denen die Beziehung zwischen Wort und Gemeintem deutlich ist. Möglicherweise ist das jedoch ein Artefakt der Untersuchungstechniken: Bezeichnungen für Gegenstände lassen sich leichter untersuchen und werden auch häufiger von den Bezugspersonen als bekannt angegeben, weil sie offensichtlicher sind (L. Bloom, 1998). Kauschke (1999) fand für deutsche Kinder, dass sie mehr personal-soziale wie „bitte“, „danke“, „guck“, „ja“ oder „nein“ und mehr relationale Wörter wie „da“, „weg“, „auf“, „oben“ verwendeten als Nomen. Mehr als die Hälfte der Wörter, die Einjährige produzieren, sind keine Objektbezeichnungen, sondern benennen Ereignisse oder Zustände (L. Bloom, 1998). Nachdem 500 bis 600 Wörter erworben sind, etwa zwischen dem zweiten und dritten Geburtstag, besteht der Wortschatz ungefähr zur Hälfte aus Nomen, ein Viertel sind Verben und ein weiteres Viertel andere Wortarten (Tomasello, 2003a). Verben, die immer Relationen zwischen einem Akteur und einem Gegenstand/einer Person, mit dem/der etwas getan wird, beinhalten, werden später erworben. Sie bereiten den Erwerb der Grammatik vor, die grundsätzlich relational ist, weil sie die Beziehungen der Wörter im Satz bestimmt (L. Bloom, 1998). Nur ca. 8 000 Wörter sind Stammwörter, alle anderen sind Ableitungen davon (Menyuk, 2000). Kinder unter drei Jahren wissen bereits, wie aus Nomen Verben werden (Meibauer, 1999), wie man an ihren Neubildungen sehen kann („ausnapfen“ – „den Topf ausschlecken“ oder „gebest“ – „gekehrt“). Oft werden solche Neubildungen zu „Familienwörtern“, die noch verwendet werden, wenn das wortschöpferische Kind längst erwachsen ist. Morphosyntaktische und phonologische Weiterentwicklungen führen auch zu einer Erweiterung des Wortschatzes. Auch das Wissen über Wörter verändert sich damit einhergehend ebenso wie der Bedeutungsumfang (Grimm & Wilde, 1998; Menyuk, 2000).
Die Begriffs- und Konzeptbildung und deren Benennung hat eine starke allgemeine kognitive Komponente (P. Bloom, 2000; Tager-Flusberg, 1999; Woodward & Markman, 1998). Bereits das Neugeborene nimmt eine organisierte und strukturierte Welt wahr. Babys werden mit weit offenen Augen geboren, sie suchen nach Informationen und kommen mit der Voreinstellung, Muster