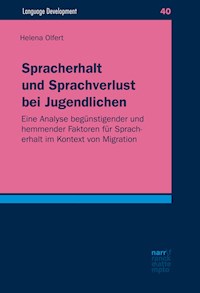
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Language Development
- Sprache: Deutsch
Der Erhalt von Minderheitensprachen ist ein in der Mehrsprachigkeitsforschung aktuell vielfach diskutiertes Thema. Die Beschäftigung mit diesem Gegenstand stellt nicht nur das gängige Verständnis von muttersprachlicher Kompetenz infrage, sondern erweitert auch eine idealisierte Vorstellung von balanciert Mehrsprachigen um Sprecher mit vielfältigeren Sprachprofilen. Dieser Band stellt nach einem umfassenden, interdisziplinär angelegten Überblick über das Forschungsfeld eine empirische quantitative Studie vor, die den Einfluss unterschiedlicher außersprachlicher Faktoren auf den Erhalt bzw. den Verlust der Herkunftssprache bei Jugendlichen der zweiten Migrantengeneration in Deutschland untersucht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helena Olfert
Spracherhalt und Sprachverlust bei Jugendlichen
Eine Analyse begünstigender und hemmender Faktoren für Spracherhalt im Kontext von Migration
Narr Francke Attempto Verlag Tübingen
© 2019 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG Dischingerweg 5 • D-72070 Tübingen www.narr.de • [email protected]
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-8233-8306-2 (Print)
ISBN 978-3-8233-0170-7 (ePub)
Inhalt
Danksagung
Zu dieser Arbeit leisteten verschiedene Personen einen wertvollen Beitrag, für den ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken möchte. Mein außerordentlicher Dank gilt Prof. Dr. Katja F. Cantone-Altıntaş für ihre Geduld, ihre Aufgeschlossenheit gegenüber meinem Zugang zu dem Thema und dafür, dass sie mir neue Denkweisen in Bezug auf Mehrsprachigkeit eröffnete. Prof. Dr. Christoph Schroeder danke ich für seine kritischen Fragen und die intensiven Diskussionen. Prof. Dr. Christina Noack möchte ich für ihr Vertrauen in mich und ihre stete Unterstützung danken. Meiner Mentorin Prof. Dr. Nicole Marx danke ich für ihre ermutigenden Worte auf den letzten Metern. Ein besonderer Dank gilt Prof. Dr. Katharina Brizić für ihre kreativen Forschungsideen, die inspirierenden Gespräche und für ihren Ansporn, dem „Rauschen in den Daten“ nachzuspüren. Prof. Dr. Utz Maas, der meine Begeisterung für die Sprachwissenschaft weckte, gilt mein herzlichster Dank. Durch ihn lernte ich, bei linguistischen Fragestellungen über den Tellerrand hinauszublicken.
Ein großer Dank geht außerdem an alle Schülerinnen und Schüler, die an der Studie teilnahmen, ebenso wie an die interessierten Lehrkräfte und Schulleiterinnen und Schulleiter. Ohne ihr Engagement hätte es diese Studie nicht gegeben.
Nicht zuletzt möchte ich mich bei allen bedanken, die mich auf meinem Weg durch wertvolle inhaltliche Diskussionen und kritisches Lesen der Arbeit, aber auch durch motivierende Aufmunterungen begleiteten: Sara Romano, Sven Oleschko, Dr. Majana Beckmann, Julia Hübner, Dr. Galina Putjata, Marina Root, Murat Kılıç, Dr. Valentina Cristante und Zuzanna Lewandowska.
Der größte Dank gilt jedoch meiner Familie und meinen Freunden, die stets an mich geglaubt haben. Jan danke ich dafür, dass er mir immer unterstützend und ermutigend zur Seite gestanden hat und mich die Arbeit auch mal hat vergessen lassen. Marina danke ich für ihren Optimismus und unerschöpflichen Humor. Schließlich möchte ich ganz besonders herzlich meinen Eltern und meiner Schwester danken, weil ich jederzeit auf sie zählen kann.
Abkürzungsverzeichnis
AILA
Association Internationale de Linguistique Appliquée
CILS
Children of Immigrants Longitudinal Study
C-Test
Cloze-Test
ECRM
Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen
GIDS
Graded Intergenerational Disruption Scale
HL
Heritage Language
IAT
Impliziter Assoziationstest
IGLU
Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung
k. A.
keine Angabe
L1
Erstsprache
L2
Zweitsprache
LOTE
Languages Other Than English
MEIM
Multigroup Ethnic Identity Measure
MLU
Mean Length of Utterance
OECD
Organisation for Economic Co-operation and Development
OPOL
One Person One Language
PISA
Programme for International Student Assessment
SBK
Serbisch, Bosnisch, Kroatisch
SOV
Subjekt, Objekt, Verb
SVO
Subjekt, Verb, Objekt
TN
Teilnehmer
VOT
Voice Onset Time
Ich finde es gut, Deutsch zu sprechen, aber meiner Meinung nach ist die Muttersprache am wichtigsten.
weiblich, 15, HL Arabisch
Ja, ich mag beide Sprachen. Wenn man mehrere Sprachen kann, hat man im Berufsleben mehr Chancen aufzusteigen, und es ist nichts Schlimmes, zwei Sprachen zu können.
männlich, 15, HL Russisch
Ich würde es sehr gut finden, wenn man in jeder Schule seine eigene Muttersprache lernen könnte!
männlich, 15, HL Türkisch
Ich finde es schön, wenn Kinder von Geburt an mehrere Sprachen lernen. Meiner Meinung nach kann das Gehirn besser Sprachen lernen, wenn man jünger ist. Später ist dann das Gehirn besser im Sprachenlernen trainiert als das von jemandem, der nur eine Sprache kann.
weiblich, 16, HL Italienisch
Um ehrlich zu sein, bin ich neidisch auf andere, die ihre Muttersprache gut sprechen können.
weiblich, 15, HL Polnisch
1 Einleitung
1.1Zielsetzung der Arbeit
Der Erhalt von Heritage Languages (HL), also von allochthonen, intergenerational im Sinne eines sprachlichen Erbes weitergegebenen Minderheitensprachen, ist ein in der Mehrsprachigkeitsforschung aktuell vielfach diskutiertes Thema. Die Beschäftigung mit diesem Gegenstand rückt migrationsbedingte Mehrsprachigkeit und Minderheitensprachen mit geringem Prestige in den Fokus der Forschung und stellt nicht nur das gängige Verständnis von „muttersprachlicher“ Kompetenz infrage, sondern erweitert auch eine idealisierte Vorstellung von balanciert Mehrsprachigen um Sprecher mit weitaus vielfältigeren Sprachprofilen. Dieser Blick in die Peripherie von Sprachkompetenz- und -dominanzgraden Mehrsprachiger entspricht ungleich häufiger der tatsächlich beschriebenen sprachlichen Realität von HL-Sprechern, die auch ausschließlich über passive Kenntnisse ihrer HL verfügen können. Zudem gibt dieses Untersuchungsfeld Aufschluss über die Auswirkungen von außersprachlichen Merkmalen ganzer Sprechergruppen oder einzelner Individuen auf den Sprachkompetenzgrad in der HL. Dieser spiegelt als Ergebnis des Spracherwerbsprozesses die Bedeutsamkeit externer Kontextbedingungen für den Erhalt von Minderheitensprachen in der Migrationssituation wider. Die vorliegende Arbeit widmet sich diesem letztgenannten Aspekt und untersucht den Einfluss unterschiedlicher außersprachlicher Faktoren auf den Erhalt bzw. den Verlust der HL bei Jugendlichen der zweiten Migrantengeneration.
Ziel dieser Arbeit ist es, zur Beschreibung der Sprachverlust- bzw. Spracherhaltprozesse ein integratives Regressionsmodell der Einflussfaktoren für Spracherhalt in der Migration zu schaffen, das bereits vorhandene Ansätze aus der Attritions- und der Sprachtodforschung auf den jugendlichen HL-Sprecher überträgt und so mit bestehenden Erkenntnissen der HL-Forschung vereint. Das Modell soll dabei sowohl sprachbiographische als auch sozio-emotionale Faktoren sowie Kontexte des Sprachgebrauchs im Sinne des Registerbegriffs berücksichtigen. Auf diese Weise können zum einen die in der Sprachtodforschung aufgestellten Hypothesen über Wirkungszusammenhänge externer Faktoren auf das Aussterben autochthoner Minderheitensprachen (vgl. Sasse 1992) in einem allochthonen Kontext überprüft werden. Zum anderen können die in der Attritionsforschung bestehenden Annahmen über die Bedeutung einzelner außersprachlicher Faktoren für den Erhalt einer Sprache in der Migrationssituation (vgl. Schmid 2011) durch deren Transfer auf Sprecher eines anderen Spracherwerbstyps validiert werden. Diese sollen zudem an einer größeren Teilnehmerzahl und an unterschiedlichen HLs getestet werden.
Zu der grundsätzlichen Frage des Erhalts oder Verlusts von allochthonen Sprachen liegt eine Vielzahl von Studien vor, die zumindest einige außersprachliche Einflussfaktoren in die Analyse einbeziehen und hierdurch wichtige Hinweise auf bedeutende Wirkungszusammenhänge liefern. Die meisten dieser Studien, die bereits Bezüge zwischen externen Faktoren und dem Erhalt bzw. Verlust von allochthonen Minderheitensprachen in der Migrationssituation nachzeichnen, sind der Attritionsforschung zu erwachsenen Sprechern der ersten Einwanderergeneration zuzurechnen (vgl. Beiträge in Köpke et al. 2007; Schmid et al. 2004; Schmid & Köpke 2013). Allerdings berücksichtigen sie meist aufgrund einer geringen Probandenanzahl nur einige der Einflussmerkmale und widmen sich der Erforschung einer spezifischen Sprechergruppe in einem bestimmten sprachlichen Kontext, was teilweise zu sich widersprechenden Ergebnissen in der Einschätzung der einflussrelevanten Faktoren führte. Da sich die Sprecher in diesen Studien zudem von HL-Sprechern durch eine anders gelagerte Spracherwerbssituation unterscheiden, wird die grundsätzliche Übertragbarkeit der gemäß der Attritionsforschung für Spracherhalt förderlichen Faktoren auf den Kontext der HL-Sprecher in dieser Forschungsarbeit überprüft.
Des Weiteren wird eingehend erörtert, ob Ergebnisse aus Studien, die Attrition zum Gegenstand haben, ebenfalls für andere Altersgruppen als für Erwachsene Gültigkeit beanspruchen können. Dabei ist insbesondere die Überprüfung der Annahmen für den Kontext der Jugendlichen als gewinnbringend einzuschätzen: Diese Altersspanne ist nicht nur selten Gegenstand von Untersuchungen zum Spracherhalt, sie zeichnet sich ebenso durch eine spezifische Konstellation an externen Faktoren aus. Beispielsweise tritt die Familie als Sozialisationsinstanz in den Hintergrund, während Gleichaltrige eine zunehmend wichtigere Rolle spielen (vgl. Ecarius 2010). Diese Tatsache gepaart mit einer für dieses Alter oftmals beschriebenen Identitätssuche könnte einen bedeutsamen Einfluss auf die Entwicklung und die Stabilität der HL ausüben.
Ein weiterer Aspekt, der für die hier vorgestellte Studie von zentraler Bedeutung ist, ist die Aufspaltung sprachlicher Fähigkeiten nach Registern (vgl. Biber 1995; Maas 2010). Register als Domänen sozialen Handelns bestimmen nicht nur die hierfür benötigten sprachlichen Mittel, sie entscheiden ferner über deren Adäquatheit und positionieren den Sprecher somit zusätzlich in einem gesetzten Kontext als ein kompetent agierendes Subjekt. Im Sinne sprachlichen Ausbaus ist der Erwerb literater, schriftsprachlicher Strukturen für ein angemessenes Handeln auch im formellen Register unabdingbar. Literate Strukturen können jedoch nur erworben werden, wenn diese von oraten Strukturen aus initialisiert werden können und wenn ihre Aneignung gleichzeitig durch die sozialen Gegebenheiten gefordert ist. Für die Mehrheitssprache stellen Bildungsinstitutionen solch eine soziale Gegebenheit dar. Hier werden die für eine gelungene Kommunikation erforderlichen sprachlichen Fertigkeiten im formellen Register von den Sprechern nicht nur abverlangt, sondern im Idealfall auch vermittelt. HL-Sprecher erhalten hingegen weitaus weniger Möglichkeiten, die literaten Strukturen ihrer HL zu erwerben und zu nutzen, da diese Sprache zumeist ausschließlich die Domäne der Familie einnimmt, die dem intimen Register zuzurechnen ist. Das formelle Register bleibt für sie häufig allein durch die Mehrheitssprache besetzt. Nur wenige Studien der Sprachtod-, Spracherhalt- und -revitalisierungsforschung thematisieren diesen Aspekt und berücksichtigen in ihren Modellen gleichermaßen Standardisierung, Normierung und Schriftsprachlichkeit als auf Gruppenebene relevante Faktoren für den Erhalt einer Sprache (vgl. Grenoble & Whaley 2006). In der HL-Forschung wird der Erwerb schriftsprachlicher Strukturen allem voran im Rahmen von herkunftssprachlichem Unterricht beforscht und stellt eine Hürde beim Erstellen geeigneter Testformate und -instrumente dar (vgl. Montrul 2008; Polinsky 2015a). Untersuchungen zu Bedingungen, die speziell den Erwerb literater Strukturen fördern, sind hier ebenso selten.
Während die Sozialpsychologie auf mehrere Jahrzehnte der Erforschung von Einstellungen und sozialer Identität zurückblicken kann (vgl. Fishbein & Ajzen 1977; Tajfel 1982) und für die Erhebung dieser Konzepte geeignete Instrumente zur Verfügung stellt, werden die Begriffe „Einstellung“ und „Identität“ in der Mehrsprachigkeitsforschung meist noch recht alltagsnah interpretiert. Eine differenzierte Auseinandersetzung mit Erkenntnissen der Sozialpsychologie oder eine daran angelehnte Erhebung von kultureller Identität und von Spracheinstellungen bilden die Ausnahme. Da diese Faktoren jedoch – wie Ergebnisse der Attritionsforschung es nahelegen – eine zentrale Rolle für den Erhalt der HL spielen können, ist ihre sorgsame Erhebung für die Erstellung eines theoretischen Einflussmodells für Spracherhalt von größter Bedeutung. Daher ist ein weiteres Ziel dieser Forschungsarbeit, in der Sozialpsychologie erarbeitete Instrumente zur Messung von Einstellung und kultureller Identität zu nutzen, um auf diese Weise das aufgestellte Modell zu externen Einflussgrößen auf den Erhalt der HL auch interdisziplinär stärker zu verorten.
1.2 Aufbau der Arbeit
Die Arbeit gliedert sich in sieben weitere Kapitel. Im zweiten Kapitel erfolgt eine einführende Auseinandersetzung mit Spracherhaltprozessen auf gesellschaftlicher, institutioneller und individueller Ebene. Diskussionen um die Bedeutung von Sprachprestige für das Aufgeben von Sprachen in der Migrationssituation und auf Mehrsprachigkeit zurückgeführte Leistungsdisparitäten werden Argumenten für den Erhalt von Minderheitensprachen gegenübergestellt. Statistische Angaben zu Mehrsprachigkeit in Deutschland bilden den Ausgangspunkt für die Frage danach, welchen Forschungs- und Erkenntnisertrag die Beschäftigung mit HLs für die Mehrsprachigkeitsforschung bieten kann.
Es folgt im dritten Kapitel eine theoretische Erörterung der konzeptionellen Hintergründe des Begriffes „Heritage Language“ samt seiner kritischen Reflexion. Neben einer definitorischen Abgrenzung zu anderen damit verwandten Begriffen wird an dieser Stelle eine Typologie des HL-Sprechers unter Einbezug seiner Sprachbiographie aufgestellt. Zur Erklärung der Varianz in der Sprachkompetenz von HL-Sprechern werden Forschungserkenntnisse zu Attrition und unvollständigem Erwerb herangezogen. Daran schließt sich ein Überblick über nationale wie internationale Studien zu sprachstrukturellen Eigenschaften von unterschiedlichen HLs auf allen linguistischen Beschreibungsebenen an.
Den im Fokus dieser Arbeit stehenden außersprachlichen Faktoren und ihrem Einfluss auf den Erhalt der HL widmet sich das vierte Kapitel. Hierin erfolgt zunächst eine Zusammenfassung gruppenspezifischer außersprachlicher Merkmale, die auf der Ebene der sprachlichen Community den HL-Erhalt steuern können. Eine systematische Analyse des aktuellen Forschungsstandes zu individuellen externen Einflussfaktoren schließt sich daran an. Hierbei erfahren zuerst die Merkmale Spracherwerbstyp, sprachliche Konstellation innerhalb der Familie und Geschwisterrangfolge entsprechend den Erkenntnissen der Spracherwerbsforschung (vgl. De Houwer 2009) als sprachbiographische Faktoren eine ausführliche Betrachtung gefolgt von unterschiedlichen Sprachgebrauchskontexten. Diese werden nach zwei Gesichtspunkten unterteilt: Unter Berücksichtigung der Theorie des sprachlichen Modus nach Grosjean (2001) sowie des Registermodells nach Maas (2010) werden Forschungsergebnisse zu diversen Kontexten sowohl des bilingualen und monolingualen Sprachgebrauchs als auch der Sprachverwendung im intimen und formellen sprachlichen Register samt ihrem Einfluss auf den Erhalt der HL referiert. Darauffolgend werden die theoretischen Grundlagen der sozio-emotionalen Faktoren „Einstellung zur Mehrsprachigkeit“ (vgl. Agheyisi & Fishman 1970) und „kulturelle Identität“ (vgl. Phinney et al. 2001) mithilfe von Erkenntnissen aus der Sozialpsychologie erläutert. Das Kapitel schließt mit Forschungsergebnissen, die den Einfluss dieser Merkmale auf den Spracherhalt in der Migration nachzeichnen.
Aufbauend auf den theoretisch bestimmten Eigenschaften der HL und ihrer Sprecher in Kapitel drei sowie auf den in Kapitel vier zusammengeführten Ergebnissen der Disziplinen Spracherwerbsforschung, Linguistik und Sozialpsychologie zu externen Faktoren wird im fünften Kapitel ein umfassendes Modell zu Spracherhalt von HLs konzipiert. Es berücksichtigt alle zuvor für relevant befundenen außersprachlichen Faktoren, die auf der Ebene des Individuums operieren, und lässt sich entsprechend den Merkmalsgruppen „sprachbiographische Faktoren“, „Kontexte des Sprachgebrauchs“ sowie „sozio-emotionale Faktoren“ in drei Teilmodelle unterteilen. Die in diesem Kapitel anhand des Modells formulierten Hypothesen bilden zugleich die Grundlage für die in den nachfolgenden Kapiteln beschriebene empirische Untersuchung.
In Kapitel sechs wird zunächst der quantitative Zugang zu den aufgestellten Forschungshypothesen mittels eines Fragebogens sowie die Wahl einer multiplen Regressionsanalyse als Methode begründet. Die Operationalisierung der in die Analyse aufgenommenen externen Faktoren wird ebenfalls an dieser Stelle ausführlich diskutiert. Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf der Erfassung der Sprachkompetenz der Studienteilnehmer in ihrer HL anhand von einer eigens für die vorliegende Arbeit konstruierten Skala zur Selbsteinschätzung, da diese die abhängige Variable in dem Regressionsmodell darstellt. Den Abschluss dieses Kapitels bildet eine Beschreibung der Stichprobenauswahl sowie der Untersuchungsdurchführung.
In Kapitel sieben werden die Ergebnisse der empirischen Studie detailliert vorgestellt. Das Kapitel beginnt mit einer eingehenden Beschreibung des Datensatzes, die sich auf die im Sample vertretenen HLs konzentriert. Hiernach werden die Skalenstatistiken zur Selbsteinschätzung der Sprachkompetenz sowie die deskriptiven Ergebnisse der einzelnen außersprachlichen Faktoren für die Stichprobe angeführt. Den Kern dieser Forschungsarbeit bildet die Auswertung der multiplen Regressionsanalyse. Diese wird sowohl für das Gesamtmodell der selbst eingeschätzten Sprachkompetenz in der HL als auch für einzelne, in sprachliche Register differenzierte Teilskalen dargestellt. Anschließend wird anhand der erzielten Ergebnisse überprüft, ob die zuvor aufgestellten Hypothesen zu bestätigen oder zu verwerfen sind. Den Schluss dieses Kapitels bildet ein Exkurs zu deskriptiven Analysen der türkischsprachigen Gruppe aufgrund ihrer zahlenmäßigen Gewichtung im Sample.
Im letzten Kapitel werden die Ergebnisse dieser Forschungsstudie unter Rückbezug auf die theoretischen Prämissen in den ersten Kapiteln kritisch diskutiert. Neben den daraus gewonnenen Erkenntnissen werden ebenfalls die inhaltlichen wie methodischen Limitationen der Studie aufgezeigt. Nach einer Skizzierung des damit einhergehenden Forschungsbedarfs schließt die Arbeit mit einem Ausblick auf weiterführende Perspektiven der HL-Forschung.
2 Spracherhalt und Sprachverlust in der Migrationssituation
2.1Spracherhalt und Sprachprestige
Spracherhalt und Sprachverlust im Kontext von Migration sind untrennbar mit gesellschaftlichen Strukturen verbunden. Will man also der Frage nachgehen, weshalb manche Sprachen in der Migrationssituation aufgegeben werden, während andere noch über Generationen hinweg gesprochen werden, erweist sich die Betrachtung sozialer Machtverhältnisse und historisch gewachsener Habitualisierungen als unerlässlich. Oftmals entscheiden sie darüber, welche Sprachen als nützlich und wertvoll angesehen werden, welche es sich zu lernen und zu erhalten lohnt und welche wiederum eine überflüssige Bürde darstellen, die es möglichst hinter sich zu lassen gilt. Dieser sozial konstruierte Bewertungsmaßstab für Sprachen kann aufgrund seiner symbolisch-hierarchischen Machtfunktion derart hohen Druck auf einen Sprecher aufbauen, dass dieser, rationaler Denkweise folgend, sich gegen das Festhalten an vermeintlichen sprachlichen Altlasten und für ein scheinbar schnelleres Vorankommen ohne eine nicht prestigeträchtige Sprache entscheidet bzw. sich zu dieser Entscheidung gedrängt sieht (vgl. Fishman 1991).
Wird Einsprachigkeit in der Mehrheitssprache gesellschaftlich als der natürliche Zustand angesehen, so bedarf der Erhalt einer Minderheitensprache seitens eines Individuums umso mehr Aufwand hinsichtlich Energie, Zeit und Rechtfertigung, da ihm eine entsprechende Unterstützung in Form von staatlich etablierten Strukturen und gesellschaftlicher Anerkennung nicht zur Verfügung steht (vgl. Herdina & Jessner 2002). Im Gegensatz dazu ist Unterstützung für die gesellschaftlich legitime Mehrheitssprache sichergestellt, da sie auf dem „sprachlichen Markt“ als Ressource fungiert, die in ökonomisches Kapital umgewandelt werden kann und somit sozialen Aufstieg und Bildungserfolg erst ermöglicht (vgl. Bourdieu 1991). Als Folge habitualisierter Bewertungsmechanismen zum einen und der Betrachtungsweise von Mehrsprachigkeit als nur einer Übergangsphase zum anderen können sich Individuen in der Migrationssituation dazu gezwungen sehen, ihre mitgebrachten Sprachen aufzugeben.
Der gesellschaftlich festgelegte Marktwert von Sprachen ist omnipräsent und lässt sich mittels eines hierarchisch geordneten Modells von De Swaan mit einem Kern und einer Peripherie beschreiben (vgl. De Swaan 2001; s. Abbildung 1). Die Position der jeweiligen Sprache in dem Modell symbolisiert gleichsam ihren kommunikativen Wert und ihr Prestige. So befinden sich nach der Analyse von De Swaan ca. 98 % aller derzeit weltweit gesprochenen Sprachen in der Peripherie des globalen Sprachsystems. Obwohl hierunter mehrere tausend Sprachen fallen, werden sie von nur ca. 10 % der Bevölkerung in sehr kleinen Sprechergruppen verwendet. In Abgrenzung zu den im Zentrum des Modells positionierten Sprachen werden periphere Sprachen ausschließlich über negative Attribute beschrieben: Sie verfügen über keinen schriftsprachlichen Ausbau, sind keine National- oder Amtssprachen und werden weder als Mutter- noch als Fremdsprachen unterrichtet. Ihre Sprecher sind zudem aufgrund der geringen Größe der eigenen Sprachgemeinschaft zu Kommunikationszwecken auf Kenntnisse anderer Sprachen angewiesen, sei es anderer ebenfalls peripherer Sprachen oder aber Sprachen mit einem höheren Kommunikationswert.
Struktur des globalen Sprachsystems nach De Swaan (2001), eigene Darstellung
Als zentrale Sprachen betrachtet De Swaan (2001: 4f.) ungefähr 100 Sprachen, die von etwa 95 % der Bevölkerung gesprochen werden. Diese Sprachen zeichnen sich durch eine Kodifizierung aus, d.h., sie verfügen über einen verbindlichen Standard. Dies ermöglicht wiederum ihre Einrichtung als Nationalsprachen, ihre Unterrichtung sowie ihre Verwendung in Medien, Verwaltung und Justiz. Sprecher zentraler Sprachen können monolingual sein, da ihre Sprache über genügend Kommunikationswert in ihrem Nationalstaat verfügt.
Superzentrale Sprachen erfüllen über die Funktionen als Staatssprachen hinaus weitere Aufgaben und gestatten u.a. internationale Kommunikation. Zu diesen Sprachen zählt De Swaan Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Hindi, Japanisch, Malaiisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Swahili (vgl. ebd.: 5). Bis auf Swahili haben sie mehr als 100 Millionen Sprecher, die meisten fanden weltweite oder übernationale Verbreitung vor allem durch Kolonialisierung und Besetzung. Heutzutage dominieren sie nach wie vor das öffentliche Leben in den entsprechenden Staaten und schreiben somit die historisch gewachsenen sprachlichen Machtkonstellationen fort. Sie finden sich in höheren Bildungsinstitutionen, in der Wissenschaft, Politik, Technologie und Administration. Superzentrale Sprachen bilden ferner die typischerweise schulisch vermittelten Fremdsprachen in anderen Staaten.
Im Zentrum des gesamten Systems steht allerdings Englisch, das als hyperzentrale Sprache, als Lingua Franca, eine globale Kommunikation ermöglicht und in der Lage ist, Sprecher anderer Sprachen miteinander zu verbinden. Dies macht Englisch momentan zur Sprache mit dem größten Prestige weltweit.
Die hierarchische Anordnung von Sprachen hat einen starken Einfluss auf das Lernen von Sprachen, das stets zentripetal funktioniert, also von der Peripherie ins Zentrum, was zu einer steten Verfestigung dieser sprachlichen Hegemonie führt (vgl. De Swaan 2001: 5). Je zentraler sich eine Sprache im System befindet, desto mehr Sprecher (als Erst- oder Zweitsprache; L1 bzw. L2) lassen sich mit ihr erreichen, desto höher ist ihr Kommunikationswert und desto größer ihr Prestige. Das bedeutet, je höher das Prestige einer Sprache in der globalen Rangordnung ist, umso mehr wird ein Sprecher bereit sein, Zeit, Energie sowie monetäre oder andere Ressourcen in ihr Erlernen zu investieren.
Diese Prägung bzw. Überlagerung von Sprachlernentscheidungen durch Sprachprestige lässt sich mit einigen Modifikationen auf die Migrationssituation übertragen. In einem konkreten Kontext haben Migrantensprachen in der Diaspora wie Minderheitensprachen per se einen geringeren Kommunikationswert als die offizielle Nationalsprache des jeweiligen Staates. Belegt eine Minderheitensprache zusätzlich hierzu generell nur einen unteren Rang in dem globalen Sprachprestigegefüge und wurde sie auch im Herkunftsland der Sprecher als peripher angesehen, so sind der Wunsch und das Bestreben nach ihrem Erhalt in der Migrationssituation sogar für die Sprecher selbst nur schwer über rationale oder ökonomische Argumente zu begründen. Der Druck zu ihrer Aufgabe ist gesellschaftlich umso größer. Sprachverlust verläuft also in diesem Modell ebenfalls von außen nach innen, sodass diejenigen Sprachen am schnellsten und am häufigsten aufgegeben werden, die sich in der Peripherie befinden.
Das Modell von De Swaan (2001) zeigt zudem, dass Sprachprestige keine natürlich gewachsene Rangordnung von Sprachen ist, die auf objektiven Kriterien o.ä. basiert. Vielmehr ist Sprachprestige gesellschaftlichen Umbrüchen, sozialen Ordnungen sowie historischen Entwicklungen geschuldet und über längere Zeitperioden entstanden. Es ist eng verknüpft mit ökonomischen Vorteilen für die Sprecher und mit ihrer Positionierung im sozialen Raum, weshalb es nicht losgelöst von diesen Faktoren betrachtet werden kann (vgl. ebd.: 6). Sprachprestige durchzieht darüber hinaus die Bildungspolitik und äußert sich über die zentripetale Lernrichtung in gesetzlichen Bestimmungen europäischer Sprachenpolitik, in institutionell etablierten und geförderten Fremdsprachen sowie in den Einstellungen der Bevölkerung bestimmten Sprachen gegenüber.
Die Eurobarometer-Umfrage zu den in der EU gesprochenen Sprachen stellte beispielsweise fest, dass die offiziellen europäischen Bemühungen um eine m+2-Sprachenpolitik1 sich in erster Linie in einem Ausbau der Englischkenntnisse, also der hyperzentralen Sprache, niederschlagen (vgl. Europäische Kommission 2012). Diese Dominanz des Englischen reflektierend betitelt De Swaan das Kapitel zu europäischen Sprachverhältnissen in seiner Arbeit auch passenderweise mit „The European Union – The more languages, the more English“ (vgl. De Swaan 2001). Nach wie vor stellt Englisch gefolgt von Französisch und Deutsch die am häufigsten gelernte europäische Fremdsprache dar (vgl. Europäische Kommission 2012: 7). Zwei Drittel der europäischen Bürgerinnen und Bürger sind davon überzeugt, dass Englisch nach ihrer Landessprache die wichtigste Sprache sei (vgl. ebd.: 8). Minderheitensprachen – ob autochthone oder allochthone – werden in der Umfrage nicht thematisiert, was erneut ihre Stellung in der Peripherie der öffentlichen Wahrnehmung unterstreicht.
Eine repräsentative Umfrage zu Sprachprestige im deutschen Kontext, die auch Minderheitensprachen berücksichtigt, legten Gärtig und Kollegen vor (2010). Sie konnten die Ergebnisse der Eurobarometer-Studie bestätigen: Die deutsche Bevölkerung befürwortete stark das europäische Mehrsprachigkeitsziel (vgl. ebd.: 250) und bekräftigte, dass Englisch, Französisch und Spanisch in der Schule als Fremdsprachen gelehrt werden sollten. 7,5 % wünschten sich zudem, dass zukünftig Chinesisch an deutschen Schulen unterrichtet wird (vgl. ebd.: 250). Chinas Entwicklung zur global agierenden und aufstrebenden Nation steigerte also in den letzten Jahren stark den Kommunikationswert des Chinesischen und spiegelt sich bereits in einer wahrnehmbaren Erhöhung seines Prestiges wider. Gleichzeitig empfanden die Deutschen fremdsprachige Akzente oben genannter Sprachen sowie Sprachen beliebter angrenzender Urlaubsländer auf subjektiver Ebene als besonders schön (Französisch, Italienisch, Englisch, Spanisch). Gefragt nach den unangenehmsten Akzenten, wurde hingegen eine russisch-, türkisch- oder polnischgefärbte Aussprache genannt (vgl. ebd.: 244-247). Jeweils ein Drittel der Befragten gab an, Schwierigkeiten bei der Verständigung mit Migranten zu haben oder es nicht gutzuheißen, wenn diese in manchen Bereichen ausschließlich ihre Muttersprache verwendeten (vgl. ebd.: 236ff.). Auf der anderen Seite begrüßten über 80 % der Bevölkerung den Erhalt von autochthonen Minderheitensprachen in Deutschland.
Die Studie von Gärtig und Kollegen (2010) verdeutlicht zusätzlich zu einer ubiquitären Rangordnung unterschiedlicher Sprachen zwei weitere Punkte: Zum einen führt die große Befürwortung autochthoner Minderheitensprachen offenbar nicht dazu, dass auch deren Unterrichtung in der Schule gefordert wird. An dieser Stelle spielt sicherlich der Kommunikationswert dieser Sprachen abseits von ideellen Vorstellungen eine, wenn nicht sogar die entscheidende Rolle. Zum anderen ist ein hohes Prestige einer Sprache wie Russisch im globalen Sprachsystem noch kein Garant für ihre Akzeptanz. Dass Sprachprestige sogar top-down installiert werden kann und gesellschaftliche Machtverhältnisse noch lange nach einer Änderung dieser unmittelbar reflektiert, wird in der Studie gerade am Russischen deutlich. So sprachen sich noch zwanzig Jahre nach der Wiedervereinigung gut 40 % der Bevölkerung in den Bundesländern der ehemaligen DDR für Russisch als Fremdsprache in der Schule aus (vgl. ebd.: 251).
Eine von der deutschen Bevölkerung ausdrücklich verlangte Förderung erfahren die Sprachen von autochthonen, auf europäischem Territorium alteingesessenen Minderheiten offiziell in der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen (ECRM, vgl. Europarat 1992). Ihr Ziel ist der Erhalt und der Schutz dieser Sprachen, was insbesondere das Recht auf ihre institutionelle Verankerung im Bildungswesen umfasst. Aber auch ihre Verwendung in den Bereichen Medien, Justiz, Kultur und Verwaltung soll gesetzlich gestärkt und garantiert werden. Von diesem Schutz profitiert in Deutschland beispielsweise die dänischsprachige Minderheit in Schleswig-Holstein. Hier bestehen neben einem sehr gut ausgebauten Netz an bilingualen Programmen in Bildungseinrichtungen aller Stufen und Zweige rein dänischsprachige Schulen, zahlreiche sprachlich-kulturelle Angebote und Lerngelegenheiten für alle Altersgruppen (vgl. Andresen 1997: 96; Boysen 2011: 13). Diese geradezu mustergültige Unterstützung des Dänischen trägt entscheidend zu seiner Stärkung, Anerkennung und zu seinem Erhalt bei, sodass heutige Schätzungen von bis zu 50.000 aktiven Dänischsprechern in Schleswig-Holstein ausgehen (vgl. ebd.).2
Für die anderen autochthonen Minderheitensprachen auf deutschem Territorium, also Sorbisch, Nord- und Saterfriesisch, Niederdeutsch sowie Romanes, stellt sich die Lage trotz eines ebenfalls durch die ECRM garantierten Schutzes gänzlich anders dar. Im Gegensatz zu ihnen verfügt das Dänische nicht nur über einen schriftsprachlichen Standard, sondern auch über den Status als Nationalsprache des benachbarten Königreichs Dänemark, was es zu einer zentralen Sprache macht, ihm einen größeren Wert auf dem „sprachlichen Markt“ zuschreibt und sein Prestige erhöht (vgl. Maas 2008: 67). Hierdurch wird die Tradierung der Sprache an nachfolgende Generationen vereinfacht, ihre Verwendung als Medium der Bildung und Unterrichtskommunikation gerechtfertigt und der Spracherhalt erleichtert. Obwohl beispielsweise Sorbisch genauso über einen schriftsprachlichen Ausbau und bilinguale Bildungsangebote verfügt, bedarf es eines starken sprachpolitischen Engagements der Sprecher, um den Verlust dieser peripheren Sprache auf lange Sicht aufzuhalten (vgl. Bundesministerium des Innern 2015: 48) – für sie gibt es keinen „Markt“. An dieser Stelle wird bereits deutlich, welche Position Sprachprestige für den Erhalt oder Verlust von Sprachen in Minderheitenkonstellationen einnimmt, selbst wenn diese offiziell anerkannt und per Gesetz geschützt und gefördert werden. Dies gilt umso mehr für allochthone Sprachen von zugewanderten Minderheiten, die von dieser Förderung explizit ausgeschlossen sind.
Die an etablierten großen Nationalsprachen ausgerichtete europäische Sprachpolitik spiegelt sich ebenso in dem Fremdsprachenangebot an deutschen Schulen wider. Nicht nur die flächendeckende Einführung des Englischen3 ab Klasse 1, auch die Teilnehmerzahlen an in der Schule angebotenen modernen Fremdsprachen belegen diese implizite Rangordnung unterschiedlicher Sprachen (s. Tabelle 1). So lernte beispielsweise in dem Schuljahr 2015 / 2016 die größte Mehrheit der Schülerinnen und Schüler in Deutschland Englisch als Fremdsprache (87 %), mit weitem Abstand gefolgt von Französisch (18 %) und Spanisch (5 %). Der Anteil an erteiltem Unterricht in Russisch oder Türkisch, den größten allochthonen Sprachen in Deutschland, lag hingegen bei 1,3 % bzw. 0,6 %.
Fremdsprache
TN gesamt
TN Grundschule
TN Gymnasium
Englisch
7.221.431
1.725.656
2.264.245
86,6%
23,9%
31,4%
Französisch
1.495.193
96.695
908.808
17,9%
6,5%
60,8%
Spanisch
416.997
2.720
295.342
5,0%
0,7%
70,8%
Russisch
111.185
2.267
51.208
1,3%
2,0%
46,1%
Türkisch
50.862
28.823
2.827
0,6%
56,7%
5,6%
Teilnehmer am Fremdsprachenunterricht im Schuljahr 2015 / 2016 im Vergleich (vgl. Statistisches Bundesamt 2017a)
Unter dem Aspekt der Schulformen betrachtet, lässt sich ebenfalls ein Ungleichgewicht zwischen den Sprachen erkennen. Während der Anstieg an Teilnehmern für die meisten angebotenen Fremdsprachen durch das Hinzukommen der zweiten und dritten Fremdsprache ab der Sekundarstufe I zu erklären ist, finden 56,7 % des Türkischunterrichts an Grundschulen4 statt – vermutlich im Rahmen des sog. herkunftssprachlichen Unterrichts. Sein Status als Ergänzungsunterricht ist grundsätzlich problematisch, da er im deutschen Bildungssystem nach wie vor nur eine marginale Rolle spielt (vgl. Gogolin & Oeter 2011: 40; Küppers & Schroeder 2017). Schwierigkeiten bei der Zertifizierung von erbrachten Leistungen, fehlende Lehrkräfte, ungeklärte Verantwortlichkeiten und Finanzierungsprobleme sowie die Voraussetzung einer bestimmten (sprachlichen, geographischen, ethnischen) Herkunft (vgl. Lengyel & Neumann 2016: 12) verhinderten bisher seine Integration in den regulären Unterricht (vgl. Schroeder 2003: 25ff.; für eine ausführliche Diskussion s. auch Abschnitt 4.4.4).
Debatten über die Funktion, den Nutzen und die Zielsetzungen herkunftssprachlichen Unterrichts werden bisweilen ebenfalls von Sprachprestigemechanismen bestimmt und münden in einem „Kosten-Nutzen-Kalkül“ (Niedrig 2011: 102). Diskutiert wird hier vor allem, ob der Erhalt und die Förderung von allochthonen Minderheitensprachen in der Verantwortung des Staates und somit der Schule lägen. Schließlich stehe diese Forderung im Widerspruch zu der symbolisch-unitarisierenden Funktion einer Nationalsprache als der einzig legitimen Sprache (vgl. Krüger-Potratz 2011: 54). Dies hat zur Folge, dass die meisten Kinder allochthoner Minderheiten in Deutschland im Rahmen von Submersionsmodellen beschult werden, eventuell mit zusätzlichen Förderangeboten in der Mehrheitssprache Deutsch (vgl. Reich & Roth 2002: 20).
Werden herkunftssprachliche Kurse dennoch eingerichtet, so lassen sich je nach Kontext folgende Beweggründe hierfür finden (vgl. Broeder & Extra 1999): Auf der einen Seite steht die Rückkehroption in das Herkunftsland, auf die die Schülerinnen und Schüler durch herkunftssprachlichen Unterricht vorbereitet werden sollen. Die sprachliche Eingliederung in die Mehrheitsgesellschaft ist hier nicht im Fokus. Diese Perspektive wurde in Deutschland vor allem in den 1970er Jahren eingenommen und wird heutzutage zumindest nicht mehr explizit angeführt (vgl. Schroeder & Küppers 2016: 201). Bei einer Bleibeperspektive wird oftmals in einem kompensatorischen Sinne für die Einrichtung herkunftssprachlichen Unterrichts argumentiert. Durch Transfer von in der Minderheitensprache Gelerntem könne die Mehrheitssprache gefestigt werden. Unterricht in der Minderheitensprache wird in diesem Argumentationsansatz durch eine Überbrückungsfunktion bzw. durch einen Ausgleich sprachlicher Defizite bis zu einer Eingliederung in die Regelklasse gerechtfertigt (vgl. Niedrig 2011: 102f.). Diese Modelle stehen nur einigen wenigen wertschätzenden Ansätzen gegenüber, die Pluralität und sprachliche Diversität unterstützen möchten. Sprachprestige durchdringt also über gesellschaftliche Machtordnungen auch die Bildungsinstitutionen, was Auseinandersetzungen über negative Auswirkungen von Spracherhalt auf Bildungserfolg befeuert und die Aufgabe peripherer Sprachen mit einem geringen Kommunikationswert zusätzlich forciert.
2.2Mehrsprachigkeit und Bildungserfolg
Das Thema Mehrsprachigkeit dominiert bildungspolitische Diskussionen insbesondere unter dem Aspekt der Bildungsrelevanz. Die Debatte findet in Deutschland vor allem auf folgender Ebene statt: Medial präsent und wissenschaftlich aufgegriffen wird die Sichtweise, die Kenntnis der Migrantensprache behindere den Erwerb der Mehrheitssprache Deutsch und schade demnach dem Bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler mit sog. Migrationshintergrund.1 Diese schneiden sowohl in Bezug auf Bildungsbeteiligung und -erfolg als auch bei Leistungsmessungen wesentlich schlechter ab als Gleichaltrige ohne Migrationshintergrund. Bereits an dem ersten Übergang im deutschen Bildungssystem, dem Übergang von Elementar- in die Primarstufe, werden Kinder mit Migrationshintergrund überdurchschnittlich häufig von der Einschulung zurückgestellt (vgl. Gomolla 2009: 29). Stanat (2006: 190) zeigt, dass Schülerinnen und Schüler ohne deutsche Staatsangehörigkeit nach wie vor deutlich geringere Bildungserfolge erreichen als Gleichaltrige mit einem deutschen Pass. Werden diese Angaben um Anteile von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund erweitert, kann ebenfalls festgestellt werden, dass Kinder und Jugendliche aus zugewanderten Familien in höheren Bildungsgängen wie dem Gymnasium in Deutschland unterrepräsentiert und in unteren wie der Förderschule überrepräsentiert sind. Dies entspreche laut Stanat „den Verhältnissen, die in Deutschland etwa 1970 anzutreffen waren“ (ebd.). Forschungsergebnisse von Kristen (2000: 15) belegen, dass der Faktor „Ethnie“ selbst nach Kontrolle der Schülerleistungen in Deutsch und Mathematik in entscheidendem Maße über einen Hauptschulbesuch entscheidet, was insbesondere auf türkisch- und italienischstämmige Schülerinnen und Schüler zutrifft. Darüber hinaus verlassen Kinder mit Migrationshintergrund das deutsche Schulsystem überproportional häufig ohne jeglichen Abschluss (vgl. Diefenbach 2007: 222).
Diese Disparitäten finden sich genauso in nationalen wie internationalen Schulleistungsvergleichsstudien. In der IGLU-Studie2 wurde beispielsweise für das Jahr 2011 ermittelt, dass in Deutschland Viertklässler mit Migrationshintergrund im Vergleich zu ihren Klassenkameraden im Leseverständnis einen Rückstand von etwa einem Lernjahr aufwiesen (vgl. Schwippert et al. 2012: 199). Der Anteil an Schülerinnen und Schülern aus zugewanderten Familien, die in dieser Studie nicht über die Lesekompetenzstufe I hinauskamen, war dreimal so hoch wie der von Schülerinnen und Schülern ohne Migrationshintergrund (3,7 % vs. 1,3 %; vgl. ebd.: 200). Für die höchste Kompetenzstufe V stellten sich die Ergebnisse genau spiegelverkehrt dar (4,0 % vs. 12,3 %; vgl. ebd.: 201). Ähnliche Befunde werden seit Jahren in der PISA-Studie3 für Fünfzehnjährige in Deutschland berichtet: Hier schneiden Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in allen untersuchten Bereichen, also Mathematik, Naturwissenschaften und Lesekompetenz, deutlich schlechter ab als Schülerinnen und Schüler ohne Migrationshintergrund (vgl. Stanat et al. 2010: 201).
Als Ursachen für dieses ungleiche Abschneiden werden je nach beteiligter Disziplin unterschiedliche Mechanismen ausgemacht wie beispielsweise bestimmte Organisationsstrukturen der Institution Schule, die auf eine sprachlich homogene Schülerschaft ausgerichtet ist, was direkte oder indirekte institutionelle Diskriminierung nach sich ziehen kann (vgl. Gomolla & Radtke 2002: 334). Diese tritt zutage, wenn Lehrkräfte die zunehmende sprachliche Heterogenität im Klassenzimmer als Störung wahrnehmen und eine stärkere Homogenisierung der Lerngruppen bevorzugen. Adäquate sprachliche Leistungen der Lernenden werden dabei nicht als das Vermittlungsziel schulischer Bildung und somit in der Verantwortung der Institution selbst betrachtet, sondern als Zugangsvoraussetzung zu dieser (vgl. Gomolla 2009: 32). Gleichzeitig werden eventuelle sprachliche Defizite als Indikatoren für fehlendes fachliches Wissen genommen oder auf individuelle Unzulänglichkeiten zurückgeführt und den Schülerinnen und Schülern angelastet. Als Folge können bestimmte Bildungsgänge und -abschlüsse Lernenden, die über die verlangten sprachlichen Ressourcen (noch) nicht verfügen, aus institutioneller Sicht legitim verwehrt werden. Dies wird insbesondere an den Übergängen im Schulsystem sichtbar, wo unterschiedliche Akteure des Bildungssystems in ihrer Funktion als „Gatekeeper“ agieren (vgl. Diefenbach 2007: 233).
Dieser „monolinguale Habitus der multilingualen Schule“ (Gogolin 1994) äußert sich überdies in einer prinzipiell negativen Grundhaltung gegenüber lebensweltlicher Mehrsprachigkeit. Wie in Abschnitt 2.1 bereits diskutiert, erhalten in Deutschland nur einige Sprachen neben dem Deutschen eine Legitimierung, sei es durch eine rechtliche Absicherung durch die ECRM wie die autochthonen Minderheitensprachen oder durch die Aufnahme in den Fremdsprachenkanon, was gleichsam ihre Aufwertung als Bildungsgut und ihre Zertifizierung bedeutet (vgl. Gogolin 2001: 2). Die Sprachen von Migranten erfahren hingegen weder Rechtsschutz noch gehören sie zu den regulär in der Schule angebotenen und für alle zugänglichen Fremdsprachen. Der Unterricht in diesen Sprachen ist als Randangebot ausschließlich für die jeweilige Minderheit geplant, wodurch ihnen der Status als gesellschaftliches und schulisch zertifiziertes, förderungswürdiges Kulturgut versagt bleibt.
Trotz dieser Sichtweise auf die lebensweltliche Mehrsprachigkeit der Schülerinnen und Schüler öffnet sich die Schule im Laufe der letzten Jahre mehr und mehr auch für andere Sprachen als Deutsch. Beispielsweise findet migrationsbedingte Mehrsprachigkeit in den von der Kultusministerkonferenz verabschiedeten Bildungsstandards für die erste Fremdsprache für den mittleren und den Hauptschulabschluss Erwähnung: „Ebenso wird der Fremdsprachenunterricht die mitgebrachte Mehrsprachigkeit von Schülerinnen und Schüler [sic!] berücksichtigen, die bereits intuitive Strategien für das Sprachenlernen (Sprachlernkompetenz) entwickelt haben, diese miteinbeziehen und ausbauen“ (Kultusministerkonferenz 2005a: 6). In den Bildungsstandards für das Fach Deutsch in der Grundschule wird der Einbezug von Herkunftssprachen zudem im Rahmen des Kompetenzbereichs „Sprache und Sprachgebrauch untersuchen“ explizit thematisiert (vgl. Kultusministerkonferenz 2005b: 13).
Dass Mehrsprachigkeit trotzdem mehr ein „Häppchen“ denn ein „Hauptgericht“ bleibt (Marx 2014), lässt sich beispielhaft anhand der Einbindung anderer Sprachen in Lehrwerke für den Deutschunterricht illustrieren: Diese erschöpft sich meist in Übersetzungen einzelner Lexeme und Redewendungen und berücksichtigt hauptsächlich Sprachen des schulischen Fremdsprachenkanons (vgl. ebd.: 16). Die Chance auf strukturierten Sprachvergleich und fundierte Sprachreflexion mit Bezug auch auf migrationsbedingte Mehrsprachigkeit bis zur Weiterarbeit mit Gelerntem wird indes vergeben.
Die Tendenz, Mehrsprachigkeit in der Theorie zu loben, in der Praxisrealität jedoch zu vernachlässigen oder gar zu pathologisieren, führt nachweislich zu negativen Konsequenzen für die Entwicklung der Mehrheitssprache, der Herkunftssprache und des metalinguistischen Bewusstseins, für das Selbstvertrauen mehrsprachiger Kinder und Jugendlicher in ihrem erweiterten linguistischen Kapital und – noch bedeutender – für die gesellschaftliche Akzeptanz von anderen Sprachen und somit von Personen mit erweiterten sprachlichen Kompetenzen. (Marx 2014: 20)
Die Geringschätzung von Sprachkenntnissen abseits des schulisch legitimierten Wissens kann darüber hinaus ihren Niederschlag in weiteren, sozio-emotionalen Prozessen auf Seiten des Sprechers finden, die wiederum einen Einfluss auf seine Leistung ausüben. So wird als eine weitere Ursache für Leistungsdisparitäten zwischen Ein- und Mehrsprachigen in den letzten Jahren auch die Bedrohung durch Stereotypisierung untersucht (vgl. Ward Schofield & Alexander 2012). Hierunter wird die unbewusst auftretende Angst gefasst, einem bestimmten negativen Stereotyp über die eigene soziale Gruppe zu entsprechen (vgl. ebd.: 66). Voraussetzung für das Greifen dieser Angst ist dabei nicht die eigene Zustimmung zu dem bestehenden Stereotyp, sondern erstens das bloße Wissen um seine Existenz und zweitens die Identifikation mit der betreffenden Gruppe. Fühlt sich eine Person durch ein leistungsbezogenes Vorurteil bedroht, so hemmt diese Angst sie besonders in Situationen, in denen ebensolche Leistung erwartet wird. Die Bedrohung durch ein Stereotyp kann dabei bereits auf subtile Weise durch die Aufforderung auf einem Arbeitsblatt, seine Gruppenzugehörigkeit anzugeben, hervorgerufen werden (vgl. Steele & Aronson 1995: 808).4
Die meisten Studien befassen sich mit der Bedrohung durch Stereotype bei Frauen (vgl. Nguyen & Ryan 2008), die Ergebnisse lassen sich jedoch ohne weiteres auf andere Minoritätengruppen übertragen. Schmader und Johns (2003: 449) konnten z.B. nachweisen, dass Probandinnen, bei denen ein gender- und ein ethniebezogenes Stereotyp aktiviert wurden, wesentlich schlechter bei einem Aufmerksamkeitstest abschnitten als die nicht betroffene Kontrollgruppe. Die mentale Beschäftigung mit dem Stereotyp nahm ihre kognitiven Ressourcen derart in Anspruch, dass ihr Arbeitsgedächtnis überlastet war. In der Studie von Gonzales und Kollegen (2002: 666) zeigten sich ebenfalls Effekte einer Bedrohung durch Stereotype bei Frauen, die sich der Gruppe der Latinas zugehörig fühlten. Durch die Aktivierung des ethnischen Stereotyps wurden bei ihren Probandinnen auch geschlechtsbezogene Vorurteile ausgelöst. Übertragen auf mehrsprachige Schülerinnen und Schüler lässt sich mit Blick auf diese Befunde das Stereotyp des sprachlich Schwachen bzw. die Angst, diesem zu entsprechen, annehmen. Diese Angst kann dann insbesondere bei Leistungsüberprüfungen wie den oben beschriebenen Schulleistungsstudien ein kompetenzadäquates Abschneiden verhindern.
Für Leistungsdisparitäten zwischen Ein- und Mehrsprachigen werden in der Soziologie vor allem sozio-ökonomische Erklärungsansätze wie geringere in die Bildung zu investierende Ressourcen gesucht. In einer groß angelegten Panelstudie (CILS – Children of Immigrants Longitudinal Study) in den USA begleiteten beispielsweise Portes und Rumbaut (1990; 2001) über zehn Jahre lang mehr als 5.000 Jugendliche der zweiten Migrantengeneration bis ins Erwachsenenalter und untersuchten die Auswirkungen unterschiedlicher Ausgangsbedingungen u.a. auf Bildungserfolg, Berufsstand, Arbeitslosigkeit, Familiengründung und Inhaftierung. Es zeigte sich, dass der elterliche sozio-ökonomische Status mit dem Bildungserfolg ihrer Kinder, ihrer finanziellen Lage und ihren Verdienstmöglichkeiten als Erwachsene zusammenhängt (vgl. Portes et al. 2005: 1025f.). Je höher das bereits von den Eltern in die Familie eingebrachte Kapital war, d.h., je länger beide Elternteile im Bildungssystem verblieben und je höher ihr erreichter Berufsstand war, desto größer war der anschließende Erfolg der Kinder. „Results from our study are almost frightening in revealing the power of structural factors – family human capital, family composition, and modes of incorporation – in shaping the lives of these young men and women“ (ebd.: 1032).
Auch in Deutschland haben Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund im Vergleich zur sozial dominanten Gruppe eine andere strukturelle Ausgangslage: Ihre Familien besitzen weniger ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital (vgl. Diefenbach 2007: 227). So verfügen Migrantengruppen in Deutschland grundsätzlich über niedrigeres Einkommen als die Mehrheitsbevölkerung und weisen zudem typischerweise einen geringeren Bildungsstand als diese auf (vgl. ebd.: 229). Beides kann nur teilweise auf die in Deutschland nicht anerkannten Abschlüsse und Zertifikate zurückgeführt werden. Sie verkehren in weniger sozial relevanten Netzwerken, die Zugänge zu weiteren Bildungsressourcen eröffnen könnten (vgl. Stanat & Edele 2011: 186). Der Faktor „Migrationshintergrund“ ist in Deutschland also stark mit dem sozialen Status konfundiert.
Die Forschungsbefunde von PISA 2000 und PISA 2003 legen in diesem Sinne ebenfalls nahe, dass insbesondere die Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen in Deutschland stark mit dem sozio-ökonomischen Status der Familie zusammenhängt. Diese enge Verkettung von schulischen Leistungen und strukturellen Merkmalen des Elternhauses wies bei der ersten Testung in diesem Ausmaß kein weiterer OECD-Mitgliedsstaat auf (vgl. Stanat et al. 2002: 13). Über die Zeit verringerten sich diese Effekte zwar, dennoch bleibt sogar bei der aktuellen PISA-Studie diese Kopplung bestehen (vgl. Müller & Ehmke 2016: 311). Bei Kontrolle des sozio-ökonomischen Status der Schülerinnen und Schüler reduziert sich hingegen der Einfluss des Faktors Migrationshintergrund auf die gemessenen Leistungen beträchtlich (vgl. Stanat et al. 2010: 202).
Mehrere Arbeiten aus der Soziologie führen als Erklärungsansatz für den geringen Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund das Festhalten an der Minderheitensprache an. So konnte u.a. Esser (2006; 2009) anhand von Reanalysen verschiedener Indikatoren für Schulleistungen und Arbeitsmarkterfolg von Migranten feststellen, dass herkunftssprachliche Kompetenz bzw. Investitionen in diese sich weder in der Schule noch später auf dem Arbeitsmarkt auszahlten. Seine Auswertung der oben diskutierten CILS-Studie (vgl. Portes & Rumbaut 1990) belegte, dass allein die Beherrschung der Mehrheitssprache sowohl für Lesekompetenzen als auch für die Leistungen in Mathematik ausschlaggebend sei. Die Minderheitensprache sei für schulischen Erfolg hingegen völlig „irrelevant“ (Esser 2006: 74). Durch die Neubetrachtung von Daten des Sozio-Ökonomischen Panels ließen sich weder beim erzielten Einkommen noch bei der beruflichen Positionierung Vorteile durch migrationsbedingte Mehrsprachigkeit ausmachen (vgl. Esser 2009: 84). Kompetenzen in der Minderheitensprache wären ausschließlich bei einigen wenigen Tätigkeiten in speziellen Arbeitsmarktsegmenten gewinnbringend.
Andere Arbeiten aus der Bildungsforschung bestätigen diese Ergebnisse zum Teil. So zeigte beispielsweise eine Metaanalyse von Studien zu bilingualen, Sprachförder- und Spracherhaltprogrammen, die im US-amerikanischen und europäischen Kontext durchgeführt wurden, keine eindeutigen Vorteile für solche Programme, in denen auch die Minderheitensprache berücksichtigt wurde (vgl. Limbird & Stanat 2006). Limbird und Stanat führen zwar selbst an, dass zum einen der Erfolg solcher Programme über das erreichte Niveau in der Mehrheitssprache gemessen wurde und zum anderen das methodische Vorgehen vieler der von ihnen zusammengetragenen Studien insbesondere hinsichtlich der Vergleichsgruppe fragwürdig ist. Dennoch lautet ihre Schlussfolgerung, dass es keine weitere Notwendigkeit zur Untersuchung von bilingualen und transitorischen Programmen gäbe. Es sei „unrealistisch“, alle Minderheitensprachen in der Schule zu berücksichtigen, selbst wenn ihre Förderung der Mehrheitssprache zugute käme (ebd.: 292).
Hopf (2005) legt eine ähnlich gerichtete Analyse für den deutschen Kontext vor und argumentiert gegen eine Förderung der Minderheitensprache vor allem mit der Knappheit der zur Verfügung stehenden Lernzeit. Der Aufwand zum Ausbau der Minderheitensprachkenntnisse stehe in keinem Verhältnis zum Ertrag, insbesondere bei Betrachtung der Schülerleistungen im Deutschen. Da viele Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund in Familien aufwachsen, in denen primär die Minderheitensprache gesprochen wird, und zugleich in Ballungsgebieten großwerden, was den Kontakt zu weiteren Sprechern derselben Minderheitensprache erleichtert, benötigten sie laut Hopf wesentlich mehr Unterrichtszeit zum Erlernen der deutschen Sprache (vgl. ebd.: 244). Erfolgreiche Zweisprachigkeit sei für ihn hingegen das Ergebnis intensiver familiärer Förderung, die nur wenige Angehörige einer „intellektuellen Elite“ meisterten (ebd.: 242).
Nach diesen Forschungsergebnissen scheint für sozialen Aufstieg in der Gesellschaft offenbar ausschließlich die Mehrheitssprache förderlich zu sein, was die Minderheitensprache zusätzlich abwertet und den Erhalt von peripheren Sprachen erschwert. Dass es sich trotz der negativen Befunde aus der Soziologie und Bildungsforschung lohnt, eine Minderheitensprache ohne Prestige und gesellschaftlichen „Marktwert“ zu erhalten und von Generation zu Generation weiterzugeben, obwohl ihre Kenntnis scheinbar keinen Nutzen mit sich bringt oder sogar für Bildungserfolg hinderlich ist, zeigen wiederum zahlreiche Studien aus der Soziolinguistik, Fremdsprachenforschung, Neurowissenschaft, Psychologie und anderen Disziplinen, auf die im folgenden Abschnitt eingegangen wird.
2.3Gründe für Spracherhalt
Entgegen der Sichtweise, das Vorhandensein mehrerer unterschiedlicher Sprachen in einem Staat führe zu politischer Spaltung und widerspreche dem Verständnis von einem Nationalstaat mit nur einer gemeinsamen Sprache für alle Bürger (vgl. Krashen 1998: 5f.), argumentiert Fishman für den Erhalt sprachlicher Diversität und belegt anhand von Daten aus 170 Ländern, dass dieser Faktor nicht ausschlaggebend für politische Instabilität ist (vgl. Fishman 1990). Im Gegenteil, die Bewahrung und Akzeptanz selbst kleinerer Minderheitensprachen ist laut Fishman gleichsam ein Zeichen kultureller Demokratie (vgl. Fishman 1991: 3). Sprachliche Pluralität aufrechtzuerhalten, bedeutet demnach die Voranstellung von Identität vor Macht, von Individuum und Gemeinschaft vor Gesellschaft und gibt darüber hinaus nicht prestigeträchtigen Sprachen genügend Raum zur Entfaltung (vgl. ebd.: 6):
The destruction of languages is an abstraction which is concretely mirrored in the concomitant destruction of intimacy, family and community, via national and international involvements and intrusions, the destruction of local life by mass-market hype and fad, of the weak by the strong, of the unique and traditional by the uniformizing, purportedly ‘stylish’ and purposely ephemeral. (Fishman 1991: 4)
Es lassen sich zahlreiche weitere Argumente für den Erhalt einer Minderheitensprache jenseits von verklärter Vorstellung von sprachlicher Diversität anführen. So ist das Versprechen, durch die Mehrheitssprache sozial aufzusteigen und seine Chancen auf Erfolg zu erhöhen, insbesondere wenn man die Minderheitensprache hinter sich lässt, entgegen den in Abschnitt 2.2 zitierten Studien nicht universell einlösbar, wie die Forschungen von Brizić (2007; 2009) nachweisen. In ihrer Studie zeigte sich, dass Schülerinnen und Schüler mit der geringsten Deutschkompetenz gleichzeitig über die geringsten Sprachkenntnisse in der vermeintlichen Erstsprache verfügten. Dies widerspricht also den oben diskutierten Befunden, das schlechte Abschneiden Mehrsprachiger im Bildungssystem sei auf den Erhalt der Minderheitensprache zurückzuführen. Durch qualitative Tiefeninterviews mit den Eltern dieser Schüler konnte Brizić jedoch eine Erklärung für diese Feststellung finden und nachzeichnen, dass in der scheinbar homogenen Sprechergruppe eine Vielzahl an anderen, „verschwiegenen“ Sprachen gesprochen wurde. Diese Familien hatten den Prozess des Sprachwechsels bereits durchlaufen und schon vor der Migration eine im Herkunftsland nicht prestigeträchtige oder gar stigmatisierte Minderheitensprache zugunsten der offiziellen Mehrheitssprache aufgegeben. Brizić formuliert ihre Ergebnisse zusammenfassend wie folgt:
Die uneingeschränkte Weitergabe der Erstsprache von den Eltern an die Kinder könnte also tatsächlich so, wie es sich hier in unserem Sample präsentiert, einen entscheidenden Vorteil darstellen und sogar andere ungünstige Bedingungen aufwiegen; die teilweise Weitergabe und die Nichtweitergabe könnten dagegen gewissermaßen einen „Kapitalverlust“ bedeuten, da sie zu einem mehr oder weniger umfassenden sprachlichen Neuanfang zwingen – in der Migrationssituation möglicherweise eine besonders schwierige Ausgangsposition für jeden weiteren Spracherwerb. (Brizić 2007: 330; Hervorhebungen i.O.)1
Brizić betont also, dass die Aufgabe der familiär verwendeten Sprache in der Migrationssituation eine doppelte Belastung darstellt und die Familien sprachlich zu einem vollständigen Neustart zwingt. Somit führt Sprachwechsel zur Mehrheitssprache erst zu Bildungsbenachteiligung. Studien aus der interkulturellen Erziehungswissenschaft konnten ebenfalls nachweisen, dass diejenigen Sprecher der zweiten Generation erfolgreich am Bildungssystem und am Arbeitsmarkt partizipieren, die sowohl die Mehrheitssprache erwerben als auch die von ihren Eltern mitgebrachte Sprache beibehalten und diese als Ressource nutzen. Fürstenau (2004; 2005) legte eine Untersuchung zu Aufwertungsmöglichkeiten der Minderheitensprache in Ausbildung und Beruf aus der Perspektive Jugendlicher in der Phase der Berufsorientierung vor. In ihrer Arbeit zu portugiesischsprachigen Jugendlichen in Hamburg konnte sie u.a. nachzeichnen, dass sie ihre schulisch illegitimen Sprachkenntnisse durchaus eigenaktiv durch eine offizielle Zertifizierung aufwerten wollten (vgl. Fürstenau 2005: 373). Dies sei nach Fürstenau ein Versuch, sich gegen die bestehenden Verhältnisse auf dem sprachlichen Markt aufzulehnen. Auf dem Arbeitsmarkt zahlten sich insbesondere für die Jugendlichen mit höheren Bildungsabschlüssen die Kenntnisse in der Minderheitensprache ausdrücklich aus: Zusätzlich zu den von Esser (2009) genannten an die portugiesische Migrantengemeinde in Hamburg gebundenen Arbeitsmarktoptionen ergaben sich nach Einschätzung der Studienteilnehmer zahlreiche Berufsfelder in internationalen oder mehrsprachigen Kontexten (vgl. ebd.: 374). Zudem ermöglichte ihnen das Festhalten an der Minderheitensprache Portugiesisch, sich auch im Herkunftsland ihrer Eltern zu bewerben und dort beruflich tätig zu sein.
Auf positive Effekte des Erhalts der Minderheitensprache für das Individuum verweisen Ergebnisse der Akkulturationsforschung, die sich mit auftretenden Verhaltens- oder Werteänderungen bei Kontakt zwischen zwei unterschiedlichen Gruppen befasst (vgl. Smith 2014: 599). Die Arbeitsgruppe um Berry (vgl. Berry 1997; Berry et al. 2010) untersuchte mittels einer umfangreichen Fragebogenstudie das Akkulturationsverhalten von 5.366 Jugendlichen sowohl der ersten als auch der zweiten Migrantengeneration in 13 unterschiedlichen Länderkontexten. Darunter befanden sich klassische Einwanderungsländer wie die USA und Kanada sowie europäische Staaten mit hohem Anteil an Einwanderern wie Frankreich, die Niederlande und Deutschland. Als Akkulturationsindikatoren wurden kulturelle Traditionen, exogame vs. endogame Partnerschaften, soziale Aktivitäten, Freundschaften und Sprache ausgewählt.
Die Analysen belegen, dass der größte Teil der Jugendlichen (36,4 %) ein integriertes Akkulturationsprofil aufwies (vgl. Berry et al. 2010: 26). Das bedeutet, dass diese Jugendlichen sich sowohl der Kultur und den Traditionen ihrer Eltern als auch des Einwanderungslandes zugehörig fühlten und soziale Aktivitäten, Freundschaften und Partnerschaften unabhängig von diesen Kategorien wählten. Diese Gruppe berichtete eine ausgebaute Kompetenz in der Mehrheitssprache sowie eine durchschnittliche in der Minderheitensprache und wies stabile familiäre Beziehungen auf. Jugendliche mit einem nationalen Profil (18,7 %) zeichneten sich in der Studie dadurch aus, dass sie sich voll und ganz der Sprache und Kultur der Mehrheitsgesellschaft zuwendeten. Sie bevorzugten Kontakte zu Mitgliedern der Mehrheitsgesellschaft und lehnten elterliche Autorität stark ab (vgl. ebd.: 25). Ihr Akkulturationsverhalten wies die Tendenz einer völligen Anpassung an die Mehrheitsgesellschaft auf.
Weitere Auswertungen belegten, dass Jugendliche mit einem integrierten Akkulturationsprofil sich weniger diskriminiert fühlten als solche mit einem nationalen Profil (vgl. ebd.: 29). Zudem zeigten Probanden mit einem integrierten Profil die besten psychologischen und sozio-kulturellen Anpassungsfähigkeiten im Vergleich zu den anderen Akkulturationsprofilen. Das bedeutet, dass sie sowohl über persönliches Wohlbefinden und mentale Stabilität verfügten als auch sozial kompetent in der Gesellschaft agierten. Sie waren zufriedener mit ihrem Leben, hatten ein höheres Selbstbewusstsein, weniger psychologische Probleme oder Verhaltensauffälligkeiten und kamen in der Schule besser zurecht (vgl. ebd.: 32). Das nationale Profil hingegen schlägt sich in durchschnittlichen sozio-kulturellen Anpassungsfähigkeiten bei gleichzeitig nur gering ausgeprägten psychologischen Akkulturationsstrategien nieder. Solche Probanden hatten im Vergleich zu anderen Gruppen weniger Selbstbewusstsein und waren seltener zufrieden mit ihren Lebensumständen. Diese Befunde widersprechen also klar der Annahme, der Erhalt der Minderheitensprache zahle sich nicht aus und sei keiner Investitionen wert:
For governments in societies that are receiving immigrants, our findings suggest that there should be support and encouragement for immigrants to pursue the integration path, since both psychological and sociocultural adaptation are more positive among those who orient themselves in this way. […] First, cultural maintenance should be desired by the immigrant community, and permitted (even encouraged) by the society as a whole. Second, participation and inclusion in the life of the larger society should be sought by the immigrants, and permitted and supported by the larger society. (Berry et al. 2010: 38f.)
Weitere Studien bescheinigen Mehrsprachigen über die emotionale Ebene hinaus zahlreiche kognitive Vorteile. So konnten beispielsweise Arbeiten aus der Fremdsprachenforschung nachweisen, dass die Förderung der Minderheitensprache und ihre Nutzbarmachung im Unterricht nicht nur einen positiven Effekt auf die Deutschkenntnisse ausübt, sondern auch den Erwerb weiterer Sprachen unterstützt (vgl. Göbel et al. 2011; Hesse & Göbel 2009; Hu 2003; Rauch et al. 2010). Ergebnisse der DESI-Studie2 zeigen beispielsweise, dass mehrsprachige Schülerinnen und Schüler im Englischunterricht ihren einsprachigen Klassenkameraden um ein halbes Lernjahr voraus sind – trotz eines Leistungsrückstands im Deutschen. Ein Grund hierfür liegt in den sprachanalytischen Fähigkeiten, dem sog. metasprachlichen Wissen, das Mehrsprachige früher ausbildeten als einsprachig Sozialisierte (vgl. u.a. Bialystok 1986; 1991; 2009; Cummins 1978; Oomen-Welke 2006). Durch die bereits frühe Beschäftigung mit unterschiedlichen Sprachsystemen erfahren mehrsprachig aufwachsende Kinder stärker die formale Funktion des sprachlichen Zeichens und lernen, Form und Inhalt abstrakt zu betrachten (vgl. Adesope et al. 2010: 209). Ein weiterer Erklärungsansatz hierfür könnte die im Fremdsprachenunterricht geringere Bedrohung durch Stereotype sein (s.o.). Da das Lernen einer neuen Sprache für alle Kinder gleichermaßen neu ist und nicht so sehr mit Deutschkenntnissen verbunden ist wie andere (Sach-) Fächer, sind Mehrsprachige im Fremdsprachenunterricht keinen negativen Stereotypen ausgesetzt, die Stereotype könnten gar im Sinne der oben angeführten Argumentation positiv besetzt sein.
Erleichterte Erwerbsbedingungen gelten allerdings nicht pauschal für alle Mehrsprachigen, sondern betreffen nur Sprecher mit einem hohen Kompetenzgrad in beiden Sprachen (vgl. Cenoz 2003; Lauchlan et al. 2013; Rauch et al. 2012). Die Kenntnisse in einer Minderheitensprache können für einen Sprecher also nur dann von Vorteil für den Erwerb anderer Sprachen sein, wenn diese weit ausgebaut und erhalten sind. Weitere Belege für diese Schlussfolgerung liefert die Neurowissenschaft. Untersuchungen mittels bildgebender Verfahren wiesen nach, dass bei balanciert Mehrsprachigen beide Sprachen im gleichen Hirnareal aktiviert werden, während bei eingeschränkter Kompetenz in einer der beiden Sprachen ein zusätzliches neuronales Netzwerk aufgebaut wird (vgl. Nitsch 2007: 55). Der Mehrsprachige kann also nur bei ausgebauter Sprachkompetenz auf bereits vorhandene neuronale Strukturen zurückgreifen und diese für den Erwerb weiterer Sprachen nutzen.
Des Weiteren attestiert die Neuropsychologie Mehrsprachigen Vorteile bezüglich exekutiver Funktionen wie Problemlösekompetenz, mentaler Anpassungsfähigkeit, Aufmerksamkeitssteuerung oder kognitiver Flexibilität. Studien von Costa und Kollegen (vgl. Costa et al. 2008; 2009) zeigten beispielsweise, dass mehrsprachige Probanden in ihrem Sample effizienter und schneller Aufgaben mit inkongruentem Stimulus und widersprüchlicher Information lösten als einsprachige Studienteilnehmer. Sie schlussfolgern daraus, dass Mehrsprachigkeit einen besseren Zugang zu Aufmerksamkeitsmechanismen erlaubt, sodass diese Personen selbst unter erschwerten Bedingungen in der Lage sind, inkonsistente Daten zu verarbeiten (vgl. Costa et al. 2008: 77).
Ähnliche Ergebnisse lieferten mehrsprachige Probanden in den Studien von Bialystok und Kollegen (vgl. Bialystok et al. 2005; Emmorey et al. 2008; Moreno et al. 2010). Bei der Bearbeitung eines Simon Task3 oder bei der Beurteilung von Sätzen, die grammatisch und semantisch inkongruent waren, reagierten Mehrsprachige deutlich schneller und schnitten merklich besser ab als Einsprachige, was auf einen höheren Grad an kognitiver Flexibilität und Kontrolle der erstgenannten Sprechergruppe hindeutet. Diese Vorteile werden auf die Tatsache zurückgeführt, dass der regelmäßige Gebrauch zweier Sprachen ein erhöhtes Ausmaß an Aufmerksamkeit bei der Sprachwahl abverlange (vgl. Adesope et al. 2010: 208). Diese Aufmerksamkeitsleistung können die Probanden ebenfalls auf andere Bereiche übertragen und sie zur Lösung komplexer Probleme nutzen.
Diese auch medial sehr präsenten Annahmen der Neuropsychologie werden jüngst durch die Forschungsgruppe um Paap stark in Frage gestellt. In einer breit angelegten Studie testeten Paap und Kollegen 384 Probanden mithilfe von vier gängigen Testverfahren wie dem Simon Task oder dem Antisakkaden-Test4, um Unterschiede zwischen den einsprachigen und den mehrsprachigen Studienteilnehmern bezüglich exekutiver Funktionen zu erheben (vgl. Paap et al. 2014). Ziel war es, die gängigen Studien der Neuropsychologie zu replizieren und die als untermauert geltenden Ergebnisse zu bestätigen. Sie erhoben dabei zusätzlich Merkmale wie Beginn des L2-Erwerbs, Sprachdominanz sowie die Beherrschung weiterer Sprachen. Die Arbeitsgruppe konnte entgegen den bisherigen Annahmen unter keinen Bedingungen positive Effekte der Mehrsprachigkeit auf exekutive Funktionen auffinden: „It is likely that bilingual advantages in EF (i. e. executive functions, H. O.) do not exist. If they do exist they are restricted to specific aspects of bilingual experience that enhance only specific components of EF. Such constraints, if they exist, have yet to be determined“ (Paap et al. 2015: 276).
Der Widerspruch zu früheren Studien wird primär mit ihrer statistischen Anlage erklärt. So weise ein Großteil der diesem Gebiet zugeordneten Forschungen eine zu geringe Probandenanzahl von durchschnittlich etwa 15 bis 30 Personen pro Gruppe auf (vgl. ebd.: 266f.). Um diesem Missstand zu begegnen, würden jedoch für gewöhnlich mehrere kleinere Studien statt einer umfassenderen Arbeit durchgeführt. Eine weitere Schwäche stelle die Zusammensetzung der Vergleichsgruppen dar, die oftmals nicht nach sozio-ökonomischem Status kontrolliert oder innerhalb der mehrsprachigen Gruppe nicht nach Dauer des Aufenthaltes angeglichen werde (vgl. ebd.: 267f.). Trotz ihrer Kritik formulieren Paap und Kollegen abschließend die Hypothese, dass Mehrsprachigkeit sich dennoch positiv auf exekutive Funktionen auswirken könne, jedoch sei der entsprechende Effekt vermutlich gering und nur bei einer spezifischen Bedingungskonstellation nachweisbar.
Darüber hinaus wird Mehrsprachigen in Bezug auf den Alterungsprozess eine Überlegenheit gegenüber Einsprachigen zugeschrieben. So sei bei Ersteren die altersbedingte Abnahme kognitiver Fähigkeiten weiter nach hinten verlagert, da durch die lebenslange Verwendung zweier oder mehr Sprachen eine kognitive Resistenz geschaffen werde, die den geistigen Alterungsprozess verlangsame und das Gehirn vor Schäden schütze (vgl. Kavé et al. 2008). Dabei kann der Faktor Mehrsprachigkeit zuverlässiger die kognitiven Fertigkeiten eines älteren Probanden vorhersagen als andere demographische Variablen wie Alter, Geschlecht, Alter bei Ausreise oder Bildungsgrad (vgl. ebd.: 70). Die balancierte Beherrschung beider Sprachen scheint hier ebenso eine entscheidende Rolle zu spielen: Je ausgebauter die Sprachkenntnisse in beiden Sprachen, desto besser waren die kognitiven Fähigkeiten der Probanden im Alter erhalten. Ardila und Ramos (2008) berichten zudem über Effekte der Mehrsprachigkeit bei Demenzpatienten. Ihre kognitiven Funktionen blieben mit einer größeren Wahrscheinlichkeit erhalten, wenn sie primär in ihrer Erstsprache kommunizierten statt in der Zweitsprache (vgl. ebd.: 244). Die dargestellten Forschungsergebnisse belegen, dass Mehrsprachigkeit nicht nur einen schützenden Effekt auf kognitive Fähigkeiten bei normalen Alterserscheinungen haben kann, sondern dass sie sich auch verzögernd bei Demenz auswirkt.
Schließlich wiesen einige Studien einen reziproken Zusammenhang zwischen Mehrsprachigkeit und Kreativität nach (vgl. für einen Überblick Ricciardelli 1992). Forschungen konnten bestätigen, dass sowohl eine ausgeprägte nonverbale Kreativität die Mehrsprachigkeit vorteilhaft beeinflusse als auch die Mehrsprachigkeit selbst sich in einem positiven Maße auf den Ideenreichtum und das Vorstellungsvermögen auswirke. Hommel und Kollegen (2011) belegten ebenfalls für verbale Kreativitätsaufgaben, dass Personen, die über ausgebaute Sprachkompetenzen in ihren beiden Sprachen verfügten, eher konvergente Denkstrukturen aufwiesen und schneller in der Lage waren, Gemeinsamkeiten zwischen Begriffen zu finden sowie Assoziationen, Bedeutungen und Abstraktionen von bestimmten Konzepten zu bilden. Nicht balanciert Mehrsprachige hingegen zeigten ausgebaute divergente Denkweisen und generierten mehr originelle, detaillierte Lösungen für ein Problem (vgl. ebd.: 114). Die kognitiven Prozesse des divergenten und konvergenten Denkens sowie der dadurch erzeugte sprachliche Output sind als Manifestationen der Kreativität Mehrsprachiger zu werten (vgl. Kessler & Quinn 1987).
Mehrsprachigkeit ist also aus vielerlei Gründen eine nicht zu unterschätzende gesellschaftliche wie persönliche Ressource, die es aufrechtzuerhalten und auszubauen gilt. Gleichzeitig erscheint eine Sichtweise auf Mehrsprachigkeit als Ressource – also als Arbeitsmittel und Rohstoff – der Sichtweise der Sprecher selbst jedoch nicht gerecht zu werden (vgl. Ricento 2005 zu einer Kritik dieser Betrachtungsweise). Denn auf der Ebene des Individuums bedarf der Erhalt der Minderheitensprache keiner weiteren Begründung als den Wunsch, diese zu erhalten. Daran gekoppelt ist die Vorstellung, das Bewahren der Sprache stärke die Verbindung sowohl zwischen den Generationen innerhalb der Familie als auch zwischen dem Sprecher und einer von ihm konstruierten Identität, Geschichte oder Herkunft. Die Vermeidung intergenerationaler Konflikte durch eine gemeinsame Sprache und somit eine erleichterte Kommunikation mit der älteren Generation, der Community in der Diaspora und den Familienangehörigen im Herkunftsland stellen seitens mehrsprachiger Eltern wichtige Beweggründe dar, dem Verlust der Minderheitensprache entgegenzuwirken (vgl. Cho & Krashen 1998: 33).





























