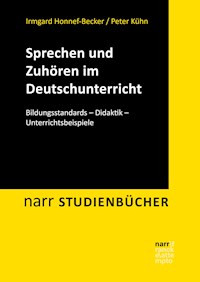
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: narr STUDIENBÜCHER
- Sprache: Deutsch
Der Kompetenzbereich "Sprechen und Zuhören" spielt im Unterricht aller Fächer eine zentrale Rolle. Im Deutschunterricht ist "Sprechen und Zuhören" zudem Lerngegenstand und als solcher in den Kerncurricula der verschiedenen Schulformen fest verankert. Das Studienbuch bietet vielfältige Anregungen, wie Sprech- und Gesprächskompetenzen gefördert werden können. Neben Teilkompetenzen wie Erzählen, Vorlesen und Diskutieren werden auch bislang im Deutschunterricht wenig berücksichtigte Teilkompetenzen behandelt: das Hörverstehen und das Hör-Seh-Verstehen. Das Buch bietet einen umfassenden Überblick über wissenschaftliche und fachdidaktische Grundlagen des Kompetenzbereichs. Es zeigt anhand zahlreicher Beispiele aus Lehrwerken, wie die Teilkompetenzen vermittelt werden können. Die Kombination von Printtext und Audios bzw. Videos ermöglicht es, didaktische Positionen und Inhalte über den auditiven bzw. visuellen Zugang zusätzlich zu erläutern. Auf Grundlage neuester didaktischer und methodischer Positionen entsteht ein Plädoyer für eine neue Sprech- und Gesprächsdidaktik im Deutschunterricht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Irmgard Honnef-Becker / Peter Kühn
Sprechen und Zuhörenim Deutschunterricht
Bildungsstandards – Didaktik – Unterrichtsbeispiele
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Dr. Irmgard Honnef-Becker ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Trier im Bereich Germanistik (Literaturdidaktik/Didaktik des Deutschen als Zweit- und Fremdsprache). Ihre Forschungsschwerpunkte sind interkulturelle und mehrsprachige Literatur und ihre Didaktik sowie die Didaktik und Methodik des Deutschen als Zweit- und Fremdsprache.
Prof. Dr. Peter Kühn ist Universitätsprofessor für Germanistische Linguistik und Deutsch als Zweit- und Fremdsprache an der Universität Trier. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Germanistischen Linguistik, insbesondere der Lexikologie, Phraseologie, Lexikographie, Grammatik, Text- und Medienlinguistik sowie der Didaktik und Methodik des Deutschen als Erst-, Zweit- und Fremdsprache und der Schulentwicklungsforschung.
© 2019 · Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Internet: www.narr.de
www.narr-studienbuch.de
eMail: [email protected]
CPI books GmbH, Leck
ISSN 0941-8105
ISBN 978-3-8233-8195-2 (Print)
ISBN 978-3-8233-9195-1 (ePDF)
ISBN 978-3-8233-0138-7 (ePub)
Inhalt
Einleitung
1Sprechen, Hören, Lesen, Schreiben
1.1Mediale und konzeptionelle Mündlichkeit
1.2Kompetenzbereiche des Sprachunterrichts
1.3Kompetenzbereiche in den Bildungsstandards Deutsch
2„Sprechen und Zuhören“ in den Bildungsstandards Deutsch
2.1Die Modellierung des Kompetenzbereichs „Sprechen und Zuhören“
2.2Ungereimtheiten in den Bildungsstandards Deutsch
2.3Gründe für eine Orientierung an den Bildungsstandards
3Positionen der Sprech- und Gesprächsdidaktik
3.1Rudolf Hildebrand: „Vom deutschen Sprachunterricht“
3.2Theodor Siebs: „Deutsche Bühnenaussprache“
3.3Erich Drach: „Sprecherziehung“
3.4Hermann Helmers: „Mündliche Gestaltungslehre“
3.5Erika Essen: „Erziehung zur Gesprächsgemeinschaft“
3.6Hellmut Geißner: „Rhetorische Kommunikation“
3.7Kommunikative Wende im Deutschunterricht
3.8Linguistische Gesprächsanalyse
3.9Bildungsstandards im Fach Deutsch
4Mündlichkeit in aktuellen Sprachdidaktiken
4.1Sprech- und gesprächsorientierte Didaktiken
4.2Linguistisch orientierte Didaktiken
4.3Sprachdidaktiken, die sich an den Bildungsstandards orientieren
4.4Sprachdidaktiken, die ein eigenes Konzept des Kompetenzbereichs entwickeln
5Sprechen und Zuhören: Didaktik und Methodik
5.1Zu anderen sprechen: „Erzählen“
5.1.1Erzähldidaktische Grundlagen
5.1.2Erzählen im Deutschbuch
5.1.3Aufgabenbeispiele aus Deutschbüchern
5.2Vor anderen sprechen: „Vorlesen“
5.2.1Grundlagen einer Vorlesedidaktik
5.2.2Vorlesen im Deutschbuch
5.2.3Aufgabenbeispiele aus Deutschbüchern
5.3Mit anderen sprechen: „Sich an Gesprächen beteiligen“
5.3.1Gesprächsdidaktische Grundlagen
5.3.2Gesprächskompetenz im Deutschbuch
5.3.3Aufgabenbeispiele zur Gesprächsdidaktik
5.3.4Gesprächskompetenz entwickeln
5.3.5Gesprächskompetenz testen und bewerten
5.4Szenisch spielen: Rollenspiele
5.4.1Sprachdidaktisches und literarisches Rollenspiel
5.4.2Didaktik und Methodik des Rollenspiels
6Hör- und Hör-Seh-Verstehen
6.1Grundlagen des Hörverstehens
6.1.1Verstehenstheoretische Grundlagen
6.1.2Hören und Lesen: Gemeinsamkeiten und Unterschiede
6.1.3Hörtextsorten und Hörstrategien
6.2Methodik des Hörverstehens
6.2.1Aufgaben vor dem Hören
6.2.2Aufgaben während des Hörens
6.2.3Aufgaben nach dem Hören
6.3Hörverstehen im Deutschbuch
6.3.1Hörverstehen eines Sachtextes (Interview)
6.3.2Hörverstehen eines literarischen Textes (Geschichte)
6.3.3Hörverstehen eines Hörbuchs/Hörspiels
6.4Hörverstehen testen
6.4.1Hörverstehensaufgaben in Abschlussprüfungen
6.4.2Niveaustufenmodelle zur Entwicklung von Hörverstehenstests
6.5Hör-Seh-Verstehen: Filme und Videos
6.5.1Hör-Seh-Verstehen im Deutschunterricht
6.5.2Grundlagen der Filmdidaktik
6.5.3Visual Literacy und Filmbildung
6.5.4Mit Filmen im Unterricht arbeiten
6.5.5Aufgabenbeispiele aus Deutschbüchern
7Ausblick: Plädoyer für eine neue Rede- und Gesprächsdidaktik
7.1Grundsätzlich: Mündlichkeit ernst nehmen
7.2Berücksichtigung des Hörverstehens und des Hör-Seh-Verstehens
7.3Plädoyer für einen konsequenten Einbezug des Zuhörers
7.4Plädoyer für eine Vielfalt mündlicher Textsorten
7.5Modellierung des Kompetenzbereichs
7.6Mündlichkeit im mehrsprachigen Kontext
7.7Einbezug der modernen Medien
7.8Beurteilung und Evaluation der Rede- und Gesprächskompetenz
7.9Gute Aufgaben fördern das Lernen
Literaturverzeichnis
Verzeichnis der QR-Codes
Abbildungsverzeichnis
Einleitung
Das vorliegende Studienbuch beschäftigt sich mit dem Kompetenzbereich „Sprechen und Zuhören“ – genauer gesagt mit der Didaktik und Methodik des Sprechens und Zuhörens im Deutschunterricht.
„Sprechen und Zuhören“ spielt im Unterricht aber in allen Schulfächern eine zentrale Rolle, denn die mündliche Sprache ist in allen Fächern vorherrschendes Unterrichtsmedium. Alle am Unterricht Beteiligten – Lehrende und Schülerinnen und Schüler – äußern sich mündlich und hören einander zu, sie nehmen entweder die Sprecher- oder die Hörerrolle ein. Im Deutschunterricht ist mündliche Kompetenz zudem aber auch Lerngegenstand und institutionell fest im Lerncurriculum verankert. Im Zuge der Ausarbeitung und Implementierung der Bildungsstandards Deutsch ist „Sprechen und Zuhören“ in allen Schulformen (Primarbereich, Hauptschulbereich, Bereich der Mittleren Schulabschlüsse, gymnasiale Oberstufe) neben den Bereichen „Lesen – Umgang mit Texten und Medien“, „Schreiben“ sowie „Sprache und Sprachgebrauch untersuchen“ einer der zentralen Kompetenzbereiche des Deutschunterrichts. Schülerinnen und Schüler sollen beispielsweise lernen, von eigenen Erlebnissen zu erzählen, ein Gedicht vorzutragen, ein Rollenspiel zu inszenieren oder auch miteinander zu diskutieren.
Gleichwohl hat das „Sprechen und Zuhören“ im Deutschunterricht gegenüber anderen Kompetenzbereichen immer noch einen schweren Stand. So hat das Lesen im Zuge der internationalen Lesestudien (PISA, PIRLS) an Stellenwert noch gewonnen, Schreiben spielt bei der Evaluation von Schülerleistungen ohnehin traditionell eine zentrale Rolle. „Sprechen und Zuhören“ gelten indes als vernachlässigte Kompetenzen. Warum wird das „Sprechen und Zuhören“ im Deutschunterricht immer noch stiefmütterlich behandelt? Die Gründe hierfür sind vielfältig. Wenn Kinder in die Schule kommen, können sie bereits sprechen, während sie das Lesen und Schreiben noch erlernen müssen. Dass auch „Sprechen und Zuhören“ Gegenstand des Unterrichts sein sollten, mag deshalb als weniger dringlich erscheinen: So bewertet Joachim Fritzsche (1994, 42) den Erfolg bei der Ausbildung mündlicher Sprachkompetenzen in der Schule als eher gering:
Da Sprechen in der primären Situation gelernt wird, braucht es nur dann und insofern auch noch in der Schule gelernt zu werden, als es irgendwelche Mängel gibt, die offenbar werden, sobald man den Sprachgebrauch des Sechsjährigen vergleicht mit dem Sprachgebrauch des Erwachsenen, des „kompetenten Sprechers“ […] Ich hege starke Zweifel, ob diese Fähigkeiten, soweit es sich um mündliche Sprache handelt, auch nur im geringsten durch den Sprachunterricht verbessert werden.
Solchen Ansichten wird – nicht zuletzt auf der Basis des kompetenzorientierten Unterrichts – in der aktuellen fachdidaktischen Diskussion vehement widersprochen. Die Notwendigkeit einer unterrichtlichen Förderung mündlicher Sprachfähigkeiten ergibt sich allein schon daraus, dass auffällig große individuelle Unterschiede in der Sprech- und Gesprächskompetenz zwischen Kindern desselben Alters bestehen. Im Kontext multilingualer Klassen spielt die Mehrsprachigkeit dabei eine zunehmend wichtige Rolle, nicht allein unter kommunikativen Gesichtspunkten, sondern auch unter dem Aspekt der Identitätskonstruktion.
Ein wesentlicher Grund für die Vernachlässigung des Mündlichen im Unterricht ist sicherlich die Dominanz des Schriftsprachlichen in Alltag und Schule. Reinhard Fiehler (2014, 26-30) nennt hierfür mehrere Gründe:
Das gesellschaftliche wie auch das wissenschaftliche und didaktische Sprachbewusstsein sind eher schriftsprachlich geprägt: Die „Dauerhaftigkeit“ von Texten führt gegenüber der Flüchtigkeit des Gesprochenen zu einer „objektmäßigen Präsenz“ des Geschriebenen. Auch wird die geschriebene Sprache „gesellschaftlich als wichtiger angesehen und höher bewertet als die gesprochene“ (Fiehler 2014, 27; vgl. auch Fiehler 2009).
Der Kenntnisstand über die Besonderheiten der gesprochenen Sprache „entspricht in keiner Weise dem, was wir über die geschriebene Sprache wissen“ (Fiehler 2014, 27). Die Beschreibung der geschriebenen Sprache in Lexikografie und Grammatik hat eine lange Tradition, die Erforschung der gesprochenen Sprache setzt eigentlich erst Ende des 19. Jahrhunderts ein.
Beschreibung und Bewertung der gesprochenen Sprache erfolgen auf der Folie der geschriebenen Sprache. Die geschriebene Sprache wird als Normalfall angesehen, die gesprochene eher als Abweichung – häufig mit negativen Bewertungen (z. B. Satzabbrüche, Verschleifungen, Wortwiederholungen).
Die linguistischen Beschreibungskategorien – auch wenn sie die gesprochene Sprache betreffen (z. B. Ellipse, Satzabbruch, Interjektion) – sind schriftsprachlich orientiert. „Ein Kategoriensystem, das in ähnlicher Weise funktional auf die gesprochene Sprache zugeschnitten wäre, existiert im Moment nur in Ansätzen“ (Fiehler 2014, 28).
Schließlich wird als wichtiger Grund für die Vernachlässigung der Mündlichkeit im Unterricht angeführt, dass „Sprechen und Zuhören“ an das flüchtige Medium gesprochener Sprache gebunden und somit im Unterricht nicht so leicht sichtbar zu machen sei. Erinnert wird in diesem Zusammenhang an die Interaktivität von Gesprächen: Diese sind zwar technisch als Datei archivierbar und abrufbar, aber immer noch schwer und kompliziert sichtbar zu machen (z. B. in Form von Transkriptionen). Diese Erklärung trifft auf den modernen Deutschunterricht allerdings nur noch bedingt zu: Soziokultureller und technisch-medialer Wandel haben zu einer grundsätzlich neuen Ausrichtung des Unterrichts geführt, der sich im Kompetenzbereich „Sprechen und Zuhören“ besonders deutlich manifestiert. Hörbücher und auditive Download-Formate gehören ebenso wie audio-visuelle Medien zu Lehrmaterialien, die mittlerweile Eingang in den Deutschunterricht gefunden haben. Mündliche Sprache kann demnach im Unterricht ohne großen Aufwand hörbar und sichtbar gemacht werden. Es zeichnet sich also ein Wandel in Richtung Mündlichkeit ab, der auch mit dem Einsatz moderner Medien im Unterricht erklärbar ist. Beredtes Beispiel hierfür sind beispielsweise die Medienpass-Initiativen der einzelnen Bundesländer zur Förderung der Medienkompetenz.
Mit den Bildungsstandards Deutsch scheint sich zudem der Stellenwert der Mündlichkeit grundlegend zu ändern, denn dieser wird unter dem Rubrum „Sprechen und Zuhören“ ein eigenständiger Kompetenzbereich zugewiesen. Ein erster Blick in deutschdidaktische Handbücher und Einführungen bestätigt, dass „Sprechen und Zuhören“ inzwischen Berücksichtigung findet, allerdings im Vergleich mit den anderen Kompetenzbereichen oft eher knapp abgehandelt wird. Dies gilt auch für den Stellenwert dieses Kompetenzbereichs in den Deutschbüchern (ab Sekundarstufe I).
Festzustellen bleibt: Eine grundlegende fachdidaktische Darstellung des Kompetenzbereichs „Sprechen und Zuhören“ liegt noch nicht vor. Diese Lücke will das vorliegende Buch schließen. Es bietet einen umfassenden Überblick über Theorien und Ansätze des Kompetenzbereichs „Sprechen und Zuhören“ und illustriert diesen an zahlreichen Beispielen aus der Praxis des Deutschunterrichts.
Die enge Verzahnung von Theorie und Unterrichtspraxis zeichnet die Darstellung aus. Dabei werden auch Teilkompetenzen untersucht, die bislang in der Deutschdidaktik wenig Berücksichtigung finden: das Hörverstehen und das Hör-Sehverstehen. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist, dass in diesem Studienbuch Audios und Videos über QR-Codes abrufbar sind. Die Kombination von Printtext und Audio bzw. Video führt zu einer neuen Qualität der inhaltlichen Darstellung und Vermittlung: Didaktische Positionen und Inhalte können über den auditiven bzw. visuellen Zugang zusätzlich erläutert werden.
Ausgehend von den Bildungsstandards Deutsch werden zunächst die Zielsetzungen des Kompetenzbereichs „Sprechen und Zuhören“ auf ihre didaktischen Ansätze und Positionen zurückgeführt und diskutiert. Dabei werden zentrale Positionen der Rede- und Gesprächsdidaktik erörtert. Das Buch bietet einen umfassenden Überblick über wissenschaftliche und fachdidaktische Grundlagen des Kompetenzbereichs „Sprechen und Zuhören“. Es zeigt aber auch, wie die Teilkompetenzen im Deutschunterricht vermittelt werden können: Zahlreiche Beispiele aus unterschiedlichen Deutschbüchern sowie eigene Unterrichtsbeispiele werden zur Erläuterung und Konkretisierung der Konzepte herangezogen. An diesen Beispielen wird gezeigt, wie „Sprechen und Zuhören“ im Unterricht entwickelt und gefördert werden kann. Die Unterrichtsbeispiele sind dabei als prototypisch anzusehen: Sie sind auf unterschiedliche Schulformen und Klassenstufen übertragbar und sie sind insofern musterhaft, als sie die neuesten didaktischen und methodischen Positionen reflektieren. Zudem gibt es Hinweise, wie der Kompetenzbereich „Sprechen und Zuhören“ in mehrsprachigen Klassen gefördert werden kann. Das Buch schließt mit einem Plädoyer für eine neue Rede- und Gesprächsdidaktik im Deutschunterricht.
Das Buch wendet sich an
Studierende der Germanistik bzw. Lehramtsstudierende, die sich im Rahmen ihrer Ausbildung mit Aspekten der Mündlichkeit beschäftigen. Sie erhalten einen Überblick über unterschiedliche Ansätze und Positionen der Rede- und Gesprächsdidaktik, denn Lehramtsstudierende „müssen befähigt werden, die Bildungsstandards der KMK zur Ausbildung und Schulung der mündlichen Kompetenz der Schüler/innen umzusetzen“ (Bose/Gutenberg 2009, 202).
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, die Ideen und Impulse für Konzepte und Methoden für die Umsetzung der Bildungsziele des Faches Deutsch im Kompetenzbereich „Sprechen und Zuhören“ suchen. Sie finden didaktische und unterrichtspraktische Hinweise und Empfehlungen, die ihnen im Seminargespräch helfen, didaktische Ansätze zu erörtern, den konkreten Unterricht zu planen sowie gemeinsam Modelle von Unterrichtseinheiten zu entwickeln.
Lehrerinnen und Lehrer im Fach Deutsch, die Anregungen und konkrete Vorschläge für ihren Unterricht suchen. Sie finden in diesem Buch zahlreiche Vorschläge, wie sich „Sprechen und Zuhören“ im Deutschunterricht umsetzen lässt.
Trier, im Dezember 2018
Irmgard Honnef-Becker
Peter Kühn
1Sprechen, Hören, Lesen, Schreiben
Im Alltag verwenden wir Sprache in verschiedenen kommunikativen Situationen. Jemand spricht, wir hören zu; wir lesen eine Nachricht auf dem Smartphone und schreiben eine Antwort, wir hören ein Referat und machen uns Notizen oder wir tippen am PC und lesen gleichzeitig in einem anderen Fenster im Internet. Die Beispiele zeigen, dass Sprechen, Hören, Lesen und Schreiben in unserem Alltag nicht isoliert vorkommen. Sie können zudem verdeutlichen, dass die Kommunikation im Mündlichen anders als im Schriftlichen verläuft: Mündlich kommunizieren wir auf direktem Wege und spontan, im Schriftlichen indirekt über das Medium der Schrift – stärker reflektiert. Auch der Zeitpunkt der Kommunikation spielt eine wichtige Rolle, denn die Kommunikation im Mündlichen erfolgt simultan, im Schriftlichen zeitlich versetzt. Trotz dieser Unterscheidungen ist es oft nicht einfach zu bestimmen, ob ein Text ein mündlicher oder ein schriftlicher Text ist. Wer am Frühstückstisch einen Zeitungstext vorliest, spricht. Der vorgelesene Text ist aber ein geschriebener Text. Bevor wir uns mit mündlichem Sprachgebrauch als Lerngegenstand befassen, wollen wir diese Zusammenhänge näher erörtern.
1.1Mediale und konzeptionelle Mündlichkeit
In der Linguistik unterscheidet man nicht nur zwischen mündlichen und schriftlichen Texten, sondern differenziert genauer zwischen medialer und konzeptioneller Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit: Medial schriftlich ist ein Text, wenn er in gedruckter Form vorliegt, egal ob als Buch oder E-Book. Medial mündlich ist ein Text, wenn er akustisch präsentiert wird, unabhängig davon ob er aus dem Radio, aus dem Internet oder von einem Gesprächspartner face-to-face stammt. Konzeptionell mündliche Texte sind Texte, die Merkmale der gesprochenen Sprache aufweisen, z. B. Gespräche. Konzeptionell schriftliche Texte sind dagegen Texte, die stärker an den Merkmalen der Schriftsprache orientiert sind (vgl. Koch/Oesterreicher 1994; zusammenfassend Spitzmüller 2014), z. B. Zeitungsberichte.
Konzeptionell mündliche Sprache unterliegt vielfach einer breiten situativen Varianz und einer geringeren und weniger offensichtlichen Normierung. Bei näher an der Schriftlichkeit angesiedelten Textsorten spielt der Bezug zur geschriebenen Sprache eine wichtige Rolle. Die Analyse und Einordnung einer Textsorte bildet die Grundlage ihrer Behandlung im Deutschunterricht: Bei einem Kurzvortrag, der medial mündlich, aber näher an der Schriftlichkeit orientiert ist, wird nicht spontan gesprochen. Der Kurzvortrag wird geplant, dabei werden zentrale Aspekte beispielsweise in einer Mindmap (schriftlich) gesammelt, der Vortrag kann anschließend mit Hilfe von Stichwörtern präsentiert werden; bei der Präsentation können die Zuhörenden durch (schriftlich präsentierte) Verstehenshilfen entlastet werden (z. B. in Form eines Plakats oder digitaler Präsentationstechniken). Demgegenüber erscheint im Gruppengespräch eine gewisse Vorläufigkeit angemessen; Alltagssprache, sprachliche Merkmale spontanen Sprechens wie Satzabbrüche, Ellipsen, Pausen usw. sollten dabei nicht als Fehler betrachtet werden.
Von besonderer Relevanz ist die Differenzierung in mediale und konzeptionelle Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit in Bezug auf die Bildungssprache, eine für „den kognitiven und v. a. schriftlichen Umgang mit Lerngegenständen typische schulsprachliche Varietät“ (vgl. Gogolin 2006, Feilke 2012). Bildungssprache ist „in der Tendenz konzeptionell schriftliche Sprache“ (Abraham 2016, 31), die von der Lehrkraft aber gesprochen wird, also medial mündlich ist (Feilke 2012, 6). In der Forschung werden bestehende Sprachbarrieren und Hürden für mehrsprachige Kinder auf diese Besonderheit der Bildungssprache zurückgeführt (vgl. dazu Kapitel 5.3.1.3).
Trotz der Relevanz der „Schriftlichkeits-Mündlichkeitsforschung“ werden für die Deutschdidaktik daraus bislang nur ansatzweise Konsequenzen gezogen (vgl. Abraham 2016, 23 f.). Auf didaktische Folgerungen werden wir in Kapitel 7 eingehen, wenn es darum geht, Perspektiven und aktuelle Ansätze einer Didaktik der Mündlichkeit aufzuzeigen.
1.2Kompetenzbereiche des Sprachunterrichts
Der Kompetenzbereich „Sprechen“ darf nicht für sich allein betrachtet werden. Dies wird besonders deutlich, wenn wir Ansätze aus der Fremdsprachendidaktik heranziehen. Wer eine Sprache erlernt, erwirbt in dieser Sprache die Fertigkeiten Sprechen, Hören, Lesen und Schreiben. Jeglicher Fremdsprachenunterricht ist auf diese vier Basiskompetenzen bezogen. Inzwischen gibt es kaum noch eine Fremdsprachendidaktik, die grundsätzlich nicht auf diesen Grundfertigkeiten basiert. Dazu hat nicht zuletzt der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen (GER) (2001) beigetragen, der als Framework das Lernen und Lehren von Sprachen und das Beurteilen von Sprachkompetenzen nach gemeinsamen Kriterien beschreibt und vergleichbar macht. Er ist ein mittlerweile in ganz Europa anerkannter Bezugsrahmen zur Beschreibung von Sprachkompetenzen und damit eine wichtige Grundlage für Curriculumentwicklung, Lehrwerkserstellung und für Sprachprüfungen.
In einem ersten Zugriff werden die sprachlichen Fertigkeiten in produktive und rezeptive unterschieden: Produktiv sind das „Sprechen“ und „Schreiben“, rezeptiv das „Hören“ und das „Lesen“. Dabei wird hervorgehoben, dass „rezeptiv“ nicht mit „passiv“ gleichzusetzen ist, Verstehen wird als aktiver Prozess verstanden. Aus diesem Grunde sprechen die Didaktiker auch von „Hörverstehen“ bzw. „Leseverstehen“. Innerhalb der produktiven und rezeptiven Fertigkeiten wird eine weitere Unterscheidung vorgenommen. Beim Lesen und Schreiben dient die geschriebene Sprache als Medium, beim Hören und Sprechen die gesprochene Sprache.
rezeptiv
produktiv
gesprochen
Hören
Sprechen
geschrieben
Lesen
Schreiben
Abb. 1:Sprachrezeptive und -produktive Grundfertigkeiten
Das Hören bezieht sich beispielsweise auf das Verstehen eines Vortrags oder Referats, auf Radio- oder Fernsehnachrichten oder auch auf Hörspiele oder Filme. Da es dabei auch um Hören und Sehen geht, wird das Hörverstehen um die visuelle Komponente erweitert (Hör-Seh-Verstehen). Das Lesen bezieht sich auf das Verstehen schriftlicher Textsorten und umfasst sowohl sachbezogene (z. B. Gebrauchsanweisung, Zeitungsmeldung oder Zeitungsinterviews) als auch literarische Texte (z. B. Märchen, Geschichten, Gedichte oder Romane). Das Sprechen betrifft das mündliche Erzählen und Berichten, es beinhaltet aber auch interaktive Formen wie Gespräche und Diskussionen. Die Schreibfertigkeit umfasst das Schreiben von didaktischen Texten (z. B. Zusammenfassung, Erörterung) sowie das Verfassen pragmatischer Texte (z. B. Briefe, E-Mails). Sprechen, Hören, Lesen und Schreiben werden dabei als gleichberechtigte und aufeinander bezogene Kompetenzbereiche angesehen. Ziel des Sprachunterrichts ist die Entwicklung einer Sprachhandlungskompetenz der Schülerinnen und Schüler, die diese vier Bereiche umfasst.
Und wo bleiben „Wortschatz“ und „Grammatik“? Wenn das Ziel des Unterrichts auf den Sprachgebrauch ausgerichtet ist, ist die isolierte Arbeit an Wortschatz und Grammatik aufzugeben. In den Fremdsprachendidaktiken hat dies zu einem Methodenwechsel geführt – weg von der sogenannten Grammatik-Übersetzungsmethode hin zum kommunikativ-pragmatischen Ansatz (vgl. hierzu Huneke/Steinig 2013, 199-215). Nur diejenige Grammatik wird vermittelt, die notwendig ist, damit Schülerinnen und Schüler in der jeweiligen Kommunikationssituation rezeptiv oder produktiv mündlich oder schriftlich sprachhandeln können. Das Konzept eines integrativen Sprachenunterrichts verlangt also eine inhaltliche Vernetzung der Grammatik- und Wortschatzarbeit mit den übergeordneten Kompetenzbereichen „Hören“, „Sprechen“, „Lesen“ und „Schreiben“ (vgl. Kühn 2010). Gerade der Erfolg beim Sprechen und Zuhören beruht immer auch auf grammatischen und lexikalischen Fähigkeiten (vgl. Steinhoff 2009).
Ein Blick in die Fremdsprachendidaktik (z. B. Huneke/Steinig 2013) kann demnach durchaus Anregungen für den Deutschunterricht liefern. Es sollte aber immer bedacht werden, dass der Fremdsprachenunterricht vor allem auf die praktische Kommunikationsfähigkeit im Alltag abzielt. Die Bildungsstandards für das Fach Deutsch gehen darüber hinaus, wie wir im Folgenden darlegen werden.
1.3Kompetenzbereiche in den Bildungsstandards Deutsch
Für den Bereich der Grundschulen und weiterführenden Schulen haben die Kultusminister der Bundesländer im Anschluss an die erste PISA-Studie der OECD 2000 Bildungsstandards für das Fach Deutsch erlassen. In diesen Bildungsstandards wird festgelegt, welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler in einer bestimmten Schulform zu einem spezifischen Ausbildungsabschnitt erwerben sollen. Bildungsstandards beschreiben somit schulisch erwünschte Lernergebnisse. Im Zentrum der Bildungsstandards Deutsch steht ein Kompetenzmodell: Die Zusammenstellung der Kompetenzen erfolgt in Bezug auf bestimmte Kompetenzbereiche, die interdependent miteinander zusammenhängen: „Sprechen und Zuhören“, „Schreiben“, „Lesen – mit Texten und Medien umgehen“ und „Sprache und Sprachgebrauch untersuchen“ (vgl. KMK 2005); „Methoden und Arbeitstechniken“ sind in diese Kompetenzbereiche integriert:
Abb. 2:Kompetenzbereiche in den Bildungsstandards Deutsch
Die Kompetenzbereiche sind im Sinne eines integrativen Deutschunterrichts in unterschiedlicher Weise aufeinander bezogen. Zunächst einmal wird der Bereich „Sprache und Sprachgebrauch untersuchen“ in Beziehung zu jedem der drei anderen Bereiche gebracht. Dies bedeutet grundsätzlich, dass die Arbeit an der Sprache und dem Sprachgebrauch funktional auf das Sprechen und Zuhören, das Schreiben sowie das Lesen bezogen werden muss. Integriert in die zentralen Kompetenzbereiche sind zudem spezifische Methoden- und Arbeitstechniken. Schließlich können im Sinne eines vernetzten Deutschunterrichtes aber auch die drei zentralen Kompetenzbereiche „Sprechen und Zuhören“, „Schreiben“ und „Lesen – mit Texten und Medien umgehen“ miteinander verknüpft werden. Das Kompetenzmodell zielt folglich auf ein vernetztes Lernen.
Die Bildungsstandards verstehen sich als abschlussbezogene Regelstandards und wollen damit die Vergleichbarkeit schulischer Abschlüsse sowie die Durchlässigkeit des Bildungssystems sichern. Das Modell bietet durchaus Gestaltungsmöglichkeiten bei der Festlegung von Lehrplänen und der konkreten unterrichtlichen Arbeit. Inzwischen haben alle Bundesländer die Bildungsstandards in Rahmen- oder Kernlehrpläne überführt. Die Vorstellung von Beispielaufgaben (vgl. z. B. durch das Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen [IQB]) sowie die Implementierung von Leistungsüberprüfungen (z. B. VERA) haben wesentlich zu einer weitgehenden Durchsetzung und Akzeptanz der Bildungsstandards beigetragen.
An dieser Stelle können Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Konzepte des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens und der Bildungsstandards Sprachen nur knapp angerissen werden. Es gibt inzwischen eine ausführliche bildungspolitische (Kissling/Klein 2011), bildungswissenschaftliche (z. B. Bildungsstandards 2004) sowie fachdidaktische Diskussion (vgl. z. B. Lehmann o. J.) der Bildungsstandards sowie auch Vergleiche zwischen den beiden Konzeptionen (vgl. z. B. Schneider 2005). Im Unterschied zum Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen werden in den Bildungsstandards Deutsch auch Kompetenzen gefordert, die nicht nur auf eine kompetente Sprachverwendung abzielen, sondern zudem auch Reflexion und eigenständige Bewertung des eigenen und fremden Sprachverhaltens umfassen.
Gleichwohl haben das Konzept des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens und das der Bildungsstandards Deutsch vieles gemeinsam: Zentraler Bezugspunkt ist die grundsätzliche Orientierung auf die kommunikativen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler in den Bereichen des Hörens, Lesens, Sprechens und Schreibens. Alles andere – vom Wortschatz und der Grammatik bis hin zu den Unterrichtsmethoden – ist dieser Zielsetzung untergeordnet. Auf einen wichtigen Unterschied wollen wir an dieser Stelle aber hinweisen: In den Fremdsprachendidaktiken wird konsequent zwischen dem rezeptiven Hörverstehen und dem produktiven Sprechen differenziert. In den Bildungsstandards Deutsch werden „Hören“ und „Sprechen“ hingegen unter dem Rubrum „Sprechen und Zuhören“ zusammengeführt. Die Reduktion des Hörverstehens auf „Zuhören“ wird der Vielfalt dieses Kompetenzbereichs jedoch nicht gerecht (vgl. Kapitel 6). „Hörverstehen“ wird in den Bildungsstandards Deutsch nicht als selbständige, zentrale Kompetenz betrachtet, obwohl es in Alltag und Unterricht eine so große Rolle spielt. Schülerinnen und Schüler sind ständig mit einer Vielzahl von Hör- und Hör-Seh-Texten konfrontiert, die sie rezeptiv verarbeiten sowie produktiv weiterverarbeiten müssen: Sie schauen sich Fernsehsendungen und Filme an, sie hören Musik auf dem Smartphone, sie schauen sich Videos auf Youtube an, sie nutzen Netflix, um Filme und Serien zu sehen. Im Unterricht hören sie Referaten ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler zu oder auch dem Lehrervortrag.
Wir wollen im Folgenden genauer untersuchen, wie der Kompetenzbereich „Sprechen und Zuhören“ in den Bildungsstandards Deutsch dargestellt wird.
2„Sprechen und Zuhören“ in den Bildungsstandards Deutsch
In den Bildungsstandards Deutsch wird zunächst die Bedeutung des Kompetenzbereichs „Sprechen und Zuhören“ herausgestellt. Der Mündlichkeit wird grundsätzlich ein wichtiger Stellenwert eingeräumt:
Die mündliche Sprache ist ein zentrales Mittel aller schulischen und außerschulischen Kommunikation. Sprechen ist immer auch soziales Handeln (Bildungsstandards Primarbereich 2005, 8).
Kompetenzen im Bereich „Sprechen und Zuhören“ gelten als Schlüsselqualifikationen im beruflichen und sozialen Alltag sowie als Voraussetzung für schulischen Erfolg. Im Unterricht spielt das „Sprechen und Zuhören“ insofern eine zentrale Rolle, als es in jedem Fach „Medium des Lernens“ ist (Bildungsstandards Primarbereich 2005, 6). Dem Deutschunterricht kommt aber eine zentrale Rolle bei der Förderung von „Sprechen und Zuhören“ zu, da die deutsche Sprache vom didaktischen Grundverständnis her „Medium, Gegenstand und Unterrichtsprinzip zugleich“ ist (Bildungsstandards Mittlerer Bildungsabschluss 2005, 6). Ziel des Deutschunterrichts ist, dass die Schülerinnen und Schüler „kommunikative Situationen in persönlichen, beruflichen und öffentlichen Zusammenhängen situationsangemessen und adressatengerecht“ bewältigen“ (Bildungsstandards Mittler Schulabschluss 2005, 8).
Mit Bezug auf die Kompetenzvermittlung nennen die Bildungsstandards folgende Ziele (Bildungsstandards Primarbereich 2005, 8; Bildungsstandards Mittlerer Abschluss 2005, 8):
die Entwicklung einer demokratischen, respektvollen Gesprächskultur,
die Erweiterung der mündlichen Sprachhandlungskompetenz in Alltag und Schule,
die Ausdrucksfähigkeit von Gedanken und Gefühlen,
das situations- und zuhörerangemessene Sprechen und Formulieren sowie das aufmerksame Zuhören,
die konstruktive Auseinandersetzung mit eigenen und fremden Äußerungen.
2.1Die Modellierung des Kompetenzbereichs „Sprechen und Zuhören“
In den Bildungsstandards Deutsch für den Primärbereich (2005) werden als eingeordnete Teilkompetenzen „Gespräche führen“, „zu anderen sprechen“, „verstehend zuhören“, „szenisch spielen“ und „über Lernen sprechen“ angeführt; diese werden in weitere Kompetenzen subspezifiziert:
3 Standards für die Kompetenzbereiche des Faches Deutsch
3.1 Sprechen und Zuhören
Gespräche führen
sich an Gesprächen beteiligen,
gemeinsam entwickelte Gesprächsregeln beachten: z.B. andere zu Ende sprechen lassen, auf Gesprächsbeiträge anderer eingehen, beim Thema bleiben,
Anliegen und Konflikte gemeinsam mit anderen diskutieren und klären.
zu anderen sprechen
an der gesprochenen Standardsprache orientiert und artikuliert sprechen,
Wirkungen der Redeweise kennen und beachten,
funktionsangemessen sprechen: erzählen, informieren, argumentieren, appellieren,
Sprechbeiträge und Gespräche situationsangemessen planen.
verstehend zuhören
Inhalte zuhörend verstehen,
gezielt nachfragen,
Verstehen und Nicht-Verstehen zum Ausdruck bringen.
szenisch spielen
Perspektiven einnehmen,
sich in eine Rolle hineinversetzen und sie gestalten,
Situationen in verschiedenen Spielformen szenisch entfalten.
über Lernen sprechen
Beobachtungen wiedergeben,
Sachverhalte beschreiben,
Begründungen und Erklärungen geben,
Lernergebnisse präsentieren und dabei Fachbegriffe benutzen,
über Lernerfahrungen sprechen und andere in ihren Lernprozessen unterstützen.
Abb. 1:Differenzierung des Kompetenzbereichs „Sprechen und Zuhören“ in den Bildungsstandards Deutsch für den Primärbereich (2005, 9 f.)
Ähnlich wird der Kompetenzbereich in den Bildungsstandards Deutsch für den Mittleren Schulabschluss (2005) konzeptionalisiert:
3 Standards für die Kompetenzbereiche im Fach Deutsch
3.1 Sprechen und Zuhören
zu anderen sprechen
sich artikuliert, verständlich, sach- und situationsangemessen äußern,
über einen umfangreichen und differenzierten Wortschatz verfügen,
verschiedene Formen mündlicher Darstellung unterscheiden und anwenden, insbesondere erzählen, berichten, informieren, beschreiben, schildern, appellieren, argumentieren, erörtern,
Wirkungen der Redeweise kennen, beachten und situations- sowie adressatengerecht anwenden: Lautstärke, Betonung, Sprechtempo, Klangfarbe, Stimmführung; Körpersprache (Gestik, Mimik),
unterschiedliche Sprechsituationen gestalten, insbesondere Vorstellungsgespräch / Bewerbungsgespräch; Antragstellung, Beschwerde, Entschuldigung; Gesprächsleitung.
vor anderen sprechen
Texte sinngebend und gestaltend vorlesen und (frei) vortragen,
längere freie Redebeiträge leisten, Kurzdarstellungen und Referate frei vortragen: ggf. mit Hilfe eines Stichwortzettels / einer Gliederung,
verschiedene Medien für die Darstellung von Sachverhalten nutzen (Präsentationstechniken): z.B. Tafel, Folie, Plakat, Moderationskarten.
mit anderen sprechen
sich konstruktiv an einem Gespräch beteiligen,
durch gezieltes Fragen notwendige Informationen beschaffen,
Gesprächsregeln einhalten,
die eigene Meinung begründet und nachvollziehbar vertreten,
auf Gegenpositionen sachlich und argumentierend eingehen,
kriterienorientiert das eigene Gesprächsverhalten und das anderer beobachten, reflektieren und bewerten.
verstehend zuhören
Gesprächsbeiträge anderer verfolgen und aufnehmen,
wesentliche Aussagen aus umfangreichen gesprochenen Texten verstehen, diese Informationen sichern und wiedergeben,
Aufmerksamkeit für verbale und nonverbale Äußerungen (z.B. Stimmführung, Körpersprache) entwickeln.
szenisch spielen
eigene Erlebnisse, Haltungen, Situationen szenisch darstellen,
Texte (medial unterschiedlich vermittelt) szenisch gestalten.
Methoden und Arbeitstechniken
verschiedene Gesprächsformen praktizieren, z.B. Dialoge, Streitgespräche, Diskussionen, Rollendiskussionen, Debatten vorbereiten und durchführen,
Gesprächsformen moderieren, leiten, beobachten, reflektieren,
Redestrategien einsetzen: z.B. Fünfsatz, Anknüpfungen formulieren, rhetorische Mittel verwenden,
sich gezielt sachgerechte Stichwörter aufschreiben,
eine Mitschrift anfertigen,
Notizen selbstständig strukturieren und Notizen zur Reproduktion des Gehörten nutzen, dabei sachlogische sprachliche Verknüpfungen herstellen,
Video-Feedback nutzen,
Portfolio (Sammlung und Vereinbarungen über Gesprächsregeln, Kriterienlisten, Stichwortkonzepte, Selbsteinschätzungen, Beobachtungsbögen von anderen, vereinbarte Lernziele etc.) nutzen.
Abb. 2:Differenzierung des Kompetenzbereichs „Sprechen und Zuhören“ in den Bildungsstandards Deutsch für den Mittleren Bildungsabschluss (2005, 10 f.)
Als Teilkompetenzen werden rubriziert: „zu anderen sprechen“, „vor anderen sprechen“, „mit anderen sprechen“, „verstehend zuhören“ sowie „szenisch spielen“ mit entsprechenden Subkompetenzen. In den zugeordneten „Methoden und Arbeitstechniken“ finden sich weitere Kompetenzen: „verschiedene Gesprächsformen praktizieren“, „Gesprächsformen moderieren, leiten, beobachten, reflektieren“, „Redestrategien einsetzen“, „Stichwörter aufschreiben“ und „eine Mitschrift anfertigen“, „Video-Feedback nutzen“.
Die Ausführungen in den Bildungsstandards Deutsch für den Kommunikationsbereich „Sprechen und Zuhören“ setzen dabei durchaus neue Akzente:
Mit der Bezeichnung „Sprechen und Zuhören“ wird zum einen die Kompetenzorientierung hervorgehoben, zum anderen wird deutlich, dass das Sprechen mit dem (Zu) Hören korrespondiert. Sprechen ist kein Selbstzweck, sondern immer adressatenbezogen. „Sprechen und Zuhören“ hebt als Terminus den Gesprächscharakter hervor. Die Kommunikation ist dialogisch und wechselseitig – Sprecherwechsel sind mit inbegriffen. Der Zuhörer wird als aktiver Gesprächspartner verstanden.
Der Kompetenzbereich „Sprechen und Zuhören“ wird nicht einschränkend auf die Vermittlung artikulatorischer Kompetenzen beschränkt: Sprechen und Zuhören ist vielmehr mündliches Sprachhandeln. Es geht um kommunikative Aufgaben wie MITTEILEN, FRAGEN, ANTWORTEN, VORWERFEN, RECHTFERTIGEN, BERICHTEN, BESCHREIBEN, ERZÄHLEN usw. und um die erfolgreiche Teilhabe an den unterschiedlichsten Rede- und Gesprächssituationen (z. B. Vortrag oder Unterrichtsgespräch in der Klasse).
Die Bezeichnungen der Teilkompetenzen (z. B. „zu anderen sprechen“, „vor anderen sprechen“ oder „mit anderen sprechen“) implizieren, dass „Sprechen und Zuhören“ immer situativ eingebettet ist. Hieraus ergibt sich, dass verschiedene Textsorten im Unterricht zu behandeln sind, z. B. Vorstellungsgespräche, Reden, Referate, Vorträge, Lehrer-Schüler-Gespräche, Gespräche im Klassenzimmer, aber auch literarische Texte, beispielsweise Hörbücher, Hörspiele, Dramentexte, Gedichte und Lieder.
Positiv herauszustellen ist grundsätzlich, dass die Bildungsstandards versuchen, die Fülle von Teilkompetenzen in eine für den Deutschunterricht richtungsgebende Struktur zu bringen. Bei genauerer Analyse zeigt sich jedoch eine Vielzahl von Ungereimtheiten.
2.2Ungereimtheiten in den Bildungsstandards Deutsch
Vergleicht man die Ausführungen zum „Sprechen und Zuhören“ in den Bildungsstandards Deutsch für den Primarbereich mit denen in den Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss, so wird zunächst deutlich, dass der Kompetenzbereich in beiden Fassungen ähnlich modelliert ist. Der Vergleich wird allerdings dadurch erschwert, dass die Teilkompetenzen unterschiedlich bezeichnet und verschiedenen Listen von Einzelkompetenzen zugeordnet werden.
Bildungsstandards Deutsch für den Primarbereich
Bildungsstandards Deutsch für den Mittleren Schulabschluss
a) Gespräche führen
a) mit anderen sprechen
b) zu anderen sprechen
b) zu anderen sprechen
c) verstehend zuhören
c) verstehend zuhören
d) szenisch spielen
d) szenisch spielen
e) über Lernen sprechen
f) vor anderen sprechen
Abb. 3:Vergleich der Bildungsstandards Deutsch im Kompetenzbereich „Sprechen und Zuhören“
Problematisch sind vor allem die vielen widersprüchlichen und unklaren Zuordnungen. Hierzu seien einige Beispiele angeführt:
a)Es deutet sich zunächst eine Einteilung der Kompetenzen nach Sprechsituationen an (vgl. Bildungsstandards Mittlerer Schulababschluss 2005): mit anderen sprechen, zu anderen sprechen, vor anderen sprechen. Die Übernahme einer an der Alltagssprache orientierten Einteilung ist jedoch nicht unproblematisch. Man kann beispielsweise in einem mündlichen Vortrag vor anderen sprechen, aber auch zu anderen sprechen. Zudem wird durch die Auflistung der zugeordneten Einzelkompetenzen nicht deutlich, worin der Unterschied zwischen den Teilkompetenzen „zu anderen sprechen“ oder „mit anderen sprechen“ eigentlich besteht: So ließe sich die Einzelkompetenz „verschiedene Formen mündlicher Darstellung unterscheiden und anwenden, insbesondere erzählen, berichten, informieren, beschreiben, schildern, appellieren, argumentieren, erörtern“ (vgl. „zu anderen sprechen“) auch zur Teilkompetenz „mit anderen sprechen“ zuordnen, da man diese Sprechhandlungen auch in Gesprächen nutzt.
b)Insgesamt erscheinen die Zuordnungen der gelisteten Einzelkompetenzen zu den Teilkompetenzen mitunter willkürlich: So wird die Einzelkompetenz „Gesprächsbeiträge anderer verfolgen und aufnehmen“ der Teilkompetenz „verstehend zuhören“ zugewiesen, passt als Einzelkompetenz jedoch auch zu „mit anderen sprechen“, da sich diese Teilkompetenz auf das Führen von Gesprächen bezieht (Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss 2005).
c)Häufig handelt es sich bei den aufgelisteten Einzelkompetenzen um Fähigkeiten und Fertigkeiten, die einen unterschiedlichen Komplexitätsgrad aufweisen, was jedoch durch die additive Auflistung unberücksichtigt bleibt. So muss beispielsweise in der Teilkompetenz „mit anderen sprechen“ die Einzelkompetenz „kriterienorientiert das eigene Gesprächsverhalten und das anderer beobachten, reflektieren und bewerten“ als komplexer angesehen werden als „durch gezieltes Fragen notwendige Informationen beschaffen“. Zudem ist die Reflexion und Bewertung des eigenen und fremden Sprechens eine Fähigkeit, die auch für alle anderen Teilkompetenzen von zentraler Bedeutung ist.
d)Die Teilkompetenz „verstehend zuhören“ ist in den Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss (2005) besonders problematisch modelliert, sie belegt einmal mehr den Mangel an wissenschaftlicher und didaktischer Reflexion:
verstehend zuhören
Gesprächsbeiträge anderer verfolgen und aufnehmen,
wesentliche Aussagen aus umfangreichen gesprochenen Texten verstehen, diese Informationen sichern und wiedergeben,
Aufmerksamkeit für verbale und nonverbale Äußerungen (z.B. Stimmführung, Körpersprache) entwickeln.
Abb. 4:Teilkompetenz „verstehend zuhören“ in den Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss (2005, 10)
In dieser Einzelkompetenz sind in additiver Auflistung zwei zentrale Kompetenzen „versteckt“: Zum einen die Kompetenz des aktiven Zuhörens in Gesprächen – „Gesprächsbeiträge anderer verfolgen und aufnehmen“, „Aufmerksamkeit für verbale und nonverbale Äußerungen (z. B. Stimmführung, Körpersprache) entwickeln“ –, zum anderen die zentrale Kompetenz des Hörverstehens: „wesentliche Aussagen aus umfangreichen gesprochenen Texten verstehen, diese Informationen sichern und wiedergeben“. Hierbei wird die Relevanz des Hörverstehens aber völlig unterschätzt: Wie wir gesehen haben (vgl. Kapitel 1.2 und 1.3) gehört das „Hörverstehen“ neben dem „Leseverstehen“, dem „Sprechen“ und dem „Schreiben“ zu den zentralen Kompetenzbereichen des Deutschunterrichts. Hier wird dieser selbständige Kompetenzbereich nur knapp angerissen und auf die Informationsentnahme und Textwiedergabe reduziert (vgl. dagegen Kapitel 6).
e)Die Teilkompetenz „szenisch spielen“ fällt als letztgenannte Kompetenz insofern aus der Reihe, als es sich im strengen Sinne um eine Methode handelt. Schülerinnen und Schüler lernen entweder ihre eigenen Erlebnisse, Gedanken und Haltungen auszudrücken oder aber literarische Texte durch szenische Gestaltung zu interpretieren. Während andere Methoden (z. B. Rollendiskussionen, Fünfsatz-Argumentation oder eine Mitschrift anfertigen) zu den „Methoden und Arbeitstechniken“ gestellt werden, erhält die Teilkompetenz „szenisch spielen“ einen prominenten Platz, ohne dass dies begründet würde (zur Einordnung des Rollenspiels vgl. Kapitel 5.4).
f)Es ist nicht einsichtig, warum die Teilkompetenz „über Lernen sprechen“ nur in den Bildungsstandards für den Primarbereich aufgenommen ist. Genauso unverständlich bleibt, warum die Teilkompetenz „vor anderen sprechen“ lediglich in den Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss erscheint und demnach als unwichtig für die Gesprächskompetenz von Primarschülerinnen und -schülern erachtet wird.
g)Schließlich sei kritisch angemerkt, dass keine Hierarchisierung und Zuordnung der Teilkompetenzen in den Bildungsstandards vorgenommen werden.
Fazit: Die Modellierung der Standards im Kompetenzbereich „Sprechen und Zuhören“ ist eigentlich enttäuschend. Es fehlt an einer schlüssigen Systematik und an exakten, plausiblen Zuordnungen. Der Kompetenzbereich spiegelt nicht die aktuelle deutschdidaktische Diskussion seit der Jahrtausendwende wider (vgl. Kapitel 3). Bei vereinzelten Formulierungen der Bildungsstandards scheinen indes traditionelle Didaktikpositionen durchzuschimmern: So geht das „sinngebende und gestaltende“ Vorlesen auf die Sprecherziehung von Erich Drach (1922/1949, 156-184) zurück. Der genannte „Fünfsatz“ in den „Methoden und Arbeitstechniken“ ist eine Argumentationsform der rhetorischen Kommunikation von Hellmut Geißner (1968), ohne dass deren Stellenwert im Kontext des gesamten Kompetenzbereichs deutlich wird.
So erscheint die Modellierung des Kompetenzbereichs „Sprechen und Zuhören“ als eine durch Kompromisse zustande gekommene Sammlung traditioneller Positionen und Lerninhalte des Deutschunterrichts. Die teilweise sporadisch wirkende additive Übernahme von Positionen der bisherigen Rede- und Gesprächsdidaktik ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass der Kompetenzbereich „Sprechen und Zuhören“ kein in sich geschlossenes Konzept aufweist. Die in den Bildungsstandards angesprochenen Kompetenzen sind eigentlich nicht neu, sie finden sich schon in Didaktiken vor Erscheinen der Bildungsstandards (vgl. z. B. Beisbart/Marenbach 1975/1990, 155-157).
An dieser Kritik ändern auch die Versuche nichts, die Bildungsstandards über „gute Aufgaben“ zu illustrieren, um ihre Akzeptanz für die unterrichtliche Umsetzung zu erhöhen (vgl. hierzu Becker-Mrotzek 2008, Behrens/Eriksson 2009, Krelle/Neumann 2014). Man gibt vor, dass sich die Leistungserwartungen in diesem Kompetenzbereich „sowohl auf Erfahrungen aus der Schulpraxis als auch auf gängige Theorieannahmen über Mündlichkeit“ beziehen würden. Die Ausführungen erschöpfen sich jedoch in einer vergleichenden Paraphrase der Bildungsstandards. Widersprüche bleiben verdeckt und neuere Ansätze ausgeblendet, wenn beispielsweise davon ausgegangen wird, dass es beim Hörverstehen „um das Erinnern oder das Wiedererkennen“ gehe (so Krelle/Neumann 2014, 25). Ein Blick über den Tellerrand auf die Hörverstehensdidaktik des fremdsprachlichen Unterrichts hätte sicherlich zu einer theoretischen Fundierung und Schärfung beitragen können (vgl. stellvertretend Solmeke 1993, Dahlhaus 1994, Kühn 1996). Der Ansatz der medialen und konzeptionellen Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit (Koch/Oesterreicher 1994) oder die linguistische Gesprächsanalyse spielen in den Bildungsstandards ebenso wenig eine Rolle wie das konstruktivistische Verstehenskonzept, nach dem sich das Verstehen mündlicher Texte aus einem Wechselspiel konzeptgeleiteter und datenorientierter Prozesse ergibt. Eine theorieorientierte Fundierung des Kompetenzbereichs bleibt durch die Diskussion um „gute Aufgaben“ ausgeklammert: Die Ergebnisse sind dürftig, wenn resümiert wird, dass „gute Aufgaben […] die Interaktivität und Flüchtigkeit von Gesprächen berücksichtigen“ müssen (Becker-Mrotzek 2008, 77). Hervorzuheben ist allerdings, dass in Folge dieser Diskussion die Kategorie des „aktiven Zuhörers“ stärker in den Blick gerät – allerdings vor allem als hierarchieniedrige Kompetenz im Sinne von Aufmerksamkeit, Konzentrationsfähigkeit und Aufnahmefähigkeit (vgl. Behrens/Böhme/Krelle 2009, Krelle/Neumann 2014, 32-38).
2.3Gründe für eine Orientierung an den Bildungsstandards
Wenn wir uns im Folgenden dennoch an der Systematik der Bildungsstandards Deutsch orientieren, so hat dies sehr praktische Gründe:
Die Kultusministerien der einzelnen Bundesländer haben die Standards als Grundlage ihrer Kernlehrpläne adaptiert. In der Regel sind dabei die Bezeichnungen für die Kompetenzbereiche sowie die Teilkompetenzen übernommen worden, so dass diese Kompetenzfestlegungen länderübergreifend Gültigkeit besitzen. So werden beispielsweise im Kerncurriculum für die integrierte Gesamtschule (2006, 14) in Niedersachsen folgende Anforderungen für das „Sprechen und Zuhören“ genannt:
Schüler und Schülerinnen müssen dabei übergreifend in der Lage sein
zu anderen zu sprechen, um eigene Positionen und Meinungen darzustellen,
vor anderen zu sprechen, Redebeiträge zu gestalten, Referate oder Vorträge zu halten,
mit anderen zu sprechen, in Dialog und Gesprächen zu einem gedanklichen Austausch zu kommen,
verstehend zuzuhören, um sowohl im Gespräch mit Partnern als auch in der Auseinandersetzung mit Reden und Vorträgen eine aktive Rolle einzunehmen,
szenisch zu spielen, wodurch ihnen Selbsterfahrungen in der Analyse kommunikativer Situationen ermöglicht werden.
Das Beispiel zeigt, dass der Kernlehrplan die Teilkompetenzen zwar übernimmt, jedoch teilweise anders akzentuiert und beschreibt.
Die enge Orientierung an den Bildungsstandards Deutsch gilt auch für die Schulbücher, die auf der Basis der Bildungsstandards und der Kernlehrpläne für die einzelnen Bundesländer genehmigt werden. Die Lehrerinnen und Lehrer, die sich in diesem Studienbuch über den Kompetenzbereich „Sprechen und Zuhören“ informieren wollen, finden folglich die Systematik ihrer Unterrichtsplanung und ihres Unterrichts hier wieder.
Die Bildungsstandards bilden zudem die Folie für die zahlreichen Lernstandserhebungen in den einzelnen Bundesländern – auch für den Kompetenzbereich „Sprechen und Zuhören“. Augenblicklich dominieren in den Lernstandserhebungen allerdings Aufgaben zum Hörverstehen. Dies liegt darin begründet, dass Hörverstehenstests standardisiert auswertbar sind. Die übrigen Kompetenzen aus dem Bereich „Sprechen und Zuhören“ spielen augenblicklich in den Lernstandserhebungen keine Rolle.
In den curricularen Standards der Lehrerausbildung an Universitäten und Studienseminaren werden die Bildungsstandards Deutsch ebenfalls reflektiert. Universitäts- und Studienseminare sind thematisch an den zentralen Kompetenzen der Bildungsstandards orientiert.
Da die Bildungsstandards demnach als anerkannte Richtschnur in Didaktik und Unterricht dienen, legen wir sie auch unserer Darstellung zu Grunde, um aber – falls es erforderlich ist – über sie hinauszugehen und aktuelle Ansätze zu erörtern. Die Unterrichtsbeispiele, die in diesem Buch kommentiert werden, sollen den (angehenden) Lehrerinnen und Lehrern Hinweise geben, wie gute Aufgaben im Kompetenzbereich „Sprechen und Zuhören“ in der Unterrichtspraxis aussehen könnten.
3Positionen der Sprech- und Gesprächsdidaktik
Abb. 1:Positionen der Sprech- und Gesprächsdidaktik
Die Ansätze und die Geschichte einer Sprech- und Gesprächsdidaktik sind – historisch betrachtet – sehr wechselvoll und durch verschiedenartige Strömungen beeinflusst (vgl. Pabst-Weinschenk 2003, Polz 2009). Die Zeitleiste verdeutlicht die sprunghafte Entwicklung und markiert entscheidende Punkte, die die Herausbildung des Bereichs maßgeblich beeinflusst haben.
Rudolf Hildebrand (1867/1917) ist der Erste, der aus didaktischer Perspektive der gesprochenen Sprache gegenüber der geschriebenen einen Vorzug einräumt. Theodor Siebs (1898/1915) befördert durch die Deutsche Bühnenaussprache eine einheitliche Ausspracheregelung – gewissermaßen als Pendant zum Orthographischen Wörterbuch von Konrad Duden (1880). Bahnbrechend für die Berücksichtigung der gesprochenen Sprache im Deutschunterricht ist Erich Drachs Sprecherziehung (1922) (vgl. Pabst-Weinschenk 1993). In den fünfziger und sechziger Jahren findet die gesprochene Sprache erstmals wieder bei Erika Essen (1956) und Hermann Helmers (1966/1970) Berücksichtigung. In den siebziger und achtziger Jahren rückt die Mündlichkeit dann in den Fokus linguistischer, rhetorischer, pragmatischer und didaktischer Strömungen und Ansätze. Die didaktische Kanonisierung der Mündlichkeit erfolgt endgültig in der Diskussion um die Bildungsstandards im Fach Deutsch zur Jahrtausendwende.
3.1Rudolf Hildebrand: „Vom deutschen Sprachunterricht“
Rudolf Hildebrand (1867/1917, 6) stellt bereits Mitte des 19. Jahrhunderts für den Sprachunterricht des Deutschen heraus:
Das Hauptgewicht im deutschen Unterrichte sollte künftig auf die gesprochene und gehörte Sprache gelegt werden, nicht auf die geschriebene und gesehene. Das Hochdeutsch, als Ziel des Unterrichts, sollte nicht als etwas für sich gelehrt werden, wie ein anderes Latein, sondern im engsten Anschluß an die in der Klasse vorfindliche Volkssprache oder Haussprache.
Abb. 2: Dr. Rudolf Hildebrand (1824-1894), Professor für neuere deutsche Literatur und Sprache an der Universität Leipzig
Hildebrand wandte sich explizit gegen das „Dintendeutsch“ (S. 29), die Zeitungssprache und das Schriftdeutsche, in das sich viel „Übel“ eingeschlichen hat (S. 36). Er spricht sich explizit gegen das „jagende Lesen“ (S. 38) bzw. das „stumme tote Augenlesen“ (S. 41) oder „stummes Überlesen“ (S. 43) aus. Die Bevorzugung der gesprochenen gegenüber der geschriebenen Sprache ist für ihn gewissermaßen naturgegeben und kulturpatriotisch sowie sprachpuristisch motiviert. Natürlichkeit, Anschaulichkeit, Sinnhaftigkeit und Bildlichkeit zeigen sich in der gesprochenen Sprache, z. B. in den Redensarten.
Aber auf allen Stufen des Unterrichts sind das Ohr und der Mund als Hauptträger der Muttersprache zu behandeln, das Auge und die Hand in die ihnen gebührende Stellung zurück zu verweisen. Das Wort auf dem Papiere darf dem Schüler nur das Kleid sein, das freilich auch geputzt und gereinigt oder sonntäglich werden muß, wie in der Handschrift, so in der Rechtschreibung; aber der Körper des Wortes muß ihm der Klang sein, wie er aus dem Munde in Ohr und Gemüt geht, um diesen seine Seele, den lebendigen Inhalt mitzuteilen, denn dies Bild vom Menschen paßt tief wesentlich, um sich die geheimnisvolle Natur des Wortes klar zu machen (S. 49f.).
Hildebrands kulturhistorische Sprachauffassung mit der Herausstellung der gesprochenen Sprache bleibt aber episodisch: Zum einen wird in Didaktik und Schule der Bereich der Mündlichkeit ab 1871 durch die Bemühungen um eine normierende Rechtschreibung und durch den Bezug auf die Schrift verdrängt. Beredtes Zeichen ist Konrad Dudens Orthographisches Wörterbuch von 1880, das als Grundlage für eine einheitliche deutsche Rechtschreibung angesehen und in Verwaltung und Schule verbindlich eingeführt wurde. Zum anderen führt das zunehmende Aufkommen der Druckmedien gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu einer Favorisierung der Schriftsprache gegenüber der gesprochenen Sprache. Nach Rudolf Hildebrand wird in der didaktischen und unterrichtspraktischen Diskussion der Fokus auf die gesprochene Sprache zugunsten der Schriftsprache aufgegeben. Eine Didaktik der gesprochenen Sprache wird erst wieder in den 1920er Jahren durch Erich Drachs Standardwerk Sprecherziehung. Die Pflege des gesprochenen Wortes (1922) propagiert und ausgearbeitet. Die gesprochene Sprache – insbesondere die Mundarten – gilt gegen Ende des 19. Jahrhunderts „als eine Sprache zweiten Ranges, als eine Sprache der Ungebildeten“ (Hirt 1919, 253). Ab 1871 liegt das Augenmerk eindeutig auf der Sprachrichtigkeit – und zwar sowohl im Bereich des Schriftsprachlichen wie auch des Mündlichen. Einen Meilenstein für die korrekte Aussprache bildet dabei die Deutsche Bühnenaussprache von Theodor Siebs (1898).
3.2Theodor Siebs: „Deutsche Bühnenaussprache“
Abb. 3: Dr. Theodor Siebs (1862-1941), Professor für deutsche Sprache und Literatur an der Universität Breslau
Zunehmende Beachtung findet die gesprochene Sprache gegen Ende des 19. Jahrhunderts durch die Arbeiten des Germanisten Theodor Siebs. In Verbindung mit Fachkollegen und Theaterpraktikern legt Siebs 1898 im Bereich der Hochlautung (Orthoepie) seine Deutsche Bühnenaussprache vor. Der „Siebs“ war lange Zeit maßgebend für die Regelung der deutschen Aussprache. Dieses normative Wörterbuch war ausgerichtet an der norddeutschen Aussprache. Es war die niederdeutsche Schriftsprache, die auf Grund ihrer Lautreinheit als vorbildlich und lautästhetisch empfunden wurde. Dabei gelten folgende Grundsätze (Siebs 1898/1915, 10-15):
Es sollen keine neuen Ausspracheregeln „angeordnet, sondern der bestehende Gebrauch soll festgestellt werden; wo sich Unterschiede ergeben, sind sie nach Maßgabe der üblichsten und zweckmäßigsten Aussprache auszugleichen.“
„Die Schreibung kann niemals Maßstabe für die Aussprache sein. Die Schrift ist gegenüber der Aussprache stets etwas Sekundäres.“
„Die feste Regelung berücksichtigt nur die ruhige, verstandesmäßige Rede; dem Ausdrucke der Stimmung muß ein gewisser Spielraum gelassen werden.“
Von den Regelungen ausgeschlossen sind Fälle, in denen beispielsweise der Reim oder der Rhythmus „besondere Abweichungen vom Üblichen fordern.“
Dabei ist der „Siebs“ eindeutig normierend:
Wenn auf die Frage: „an welchem Tak?“ im ernsten Drama geantwortet wird: „am Tach vor jenem Siech“ und gar von anderen noch „am Tach“ oder „am Tack“ hinzugefügt wird, so ist dieses Ducheinander für den feiner Empfindenden unerträglich. Es läßt sich nur beseitigen durch Aufstellung fester Regeln, und eine solche ist daher nicht kleinliche Schulmeisterei, sondern eine notwendige Forderung der Kunst und eine willkommene Erleichterung für den Schauspieler, der sich in Zweifelsfällen beraten sieht (S. 4).
Abb. 4: Ausschnitt aus der Deutschen Bühnenaussprache (1898)
Die Deutsche Bühnenaussprache gilt fortan als Vorbild für die deutsche Theaterlandschaft und hatte darüber hinaus eine große Wirkung in den Schulunterricht. Nach Theodor Siebs (S. 20) steht zweifelsfrei fest, daß die Schule eine über den Mundarten stehende Aussprache zu pflegen und besonders für den mündlichen Vortrag zu verlangen hat. […] Wir sollten diesen für die Ausbildung des Kindes wichtigen Anspruch keineswegs der Willkür der einzelnen Lehrer preisgeben, von denen der eine vielleicht nur die reine Mundart pflegen, der andere gemäß der Rechtschreibung, der dritte streng nach den Regeln der Bühnenaussprache reden möchte.
Abb. 5: Titelei von Theodor Siebs: Deutsche Bühnenaussprache (11. Auflage. Bonn: Albert Ahn 1915)
Die Deutsche Bühnenaussprache wird zur lautnormierenden Richtlinie der sogenannten „Sprecherziehung“, die sich episodisch durch das gesamte 20. Jahrhundert zieht. Hermann Hirt (1919, 283) resümiert:
In Schreibung und Aussprache wissen wir jetzt, woran wir uns im Deutschen zu halten haben, und vor allem ist die Schule froh, hier eine Vorschrift zu besitzen, nach der man sich zu richten hat, und die auch erlernt werden kann.
Diese orthoepische Orientierung der gesprochenen Sprache auf die Schriftsprache zieht sich fortan wie ein roter Faden durch die Didaktik der Mündlichkeit: noch in den Bildungsstandards Deutsch findet man dazu Belege. Unter „Sprechen und Zuhören“ heißt es: Die Schülerinnen und Schüler „benutzen die Standardsprache“ (Bildungsstandards Mittlerer Schulabschluss 2005, 8; vgl. auch die sprechdidaktische Position bei Hermann Helmers in Kapitel 3.4).
3.3Erich Drach: „Sprecherziehung“
Im Bereich der Sprachdidaktik hat Erich Drach 1922 die Mündlichkeit als „Sprecherziehung“ in der Schule etabliert.
Seine Pflege des gesprochenen Wortes in der Schule hatte den Anspruch, „eine grundsätzliche Fachlehre des Sprechens, eine Sprechkunde, zu schaffen“. Erich Drach will „den Gesamtstoff geordnet, wissenschaftlich vertieft und schulmäßig geformt dem einzelnen Lehrer in die Hand legen“ (Drach 1922/1949, 4). Der Schwerpunkt der Sprecherziehung liegt im Bereich der genetisch-artikulatorischen Phonetik („Stimm- und Sprechbildung“, S. 8-90), allerdings erweitert Erich Drach die phonetische Perspektive: Er untersucht den Gebrauch des Sprechens in unterschiedlichen „Sprechlagen“, d. h. Sprechsituationen.
Abb. 6: Dr. Erich Drach (1885-1935), Gymnasiallehrer und Lektor für Stimmkunde am Berliner Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht
Erich Drachs Sprecherziehung mutet aus heutiger Sicht sehr fortschrittlich und pragmatisch an:
Sprechlage heißt die Gesamtheit aller derjenigen Voraussetzungen, die dazu führen, daß der Sprecher gerade in dem Augenblick gerade die Worte an gerade den Hörer richtet. In diese Gesamtheit fließen die verschiedensten Teilströme: Was weiß der Sprecher schon von der Angelegenheit? Was will er dem Hörer mitteilen? Was will er ihm etwa verschweigen? In welcher Stimmung ist der Sprecher? Wie stehen die beiden Gesprächspartner menschlich und gesellschaftlich zueinander? Was kann über die Angelegenheit als bekannt oder nicht bekannt vorausgesetzt werden? Welcher sachliche Eindruck, welche Gefühlswirkung, welche Antwort wird von dem Hörer erwartet? Kurzum: Was liegt voraus, aus dem der Satz geboren wird? Im Verlauf einer Rede, eines Gespräches gehört zur Sprechlage jedes neuen Satzes dementsprechend auch alles, was bisher von den beiden Unterrednern über die Sache gesagt wurde. Dieser Begriff der Sprechlage – der tatsächlich vorhandenen oder vorausgesetzten – muß zuerst erfaßt werden (S. 118).
Unter sprachpsychologischen Gesichtspunkten ist dabei nicht nur entscheidend, „was man sagt, sondern ebenso stark, ja noch stärker, wie man es sagt. Der hochwertigste Inhalt läßt kalt, wenn er schlecht geredet wird“ (S. 96).
Dabei verweist Erich Drach ausdrücklich auf die grundsätzliche Ausrichtung des Sprechens auf den Zuhörer, denn
wenn der Sprechschüler von vornherein daran gewöhnt ist, den Stoff nicht rein als solchen zu gestalten und in die leere Luft hinaus zu sprechen, sondern ihn zuhörenden Menschen darzubieten, lernt er es auch rasch, seine Redeweise auf die Art seiner jeweiligen Zuhörer abzustimmen. (S. 99)
Erich Drach illustriert seine sprecherzieherischen Grundlagen an zahlreichen Beispielen:
Damit der Satz „das Pferd ist schwarz“ als lebendig gesprochene Rede überhaupt nur denkbar werde, müssen immer ausnahmslos irgendwelche Anlässe vorausliegen, die erst erzeugen, daß der Sprecher zum Hörer sich über das betreffende Pferd und seine Farbe äußert. Einmal hat sich der Frager nach der Farbe des Tieres erkundigt und bekommt die Antwort: „das Pferd ist schwarz“. Fragt er etwa in dem dunkeln unübersichtlichen Stall, welches von den Pferden der Rappe sei, so zeigt ihm der Sprecher: „das Pferd ist schwarz“. Und wenn er daran Zweifel ausdrückt, so tönt es ihm entgegen: „das Pferd ist schwarz, ob Sie es nun glauben oder nicht“. Mit anderen Worten: beim Sprechen gibt es keine vereinzelten, voraussetzungslosen, gleichsam vom Himmel gefallenen Sätze wie in der Grammatik. Jeder Satz und jede Rede wird geboren aus einer Sprechlage. (S. 118)
Abb. 7:Titel von Erich Drach: Sprecherziehung (Frankfurt: Diesterweg 1926)
Erich Drachs Sprecherziehung geht also weit über die Stimm- und Sprechbildung hinaus. Er thematisiert gesprächsanalytische Grundlagen, insbesondere auch des Unterrichtsgesprächs (S. 134-148), die Berücksichtigung von Gestik und Mimik (S. 149-155), er entwirft eine „Leselehre“, verstanden als „Ausdruckslesen“ als das „Sinn verlebendigende Lautlesen“ (S. 156; S. 156-184), er beschreibt den Vortrag von Gedichten (S. 185-212) sowie Aspekte des chorischen Sprechens (S. 213-225).
3.4Hermann Helmers: „Mündliche Gestaltungslehre“
Hermann Helmers beruft sich in seinen Schriften auf Theodor Siebs und Erich Drach sowie auf ausgewählte Bearbeitungsphasen der antiken Rhetorik („pronuntatio“ [Betonung] und „memoria“ [Auswendiglernen]). Er verankert in seiner Didaktik der deutschen Sprache (1966/1970), der ersten maßgeblichen Didaktik nach dem Zweiten Weltkrieg, die „Sprecherziehung“ als „lautreines und gestaltetes Sprechen“ im Aufgabenfeld „Sprechen“. Helmers’ Sprecherziehung bezieht sich zum einen auf den „Unterricht im lautreinen Sprechen“ und zum anderen auf die „Lehre der mündlichen Darstellungsarten“ (S. 113). Seine didaktischen Ansätze zur gesprochenen Sprache sind sprachsystematisch und schränken die Mündlichkeit auf die Sprechnormierung ein. Es geht Helmers vor allem um ein „differenziertes Sprechverhalten“ (S. 124) bzw. um die Behebung „artikulatorischer Schwächen“ und die Beseitigung von „Fehler-Ecken“ (S. 126). Lediglich für den Bereich des gestalteten Sprechens („mündliche Gestaltungslehre“, S. 132-135) werden von Hermann Helmers unter Rückgriff auf die antike Rhetorik Gesprächs- und Diskussionsformen aufgelistet und kurz erläutert. Grundsätzlich ist aber alles der Sprecherziehung untergeordnet, so soll z. B. die „Lesung […] der Sprecherziehung dienen“ (S. 128). Durch Helmers’ Konzept der Sprecherziehung wurde die Didaktik der Mündlichkeit – im Gegensatz etwa zum Konzept der Sprecherziehung von Erich Drach (1922/1949) – einseitig auf den normativen Aspekt des lautreinen Sprechens reduziert.
3.5Erika Essen: „Erziehung zur Gesprächsgemeinschaft“
Abb. 8: Dr. Erika Essen (1914-1986), Honorarprofessorin an der Universität Marburg und Leiterin des Studienseminars für Gymnasien in Marburg
Erika Essen (1956) nimmt in ihrer Methodik des Deutschunterrichts





























