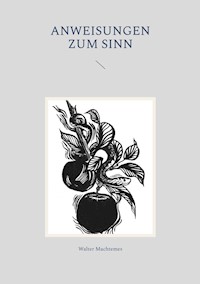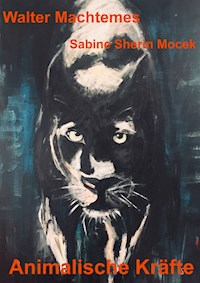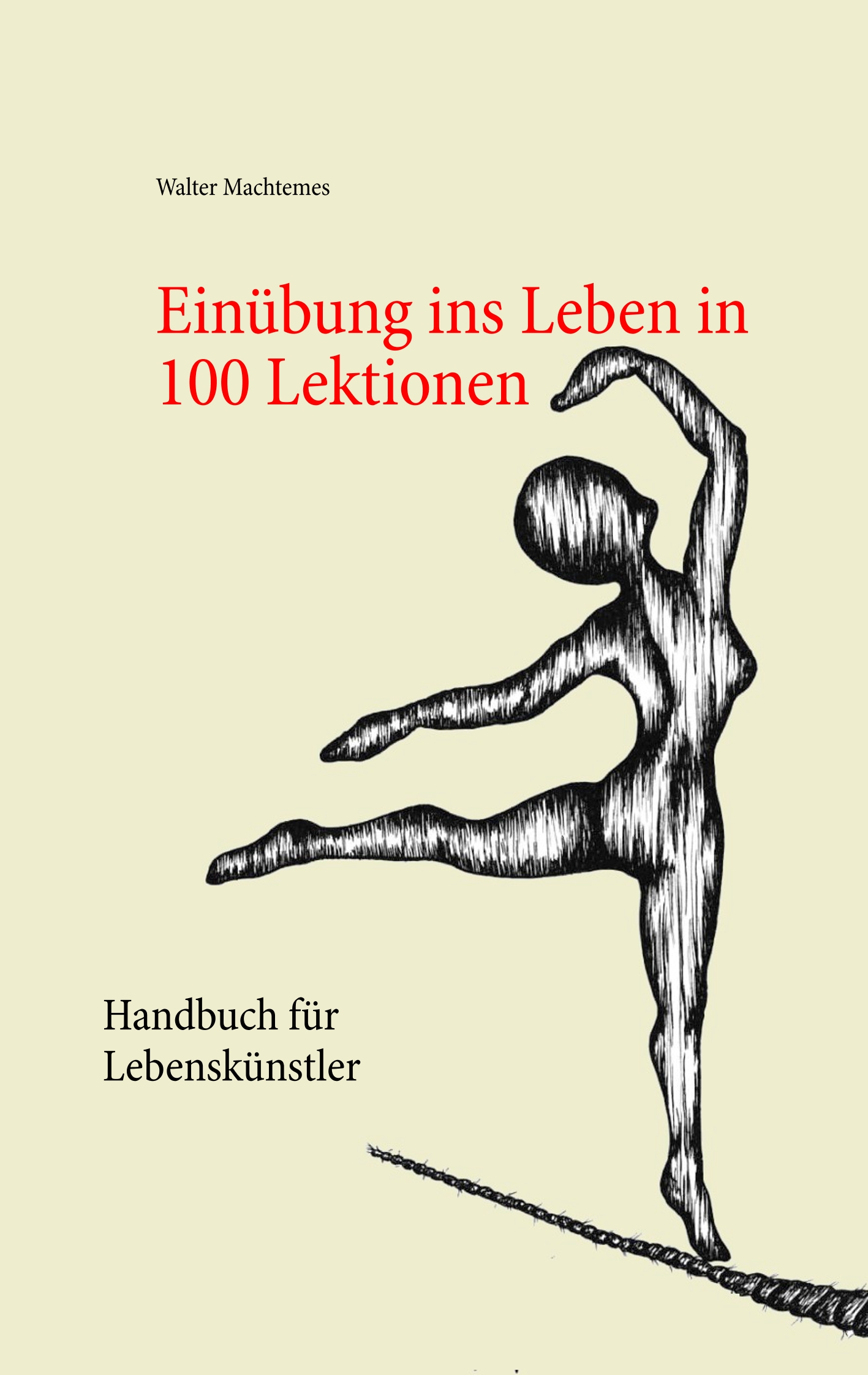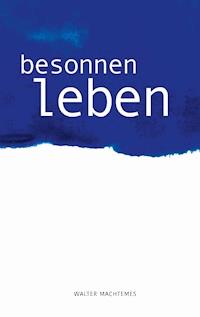Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
"Sprich, damit ich dich sehe, und höre, was ich nicht sagen will!" In dieser Form bilden die beiden Sätze ein Art Programm. Sie sind das unübertreffliche Leitmotiv für alle Versuche, die Grenzen des menschlichen Miteinanders zu überwinden für Versuche, die um die Klippen und Untiefen menschlicher Kommunikation wissen, sich aber dennoch bemühen, den Mitmenschen zu erreichen, so gut es nun einmal geht. Und hoffentlich ein wenig besser als sonst! Denn meistens, das wissen wir aus schmerzlicher Erfahrung nur allzu genau, geht es ja gar nicht gut. Dieses Nachsinnen darüber, was wirklich wichtig ist, soll im vorliegenden Buch durch achtundzwanzig Meditationen gefördert werden, die sich etliche Texte der Weltliteratur zum Gegenstand nehmen, und zwar überwiegend - aber keineswegs ausschließlich - kurze Gedichte. Im Übrigen: "Censio ergo sum". (Ich urteile, also bin ich")
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
SPRICH, DAMIT ICH DICH SEHE...
HÖRE, WAS ICH NICHT SAGEN WILL
DIE GRENZEN DER SPRACHE
MÖGLICHKEITSMENSCH WERDEN!
MICH WUNDERT, DASS ICH FRÖHLICH BIN...
PLÄDOYER FÜR DEN DIONYSISCHEN LEBENSAUFTRAG
DIE TANZENDEN STACHELSCHWEINE...
HINFÜHRUNG ZUM TITELTHEMA
DU TÄTST ES NOCH EINMAL, MEIN HERZ...
WIEDERANNÄHERUNGEN AN DIE TIEFSTE DER MENSCHLICHEN BEZIEHUNGEN: DIE LIEBE
DIE SCHÖNEN WEISSEN WOLKEN ZIEHN DAHIN...
EINSAMKEIT – JA DANKE
ÜBER DEM AUFSCHIEBEN SCHWINDET DAS LEBEN DAHIN...
VIELLEICHT BIST DU EIN CLOWN?
ES GIBT NICHTS WEICHERES ALS DAS WASSER...
TRINKT, O AUGEN, WAS DIE WIMPER HÄLT…
SCHLÄFT EIN LIED IN ALLEN DINGEN...
ÜBER DAS MASS DER DINGE HINAUS…
EILE UND MUSSE
VOM ÜBERFLUSS ZUM ÜBERDRUSS
MUSIK UND STILLE…
FÜRSPRACHE FÜR DAS WUNDERBARE
VOR MEINEM EIGNEN TOD IST MIR NICHT BANG...
GRUBENLAMPEN FÜR DEN WEG INS DUNKEL
NOCH EINMAL: DER MÖGLICHKEITSSINN
ERLEUCHTUNG – ABER WANN?
DAS LEBEN BLEIBT EIN RÄTSEL – GENIESSEN WIR ES EBEN DRUM!
WIDER DIE GEHORSAMSPFLICHT!
WIDER DEN WAFFENWAHN!
DESPOTEN DER WAHRHEIT UND IHRE GEGNER
DER DUNKLE PUNKT...
TREFFPUNKT:
GESTIRNTER HIMMEL
WAS BLEIBT...
Zum guten Start:
Zwei Einführungen
Die erste Einführung:
„SPRICH, DAMIT ICH DICH SEHE...“
von Till Bastian
Der scheinbar paradoxe Satz „Sprich, damit ich dich sehe!“ wird dem griechischen Philosophen Sokrates (469 – 399 v. d. Zeitenwende) zugeschrieben (siehe dazu auch die „Vierte Meditation“ von Walter Machtemes!). Ich schätze ihn – diesen Satz (Machtemes freilich auch!) - außerordentlich, weil er in aller Kürze deutlich macht, wie vielgestaltig jenes mühsame Geschäft ist, das wir zwischenmenschliche Kommunikation nennen; ein Geschehen, das, modern ausgedrückt, sich stets mehrkanalig vollzieht. Seit jeher brauche ich, um in einen wirklichen Dialog mit einen anderen Menschen eintreten zu können, den lebendigen Anblick dieses Gegenübers „von Angesicht zu Angesicht“, und ich hasse es, wichtige Unterredungen am Telefon durchführen zu müssen; ich kann – wie Sokrates – meinen Gesprächspartner weit besser erkennen, wenn ich ihn beim Sprechen nicht nur hören, sondern auch sehen kann.
Die zweite Aufforderung „Höre, was ich nicht sagen will“ ist deutlich jüngeren Ursprungs: Im englischen Original („Please Hear, What I’m Not Saying…“) stellt er die erste Zeile eines langen Gedichtes dar, das der amerikanische Dichter Charles C. Finn (geb. 1941) im September 1966 veröffentlicht hat.
Ich mag es, beide Aufforderungen miteinander zu kombinieren, so wie es im Titel unseres Buches geschehen ist: „Sprich, damit ich dich sehe, und höre, was ich nicht sagen will!“ In dieser Form bilden die beiden Sätze eine Art Programm. Sie sind das unübertreffliche Leitmotiv für alle Versuche, die Grenzen des menschlichen Miteinanders zu überwinden – für Versuche, die um die Klippen und Untiefen menschlicher Kommunikation wissen, sich aber dennoch bemühen, den Mitmenschen zu erreichen, so gut es nun einmal geht. Und hoffentlich ein wenig besser als sonst! Denn meistens, das wissen wir aus schmerzlicher Erfahrung nur allzu genau, geht es ja gar nicht gut.
Unsere Wünsche und Ziele, wenn wir mit anderen kommunizieren, aber auch die Probleme und Schwierigkeiten dieser Kommunikation selbstkritisch zu überdenken, ist gut – noch besser aber wäre es, diese Selbstreflexion zu ergänzen durch ein ruhiges, gelassenes Fühlen und Spüren, das uns nicht nur rational, sondern eben auch emotional deutlich werden lässt, was wirklich wichtig und wertvoll ist – und wie viel unnützer Ballast unser Leben beschwert.
Dieses Nachsinnen darüber, was wirklich wichtig ist, soll im vorliegenden Buch durch achtundzwanzig Meditationen gefördert werden, die sich etliche Texte der Weltliteratur zum Gegenstand nehmen, und zwar überwiegend - aber keineswegs ausschließlich - kurze Gedichte. Ich empfehle Leserin und Leser, sich für die Lektüre, aber auch für das sich anschließende Nachsinnen, Zeit und Ruhe in ausreichendem Maße zu gönnen. Dann, aber vermutlich nur dann, kann die Meditation im wahrsten Wortsinne zur schöpferischen Pause werden: Zum An- und Innehalten, zum Genuss einer Zeit, in der nichts geschieht und die wir nicht nutzen und verwerten, sondern in der wir uns einzig gönnen, dass sie – die Zeit und die in ihr empfangenen Eindrücke – auf uns wirken möge.
Und dazu noch ein Kommentar von Walter Machtemes
„HÖRE, WAS ICH NICHT SAGEN WILL“
Eine alte persische Weisheit lautet „Zwei Dinge sind Zeichen von Schwäche: Schweigen, wenn man reden müsste und sprechen, wenn man schweigen sollte.“
Wir dürfen darüber sinnieren, ob es einen Mittelweg zwischen dem Sagen und dem Nicht-Sagen geben kann. Sind Mitteilungen anderer Art möglich? Was erwarten wir von unseren Kommunikationspartnern und von uns selbst, wenn wir ohne Worte miteinander reden? Können wir hören, was nicht verlautet wird? Benedikt von Nursia, der Begründer des Benediktiner-Ordens verfasste ein Regularium für seine Mitbrüder, die sogenannte Magisterregel. Die Mönche sollen vor allem gemäß dreier monastischer Tugenden leben, Gehorsam, Demut und Schweigen. Benedikt soll dazu aufgefordert haben, zunächst zu hören, dann zu urteilen und erst dann zu handeln. Nur den Hörenden könne eine echte Begegnung gelingen. Dies hatte schon der griechische Philosoph und Schriftsteller Plutarch im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung festgestellt: „Der Anfang des rechten Lebens ist das rechte Hören.“
Was aber können wir unter den Phänomenen des rechten Hörens verstehen? Die akustischen Umweltsignale überfordern uns mit ihrer Fülle und ihren Aufforderungsmustern. Wir werden ständig vor die Wahl gestellt, was wir hören möchten.
Wie lassen wir das Angehörte an uns heran und wie, unter welchen Einstellungen, verarbeiten wir es?
Wie werden wir mit dem Gehörten umgehen?
Konkret geht es um drei Grundfragen:
Was wollen wir uns anhören?
Mit welcher Tatbereitschaft hören wir zu?
Welche Lebensentscheidungen treffen wir als Konsequenzen?
Das Hören dürfen wir nicht lediglich unseren Ohren überlassen. In der Benediktinerregel heißt es unter anderem „Neige das Ohr Deines Herzens.“
Der expressionistische Künstler Toni Zenz schuf die Bronze-Skulptur „Der Hörende“. Sie stellte einen Menschen dar, der mit an den Ohren angelegten Händen vergrößerte Schalltrichter formt, um besser hören zu können. Die erwartete Botschaft gelangt jedoch nicht zu den Ohren. Sie erreicht eine Herzenspforte im Thorax des Hörenden. Der mit der Skulptur Dargestellte betont die Sehnsucht des Herzens; der Hörende öffnet sich auf diese Weise mit anderen Sinnen geistig-seelischen Botschaften.
Das Hören darf nicht nur als akustischer Auftrag verstanden werden. Häufig lassen sich für das Mitzuteilende keine Begriffe finden. Der spanische Dichter Federico Garcia Lorca stellte dementsprechend fest:
„Es gibt Dinge, die man nicht sagen kann, weil es keine Worte gibt, um sie zu sagen.“
Es gilt daher als Basis unserer Existenz, das „Unsägliche“ wieder zu berücksichtigen. In einer Zeit der Verwissenschaftlichung und der sprachlichen Verdichtung unseres Denkens sowie der Vermessung und logischen Erklärung der Welt scheint es verloren und untergegangen zu sein. Das Unsägliche stellt dabei gleichzeitig das theoretisch wie moralisch Unfassbare der Moderne dar. Wir müssen uns erreichbar zeigen für die Notleidenden und Geknechteten dieser Welt. Höre die unerhörten Schreie!
Ebenso dürfen wir die unserem vordergründigen Nützlichkeits- und Zweckdenken unterworfene Natur nicht länger missachten: Höre das Stöhnen unserer Erde!
Letztendlich signalisieren uns auch unser Körper und unsere Psyche über Störungen und Krankheiten unseren verlorenen Zugang zum gesunden Leben.
Die Aufforderung „Höre, was ich nicht sagen will!“ muss als Weckruf verstanden werden. Höre nicht auf die Stimmen und das oberflächliche Gerede der Anderen. Höre die Botschaften der mitleidenden Seele, höre auf die Sprache des Herzens. Sei mit dem, was Du sagst und feststellst anwesend in dieser Welt. Vermeide die theoretisierende Sprache der Abwesenden. Suche eine empathische Beziehung zu dem Dir existenziell Angebotenen. Erlerne die Sprache der unbedingten Zugewandtheit und der Liebe. Die Liebenden schmerzt die Distanz.
Demnach durfte Roland Barthes (Philosophie des Poststrukturalismus) behaupten, dass für die Liebe keine angemessene Sprache existiert. Dem auf sich selbst verwiesenen liebenden Menschen stünden nur sprachliche Fragmente zur Verfügung, um sich zu begreifen und sich verständlich zu äußern. In der Sprachlosigkeit des Liebenden gewinnt jedoch seine Sehnsucht an Bedeutung. Wir dürfen behaupten: die Sprachlosigkeit und die Instrumentalisierung der Sprache spiegeln die komplexe Liebeskrise unserer Zeit wieder!
„Eifrig, unermüdlich fabriziert die in mir dröhnende Sprachmaschine – sie funktioniert ja so gut! - ihre Adjektivketten. Ich decke den Anderen mit Adjektiven zu, ich enthülse seine Eigenschaften, seine Qualitas!“
(Roland Barthes: Fragmente einer Sprache der Liebe).
Die zweite Einführung:
DIE GRENZEN DER SPRACHE
von Walter Machtemes
„Meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie – auf ihnen – über sie hinaus gestiegen ist. (Er muss sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinaufgestiegen ist.) Er muss diese Sätze überwinden, dann sieht er die Welt richtig.“
(Ludwig Wittgenstein: Tractatus-logico-philosophicus, 6.54)
Mit seiner bekannten Leiter-Metapher stellt Ludwig Wittgenstein die Möglichkeit infrage, die Realität mittels der menschlichen Sprache zu erfassen. Die Grenzen unserer Sprache müssten als Begrenzung unserer Welt begriffen werden.
Jacques Derrida betonte, dass bei allem alltäglichem oder wissenschaftlichem Reden das Nicht-Gesagte berücksichtigt werden müsste. Im Prozess der Dekonstruktion wird die Aufmerksamkeit auf das Ausgelassene und auf das Unbeachtete gelenkt. Mit jedem Urteil müsste das Gegenteil mit in die Betrachtung einbezogen werden. Deutung und Bedeutung müssten demnach immer offen gehalten werden für das Anderssein. Derrida plädiert konsequent für die Dekonstruktion. Es sei letztendlich unmöglich, über das jeweilige zeitliche Erleben hinaus Sinn zu vermitteln.
Worüber können und dürfen wir dann noch sinnvoll sprechen?
Erscheint es nicht logischer, hinsichtlich des Nichtsagbaren zu schweigen? Verhalten diejenigen sich vernünftig, die sich klugerweise nicht äußern?
Bedeutet dann das Nichtreden Zustimmung oder Ablehnung, oder die sich selbst zurücknehmende Indifferenz?
Hier sei jeweils die erschließende Frage erlaubt, welche symbolische Aussage mit dem Schweigen getroffen werden soll. Nicht selten vermitteln die Schweigenden und das Ungesagte mehr Denk- und Handlungsanstöße als die ausgesprochenen Worte und Sätze. Schon Pythagoras hatte festgestellt, man solle schweigen, oder Dinge sagen, die noch besser sind als das Schweigen.
Die besseren Sätze könnten in dem Fall die sein, die uns „auf die Spur“ zu uns und zum richtig oder falsch verstandenen Selbstauftrag führen. Es gilt also, mit oder jenseits der Sprache, auf Spurensuche zu gehen.
Ernst Bloch unternahm mit den ihm eigenen 90 Sinn-Geschichten diesen Versuch:
„Kurz, es ist gut, auch fabelnd zu denken... Es ist ein Spurenlesen kreuz und quer.“ Bloch fordert auf, sich sprachlich wie sinnlich einzulassen und das Merken als Ziel zu bestimmen.
Zwei dieser Gedankenanstöße seien hier beispielhaft zitiert:
„Zu wenig: man ist mit sich allein. Mit den anderen zusammen sind es die meisten auch ohne sich. Aus beidem muss man heraus...“
„Aber da fand einmal ein Bursche, weit von hier einen Spiegel, kannte so etwas noch gar nicht. Er hob das Glas auf, sah es an und gab es seinem Freund: 'Ich wusste nicht, dass es dir gehört.' Dem anderen gehörte das Gesicht auch nicht, obwohl es ganz hübsch war.“
Sprache, vor allem symbolisch genutzt, führt uns zunächst heraus aus der scheinbaren Unbegreiflichkeit der Welt. Sie fordert uns auf zu einem ständigen Dialog, zur Unterredung, zur Meditation und dazu, uns zwischen den Worten selbst mit uns einzurichten. Auch wenn vieles nicht gesagt werden kann, so kann es doch an-gedacht werden.
Walter Benjamin gebrauchte für diesen uns fordernden Lebensanspruch den Begriff der Montage, „sowohl als philosophischen Auftrag als auch als praktischen Impuls, das Diffuse mittels der Sprache zusammenzufügen zu Denkbildern.“
Wir können nicht davon ausgehen, mit logischen Konstrukten die Welt zu erobern. Am Anfang und am Ende unserer Sinnsuche steht jedoch das Wort: „Am Ende ist das Wort, immer am Ende das Wort.“ (Hilde Domin).
Und dazu noch ein Kommentar von Till Bastian
„MÖGLICHKEITSMENSCH WERDEN!“
In der Wiener Rasumofsky-Gasse 34/11 im III. Bezirk wohnte nach dem Ersten Weltkrieg eine Zeitlang auch der heute sehr berühmte, oben von Walter Machtemes bereits zitierte Philosoph Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951), der damals soeben den eigenen Anteil am sehr beträchtlichen Vermögen seines Vaters verschenkt und eine Ausbildung zum Volksschullehrer begonnen hatte. Und ein anderer Bewohner dieses Hauses war der bekannte Dichter Robert Musil (1880 – 1942), fast zehn Jahre älter als sein Nachbar.
Nur auf etwas mehr als drei Seiten bemisst sich das berühmte vierte Kapitel in Musils Monumentalopus „Der Mann ohne Eigenschaften“, dessen erstes und zweites Buch – der Roman ist unvollendet geblieben – zusammen immerhin 990 Seiten zählen! Der Protagonist der Handlung, Ulrich, ist das, was der Verfasser einen „Möglichkeitsmenschen“ nennt: „Solche Möglichkeitsmenschen leben, wie man sagt, in einem feineren Gespinst, in einem Gespinst von Dunst, Einbildung, Träumerei und Konjunktiven; Kinder, die diesen Hang haben, treibt man ihn nachdrücklich aus und nennt solche Menschen vor ihnen Phantasten, Träumer, Schwächlinge und Besserwisser oder Krittler“. Ulrich erweist sich erstmals als ein solcher echter Möglichkeitsmensch, als er in während seiner Schulzeit einem Aufsatz schreibt, dass wohl auch Gott von seiner Welt am liebsten im Konjunktiv spreche – „denn Gott macht die Welt und denkt dabei, es könnte ebensogut anders sein. – Er war sehr stolz auf diesen Satz gewesen, aber er hatte sich vielleicht nicht verständlich genug ausgedrückt, denn es entstand große Aufregung darüber, und man hätte ihn beinahe aus der Schule entfernt...“ (Ebenda, S. 22).
Es ist eine große Versuchung für meinen ganz persönlichen Möglichkeitssinn, mir vorzustellen, diese beiden Männer könnten einander im Haus oder auf der Gasse davor begegnet sein, ja sich vielleicht sogar in ein Gespräch über Wirklichkeit, Möglichkeit und den „anderen Zustand“ vertieft haben... Eine derartige Phantasie ist nicht völlig abwegig, denn Einiges, was wir in Wittgensteins in jenen Tagen noch nicht veröffentlichtem „Tractatus logico-philosophicus“ lesen können, gemahnt stark an Musils anno 1921 ebenfalls noch nicht gedruckte Gedanken, vor allem der kurze, gerade eben 47 Zeilen zählende Absatz 6.5 am Ende des „Tractatus“, in dem es unter anderen heißt: „Die Lösung des Problems des Lebens merkt man am Verschwinden dieses Problems“ – und er beendet seine Betrachtungen dann mit dem berühmten Satz 7: „Wovon man nicht sprechen kann, davon muss man schweigen“. Lernen wir also von den Nachbarn Musil und Wittgenstein, versuchen wir, „Möglichkeitsmenschen“ zu werden und trainieren wir unseren entsprechenden Sinn – das vorliegende Buch gibt hierfür, so möchte ich hoffen, eine Menge Anregungen!
Die erste Meditation
Von Till Bastian
„MICH WUNDERT, DASS ICH FRÖHLICH BIN...“
„Ich lebe und weiß nicht, wie lang,
Ich sterbe und weiß nicht, wann,
Ich fahre und weiß nicht, wohin,
Mich wundert, dass ich fröhlich bin...“
Dieses vierzeilige Gedicht – irrtümlich als ein Grabspruch bezeichnet, zudem einem „Magister Martinus von Biberach“ und dem Jahr 1498 zugeschrieben (ob dem wirklich so sein mag, ist jedoch nicht sicher bezeugt!) – fasst in seiner lakonischen Kürze und in seinem klaren Bekenntnis zu jener Ungewissheit, die unser Leben von der Wiege bis zur Bahre prägt, das Grunddilemma der menschlichen Existenz eindrucksvoll zusammen. Wir wissen nicht, woher wir kommen und wohin wir gehen – aber anders als die anderen Tiere, die weder die Angst vor dem Tod noch Lebensüberdruss oder Weltschmerz kennen, sind wir von Natur aus mit einem „Innenleben“ ausgestattet, das uns eben jene Ungewissheit immer wieder neu und oft quälend vor Augen führt. Man mag es „Seele“ nennen: eine Innenwelt, die uns nicht selten dazu nötigt, über all das Ungewisse ringsum nachzugrübeln, wenn nicht gar an ihm zu verzweifeln.
Mit dieser schweren Hypothek belastet sind wir ins Dasein geworfen worden. Die Entwicklung des Lebens auf dieser Erde hat mit unserer Spezies, hat mit „Homo sapiens“ allem Anschein nach ein recht eigentümliches Wesen hervorgebracht. Schon dadurch, dass er sich selbst als „weise“ („sapiens“) klassifiziert, erweist sich „Homo“, der Mensch als ein Wesen, das befähigt ist, über die Entwicklung der Biosphäre – und damit auch über seine eigene Geschichte – mit beträchtlichem Scharfsinn nachzudenken. Durch unser Denkvermögen können wir freilich auch die Zwiespältigkeit dieser Evolution des Lebens erkennen: Jede Errungenschaft hat ihren Preis, für jeden Fortschritt muss auch bezahlt werden. Mit einem Nervensystem, das zu immer feineren Reaktionen in der Lage ist, kommt der Schmerz in die Welt. Und weiter: Mit der Fähigkeit der zentralen Instanz in diesem Nervensystem, Vorsorge für die Zukunft zu treffen (und dafür höchst erfolgreich die eigene Umwelt zu manipulieren), geht die Angst einher, gepaart mit der Sorge was diese Zukunft an Nöten und Schmerzen für uns bereithalten mag (ich komme andernorts darauf zurück!). Dieses Unbehagen an der Zukunft mag bisweilen in tiefe Verzweiflung münden. Aber eine solche Verzweiflung ist kein unentrinnbares Schicksal; ihr Gegenpol ist die Fröhlichkeit, zu der wir trotz aller bedrängenden Ungewissheit durchaus begabt sind. Diese Begabung erschien dem Dichter des Mittelalters zwar recht verwunderlich; dennoch hat er an ihr nicht gezweifelt.
Einerseits also quälende Ungewissheit, andererseits staunenswerte Fröhlichkeit - so alt wie die Geschichte der Menschheit ist auch die Geschichte ihrer Versuche, diesem Dilemma zu entfliehen, doch sie waren trotz ihrer großen Vielfalt samt und sonders zum Scheitern verurteilt. Mit einem solchen Scheitern aller „Lösungen“ müssen wir uns, wie es scheint, wohl abfinden, und da dem so ist, mag es uns eine erhebliche Erleichterung bringen, wenn wir uns zu dieser Selbstbescheidung endlich einmal frei bekennen können. Unser innerer Zwiespalt endet erst, wenn unser zwiespältiges Leben endet; so lange wir noch am Leben teilnehmen, sollten wir nicht versuchen, diesem eine Eindeutigkeit abzutrotzen, die es nun einmal nicht besitzt und seinem ureigensten Wesen nach wohl auch nicht besitzen kann. Der Wunsch nach Eindeutigkeit macht alles nur noch schlimmer – insbesondere dann, wenn wir sie herbeizuzwingen trachten. Gerade der Verzicht auf den Wunsch nach Eindeutigkeit macht es uns möglich, unbefangen, ja fröhlich im Ozean des Lebens dahinzutreiben.
In diesem Meer der Ungewissheit gibt es also durchaus Inseln des Frohsinns. Sie mögen klein sein und die Zeit, die wir auf ihnen verbringen können, knapp bemessen – aber es gibt sie nun einmal, und sie sind keineswegs unzugänglich.
Unsere wundersame Fähigkeit zum Fröhlichsein speist sich – so weit ich das sehen kann – aus zwei bedeutsamen Quellen, deren Wasser oft ineinander fließen: Erstens das Spiel, das sozusagen eine Wendung der Phantasie nach außen darstellt und aus dem auch höhere Formen des Spielens wie Kreativität und Kunst hervorgehen; zweitens das Miteinander, die mitmenschliche Gemeinsamkeit. Denn der Mensch ist ein Gemeinschaftstier, dessen innere Natur ihn zur Zusammenkunft mit anderen drängt; alle Einzelgängerei ist sekundär, ist reaktiv, ist eine Konsequenz erlittener Enttäuschungen und anderer bedrängender Erfahrungen.
Eine der Hochformen der fröhlichen Gemeinsamkeit in ihrer kreativen Ausgestaltung ist die Musik: Sie wurde von den Menschenhorden der Steinzeit schon vor Zigtausenden von Jahren geübt, wie eine 2008 in einer Höhle auf der Schwäbischen Alb gefundene, rund 40.000 Jahre alte Flöte beweist. Das Neue von ihr ist die von den Gegenständen sehr weit abgelöste, völlig eigenständige Sprache – die „Tonsprache“ eben.
Ein Musikstück, das wie kaum ein zweites den Zusammenhang von Melancholie und Frohsinn verdeutlicht, ist der Dritte Satz von Beethovens berühmter Neunter Symphonie, der dem letzten Satz mit seinem Hymnus unter dem Leitmotiv „Freude, schöner Götterfunken“ unmittelbar vorausgeht und uns mit musikalischen Mitteln fühlen lässt, dass jener Götterfunke einer wirklichen Freude sich immer nur am Erlebnis unserer bedrängenden Lebensnot entzünden lässt: ohne ein Empfinden für diese Not ist auch die Freude nicht zu haben (eine kurze Anmerkung hierzu findet sich im Anhang zu diesem Buch!). Nur, wer sich zuvor aufs offene Meer hinausgewagt hat, darf hoffen, eine idyllische Insel betreten zu können.
Auch in der Phantasie lassen sich solche Reisen auf die Inseln des Frohsinns unternehmen. Solche aktiv betriebene Imagination ist etwas ganz anderes als die in der Umgangssprache oft vorschnell abgewertete „Einbildung“ („Was du dir bloß wieder eingebildet hast...!“). Sie stärkt unseren bereits erwähnten Möglichkeitssinn, und Möglichkeiten gehören auch zur Realität, und zwar auch dann, wenn sie quasi unentdeckt in ihr schlummern. Und gerade diese Entdeckung neuer Möglichkeiten ist einer der wichtigsten Wege zur Umgestaltung der Realität, wo immer nötig. Es ist deshalb töricht, die Phantasie als Mittel der Flucht aus der Realität zu diskriminieren – auch, wenn sie ohne Zweifel immer wieder zu diesem Zweck missbraucht worden ist. Aber dieser Missbrauch sollte uns nicht an ihr zweifeln lassen. Im Gegenteil – er sollte uns zu einem besseren Gebrauch der aktiven Imagination verleiten!