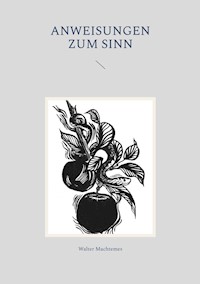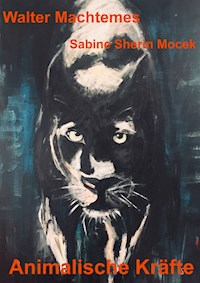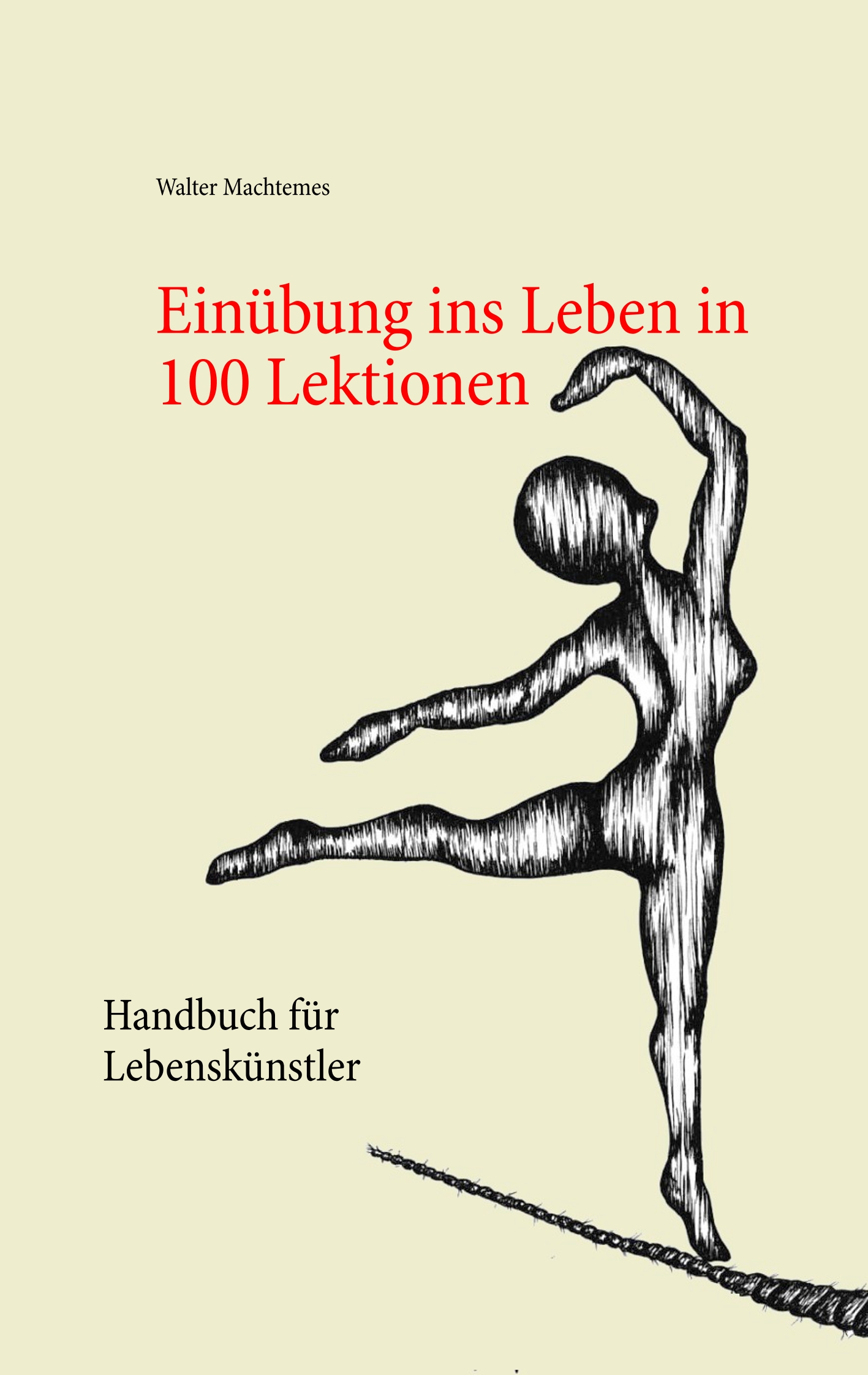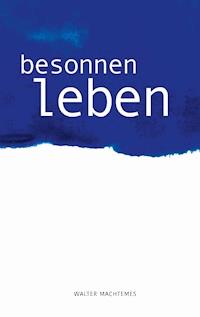Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wer ist Energon? Energon schildert seine persönliche Geschichte über philosophische Betrachtungen seiner einzelnen Lebensphasen. Er erwacht zum Leben, erfährt auf besondere Art sein Kindsein, ist immer in Bewegung, stellt sich allen neuen Herausforderungen deutend und mit einem unbedingten Willen. Er entwickelt Sinnbilder, nähert sich mehr und mehr seiner Erfüllung an und erlebt schließlich sein nahendes Ende als verlockenden Anfang. Energon fragt, erlebt und interpretiert auf faszinierende Weise anders und intensiver. Er lebt in und mit einem umfassenden Vertrauen zum Dasein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 84
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prof. Dr. Dr. Walter Machtemes
Walter Machtemes ist Arzt, Philosoph und Soziologe. Er hat langjährige Erfahrung in der klinischen und ambulanten Psychiatrie und Psychotherapie, in der Erwachsenenbildung sowie als Hochschullehrer und ist Autor zahlreicher Bücher und wissenschaftlicher Veröffentlichungen. Sein Denken und sein Handeln sind geprägt durch viele Aufenthalte in asiatischen Ländern. Seinen Arbeitsschwerpunkt findet er bei den suchenden Menschen, die sich selbst und ihre körperliche, seelische und soziale Sicherheit (vorübergehend) verloren haben. Er will mit den Leidenden ("Patienten") hinter die Fassaden des Alltags schauen, gemeinsam mit ihnen Konflikte lösen und helfen, Gleichgewicht wieder herzustellen.
"Jeder Zustand der Seele und des Körpers besitzt einen hintergründigen Sinn, den wir begreifen und beachten müssen. Behandlung beginnt mit dem Verstehen und endet mit der Veränderung."
Mit Zeichnungen von Walter Machtemes
Inhaltsverzeichnis
Einstimmung
Erwachen
Geboren werden
Erfahrungen des Kindseins
Immer in Bewegung
Deuten und Wollen
Einsamkeit
Absurde Welt
Sinn-Bilder
Selbstannäherung
Hier ist ein Mensch
Die drei Prinzipien
Das Ende als Anfang
Nachrede
Einstimmung
Gesprochene und geschriebene Worte bedeuten mehr als nur eine Aneinanderreihung von Lauten oder Zeichen. Sie stellen den – letztendlich notwendig vergeblichen - Versuch dar, die umfassende Wahrheit der Welt und der eigenen Person zu begreifen und zum Ausdruck zu bringen. In der Dichtung 'verdichtet' der Mensch Raum, Zeit und Grund zu einer für ihn verständlichen Sinnhaftigkeit. Die Sprache schafft die Verbindung vom innersten Fühlen zum äußersten Wollen. Die Fähigkeit, sich in Ihr mitzuteilen schenkt eine intensivere Beziehung zum Gegebenen.
Der eher theoretische Begriff 'Wortschatz' kann daher durchaus wörtlich verstanden werden. Worte erschließen prachtvolle Räume und ungeahnte Phantasmen des Daseins. Wer sie zu nutzen, zu sprechen und zu lesen weiß, lebt in einer anderen Welt. Leser, Zuhörer und Erzähler entwerfen gemeinsam eine Lebenswelt ihrer Träume. Fühlen und Streben, subjektive Wahr-"nehmung" und Deutung, Besinnung und Versenkung gipfeln im Wort.
In kaum einer anderen Gattung der Literatur wird dies so deutlich wie im Märchen. Seit ewigen Zeiten suchen Menschen in mythischen, phantastischen und märchenhaften Erzählungen die Befriedigung ihres Lebens-Bedürfnisses nach (Er-)Klärung und (Er-)Füllung der Existenz.
Helden, die sie selbst nie waren und nie sein werden, kämpfen für sie ein siegreiches Gefecht für Gerechtigkeit und Freiheit.
Glückskinder weisen den Weg und dringen vor zum verborgenen Quell des Daseinssinns.
Seher und Weise führen als Stellvertreter der Fragenden Dialoge mit den Göttern und zitieren Prinzipien des Seins.
Für die Stunden der märchenhaften Versenkung weichen Ernst, Rationalität und Realismus einem Rausch des spielerischen Erlebens. Vorstellungskraft, Sprachfülle und Handlungsklugheit ergänzen einander zu einer umfassenden Kreativität des Welt- und Selbstentwurfs.
Ein besseres, schöneres und vollkommeneres Ich wächst auf einem fruchtbareren Boden der Wirklichkeitserfassung.
Die Sprache des Märchens gewinnt damit die Bedeutung eines Pharmakons. Der Heilsuchende öffnet sich und überantwortet sich vielfältigen Wirkungen, die das Zusammenspiel seiner Kräfte verändern können. Er findet eine andere Form des Gleichgewichts und stellt sich auf einer anderen Ebene den Herausforderungen des Willens in ihm und außerhalb seiner selbst.
Leider macht der sprachliche Rahmen der meisten, uns seit Kindertagen bekannten Märchen, deren – für uns nur scheinbare! – Unvereinbarkeit mit der wahren Welt der Erwachsenen deutlich.
Sie beginnen mit den Worten "Es war einmal ... und enden mit der eher resignativen Feststellung "und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute".
Diese Erzählungen weisen den Leser beziehungsweise den Zuhörer unmissverständlich darauf hin, dass es sich um abgeschlossene Ereignisse der Vergangenheit handelt. Die Kraft dieser Tapferen und Gescheiten, Feinfühligen und Lebensmächtigen ist erloschen, denn mit der Realität ist ein Überwinden des Todes nicht vereinbar.
Für unser Märchen haben wir daher einen anderen Anfang gewählt. Die Formulierung "Es wurde einmal ..." berücksichtigt und unterstreicht die prozesshafte Entwicklung der Wirklichkeit. Sie vermittelt die Hoffnung, dass ein vergleichbares Werden jeden erfassen kann, der sich einlässt auf Umstände und Zustände seines Lebens, die denen der Hauptgestalt des Märchens durchaus vergleichbar sein können.
Auch das Ende lässt vielfache Perspektiven offen. Das Werden ist seinem Wesen nach gegenstandslos.
Es ruht in der Tiefe jedes belebten und unbelebten 'Dings', Seine Entdeckung und Entwicklung wird zur je persönlichen Aufgabe. Denn 'Werden' stirbt und endet nicht.
Doch wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen, sondern es dem Leser überlassen, unsere geschaffene und seine tatsächliche Wirklichkeit mitzuentwickeln.
Erwachen
Es wurde einmal ein Mensch. Der Raum, in dem er sich vorfand, dahin-geworfen wie ein Stein, der ins Wasser nicht mehr als einige wenige Kreise schreibt, erschien ihm merkwürdig fremd und – parodoxerweise – doch unsagbar vertraut. Die vollkommene Dunkelheit umhüllte ihn wie eine Schäfchenwolke am gestirnlosen Himmel. Weich und sanft fühlte er sich getragen und aufgehoben, einem Zustand entgegengeführt, über den er nichts wusste.
Die Wärme, die nicht ihm gehörte, die aber doch für ihn da war, spürte er als seine Kraft. Die äußerlich erfassbare Winzigkeit seiner Erscheinung stand In keinem Verhältnis zur Mannigfaltigkeit des Möglichen, die er in sich fühlte und zur in ihm angelegten, absolut einmaligen Menschlichkeit. Seinen drängenden Lebenswillen in sich selbst erfasste er daher sehr viel früher als die Gesamtheit seiner Gestalt.
Er pulsierte, vibrierte, öffnete und schloss ohne wissentliche oder willentliche Entscheidung Wege und Bahnen in seinem kleinen Körper. Er sollte sein – das konnte er in allen diesen Vorgängen erkennen, die er als noch unbekanntes Harmoniestreben in jeder einzelnen Körperzelle wahrnahm.
Diese eigentümliche Fremdheit der eigenen Lebendigkeit verwirrte ihn. Verwirrung, dies war überhaupt sein erstes Lebensgefühl, lange bevor sein Bewusstsein erste zaghafte Versuche startete, sich selbst zu begreifen. Er fühlte sich lebendig und doch ungeboren, unfassbar klein, aber in jedem Mikrometer organischer' Substanz überlebensmächtig; er lebte zu zunehmender Bewegungslosigkeit in der Enge verurteilt und doch schien alles in ihm in Gang gesetzt zu werden. Was wollte er und wer war er? Gab es etwas außer diesem spürbaren Drängen, das was ihn ausmachte? Einen Augenblick hielt er in seinem Wachstums-prozess inne, um zu ordnen. Er versuchte nicht zu verstehen, wohl aber seine eigene Unordnung als zusätzliche Kraft für sich selbst zu nutzen.
Er beschloss ein Fragenderzu werden. Neben den Antrieb von innen wollte er die Faszi – nation vor und in der Welt setzen, neben dem Willen zum Leben – sollte der Wille zum Wissen ihn in seinem Dasein tragen.
Damit war er, ohne sich bewusst damit auseinandergesetzt zu haben, einen ersten frühen Schritt nach vorn zur Beantwortung der Grundfrage nach sich selbst gegangen. Er wusste nicht, aber er spürte, wer und was er war: persongebundene, strömende, überfließende Lebensstärke, die unaufhaltsam wachsen wollte, Vor allem anderen erfasste er sich als in sich begründete Energie. Dies sollte, so beschloss er, auch sein Name zum Ausdruck bringen. Er wollte " Energon " heißen, die sich selbst als Werk begehrende, beginnende, gestaltende und vollendende Kraft. Einerlei wie seine Eltern ihn später nennen sollten, er würde sich damit nicht angesprochen fühlen.
Er, Energon, war mehr als eine durch eine Namensbezeichnung ausgrenzbare Lebenseinheit. Er spürte in sich männliche und weibliche Lebenszüge heranreifen und er wusste wohl, dass die Natur sowie noch mehr die Menschen, mit denen er leben sollte, ihn zwingen würden, sich definitiv zu entscheiden.
Energon aber wollte weder zur männlichen Heldenhaftigkeit noch zu lieblicher Weiblichkeit erwachsen. Er schob alle Rollenbilder und Vorurteile weit von sich und verstand es, die noch spürbare Unentschiedenheit seines Daseins zu genießen. Sich nicht festgelegt, als Werden zu begreifen, erfüllte ihn mit einem Gefühl der Größe, Ganzheit und Unversehrtheit.
Hier fasste Energon einen weiteren tiefgreifenden Lebensentschluss; Er wollte nicht abschätzbar, nicht kalkulierbar, nicht festlegbar sein. Eines seiner Lebensideale sollte die weitgehende Wahrung seiner Möglichkeit darstellen. Er wollte immer wieder aufs Neue und in jeweils anderer Weise existieren können. Schranken und Grenzen würde er so lange umdeuten, bis er sie als selbstgesetzte Markierungspunkte verstehen und hinnehmen konnte.
Energon würde fließen wie der Quell, der sich mit unendlicher Geduld und Ausdauer schließlich s e in e n Weg auch im härtesten Gestein sucht. Seinen Lauf würde er selbst bestimmen mit jener kaum begreiflichen, letztlich weltverändernden Leichtigkeit seines Wesens.
Alles auf ihn Einwirkende würde er als bloße Herausforderung wahrnehmen und ihm nichts anderes entgegenstellen als seine strömende, werdende und wachsende Gelassenheit. In eben dieser Gelassenheit hatte er sich mit dem ersten Moment des Lebens gefunden, in ihr wollte er bleiben, solange es ihm möglich war.
Wenn er sich selbst übergeben und anvertrauen konnte, dies spürte Energon, so würde niemand willentlich gewaltvolle Veränderungen an ihm erreichen können. Was der Andere auch entscheiden wollte, es würde schließlich in ihm und dadurch in sich selbst ruhen. Niemand anderer könnte den Triumph auskosten, Energons Dasein entscheidend bestimmt zu haben, außer der Kraft, die ihn selbst sein ließ.
Auf diese Weise fand Energon zu seinem dritten bedeutenden Vorsatz: Sein Leben sollte getragen sein von Vertrauen, Ruhe, Gelassenheit und Treue zum in sich selbst waltenden Sinn.
Als er jetzt um sich schaute, empfand er eine gewisse Genugtuung sowie eine eigenartige Lebensbereitschaft. Ja, er, Energon, hatte schon vor seiner offiziellen Anerkennung als Person, schon vor seiner Geburt zu sich selbst eine tiefe Lebensbeziehung aufgenommen, die er nicht wieder aufgeben würde. Er nahm sehr früh wahr, wie und was er war und in welcher Weise er sich selbst erschließen konnte. Alles war letztlich ihm selbst überlassen und ihm als Summe unzähliger Lebensschritte aufgegeben.
Energon musste nichts weiter tun als 'Ja' zu dieser Aufgabe und damit zu sich selbst zu sagen. Denn daran gab es keinen Zweifel: Er spürte, dass alles in ihm leben wollte und dass alles um ihn herum auf sein Leben und Überleben abgestimmt war.
Das über Energon rhythmisch schlagende mütterliche Herz schlug für ihn. Die Lungen atmeten für ihn den lebensnotwendigen Sauerstoff. Die Nieren schieden für ihn die schädigenden Stoffwechselprodukte aus, um ihn heil und unversehrt zu erhalten,
Welchen Grund sollte es geben, alle diese "Dienstleistungen" zu verweigern?
Geboren werden
Der Drang, den Energon in sich spürte, schien übermächtig zu sein. Wie sollte er all diese Trieb- und Tatkraft soweit kanalisieren, dass er nicht zu früh, als körperlich kaum überlebensfähiges Wesen, sein menschliches Leben beginnen würde? Ein inneres Wollen stieß ihn weiter und weiter. In seinem kleinen Körper tobten zwei Kräfte in wildem Kampf gegeneinander. 'Es' und 'Ich' stellten unvereinbare Forderungen.