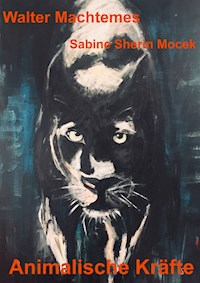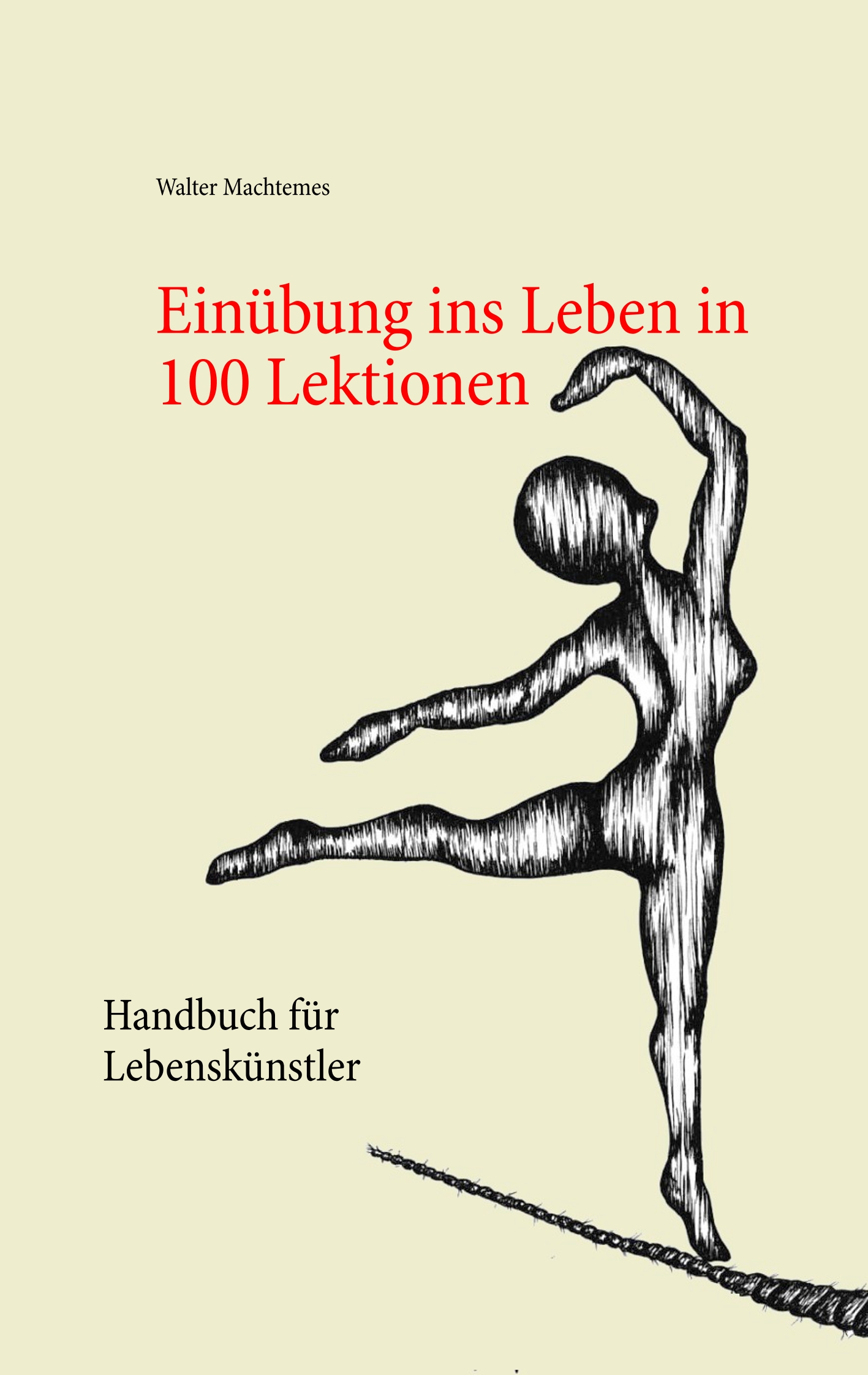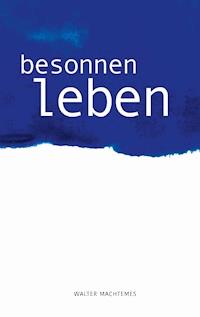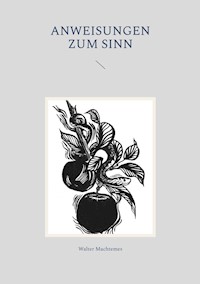
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Mit 50 Impulstexten und ebensovielen Meditationen sollen die Leser*innen angeregt werden, eigene Wege der Sinnsuche und Sinnreflexion zu finden.
Das E-Book Anweisungen zum Sinn wird angeboten von und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sinn des Lebens, Meditation, Zeitkritik
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Persönliches
Prof. Dr. Dr. Walter Machtemes
Walter Machtemes ist Arzt, Philosoph und Soziologe. Er hat langjährige Erfahrung in der klinischen und ambulanten Psychiatrie und Psychotherapie, in der Erwachsenenbildung sowie als Hochschullehrer und ist Autor zahlreicher Bücher und wissenschaftlicher Veröffentlichungen. Sein Denken und sein Handeln sind geprägt durch viele Aufenthalte in asiatischen Ländern. Seinen Arbeitsschwerpunkt findet er bei den suchenden Menschen, die sich selbst und ihre körperliche, seelische und soziale Sicherheit (vorübergehend) verloren haben. Er will mit den Leidenden ("Patienten") hinter die Fassaden des Alltags schauen, gemeinsam mit ihnen Konflikte lösen und helfen, Gleichgewicht wieder herzustellen.
"Jeder Zustand der Seele und des Körpers besitzt einen hintergründigen Sinn, den wir begreifen und beachten müssen. Behandlung beginnt mit dem Verstehen und endet mit der Veränderung."
Illustrationen: Anna Wikarek
Inhalt
SINN-DIALOGE MIT DIR (VORWORT)
ZEITBEWUSST
SINN-HERAUSFORDERUNGEN
PERSPEKTIVISCH GESEHEN …
WAHRHEIT(EN)
WAHRNEHMUNG ODER WAHR-NEHMEN
ZWEIFEL ERLAUBT
SINN SETZT UN-SINN VORAUS
GIBT ES MICH?
ENTSCHIEDEN ODER UNENTSCHIEDEN
LEBEN
VOM EINKLANG MIT DER WIRKLICHKEIT
HERGEBEN ODER BEHALTEN
SICH GEHALTEN WISSEN
FINDE DICH VOR
SICHERHEIT UND GEWISSHEIT
DU BIST MÖGLICH
ROUTINEN UND KONVENTIONEN
DAS PASSENDE TUN
HOFFNUNG UND ZUVERSICHT
BAUMEISTER
AM ANFANG WAR DAS WORT
GÄRTNER/IN GESUCHT
ALTRUISMUS VERSUS EGOISMUS?
BEGIB DICH AUF AUGENHÖHE
AUTHENTIZITÄT: MIT SICH EINS SEIN
SELBSTVERLIEBT?
BARMHERZIGKEIT
WOCHE DER NEUGIERDE
BIST DU NOCH GANZ NORMAL?
FREI-RÄUME
DARUM ÄNGSTIGT EUCH (NICHT?)
ZEHN BEZIEHUNGSANGEBOTE
DAS PASSENDE TUN
SELBSTANNAHMEN
DISKURS ÜBER DIE GIER
VORSTELLUNGSBILDER
EHRFURCHT ALS LEBENSPRINZIP
APPELLE
EINIGKEITSERLEBEN
NACHTRUHE
EINSAM MIT MIR
ICH HABE RECHT:
ENDZEIT ODER WENDEZEIT
LIEBE BRAUCHT ORDNUNG
FREI ODER PROGRAMMIERT?
SAG HÄUFIGER EINMAL STOPP
ICH WÜNSCHE DIR EINEN GESUNDEN 4-S-STATUS:
DANN VIEL VERG(E)NÜGEN!
GUT ODER NICHT GUT?
AUF ZUR FRÖHLICHEN REGRESSION
GUTMENSCHEN UND BÖSEWICHTE
REFORMATIONSZEIT
NACHDENKLICHES ÜBER DEN ABSCHIED
PROVOKATIV-KONSTRUKTIV
PLÄDOYER FÜR DIE SEELSORGE
VOLLKOMMEN STUMM
REFLEXIONEN ÜBER DAS ABSOLUTE
GLÜCK JENSEITS DER TORE
SCHULDIG PER EXISTENZ?
AUßER RAND UND BAND
SEHNSUCHT ALS EXISTENZIAL
ZUM ENTWURF FREIGEGEBEN
SELBST-ERKENNTNISSE
SCHÄTZE DAS „PFLEGLICHE“
SPIELE DER MENSCHEN
ANGST VOR DIR SELBST?
TRÄUME MAL DARÜBER NACH!
CHIFFREN DES SEINS
TRÖSTE DICH SELBST
DEKONNEKTION
DAS BEWAHREN
SCHÖN, DASS DU DA BIST!
DIE ERWECKENDE LIEBE
BERUFSBILD „CEO“
DIE KRISE DER MODERNE
HYPERMOTIVATION
ÜBER DIE SOUVERÄNITÄT DES BETRACHTERS
GESCHENKE DER ERINNERUNG
ÜBER EMOTIONALE UND SPIRITUELLE BINDUNGSBEDÜRFNISSE
GEZEITEN
ROUTINEN UND KONVENTIONEN
LASST UNS SIMPELN!
SEELENVERWANDTSCHAFT UND FREUNDSCHAFT
ES TUT GUT!
WOHLWOLLEN UND GÜTE
VORSÄTZE
VOM NUTZEN DES ALTRUISMUS
ICH BIN DA!
ERSCHAFFE DICH SELBST!
MEHR GELASSENHEIT BITTE
VOM TUGENDHAFTEN LEBEN
WOCHE DES FROHSINNS
REFLEXIONEN ÜBER DAS EWIGE LEBEN
SOLLEN ODER WOLLEN?
DISKURS ÜBER DAS ABSURDE
DEFINITIONEN
ÜBER DIE LIEBE ZUR NOTWENDIGKEIT
VOM RICHTIGEN SEIN
DER IMPERATIV DES LEBENS
GEFALLEN WOLLEN
BEKENNTNISSE
ENDE ODER ÜBERGANG
Sinn-Dialoge mit Dir (Vorwort)
Absichtserklärung
„Ich nehme ihn, der mir zuhört, an die Hand und führe ihn zum Fenster. Ich stoße das Fenster auf und zeige hinaus. Ich habe keine Lehre, aber ich führe ein Gespräch.“ (Martin Buber)
Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber (1878 – 1956) propagierte das unbedingte Postulat des Dialogischen. Erkenntnis und Sinnerfahrung wären nur in der tatsächlichen oder imaginären Begegnung zwischen sowie mit Anderen wahrhaft möglich. Die Vereinzelung distanziert und liefert den Menschen manipulativen Ideen und Kräften aus. Der Dialog fordert Selbstpräsentation und Verantwortlichkeit.
Wir leben in einer Zeit der Anonymisierung, der Massenphänomene und des Abschiebens von Zuständigkeit. Martin Buber betonte die soziale und die individuelle Offenheit in der authentischen Begegnung. Echte Verantwortung müsste dann wörtlich verstanden werden als „wirkliches Antworten“ auf das, was uns täglich widerfährt, auf das, was wir oft unreflektiert geschehen und zulassen.
Wir sind es gewohnt, in Ich-Es-Beziehungen zu denken, zu arbeiten und zu leben („es ist, wie es ist …“). Wir verschaffen uns auf diese Weise einen rationalen Zugang zur Welt. Dinge und Mitmenschen stellen sich als jeweils empirisch reduzierte Objekte der Erkenntnis dar.
Die Ich-Du-Beziehung vermittelt Nähe, Beachtung und einen gemeinsamen Sinn-Raum. Alles Wirkliche muss als Begegnung verstanden werden. Im Dialog wird das Unerschlossene angehbar.
Auch die Philosophen der sogenannten Frankfurter Schule (Horkheimer, Adorno, Habermas u.a.) vertraten ein kommunikatives Verständnis der Erkenntnis. Sie forderten den offenen Diskurs, die stets aktuelle Aussprache und die vorurteilsfreie Verständigung auf das jeweils Wahre. Jürgen Habermas verlieh dem Diskurs die Bedeutung eines „Schauplatzes kommunikativer Rationalität“. Die für den Dialog offene Vernunft vermittele auf diese Weise zeitlich und sachlich begrenzte intersubjektive Weisheiten.
Schon Aristoteles verstand Rhetorik als Fähigkeit, in der Argumentation das Überzeugende zu erkennen, das jeder Sache innewohnt. Er unterschied drei sogenannte Überzeugungsmittel, den Charakter des Redners, die Emotionen des Publikums und das Argument (Ethos-Pathos-Logos).
In der Gesprächsführung des Sokrates spielt der Dialog eine zentrale Rolle. Die Gesprächsteilnehmer werden über offene Fragen in den Erörterungsprozess einbezogen und in keiner Weise belehrt. Die Eigenständigkeit, die selbständige Reflexion und die Entscheidungsfähigkeit jedes Einzelnen werden gefordert beziehungsweise gefördert. Sokrates verglich seine Art und Weise der kommunikativen Argumentation mit der Hebammenkunst (Maieutik). Er helfe den Seelen bei der Geburt ihrer Einsichten wie die Hebamme den Müttern bei der Geburt ihrer Kinder. Er vermittele nicht anderen Menschen seine Erkenntnisse und sein Wissen. Er behandele sie, als wenn sie gleichsam schwanger seien und die Geburt einer Einsicht unmittelbar bevorstehe.
Der Begriff „Dialog“ kann aus dem Griechischen übersetzt werden mit „offene Unterredung“, im übertragenen Sinne als „Fließen von Worten und Gedanken“. In den folgenden Texten wird der Dialog gleichgesetzt mit dem Zwiegespräch. Dein Gesprächspartner fordert Dich heraus, Dich mit Deinen Gedanken und Ansichten zu unterschiedlichen Themen einzubringen. Einer der in diesem Zusammenhang wichtigsten Grundsätze lautet: „Zweisichten sind besser als Einsichten“. Interessierte Sinnsuchende sollen angesprochen und zu einem erweiterten imaginären Explorationsgespräch eingeladen und aufgefordert werden.
Der gemeinsame Auftrag besteht dann in der Eröffnung konstruktiver Dialoge. Wir leben in einer Zeit der kollektiven Verunsicherung und der zunehmenden Entfremdung. Kirchen und andere sinnstiftende Institutionen müssen sich zunehmenden Glaubwürdigkeitskrisen stellen. Wahrheiten dürfen und können nicht nur theoretisch begründet und/oder verkündet werden. Sie sollten nicht als Ideologien verpackt geliefert werden. Sie können vielmehr aus der Begegnung von Menschen in der jeweiligen Gegenwartserfahrung abgeleitet werden.
Es gibt keine objektiven, ohne die Ansicht, Einsicht, hier: Zweisicht existierenden Wahrheiten. Sie dürfen niemals unhinterfragt festgelegt werden, sondern sind stets zur Disputation freizugeben.
Wir möchten mit Dir imaginative Sinn-Dialoge führen, Dir mit unterschiedlichen Fragen deutlich machen, dass es sich lohnt, eigene Antworten zu suchen zu existenziellen Grundfragen. Wir hoffen, dass Du Dich einlassen wirst, unsere Impulse aufnehmen und auf deine reflektierte Weise Stellung nehmen wirst. Vielleicht wirst Du auch Deine Auffassungen schriftlich oder mündlich zur Disposition stellen wollen. Erfahre Dich in diesem Fall aufgefordert, Deine realen Gesprächspartner zu suchen und zu Sinn-Dialogen herauszufordern.
Zeitbewusst
Betrachte die Zeit als dir unentgeltlich zur Verfügung gestellte Gabe. Sie hat keinen objektivierbaren Anfang und kein absolutes Ende.
Gehörst du zu der Berufsgruppe der „Ich-habe-keine-Zeit-Spezialisten“?
Dir werden täglich 24 Stunden geschenkt.
Wisse sie zu nutzen. Genieße immer wieder einmal Aus- und Ruhezeiten, ebenso das unendliche Angebot an Erfahrungs- und Sinnmomenten.
Bedenke: Jeder deiner Tage besteht aus 86.400 Sekunden Lebenszeit.
Sinn-Herausforderungen
„Denken wir diesen Gedanken in seiner furchtbarsten Form: das Dasein, so wie es ist, ohne Sinn und Ziel, aber unvermeidlich wiederkehrend, ohne ein Finale ins Nichts: ‚die ewige Wiederkehr‘. Das ist die extremste Form des Nihilismus (das ‚Sinnlose‘) ewig!“ (Friedrich Nietzsche)
Hand aufs Herz, was hast du Nietzsches sinnvernichtender These entgegenzusetzen? Welche Antwort(en) findest du selbst auf die zentrale existenzielle Herausforderung in deinem Leben? Kannst und willst du dich dir selbst stellen? Schon Sokrates formulierte in seiner Verteidigungsrede (Apologie) eben diese Antwort: „Ein Leben ohne Selbstprüfung verdient nicht gelebt zu werden.“ Wo also sollten wir mit der Selbstprüfung beginnen? Nehmen wir den Anfang jedes individuellen Lebens zum Ausgangspunkt, dann muss die Frage nach dem Sinn der je eigenen Geburt beantwortet werden. Wäre die Welt ohne dich auf irgendeine Weise ärmer? Du solltest entschieden „Ja“ sagen, auch wenn du als Narziss gescholten werden solltest. Es geht um „deine Welt“, die du dir mit deinen Anschauungen, mit deiner Energie und mit deinen Taten schaffst, in der du eine wichtige Position einnimmst und in der man dich vermissen würde. Frage deine Eltern, wie sie deine Geburt und dich als Geschenk erfahren haben.
Wählen wir den Endpunkt eines jeden Lebensprozesses dürfen wir nach unserem gelebten Sinn und nach unserer (Er)Lebensfülle fragen. Die Buddhisten beschreiben einen achtfachen Pfad auf dem Weg zur Selbsterweckung. Sinnstiftend seien das rechte Glauben, das rechte Denken, das rechte Sprechen, das rechte Tun, das rechte Leben, das rechte Streben, die rechte Konzentration und das recht sich Versenken. „Kein anderer Pfad wie dieser ist’s, der zur Erkenntnisreinheit führt.“ (Buddha). Willst du dich prüfen? Was ist für dich das Rechte?
Du wirst den Zugang zu deinem rechten Weg finden, wenn du zur Sinnfindung deine Sinne zu nutzen weißt. Alle deine Sinne ermöglichen dir Tiefenerfahrungen, wenn du achtsam, besonnen und kontemplativ zu leben verstehst. Wenn du deine Aufmerksamkeit und deinen Blick „richten“ kannst, wirst du Ordnungen erkennen, übergeordnete Ideen oder immanente Gesetze. Aristoteles beurteilte das betrachtende Leben als höchste Fähigkeit des Menschen und als Wirken eines göttlichen Elements.
Sinn wird nicht überzeitlich und überindividuell definierbar und vorgebbar sondern nur in der eigenen Existenz erfahrbar sein. Ludwig Feuerbach kritisierte die falschen Versprechungen vieler Religionen, Sinnantworten nicht im Leben sondern erst nach dem Tod zu finden. „Verliert nicht das Leben gerade durch das Jenseits, in dem es erst einen Sinn finden soll, allen Sinn, allen Zweck?“
Sinn wird überall und jederzeit gefordert. Wir wollen nichts Sinnloses tun. Wir wollen nicht sinnentleert unser Leben einfach ableben. Der Logotherapeut Viktor Frankl konnte daher zu Recht behaupten: „Der Mensch kann seinem Leben prinzipiell in jeder Situation Sinn abgewinnen oder geben, solange er bei Bewusstsein ist … Was ist der Mensch? Er ist ein Wesen, das immer entscheidet was er ist.“ Sinn ist somit sowohl im gelingenden, wie im scheiternden Leben erfahrbar, im Glück wie im Leiden. Im wahrsten Wortverständnis öffnen Sinnerleben und Sinndeutung die Sinne. Den Sinn verloren zu haben oder als verloren zu erklären, gilt als Aufforderung zum Umdenken und zur Umdeutung. Die existenzielle Krise fordert heraus zur erduldenden Akzeptanz, zur Reattribuierung beziehungsweise zum kognitiven Neubenennen von Lebensregeln, zur Neubewertung sowie zu grundlegenden Änderungen von Überzeugungen, Anschauungen und Zielsetzungen.
Menschen sind sinnentwerfende Wesen. Sie vermögen sich mittels ihrer Vernunft von Instinkten und Triebsteuerungen zu lösen. Sie stehen sich selbst damit stets daseinsoffen gegenüber. Existenzieller Sinn entsteht dann, wenn jeder Einzelne sich selbst annehmen, kreativ konstruieren und leben will. Der Soziologe Niklas Luhmann konnte demnach Sinn definieren als „laufendes Aktualisieren der Möglichkeiten“ jedes Menschen. Es gäbe damit kein sinnloses Erleben und keine sinnleeren Selbstentäußerungen. In jeglicher Ordnungsform menschlichen bewussten Erlebens existiere ein verborgener Sinnentwurf beziehungsweise eine existenzielle Sinnanfrage. Der Mensch müsse daher jederzeit aufgefordert werden zum subjektiven Selbst-, System- und Weltentwurf. Aus der wahrgenommenen scheinbaren Unbestimmtheit und existenziellen Unsicherheit erwächst durch den Willen zum Selbst eine jeweilige individuelle Bestimmtheit. Daher solltest du einen Begriff unbedingt aus deinem Vokabular streichen, das Wort „Unsinn“. Wir konstruieren, wenn wir bewusst leben und kommunizieren, immer Sinn. Wichtig ist hier jedoch die Unterscheidung von Sinn, Zweck und Nutzen. Sinn muss nicht notwendigerweise ein Ziel (Telos) erreichen und keinen Gewinn verheißen. Sinnvoll leben heißt zunächst nicht mehr, aber auch nicht weniger, als sich selbst mit seinen Möglichkeiten zu erschaffen und zu erhalten (griechisch: Autopoiesis).
Perspektivisch gesehen …
Das Besorgniserregende an der Zukunft ist ihre Ungewissheit!
Du weißt weder welche Leiden noch welche Glückserfahrungen auf dich zukommen werden.
Bedenke: Dir wird in jedem Falle die Chance der Gestaltung überlassen sein.
Damit wird alles Zukünftige zu deiner Möglichkeit.
Du wirst niemals ohnmächtig den Ereignissen gegenüber stehen.
Du wirst allem auf die Zukommenden deinen persönlichen Stempel aufdrücken.
Auf diese Weise wirst du niemals verlieren, alles zum Deinigen werden lassen.
Wahrheit(en)
Heinz war unser Lieblingsbusfahrer. Er begleitete uns auf vielen Seminarreisen und lenkte uns immer sicher zu unseren Zielorten. Als er anfragte, ob es auch ihm gestattet sei, an einer Vortragsreihe zum Thema Wahrheit teilzunehmen, willigten wir ohne Bedenken ein. Nach der Veranstaltung begegnete er uns sichtlich irritiert. Kopfschüttelnd kommentierte er: „Wie kann man nur stundenlang darüber nachdenken und reden, was Wahrheit ist. Wenn ihr mich fragt, dann gibt es eine einfache Antwort: Wahrheit ist, wenn einer nicht lügt.“
Philosophen und Wissenschaftler reflektierten zu allen Zeiten und an allen Orten nicht nur über Stunden, sondern über mehr als zwei Jahrtausende öffentlichkeitswirksam, was als wahr beziehungsweise was als nicht wahr, mit welcher gültigen Begründung bezeichnet werden darf.
Die politischen Entwicklungen der letzten Jahre zeigen deutlich, wie wichtig auch gegenwärtig die Beantwortung der zentralen Frage des nach sich selbst und nach seiner Rationalität forschenden Menschen ist. Ein US-Präsident, ausgestattet mit der ihm legitim zugestandenen Meinungsmacht, attackierte repetitiv von ihm ausgewählte und so bezeichnete „fake-news“ oder wurde es nicht müde, von ihm so genannte „alternative Fakten“ zu proklamieren. Wahrheit(en) wurde(n) der willkürlichen Gestaltung, Präsentation und Geltung freigegeben.
Viele Autoren kommen zu dem Schluss, dass wir im 21. Jahrhundert in einer „post-truth-era“ leben, in einem Zeitalter, in dem objektiven Fakten für die öffentliche Meinung weniger Bedeutung beigemessen wird als demagogisch erweckten Emotionen und nicht notwendig zu begründenden persönlichen Überzeugungen. Die Gesellschaft für deutsche Sprache wählte den Begriff des „Postfaktischen“ aus als Wort des Jahres 2016. Wahrheit wird damit der Beliebigkeit überlassen. Wir dürfen selbst darüber entscheiden, was wir für wahr halten und als Leitlinie für unseren Alltag festlegen wollen.
Wahrheit verlangt Verlässlichkeit, Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit und verbietet jegliche Willkür. Wir müssen uns daher fragen, ob es objektive, für alle Menschen erfassbare und ergründbare Wahrheiten gibt. Oder sind Weltgeschehen, Menschsein und Sinnantworten uns zur immerwährenden Interpretation als geistiges Konstrukt aufgegeben? Hat jeder Mensch seine eigenen Wahrheiten und seinen je eigenen Zugang zu ihnen? Gibt es Wahrheit oder Wahrheiten an sich? Oder ist Wahrheit immer nur das, was wir für wahr halten?
Der französische Schriftsteller und Literatur-Nobelpreisträger André Gide forderte auf zum dauerhaften Wahrheitsdiskurs: Glaube denen, die die Wahrheit suchen und zweifle an denen, die sie gefunden haben.“ Dies hatten schon andere vor ihm vergleichbar gesehen und bestätigt. Der römische Kaiser und Stoiker Marc Aurel stellte fest: „Alles was wir hören ist eine Meinung, keine Tatsache. Alles was wir sehen ist eine Perspektive, nicht die Wahrheit.“ Nietzsche kritisierte und verspottete die öffentlich verbreitete Wahrheit als konventionelle Lüge. Der französische Existenzialist Albert Camus schließlich bemerkte, der Mensch sei immer das Opfer seiner Wahrheiten. Was also wollen wir unter Wahrheit verstehen und als Wahrheit akzeptieren? Wir dürfen annehmen, dass diejenigen, die behaupten, sie hätten Wahrheiten exploriert und bewiesen, Aussagen formulieren, die mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Aber, lässt sich Wirklichkeit unabhängig und vollständig erfassen und prüfen? Vielleicht dürfen wir davon ausgehen, dass wir dann von wahren Erkenntnissen sprechen dürfen, wenn unsere Wahrnehmungen und Schlussfolgerungen mit anderen als wahr erkannten Aussagen verknüpft und begründet werden können. Sogenannte wahre Aussagen stützen sich jedoch dann lediglich gegenseitig. Alleinständige und für sich konsistente wahre Tatsachen werden wir nicht beschreiben können. Wenn wir die sokratische Art und Weise der Wahrheitsfindung bevorzugen wollen, sollten wir für den klassischen Wahrheitsdiskurs plädieren. Ob eine Aussage oder Feststellung wahr oder falsch ist, wird zusammen mit einer möglichst großen Gruppe Wissender oder Wahrheitssuchender erörtert und schließlich als zeitlich begrenzte stets hinterfragbare Übereinkunft festgelegt. Gibt es dann überhaupt verallgemeinerbare wahre Erkenntnisse? Letztendlich könnten wir uns mit einer Minimalismus-Theorie der Wahrheit begnügen. Wir listen eine jeweilige Sammlung von individuellen Aussagen auf. Ludwig Wittgenstein bezeichnete dementsprechend die Wirklichkeit als Sammelsurium von Tatsachen, die nicht notwendigerweise einen allumfassenden Sinn-Zusammenhang bilden. In der Folge entspräche Wahrheit keiner Struktur, die die Wirklichkeit abbildet. Sie wäre lediglich eine Erfindung der Menschen.
Einerlei von welcher Seite oder Theorie aus wir uns der Wahrheit nähern, wir können und dürfen uns der Verantwortung nicht entziehen, uns eine eigene Meinung zu bilden. Die Wahrheitssuche fordert auf zu individuellem Engagement, zu eigenen Erfahrungen und Sinndeutungen. Dabei scheint es unbedeutend zu sein, ob wir mittels mathematischer Logik oder spielerisch die Welt begreifen wollen. Wahrheit ist subjekt- und zeitgebunden. Sie fordert heraus zur Klärung, zur Aufklärung und zum Meinungsaustausch. Wahrheit lässt sich jeweils räumlich und zeitlich erschließen. Sie verbirgt sich nicht vor den Menschen, sondern wird von ihnen allzu häufig ideologisch in Programmen und Glaubenssätzen versteckt und pervertiert.
Wenn wir einander respektieren und verstehen wollen, dann werden wir uns jeweils über das austauschen können und wollen, was wir für wahr halten. Wir suchen und finden auf diese Weise einen grundlegenden Sinngehalt des Gegenwärtigen: Dies wollen wir als kommunikative Wahrheit bezeichnen.
Wahrnehmung oder wahr-nehmen
Machst du dir bewusst, wie viele Millionen Eindrücke in jedem Moment deines Lebens deiner Wahrnehmungsfähigkeit angeboten werden?
Du kannst dich auffordern, statt der oft unbewussten Wahrnehmung immer wieder einmal für einige Minuten gezielt wahrzunehmen.
Du forderst dich dann zur unbedingten Achtsamkeit auf, ohne vorherige Wertungen zu treffen.
Auf diese Weise könnte bisher Unbeachtetes eine spontane Faszination auslösen.
Du kannst deinen eigenen Wahrheiten erfahren.
Übe die Kunst des Wahrnehmens, du wirst die Welt intensiver erleben.
Zweifel erlaubt
„Das wertvollste Resultat dürfte dies sein, uns gegen unsere heutige Erkenntnis äußerst misstrauisch zu machen, dass wir ja aller Wahrscheinlichkeit nach so ziemlich am Anfang der Menschheitsgeschichte stehen und die Generationen, die uns berichtigen werden, wohl viel zahlreicher sein dürften als diejenigen, deren Erkenntnis wir – oft genug mit beträchtlicher Geringschätzung – zu berichtigen im Falle sind“ (Friedrich Engels)
Am Anfang der kognitiven Menschheitsgeschichte und über Epochen der geistigen Entwicklung hinweg konstruierten und übernahmen Menschen eine Vielzahl von Glaubenssätzen. Jegliches Bestreben ging und geht dahin, das, was wir annehmen, als Wissen zu verdichten, zu verstetigen und weiterzugeben. Jede Kultur entwickelte auf je eigene Weise und mit jeweils spezifisch begründeter inhaltlicher Gestaltung religiöse und politische Dogmen, an die man – nicht selten durch harte Strafen abgesichert – zu glauben verpflichtet wurde. Wer dies nicht akzeptieren wollte, wurde als Verräter, Systemkritiker, Ketzer oder Ungläubiger verachtet, verfolgt und verurteilt.
Die Philosophiegeschichte ist eine Geschichte der Weisheiten, nicht des Wissens. Sie begründet sich selbst durch Fragen, weniger durch Antworten. Sie fordert den stets offenen Entwurf, nicht das fertige System, den Diskurs, nicht die geistige Unterwerfung. Dies propagierten schon die Skeptiker der griechischen Antike. Arkesilaos (circa 250 v. Chr.) stellte fest, dass endgültige Urteile grundsätzlich nicht möglich seien. Seine bekannte Schlussfolgerung lautet demnach: „Nichts ist sicher, und nicht einmal das ist sicher“. Pyrrhon führte dementsprechend weiter aus, man müsse darauf verzichten, eigene Beobachtungen als für alle gültiges Wissen auszugeben. Zu allen Positionen dürfe es immer auch gegensätzliche, gut begründete Antworten geben, denen Beachtung verschafft werden müsse.
Die Wissenschaftstheorie der Gegenwart geht von eben diesen Erkenntnisvoraussetzungen aus. Wahrheit kann niemals als absolut geltend deklariert werden. Man könne niemals sicher sein, dass an einem noch nicht bekannten Ort, zu einer nicht definierten Zeit das Gegenteil der gewonnenen Erkenntnis gelte und dementsprechende Fakten dies bestätigen. Wahre Aussagen besitzen daher immer nur so lange Gültigkeit bis sie widerlegt werden können. „Wir sind alle nur vorläufig. Wir müssen unsere Auffassung immer wieder revidieren“ (Hans Albert). Wissenschaftlich arbeiten bedeutet demnach, sowohl die Bestätigung eigener Hypothesen zu erfahren als auch die Widersprüche aufzudecken. Wissen fasst lediglich für eine begrenzte Zeit geltende Annahmen und Glaubenssätze zusammen.
Häufig beherrscht der Glaube die Erkenntnis, insbesondere dann, wenn er als sogenannte höhere Einsicht ausgegeben wird. Herrschende Ideologien und Systeme vermitteln dann scheinbare Gewissheiten sowie überhistorische und universelle Antworten auf die existenziellen Grundfragen der Menschen. Diese kann und darf es jedoch nicht geben, da jeder Kraft seiner geistigen Fähigkeiten und entsprechend seiner Sinnes- und Sinnerfahrungen in der Lage ist, eigene Auffassungen und Positionen zu entwickeln. Dies betonte schon der chinesische Philosoph und Dichter Zhuang Zhou (circa 300 v.Chr.). In einer Epoche geistiger und politischer Unruhen in China, in der sogenannten „Zeit der hundert Schulen“, stellte er fest: „Es ist derjenige am weitesten von der Wahrheit entfernt, der auf alles eine Antwort weiß“. Karl Marx soll sein Leben und seine Forschung unter eine vergleichbare Maxime gestellt haben: „De omnibus dubitandum“, an allem ist zu zweifeln. Marx soll, ausgehend von den Berichten seiner Biografen, seiner Tochter Jenny diesen Satz als „Lieblingsmotto“ in ihr Poesiealbum geschrieben haben.
Der bekannteste Zweifler der neueren westlichen Philosophiegeschichte ist der als Begründer des neuzeitlichen Rationalismus geltende René Descartes. Er nahm die frühen Positionen des methodischen Zweifels systematisch wieder auf. Alles ist solange und so gründlich zu hinterfragen, bis zumindest zeitlich begrenzt ein nur vermeintliches Wissen ausgeschlossen, beziehungsweise minimiert werden kann. Der methodische Zweifel basiert auf einer wesentlich tiefergreifenden Verunsicherung des Menschen, auf dem existenziellen Zweifel. Montaigne zog sich schon im Alter von 38 Jahren in den Turm des väterlichen Schlosses zurück. Er musste erfahren, „dass der Geist, vom Müßiggang verwirrt, zum ruhelosen Irrlicht wird.“ Spätestens mit dieser Erfahrung wird die Notwendigkeit persönlich verbindlicher Glaubenssätze deutlich. Skeptizismus und Zweifel zerstören Scheinwissen und Dogmatismus. Menschen aller Epochen und Kulturen erleben sich jedoch der dauerhaften Herausforderung ausgesetzt, individuelle Sinnantworten zu finden und zu formulieren. Der Glaube an sich selbst und an die Nicht-Zufälligkeit allen Geschehens will und soll methodisch untermauert werden. Zweifel, Skepsis, Glaube und Wissen gehören untrennbar zueinander.
Sinn setzt Un-Sinn voraus
Das ist doch alles unsinnig.
Hörst du häufiger diesen Satz?
Musst du ihn wiederholt selbst formulieren?
Bravo! Prüfe deinen und unseren Alltag.
Hinterfrage immer wieder einmal Vorgaben, Regeln und soziale Gebote.
Willst du fremd- oder selbstgestaltet leben?
Wenn du keine konkrete Antwort auf die Frage nach deinem oder gar nach dem Sinn deines oder des Lebens findest, wird das eher die übliche Erfahrung sein.
Nähere dich daher deinem Sinn an durch das Bewusstwerden und das Aussortieren des Überflüssigen, des nicht zu dir Gehörigen.
Was bleibt?
Filtere deinen Sinn aus!
Verzichte auf das Überflüssige.
Gibt es mich?
„Es gibt nichts Unsinniges auf der Welt, wenn du es mit Bewusstsein erfüllst.“ (Zen-Weisheit)
Im Jahr 2005 erhielt der Cartoonist Hans Traxler den Auftrag, am Frankfurter Mainufer ein Ich-Denkmal zu errichten. Er ließ lediglich einen Betonsockel gießen, zu dem mehrere Stufen hinaufführten, für jeden frei zu besteigen. Auf der Stirnseite war in goldenen Lettern das Wort „Ich“ zu lesen. Viele Besucher des „Kunstwerks für alle“ nutzten die Chance, sich selbst in Position zu bringen. Die jeweils gewählte Haltung und die Gestaltung waren niemals beliebig. Sie ließen in der Regel grundlegende Deutungen zu, die Selbstsinnsetzung und Selbstausrichtung der Einzelnen betreffend.
Das Ich eines jeden Menschen bietet ihm jeweils engere oder weitere Gestaltungsmöglichkeiten. Deshalb bleibt die Beantwortung der Frage, wer, was oder wie das Ich erfassbar, beschreibbar und individuell (er)lebbar ist, eine überhistorisch zentrale Herausforderung der Menschheit. Dabei gibt es unendliche Wahlmöglichkeiten, die zum gefälligen Gebrauch zur Verfügung stehen. Daher konnte der indische Mystiker Kabir behaupten: „Ich lache, wenn ich höre, dass den Fisch dürstet im Wasser.“
Jedoch, die Skeptiker zweifeln. Zwei Jahrtausende galt es als unwidersprochen wahr, dass jeder Mensch ein ihm eigenes Ich besitzt. Nicht wenige Philosophen der Neuzeit stellten dies infrage, so Baruch de Spinoza oder David Hume. Ernst Mach behauptete, dass kein von der Außenwelt trennbares Ich existiere. Mit der Wende zum Rationalismus hatten Descartes, Kant oder Fichte deutlich als Fürsprecher eines solitären Ichs Stellung bezogen. René Descartes formulierte sein bekanntes „cogito ergo sum“, ich denke also bin ich. Immanuel Kant ernannte und ermächtigte das Ich zum Schöpfer seiner eigenen Welt. Das Wahrgenommene sei lediglich geformt und überformt durch den menschlichen Sinnesapparat, durch seinen Verstand und durch seine Vernunft abbildbar. Nicht die Welt erschaffe das Ich, sondern das Ich gestalte seine Welt. Johann Gottlieb Fichte postulierte, dass es keine Trennung von individuellem und absolutem Ich geben könnte. Das Ich würde sich selbst setzen und immer es selbst bleiben. Das „Ich bin“ bliebe damit immer eine Tathandlung.
Nietzsche griff diesen Gedanken auf seine Weise auf. Dem Menschen wäre die lebendige Selbstgestaltung dauerhaft aufgegeben. Er bliebe demnach ständig aufgefordert und herausgefordert, sich selbst zu finden und zu leben. Seine Selbstbegründung könnte er nur schöpfen aus dem in ihm drängenden Lebenswillen. „Werde fort und fort der Lehrer und Bildner deiner selbst … Wir aber wollen die werden, die wir sind, die Neuen, die Einmaligen, die Unvergleichbaren, die Sich-Selber-Gesetzgebenden. Die Sich-Selber-Schaffenden!“
Jean Paul Sartre fand keinen irgend möglichen kognitiven Zugang des fragenden Menschen zu sich selbst. Das Ich könne sich rein formal-logisch nicht neutral selbst als Objekt zum Thema machen. Allein über die Wahrnehmung durch die Anderen könnte das Ich für eine begrenzte Zeit erblickt und festgelegt werden. Die meisten Soziologen teilen hier Sartres Urteil. Erving Goffman setzt das Ich der ständigen interaktiven Bestimmung aus. Es gäbe dementsprechend kein überdauerndes personales Ich. Der Mensch agiere in allen Handlungsfeldern als Schauspieler beziehungsweise als Dramaturg. Er bringe sich in unterschiedlichen Rollen mit jeweils selbst- oder fremd- verordneten Drehbüchern auf die Bühnen des alltäglichen Lebens. George Herbert Mead unterschied das autonome, individuelle Ich (englisch: „I“) vom geformten und präsentierten fremddefinierten „man“ (englisch: „me“). Das sich nach Normen, Regeln und vorgegebenen Handlungsmustern verhaltende Ich dominiere den Menschen dabei eindeutig. Der Mensch der Gegenwart ist ein Rollenspieler, ein „homo sociologicus“, ein Menschenbildner, der täglich sein „Ich-Make-Up“ aufträgt, die gebotene modische Garderobe trägt und sich „normal“ verhält.
Wer ichbetont leben möchte, sollte sich herausgefordert sehen, Normalität zu hinterfragen. Das Urteil „Du bist doch nicht normal“ darf dann als Lob und Anerkennung des Eigenen interpretiert werden. Siegmund Freud beschrieb in seiner Strukturlehre das Ich als bipolar den erlernten Regeln, Normen und Kontrollen des Überichs und den Triebsteuerungen des Es ausgeliefert. Es müsse sich ständigen Regulationsaufgaben stellen. Es müsse Beziehungen und die Realität dauerhaft überprüfen und schaffe es immer nur über begrenzte Zeiträume und differenzierte Abwehrprozesse Autonomie zu erreichen und zu bewahren. In den unterschiedlichen psychischen Störungen und Erkrankungen würden sich jeweils defizitäre oder verfehlte Ich-Entwicklungen abbilden.