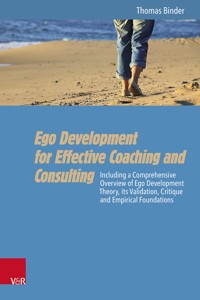Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elster Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Da sind der Lastwagenfahrer, dem sein Renommierbedürfnis zum Verhängnis wird; der nierenkranke Lyriker, der aus seinem Elend Kapital zu schlagen sucht; der versponnene Biologe, der sich überall missverstanden fühlt, und schliesslich der Urgrossvater, der nach dem Tod sei- ner Frau mit den fünf Kindern nicht mehr zurechtkommt – alle geraten sie ins Abseits, und sie alle sind eine Zeitlang Teil des Alltags des Archivars Theo Link. Link lebt in gesicherter Stellung im Archiv einer grösseren Stadt; er ist nicht frei von der Angst, auch einmal zu versagen. Gerade deshalb fühlt er sich solchen Existenzen in Sympathie und Anteilnahme verbunden. Thomas Binder hat einen Roman des Zürcher Lebens geschrieben. Wie in Kurt Guggenheims Zürcher Epochenroman «Alles in allem» agieren Binders Protagonisten in den Zwängen ihrer Zeit, auf der Suche nach ihrem persönlichen Glück. Der Archivar beobachtet sie: Er greift nicht ein, sondern nimmt wahr, und indem er notiert, schafft er ein Protokoll des Wandels und des Alltagsgefühls des 21. Jahrhunderts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 449
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas BinderSpuren im Abseits
Thomas Binder
Spuren im Abseits
Theo Links Annäherungen
Roman
© 2016 by Elster Verlagsbuchhandlung AG, Zürich
Alle Rechte vorbehalten
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Dadurch begründete Rechte, insbesondere der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Vervielfältigungen des Werkes oder von Teilen des Werkes sind auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie sind grundsätzlich vergütungspflichtig.
Elster Verlagsbuchhandlung AG
Hofackerstrasse 13, CH 8032 Zürich
Telefon 0041 (0)44 385 55 10, Fax 0041 (0)44 385 55 19
www.elsterverlag.ch
ISBN 978-3-906065-47-2
eISBN 978-3-906903-98-9
Umschlagabbildung Hannes Binder, Zürich
Umschlag: Alex Werth nach einem Konzept der dreh gmbh, Zürich Gesetzt aus der Adobe Garamond 10.5/13.5 LW 5
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Inhalt
Annäherung eins: Füglistaller
Annäherung zwei: Goldbacher
Annäherung drei: Kuno
Annäherung vier: Johann
Annäherung eins:Füglistaller
1
Der Archivar freute sich beim Salzen und Einwickeln der Kaninchenfiletstückchen in die Speckscheiben, freute sich beim Würfeln der Zucchetti, beim Mais-Abmessen für die Polenta, freute sich darauf, Nina die Fortsetzung erzählen zu können. Sie hatte heute ihren langen Tag und um sechs zudem noch eine Sitzung. Er erwartete sie nicht vor acht Uhr.
Drei Wochen war das jetzt her: Da hatte er mit ihr – überhaupt zum ersten Mal mit jemandem – über den Fall gesprochen. Nur bruchstückhaft war die Erinnerung beim Erzählen wieder in ihm aufgestiegen. Dreissig Jahre hatten sich darüber abgelagert. Nur eine leicht sumpfige Stelle war zurückgeblieben in seinem Gedächtnis. Plötzlich wurde das Versunkene durch Ninas neugierige und doch verständnisvolle Fragen wieder aufgerührt. Sie hätte auch Psychotherapeutin werden können, fand er manchmal. Mit einem Therapeuten pflegte man allerdings nicht zu dinieren, erst recht nicht in der dunkel getäferten historischen Gaststube des Hotels «Gotthard» in Hospental wie sie beide vor gut drei Wochen. Durchs offene Fenster waren Windstösse gedrungen, bis sie es schlossen. Und dann hörten sie den Abkühlung bringenden Regen niederprasseln.
Er sah ihre Ankunft beim Hotel wieder vor sich an jenem Samstag Abend. Vorsichtig wendete er die im Öl brutzelnden Coniglio-Stücke. Es war ein heisser Aufstieg gewesen. Beide waren sie ziemlich verschwitzt, als Nina erfreut ausrief: «Das ist es!»
Sie wies mit ihren zusammengeschobenen Leichtmetallstöcken auf das grosse, weisse Haus bei der Brücke am Dorfeingang. Auf dem goldenen Schild stand «Gasthaus Gotthard». Die Fassade schien frisch renoviert. Grau auf weissem Grund waren reich verzierte Fensterumrandungen gemalt – und eine Inschrift: «Quartier des Generalissimus Suworow am 24. September 1799.» Schon wieder der.
Aber nicht das hatte den Archivar irritiert, sondern das Haus selbst. Es kam ihm bekannt vor, ganz anders als auf dem Bild im Internet, das ihm Nina vor einigen Tagen gezeigt hatte. Irgendeine unangenehme Geschichte war damit verbunden. Er fühlte einen leichten Widerstand, es überhaupt zu betreten. Aber schon fielen die ersten Tropfen. Und überhaupt: Es war doch ein schönes, historisches Haus. Und sie hatten sich einen gemütlichen Abend verdient.
Er gab nun die Zucchetti-Würfel ins Olivenöl. Zuvor hatte er etwas Knoblauch darin gedünstet. Die Wanderung vom Urner Loch über Andermatt, der jungen Reuss entlang durchs Urserental bis Hospental hatte etwas für die Schöllenen entschädigt, trotz der schwülen Hitze, trotz der Kaserne, die Erinnerungen weckte. Die Schöllenen hatte ihre Werbewirkung als «wildromantische Schlucht» nicht wirklich entfalten können, vor allem nicht bei Nina. Teufelsbrücke und Suworow-Denkmal kamen nicht auf gegen Lärm und Gestank. Nicht nur die zwei Fussgänger auf ihrem Pfad, auch unzählige Autos in den lärmverstärkenden Galerien zwängten sich, oft dicht daneben, empor, und ausserdem die Zahnradbahn. Und all die Bildungsassoziationen, die sie sich von Göschenen an aufzählten, hatten das Getöse noch verstärkt: die sagenhafte Ziege als erste Passantin der epochalen Brücke; der Generalissimus Suworow im Kampf mit Napoleons Truppen, der gemäss Fresko an der Felswand ebenfalls auf der Teufelsbrücke stattgefunden hatte; dann der Tausendsassa Goethe, vom Gotthard nach Süden hinüberblikkend; Alfred Escher, Louis Favre und die Gotthardbahn, die dem einen beinah, dem anderen ganz über den Kopf gewachsen war; der höhenkranke Ernst Zahn in Göschenen; der schwermütige Hermann Burger mit dem Traum von der Rückkehr in den Gotthard-Mutterleib und so weiter.
Er schaute auf die Uhr: noch eine Viertelstunde. Er rührte in der Polenta. Es war Zeit, die Tomatensauce bereit zu machen. Er stellte das Sieb mit den Salatblättern beiseite.
Kaum waren sie aufgetaucht aus dem Urner Loch und hatten die grüne Hochebene des Urserentals überblickt, rechts begrenzt von kahlen, aus Geröll aufsteigenden Felswänden, die einen Horizont voller Zacken bildeten – Gendarmen, wie ihm plötzlich einfiel –, sah er sich wieder als frisch Promovierten in der Uniform eines Sanitätssoldaten. Gleich links lag das Kasernenareal. Im Weitergehen erzählte er Nina: Wegen der Prüfungen hatte er damals, vor mehr als dreissig Jahren, um Verschiebung seines jährlichen WKs ersucht. Und absolvierte den Dienst dann im Militärspital Andermatt. Während neben ihnen die Reuss sprudelte, ringsum Geläut von Kuhglokken, drängte sich stockend ein Sanitätserlebnis in ihm empor. Eines Morgens hatte er mit dem Berufspfleger in der Ambulanz als Beifahrer losbrausen müssen, die Schöllenen hinunter, nach Amsteg oder so, wo sie aus einem Wohnblock eine ohnmächtige Angina-pectoris-Patientin hatten heruntertragen müssen.
Er fühlte sich seltsam. Hatte er Nina jemals Militärerlebnisse erzählt? Die lagen zum grossen Teil vor ihrer Zeit und sollten dort versenkt bleiben, vor allem auch diese Ambulanzfahrt. Sie war ihm einmal im Traum und verschiedentlich im Halbschlaf wieder erschienen, wenn er sich irgendwelche Unterlassungen vorwarf.
Er hob den Deckel von der Bratpfanne. Goss etwas Weisswein über die Kaninchenstücke, die nur noch auf kleinem Feuer brutzelten. Hätte er den Tod jener Frau verhindern können, wenn er etwas geschickter mit dem ihm unbekannten Sauerstoffgerät in der Ambulanz umgegangen wäre? Ach was. Die war schon tot gewesen, als sie sie auf der Bahre in die Ambulanz schoben. Angina pectoris: er hatte später darüber nachgelesen. Sauerstoff war wichtig. Aber sie hatte sich schon nicht mehr gerührt, als sie in die Wohnung kamen. Das Bild der wachsbleichen, korpulenten Frau hatte er nie ganz vergessen. Er wunderte sich, dass Nina nicht lachte über seine Militäranekdote, sondern Anteil nahm. Über der Hochebene war Bewölkung aufgezogen. Der Wiesenweg führte um einen grünen Hügel herum. Zwei gut getarnte Pforten verrieten: Der Hügel hatte einst zur Befestigung gehört, war womöglich Teil des Réduit-Konzepts gewesen.
Er streute von der italienischen Gewürzmischung auf die gehackten Tomatenstücke, die er aus einer Dose in die kleine Pfanne geschüttet hatte. Seltsam, dass das zweite Andermatter Erlebnis ganz ohne Traumechos in ihm versunken war, bis es vor drei Wochen in Hospental wieder auftauchte.
Er schaute auf die Uhr. Gleich würde sie kommen. Also schüttete er die Tomatensauce in die Coniglio-Pfanne und gab die gewaschenen Salatblätter aus dem Sieb in die Schüssel. Nachdenklich den Kopf wiegend, trug er die Teller auf den Gartentisch vor der Küchentür, um draussen zu decken.
War er noch derselbe wie damals? Nur zum Teil. Sein damaliges Lebensgefühl war ihm wieder gegenwärtiger, seit er das Tagebuch jenes Jahrs gefunden und darin gelesen hatte. Sehr gemischt hatte er sich gefühlt.
Erleichtert war er gewesen, dass er alle Prüfungen hinter sich gebracht hatte, stolz natürlich auch, ohne es sich recht einzugestehen. Er war jetzt Doktor, aber sehr unsicher, wie er sich nun durchs Erwachsenenleben schlagen und wo er endlich ein regelmässiges und sicheres Auskommen finden würde. Entsprechend unsicher bewegte er sich unter den Kameraden und Vorgesetzten in Andermatt. In manchem fühlte er sich ihnen unterlegen.
Er schob das Zuchettipfännchen von der Platte. Auch das zweite Erlebnis betraf ja einen Todesfall. Der hatte sich aber ganz ausserhalb seiner Wahrnehmung ereignet. Nur Vermutungen darüber hatten ihn bedrängt. Dass er sie für sich behalten hatte, darin erkannte er sich wieder. Wer war er denn schon gewesen damals, noch vor seinem eigentlichen Berufsleben stehend? Er grinste vor sich hin, stand wieder in der Küche, rührte in der Polenta. Wer war er denn jetzt, wenige Jahre vor der Pensionierung? Seine unmassgeblichen Vermutungen hatte er leicht vergessen können und mit ihnen den Todesfall. Ein einziger Mensch wusste, ob an seinen damaligen Vermutungen etwas dran gewesen war, oder vielmehr: hatte es gewusst. Denn er war schon einige Jahre tot. Das hatte er heute von dem Beamten der Gemeinde Amriswil erfahren. Das alles zusammen gab schon etwas zu erzählen. Er warf einen Kontrollblick auf den Herd. Alles war bereit. Da hörte er auch schon die Türe gehen, Ninas Schritte, ihren Gruss.
«Hallo! Ich bin schon am Anrichten. Du kannst dich gleich an den Tisch setzen.»
«Fein riecht es», rief sie lachend, als sie an ihm vorbei in den Garten ging.
Er schüttete eben die Coniglio-Stücke samt Sauce in eine Schale und trug dann das ganze Gericht hinaus auf den Gartentisch. Nina hatte im Vorbeigehen die beiden jungen Oleander in den Töpfen gegossen, bevor sie sich setzte. Es war noch hell, ein lauer Sommerabend.
«Müde», antwortete sie seufzend auf seine Frage. «Du weisst ja: fünf Lektionen, dann noch die Fachschaftssitzung.» Zum neuen Qualitätsleitbild der Schule hätten sie Stellung nehmen müssen, das eine Gruppe von Kollegen ausgearbeitet hatte, auf Verfügung von oben.
Ob die Qualität nun endlich genug gesichert oder ob noch weitere Leerlaufübungen zu erwarten seien, fragte er. Sie reagierte leicht ungehalten auf seinen ironischen Ton. Zynismen habe sie heute schon genug gehört. Entweder lasse man sich auf so ein Leitbild ein und nehme es ernst, oder dann verweigere man die Mitarbeit mit klarer Begründung. Sie seufzte wieder, streckte sich und lachte dann.
Eine Weile assen sie schweigend. Das Kaninchen schmeckte.
Von der Qualität des Status quo überzeugt zu sein, das sei ja immer am bequemsten. Man drehe dann die neuen Begriffe möglichst so, dass an diesem gewohnten Status nichts geändert werden müsse. Aber etwas anderes habe sie heute viel mehr bewegt. Sie blickte ins Laub der Pergola. Die kleinen Beeren des wilden Weins waren teilweise schon blau. Sie sassen gerne hier. Die Hecke schützte jetzt gut vor den Blicken der Passanten.
Als sie in der Drei-Uhr-Pause vom Kopierraum ins Lehrerzimmer zurückgegangen sei, habe ihr Carlo, der Mathematiker, zugeflüstert: ob sie es gehört habe. Theo sei tot. Er habe sich das Leben genommen.
«Du kannst dir denken, wie mir das eingefahren ist. Natürlich warst nicht du gemeint, sondern Theo Fasel. Das kapierte ich dann schon.»
Der Archivar erinnerte sich: Über diesen Theo Fasel, Historiker wie er, hatten sie doch kürzlich gesprochen – genau: als sie am Bahnhof Andermatt vorbeiwanderten. So bereitete Ninas Erlebnis seiner Erzählung schon das Terrain vor, fuhr es ihm durch den Kopf. Aber Theo Fasel war jetzt wichtiger. Das entnahm er deutlich Ninas Gesichtsausdruck. Was? Der hatte sich umgebracht? Er wusste, dass Nina ihn gemocht hatte. Trotz gewisser narzisstischer Züge war er ein gutmütiger, sensibler, auch begabter Mensch – gewesen.
Der Archivar erinnerte sich an ihn als wenig älteren Studenten, der als Doktorand eine Assistentenstelle versah und bereits Kurzgeschichten publizierte. Man prophezeite ihm eine grosse Karriere. So einer verschwand nicht in einem Archiv oder im Lehrkörper eines Gymnasiums, glaubte man. Und er selber glaubte es erst recht.
Nina hatte vor einiger Zeit zwei Tage mit ihm verbracht, der dann doch zum Farbtupfer in einem gymnasialen Lehrkörper geworden war, immerhin zum Farbtupfer, erfrischend, aber nicht immer leicht zu behandeln. Sie hatten zusammen eine Klasse auf einer Kulturreise begleitetet. Am Bahnhof Andermatt hatten sie Mietvelos bezogen und fuhren dann gemeinsam über den Gotthard ins Tessin hinunter. Zwar habe er es sich nicht ganz verklemmen können, seine Sportlichkeit vor den Burschen und seine historischen und geographischen Kenntnisse vor allen auszuspielen. Aber er sei sehr ritterlich und verständnisvoll umgegangen mit den jungen Frauen und auch mit dem einen, körperlich leicht behinderten jungen Mann. Halb ironisch, halb verbittert habe er ihr beim Nachtessen im Gotthard Hospiz von seinen literarischen und wissenschaftlichen Ambitionen erzählt.
Der Archivar nahm wahr, dass Nina ihren Teller leergegessen hatte und sinnend davor sass. Er zeigte auffordernd auf die Schüsseln, die zwischen ihnen standen. Nun kam wieder Bewegung in ihr vertrautes, rundes Gesicht. Der Blick kehrte zurück in die gegenwärtige Umgebung. Sie nahm sich noch einen Löffel Polenta und ein Kaninchenstück. Dabei habe sie gemeint, es gehe ihm jetzt besser. Nach einem Nervenzusammenbruch in der Schule hatte er sich vor einem Jahr vorzeitig pensionieren lassen, hatte nun Zeit und Raum, sich seinen wissenschaftlichen und literarischen Projekten zu widmen. Er lebte seit einiger Zeit getrennt von seiner Frau, denn die hatte den Glanz eines brillanten Wissenschafters und Schriftstellers neben sich gewünscht und nicht den Mief eines Schulmanns. So stellte er es dar. Er habe einen Roman beendet, sei in der Schule erzählt worden. Die Publikation stehe unmittelbar bevor. Und jetzt das.
Nachdenklich musterte der Archivar das Glas, das er in der Hand hielt. Er dachte an seine eigenen Manuskripte, die unpublizierten, besonders an seinen Leo-Roman, den er vor zwei Jahren vermisste und in den Fängen eines Plagiators glaubte, dann an die eine Erzählung Fasels, die ihm Nina einmal zu lesen gegeben hatte.
Sie schloss an eine Erzählung Kleists an, verflocht diese Handlung mit Kleists Biographie, zugleich aber mit einer Gegenwartshandlung, in der es um Erforschung des Klimawandels ging, aber auch um das Aufdecken historischer Spuren der Kleisterzählung und eines vergangenen Verbrechens. Das Ganze war sehr vielschichtig und zum Teil verworren präsentiert. Er hatte den Überblick trotz zweimaliger Lektüre nicht ganz behalten. Fasel hatte eine originelle, spielerisch wuchernde Sprache, deren Satzperioden in der Länge an die Kleists heranreichten, aber wegen gelegentlicher Ungenauigkeiten improvisierter wirkten.
Nina blickte auf und machte ihn auf die kleinen rötlichen Wolken am Abendhimmel aufmerksam. «Es hat übrigens gut geschmeckt», sagte sie, indem sie Messer und Gabel auf den Teller legte.
«Halt, halt, erst kommt noch der Salat», erwiderte er, und nach einem Blick zu den Wolken: «Immer kommt mir Kleist in den Sinn, wenn ich an Fasel denke.»
«Ja natürlich», meinte sie, «‹Die Wahrheit ist, dass mir auf Erden nicht zu helfen war.› – In den Mund geschossen.» Sie schüttelte sich. «Wie Theo es gemacht hat, weiss ich nicht.»
So genau wolle er das eigentlich nicht wissen, meinte der Archivar. Aber es berühre ihn schon eigenartig: Der dritte Todesfall sei das, der sich für ihn mit Andermatt verbinde.
Verständnislos blickte Nina ihn an. Dann lachte sie: «Ach so, deine Militärgeschichten – bei mir ergeben sich da ganz andere Verknüpfungen.»
Der Archivar lachte ebenfalls: «Kunststück, du warst ja auch nie im Militär. Nein, Spass beiseite. Ich habe mich gerade wieder damit beschäftigt. Mit dem, was ich lange vergessen hatte. Immerhin: du erinnerst dich noch daran.»
In diesem Moment meldete sich der Dreiklang des Telefons.
«Natürlich erinnere ich mich», erwiderte Nina, indem sie aufsprang. Sie nehme schon ab. Das werde Gerda sein. Bereits war sie in der Küche verschwunden. Er sah sie mit dem Hörer am Ohr hin und her gehen. Hörte ihr Lachen, ihre Ausrufe. Sie war plötzlich wieder sehr wach. Ja, das musste Gerda sein. – Das konnte dauern. Sie verschwand aus seinem Blickfeld ins Wohnzimmer.
Der Archivar wendete sich wieder dem Tisch zu, sah die Teller, die Schüsseln. Wenigstens waren sie fertig geworden mit Essen. Er sass da, als hätte man ihm mitten im Essen den Teller weggezogen. In den Gläsern war noch Wein. Und im Kühlschrank stand ein Dessert bereit. Er würde ihr nachher erzählen, was er Neues erkundet hatte. Inzwischen konnte er hier Ordnung schaffen. Seufzend erhob er sich, schob das Geschirr zusammen bis auf die Gläser und trug es in die Küche. Jetzt hatte er Zeit, Zeit zu ordnen: Ordnung in der Spülmaschine, Ordnung im Kopf. Was konnte Nina schon wissen? Was hatte er ihr schon erzählt in Hospental, was noch nicht? Er wollte sich ja nicht wiederholen, in Details verlieren, sich einmal nicht durch eine Schutthalde hindurchkämpfen müssen, eine Halde von Archivalien. Denn meist gelang ihm Ordnung erst so, halb intuitiv. Darum war er wohl Archivar geworden.
Frisch geduscht hatten sie sich gegenüber gesessen in der dunkel getäferten Gaststube. Draussen prasselte der Regen nieder. Schon der Wind hatte die Atmosphäre aufgefrischt. In ihrem historischen Zimmer, ebenfalls getäfert, mit schönem Teppich auf Parkett, hatten sie eine glänzend polierte Waschkommode vorgefunden: Marmorplatte mit Spiegelaufsatz. Ein leichter Duft von Bohnerwachs hing im Zimmer. Vielleicht hatte sich Suworow hier den Pulverdampf vom Gesicht gewaschen. Die Erinnerung an seine Studentenbude in München lag allerdings näher, die er dort in den ersten zwei Monaten bewohnt hatte, bevor er zu Wolf in die WG gezogen war. Im Pfännchen hatte er sich jeweils das Waschwasser gewärmt – mit dem Tauchsieder, dessen Heizspirale er einmal geschmolzen im glühenden Pfännchen vorfand, da er vergessen hatte, vor seinem Gang zur Uni das Kabel auszuziehen. Zum Glück stand das Pfännchen auf einer Marmorplatte.
Das historische Zimmer in Hospental hatte allerdings eine zweite, ebenso stilechte Tür. Dahinter fanden sie ein durchaus zeitgemässes Bad. Im Dampf der Dusche hatte sich der Umriss des bärenhaften Sanitätsmotorfahrers allmählich verdichtet, der damals mit ihm Dienst getan hatte. Er schien etwas mit dem unguten Gefühl zu tun zu haben, das ihn vor dem Betreten des Gebäudes ergriffen hatte.
Füglistaller: den Namen hatte er erst nach der Heimkehr im Tagebuch von damals wieder gefunden. Fast gleichzeitig war auch die geschniegelte Gestalt des Adjutant-Unteroffiziers wieder vor ihm aufgetaucht, der die militärische Leitung des kleinen Spitals innehatte: Dressmanfigur, straff nach hinten gekämmtes, schwarzes Haar, glatte, gebräunte Gesichtshaut, fast kein Bartwuchs, mit Vorliebe im schwarzen Ledermantel auftretend. Sein weicher Bündner Dialekt brachte ihn dem Archivar auch nicht näher, der damals noch nicht Archivar war, sondern frisch gebackener Doktor, noch ohne Beruf, weshalb er das eine wie das andere zu erwähnen vermied. Man wusste nichts von ihm in dieser Umgebung, wo man normale Berufe hatte und keine Bücher las. Oft hatte er im Büro des Adjutanten zu arbeiten, der sein sonores Organ am Telefon ertönen liess, während der Noch-nicht-Archivar Listen abtippte und ergänzte.
Und nun sassen Nina und er vor einem scharf gewürzten Gulasch. Schliesslich war es auf den Namen Suworow getauft worden. Und er versuchte erzählend die Handlung zu rekonstruieren, welche die beiden im Dampf der Dusche wieder aufgetauchten Personen mit ihm verband. Mit dem gutmütigen Bär von Fahrer hatte er sich problemlos verstanden. Einige Male hatten sie mit der Ambulanz die Rekruten zu irgendwelchen Übungen begleiten müssen. Als Beifahrer hatte er die Karte zu studieren, den Fahrer an die abgelegenen Schauplätze zu lotsen. Er war dabei meist etwas zu langsam.
«Du kennst mich ja», sagte er zu Nina. Und spiesste ein weiteres Gulaschstück auf die Gabel. «Noch heute orientiere ich mich lieber nach Wegweisern und anderen äusseren Merkmalen als nach der Karte. Deine Pausen zum Kartenstudium finde ich meist überflüssig.» Damals fiel das kaum auf. Denn Füglistaller kannte die Gegend wie seine Hosentasche und hatte einen unfehlbaren Instinkt, was militärische Übungsplätze anging. Überhaupt war er stolz auf seine Fahrkünste. Mit Recht. Als Beifahrer hatte er sich jederzeit sicher gefühlt, wenn Füglistallers Pranken in aller Ruhe Lenkrad und Schalthebel bedienten. Man sah ihm sein ständiges Renommieren gerne nach: Erfolge als Lastwagenfahrer bei der Amriswiler Baufirma; Erfolge im Militär; Erfolge bei den Frauen; Erfolge in der Feuerwehr; Erfolge beim Jassen. Das war eine ständig sprudelnde Litanei in volkstümlich-bildhafter Sprache.
«Aber weisst Du, ich hörte ihm gerne zu», hatte er zu Nina gesagt, die ihn mit der Gabel in der Hand stirnrunzelnd anblickte, damals in Andermatt. Ständig habe Füglistaller an seinem Selbstbild gearbeitet, das in eklatantem Widerspruch stand zu seiner schwerfällig-gutmütigen realen Existenz. Manchmal schien er das sogar selbst zu spüren. Denn er hatte durchaus Humor. Wirklich, er habe ihm – immer wieder gerührt – gerne zugehört. Und dafür wohl habe Füglistaller auch ihn gemocht, obwohl er in ihm wahrscheinlich einen bleichen Schwächling aus der Stadt sah.
Aber sein Renommierbedürfnis war auch seine Schwäche und wurde schliesslich sein Verhängnis. Jeden Abend sass er in den zahlreichen Wirtshäusern Andermatts, um Publikum zu haben, beeindruckbare Rekruten. Und dabei wurde natürlich getrunken, viel getrunken.
Der Archivar hatte sein Glas ergriffen und Nina zugeprostet, die lachend mit ihm anstiess: «Und du hast da wacker mitgehalten? Von dieser Beizenhocker-Seite kenne ich dich ja gar nicht.»
Er hatte ihr bestätigt, dass sie mit ihrer Verwunderung schon richtig liege. Er sei nur wenige Male abends mitgegangen – und nie lange geblieben. Obwohl er schon damals Bier und Wein durchaus nicht verachtet habe. Er sei sich seiner selbst noch zu wenig sicher gewesen, habe die lärmige Gemeinschaft gescheut und deshalb die beiden Cafés vorgezogen, die es damals in Andermatt gab. Da sass er für sich an einem Tischchen, las Zeitung oder sonst etwas.
Im Geschirrspüler herrschte inzwischen Ordnung. Doch in seinem Kopf? Er mühte sich gerade mit der Polenta-Pfanne ab. Wieder überraschte ihn die enorme Klebefähigkeit des Maises. Natürlich verlor er sich wieder in den Details, sobald er sich den Abend in Hospental vorzustellen versuchte. Gut, dass er das jetzt noch ordnete, bevor er Nina die Fortsetzung erzählte. Erst allmählich war er ja wieder darauf gekommen, was damals zwischen Füglistaller und dem Adjutanten vorgefallen war (Ziegler hiess er laut Urner Zeitung vom Montag, 30. Juni 1975. Er hatte sich beim Urner Staatsarchiv nach der Unfallmeldung erkundigt.) und was das mit dem Gasthaus in Hospental zu tun hatte.
Das Gespräch der Familie am Nebentisch hatte ihn dabei unterstützt. Ein Paar mittleren Alters mit zwei Töchtern, die eine pubertierend, die andere noch etwas jünger. Die Pubertierende beschimpfte unüberhörbar die Mutter. Immer bestimme sie das Tagesprogramm. Immer müsse man wandern. Nie könne man ausschlafen und gemütlich herumhängen. Der Vater erklärte schliesslich bestimmt: Das Wandern sei ein Hauptzweck dieser Ferien in Realp. Die sie gemeinsam beschlossen hätten. Sie solle jetzt aufhören zu motzen und froh sein, dass er heute Morgen vor der Wanderung das Auto hierhergebracht habe, sodass sie nur noch bis zum Parkplatz da draussen zu gehen brauche.
Doch die Tochter hörte nicht auf zu motzen. Als müsste sie damit kompensieren, dass ihre sekundären Geschlechtsmerkmale trotz der schönen langen Haar noch nicht recht zur Geltung kamen. Sie verspottete nun den Toyota des Vaters.
Genau: Füglistaller hatte einen Toyota Corolla besessen, auf den er sehr stolz war und den er noch nicht fertig abgezahlt hatte. Ungewollt hatte er das gestanden, indem er damit aufschnitt, wie souverän er mit dem Autohändler verhandelt habe. Und dieser Wagen hatte am Samstag Abend nach der zweiten WK-Woche (der künftige Archivar hatte Sonntagsdienst) auf dem Parkplatz da draussen gestanden. Das hatte ihn damals auf seinem Abendspaziergang in Uniform überrascht. Denn Füglistaller hätte eigentlich gar nicht mehr da sein sollen, erinnerte er sich verschwommen. Wahrscheinlich war er am Morgen schon entlassen worden und weggefahren. Seine drei Wochen waren abverdient. Es war unzweifelhaft sein Wagen gewesen. Das hatte er plötzlich wieder vor Augen.
Auf dem Rücksitz lagen verstreut seine Militärsachen. Also war er hängen geblieben, trank seinen Kummer weg. Wenn er nur nicht nochmals einen Unfall baute. Nochmals: das war so ein Wort von damals. Unfall und Kummer musste er erst wieder auf die Spur kommen. Der Noch-nicht-Archivar hatte jedenfalls keine Lust gehabt, den kompensierenden Renommierreden und der alkoholisierten Weiterfahrt beizuwohnen. Er betrat die Gaststube deshalb nicht und beendigte seinen Ausgang nach Hospental ohne Einkehr. So meinte er sich zu erinnern. Hospental hatte wohl ohnehin ausserhalb des bewilligten Rayons gelegen. Aber die damalige Umkehr erklärte noch nicht den Widerstand, der ihn eben bei der Wiederbegegnung mit diesem Haus erfüllt hatte.
Jetzt glänzte die Pfanne wieder. Er nahm sich den Zucchetti-Topf vor. Telefone mit Gerda konnten ohne weiteres eine halbe Stunde dauern. Ihn, der nicht gern telefonierte, erstaunte das immer wieder. Sie waren damals schon beim Kaffee angelangt gewesen, bis er die Zusammenhänge, seine damaligen Spekulationen, wieder einigermassen beisammen hatte.
Nina hatte das Gespräch zwischendurch nochmals auf Theo Fasel gebracht, der sie in seiner ständigen Suche nach Bestätigung ein wenig an Füglistaller erinnerte, obwohl er natürlich intelligenter und begabter war. Der Archivar erinnerte sich: Damals nach seiner Rückkehr von Hospental hatte er Wachdienst im Büro gehabt und inständig gehofft, dass nichts Gravierendes passiere in dieser Nacht, dass er nicht den Berufspfleger rufen und selber mit ausrücken müsse.
Und dann das. Kaum hatte er sich richtig eingerichtet, läutete – wohl etwa um acht Uhr abends – das Telefon: die aufgeregte Stimme eines Bergführers aus Andermatt, eines Bekannten des Adjutanten, der wie dieser begeisterter Strahler, Kristallsucher, war. Ziegler sei abgestürzt heute Nachmittag. Wahrscheinlich tödlich verunfallt. Nächstens werde er hergebracht zur näheren Abklärung der Umstände. Auch die Polizei werde kommen.
«Du kannst dir denken, Nina, wie überfordert ich mich fühlte.» Er habe den Berufspfleger angerufen, der auf Pikett war. Sonst erinnere er sich an das alles nur noch verschwommen. Habe ja auch seit Jahrzehnten nicht mehr daran gedacht.
Ziegler auf einer Bahre mit grausig zerschlagenem Schädel sehe er verschwommen wieder vor sich. Offensichtlich tot. Das festzustellen hatte es weder Arzt noch Pfleger gebraucht. Dennoch wurde er genau untersucht. Eine vage Erinnerung sage ihm, dass Ziegler an jenem Samstag schon früh morgens zusammen mit dem Bergführer zum Strahlen aufgebrochen sei. Sie waren auf der Oberalppassstrasse hochgefahren bis zur Mittelstation der Bahn, die damals noch die Furka-Oberalpbahn war. Nätschen hiess es da. Den Namen habe er heute auf einem Wanderwegweiser wieder gelesen. Und von dort seien sie auf einem Alp-Fahrweg noch höher gefahren Richtung Urner Loch. Dort hätten sie parkiert und seien in eine Wand und Geröllhalde hineingestiegen im sogenannten Teufelstal, einer schmalen Rinne, die steil hinabfällt zum Suworowdenkmal. Dort konnte man immer noch auf Kristalladern stossen.
Den Namen «Teufelstal» hatte er Nina vor drei Wochen nicht nennen können. Erst das Tagebuch hatte ihn in Erinnerung gerufen. Dort hatte er auch gelesen, dass er selber einige Tage zuvor an einem freien Nachmittag jenen Alpweg hinaufgewandert und von Schwindel ergriffen in die Tiefe geblickt hatte. Fast auf der Höhe der «Gendarmen» am jenseitigen Horizont hatte er gestanden, die er gewöhnlich vom Militärspital aus weit oben ragen sah. Das war ihm völlig entfallen.
Eigentlich war das Fegen der Pfannen eine befriedigende Tätigkeit. Man beseitigte die Spuren des Gebrauchs und stellte wieder Ordnung her, den Stand der Unschuld, für den nächsten Gebrauch und Sündenfall. Damals war es darum gegangen, die Spuren und fixierbaren Umstände des Unfalls genau festzuhalten. Er selber hatte für den Dorfpolizisten auf der Büroschreibmaschine den Rapport tippen müssen, wahrscheinlich Aussagen des Bergführers und einzigen indirekten Zeugen.
«Langweile ich dich auch nicht mit dem Herumkramen in meinen versunkenen Erinnerungen?» Immer wieder hatte er Ninas Gesichtsausdruck kontrolliert – beim Suworow-Gulasch vor drei Wochen. Sie schien wirklich interessiert zuzuhören. Inzwischen wusste er es wieder genauer. Ziegler und der Bergführer hatten ziemlich weit voneinander gearbeitet mit ihren Hämmern.
Die Familie mit den zwei Töchtern verabschiedete sich herzlich vom Kellner, der aus dem Unterland stammte. Er war früher bei der Swissair Flight Attendant gewesen wie die Mutter der Töchter. So stellte es sich heraus. Und der Vater war Pilot, jetzt bei der Swiss.
Richtig: Ziegler war damals mit dem Helikopter gebracht worden, kam ihm mitten in dieser aviatischen Familienzusammenführung in den Sinn. Dass er das hatte vergessen können: den Lärm der Rotoren auf dem Exerzierplatz, der die Situation noch bedrohlicher zuspitzte. Sie hätten sich zwar nicht immer gesehen, aber doch hämmern gehört, immer auf Hördistanz voneinander. Das sei so Strahlerbrauch. Gegen Ladenschluss habe Ziegler ihm zugerufen: Er gehe jetzt zurück, müsse noch etwas besorgen im Dorf. Sie hätten sich rufend verabschiedet.
Eine Stunde später sei er, der Bergführer, auch wieder hinüber gestiegen zum Alpweg und habe schon von weitem gesehen: Zieglers Wagen stand noch immer in der Kurve. Und auf dem schmalen Felsband, das wie ein natürlicher Pfad zur Kurve des Fahrwegs hochführt, habe Zieglers Hammer gelegen. Beunruhigt habe er den Blick rundum kreisen lassen. Und habe ihn schliesslich liegen gesehen, weit unten, in seltsamer Verrenkung vor einem Felsblock, an einer ohne Seil unzugänglichen Stelle: ausgerutscht, ein so geübter Bergsteiger, und ausgerechnet an dieser Stelle, wo eigentlich keine Schwierigkeit mehr bestand. Hatte er gerade deshalb nicht mehr aufgepasst? Nachträglich sei es ihm gewesen, als hätte er einmal einen Schrei gehört, vielleicht sogar einen Wortwechsel. Aber durchs Teufelstal halle sowieso immer der Verkehrslärm herauf, auch das Gelächter und die Rufe der Touristen beim Suworowdenkmal.
So hatte er sich das inzwischen wieder rekonstruiert. Nina hatte er an jenem Abend in Hospental nur in ganz groben Zügen davon berichten können. Der Archivar sass wieder im Garten und nippte an seinem Glas. Die Küche war aufgeräumt, die Dämmerung hereingebrochen, das Blätterdach der Pergola vor dem dunkelroten Himmel zu einer schwarzen Fläche zusammengeschmolzen. Auch die Geschichte vom Vorabend war ihm damals erst in Umrissen wieder aufgestiegen: Es hatte eine Auseinandersetzung gegeben zwischen Ziegler und Füglistaller, bevor dieser entlassen wurde. Und irgendwie hatte ihn die Gedankenkette verfolgt – ihn, den frisch Promovierten, den Berufslosen, wer war er denn schon? Die Gedankenkette: Am Freitag Abend wird Füglistaller entlassen, kann also am Samstag Morgen nach Hause fahren. Am Samstag-Nachmittag hört der Bergführer einen Wortwechsel des vom Strahlen zurückkehrenden Ziegler im Teufelstal. Kurz darauf stürzt Ziegler ab. Und um fünf steht Füglistallers Toyota vor dem Hotel «Gotthard» in Hospental. Und? Was war daran auffällig? Der trieb sich eben gerne herum. Auch Nina fand die Spekulationen weit hergeholt, die ihm damals – vor gut dreissig Jahren – so zugesetzt hatten. Er verstand das selber nicht mehr. Beruhigt ging er zu Bett. Sicher war die Matratze bequemer als zu Suworows Zeiten. Er spürte Ninas warmen Körper neben sich. Und mit dem Absinken in den Schlaf schien auch diese ganze Geschichte wieder – ins wohl endgültige – Vergessen absinken zu können.
Der Archivar überlegte, ob er Licht machen sollte. Sie hatten doch vor ein paar Wochen diese Girlande mit den farbigen Lämpchen in die Pergola gehängt. Oder sollte er ganz schlicht und unromantisch die Aussenlampe neben der Küchentür anzünden? Jedenfalls: Nina sollte das Dessert sehen, das sie bald essen würden.
Er war dann früh erwacht im historischen Hospentaler Zimmer, erinnerte er sich weiter, hatte sich im Halbschlaf hin und her gewälzt, während es heller wurde. Und immer deutlicher sah er jene Szene zwischen Füglistaller und Ziegler wieder vor sich. Nichts von Absinken ins endgültige Vergessen. Die Bedrängnis hatte ihn wieder eingeholt. Mit Recht? Das wollte er damals beim Frühstück von Nina wissen.
Er stand jetzt auf und knipste das Licht der Aussenlampe an. Dabei sah er: Nina ging wieder in der Küche hin und her mit dem Hörer in der Hand. Offenbar hatte sie die Absicht, das Gespräch zu beenden. Das hiess aber noch nichts, wie er aus Erfahrung wusste. Er setzte sich wieder. Immer noch war es angenehm warm. Aber ein leichter Wind bewegte das Laub der Birke vor der Hecke.
Ein gutes, dunkles Brot und frische Croissants hatte es damals zum Frühstück gegeben. Auch der Kaffee war nicht schlecht. Zuerst wurden sie abgelenkt. Am Nebentisch sassen zwei junge Männer im Radfahrerdress. Wahrscheinlich wollten die auch über den Gotthard. Ihrem Gespräch liess es sich leicht entnehmen: Es waren ebenfalls Flight Attendants, Ex-Kollegen des Kellners also, der morgens um acht noch nicht erschienen war.
Endlich, das Frühstück war schon fast beendet, fand er die nötige Konzentration, Nina jene wieder aufgetauchte Szene zu schildern. Freitag Nachmittag, an seinem letzten Dienstnachmittag, war Füglistaller eine halbe Stunde bei ihm im Büro gehockt, bis er nochmals zu einer Fahrt abbeordert wurde. In immer wieder neuen Anläufen und Beispielen wiederholte er lauthals, wie froh er sei, dass dieser Scheissdienst endlich zu Ende sei. Immer klarer wurde dem Noch-Nicht-Archivar, dass er damit die diametral entgegengesetzte Gefühlslage zu bekämpfen versuchte. Er roch es auch: Füglistaller hatte getrunken, schon am Nachmittag und noch im Dienst. Das war bisher nicht vorgekommen. Wo denn hatte er sonst ein so bequemes Fahrerleben? Sicher nicht bei seiner Baufirma in Amriswil, wo er den ganzen Tag unterwegs war, auf- und abladen musste. Wo hatte er ein so dankbares Publikum wie hier die Rekruten abends in den Beizen? Die Namen der jungen Männer hatte er sich alle gemerkt. Als wäre man eine grosse Familie. (Nur der Noch-nicht-Archivar war darin ein natürlich selbst verschuldeter Waisenknabe.)
Und dann die Szene im Büro vor dem Nachtessen, als Füglistaller aus dem Dienst entlassen wurde. Ziegler machte das am Freitag Abend, weil er ja am Samstag strahlen gehen wollte. Füglistaller hatte nochmals ausrücken müssen. War eben erst zurückgekommen. Der Adjutant-Unteroffizier hatte durchs offene Fenster beobachtet und gehört: Beim Parkieren der Ambulanz hatte der Betrunkene die Laderampe des Materialmagazins touchiert. Und beim zweiten Versuch hörte man es gleich nochmals bedenklich kratzen. «Aha», hatte Ziegler gemurmelt und Füglistaller dann rufen lassen, um ihn zu verabschieden. Freundlich begrüsste er ihn – und schiss ihn dann unvermittelt zusammen. (So hiess das in der Soldatensprache, erklärte er Nina, in der Schülersprache ja wohl auch.)
Auf eine ganz perfide Art hatte er das getan, leise, lächelnd: «Kommen Sie mal etwas näher, Motorfahrer Füglistaller. Hauchen Sie mich an. Tja. Was riechen Sie, Sanitätssoldat Link?» Der Noch-nicht-Archivar sass an der Schreibmaschine und tippte Listen. Er hätte Ziegler am liebsten geohrfeigt.
«Alkohol im Dienst. Bei einem Motorfahrer. Sie wissen, was das heisst, Füglistaller! Das müssen wir jetzt aber genau haben. Da wird ins Röhrchen geblasen.» Und er holte das entsprechende Testgerät. Der bärenhafte Füglistaller fiel immer mehr in sich zusammen. Doch Ziegler liess nicht ab. «Das werde ich ihrem Kompaniekommandanten melden müssen. Ob Sie als Motorfahrer noch tragbar sind, wird sich weisen. Ihre abendlichen Ausgänge verliefen ja auch nicht gerade trocken, wie man hört. Auch Ihren zivilen Arbeitgeber werde ich orientieren müssen. Sie fahren doch Lastwagen?» Etwa in dieser Tonlage hatte er gesprochen. Für ihn, hatte er Nina erzählt, sei der Zusammenbruch Füglistallers kaum mehr auszuhalten gewesen. Die beiden jungen Männer am Nebentisch unterhielten sich über den Bordservice anderer Fluggesellschaften. Und über die Vor- und Nachteile verschiedener Rahmenmaterialien von Rennrädern.
Füglistaller fiel schliesslich plump und ungeschickt auf die Knie vor Ziegler, flehte ihn weinend und Hände ringend an: Er solle doch bitte, bitte noch einmal ein Auge zudrücken. Es werde auch nie wieder vorkommen. Aber Ziegler, dieser glatthäutige Sadist, blieb ungerührt. Er schien Füglistallers Zerfall buchstäblich zu geniessen. Das war es, was ihn als unfreiwilligen Zuschauer so masslos aufbrachte. Denn andererseits sah er ein: Man musste es Füglistaller einmal klar machen, dass er so nicht weitermachen konnte.
Nina erschien in der Küchentür. Sie winkte ihm zu, deutete an, dass sie bald kommen würde, sprach aber immer noch in den Hörer. «Also dann», hörte er, dann aber wieder «sicher … eben … genau …» Sie ging wieder hinein.
Sie verstehe seine Spekulationen jetzt besser, hatte sie damals gesagt, als sie durch taunasses Gras der Gotthardreuss entlang emporstiegen, und dass sie zu einer Art Gewissensfrage geworden seien: Ob man selber schuldig werde, wenn man den Schuldverdacht gegen einen Mitmenschen verschweige. Warum er eigentlich später nie diesen Füglistaller aufgesucht habe? Der Archivar blickte immer wieder hoch zu den Kurven der Passstrasse. Vielleicht sah man die beiden Flight Attendants vorbeiradeln. Er war doch froh gewesen, diese ganze Militärwelt wieder vergessen zu können, hatte mit Stellensuche und Zukunftsplanung genug zu tun gehabt. Einen Dienstkollegen zu Hause aufzusuchen, wäre ihm wirklich nie eingefallen. Und inzwischen war es dazu eh zu spät.
Er streckte sich und stand auf, um den bereitgestellten Fruchtsalat aus dem Kühlschrank zu holen.
Nina kam ihm entgegen. «Gehst du rein? Jetzt, wo ich endlich wieder da bin? Es ist doch noch warm draussen.»
«Keine Angst, ich sorge nur für das Dessert.»
Schon stellte er die beiden Schalen auf den Gartentisch. Gerda habe megacoole News mit ihr besprechen müssen, um mit Lajos’ Worten zu reden oder mit denen ihrer Studierenden. Beide waren sie mit dem Löffeln der Macedonia beschäftigt. Sie habe einen Ruf erhalten aus München: eine einmalige Chance für die auch schon Fünfundfünfzigjährige. Da gebe es vieles zu bedenken und zu organisieren. Sie werde wahrscheinlich eine kleine Wohnung mieten in München.
«Und Heiner?», erkundigte sich der Archivar, dem seine Erzähllust zunehmend zerbröckelte. Was sollten auch seine dreissig Jahre zurückliegenden Geschichten?
Heiner werde natürlich da bleiben. Er könne dann ungehindert die ganze Wohnung vollqualmen. Doch Spass beiseite: Gerda werde über die Wochenenden heimkommen und überhaupt sich aufs Pendeln einstellen. Im Erstklassabteil des ICE lasse sich ja prima arbeiten. Gerda habe ihr versprochen, dass der Kontakt zwischen ihnen nicht abbreche. Nina freute sich für ihre Freundin, deren Publikationen nun endlich die verdiente Anerkennung fänden. Natürlich werde man sie in München besuchen. Ganz begeistert trank Nina ihr Weinglas leer und hatte nichts dagegen, dass der Archivar den Rest in der Flasche noch sorgfältig auf die zwei Gläser verteilte. Das habe sie jetzt richtig aufgestellt. Die trübe Stimmung wegen Theos Suizid sei verflogen.
Sie begann zu erzählen von einer Münchner Dozentin namens Silke, die sie damals in der Taklamakanwüste getroffen hätten: eine interessante Person. Die würde ihm sicher auch gefallen. Sie schaute zum Archivar hinüber, der sinnend sein Glas betrachtete. Ninas letztjährige Tour mit Gerda durch die Seidenstrasse blitzte kurz auf, seine Zeit als Strohwitwer und die Bekanntschaft mit Lea und dem jungen Lajos.
Was er von einer kleinen Reise halte, zum Beispiel in den Herbstferien? Sie hätten ja sowieso einmal nach Budapest fahren wollen, um Ferenc zu besuchen. Das könne man doch mit einem Aufenthalt in München verbinden.
Da von Seiten des Archivars nur ein wenig begeistertes «Warum nicht?» kam, hielt sie inne. Sie atmete tief durch und schaute ins Rebenlaub der Pergola.
«Das war ein Tag!» sagte sie schliesslich, «fünf Lektionen Schule, Qualitätsleitbild, Theos Selbstmord, Gerdas Berufung!» Und nach einer kurzen Pause: «Was war es denn, was du mir vorhin erzählen wolltest? Von deinen Erlebnissen in Andermatt?»
Der Archivar seufzte: «Ach, lassen wir das. Ist doch unwichtig. Schon bald nicht mehr wahr.» Im letzten Moment konnte er diese Bemerkung zurückhalten, die sich während der letzten Minuten in ihm gebildet und seine Erzähllust zunehmend überlagert hatte.
Stattdessen sagte er, sich aufrecht hinsetzend: «Ach, weisst du, heute Nachmittag habe ich mit einem Beamten der Gemeinde Amriswil telefoniert. Da hat doch dieser Füglistaller, der Sanitätsmotorfahrer, von dem wir sprachen, gewohnt und gearbeitet. Du hast mir damals geraten zu recherchieren, wenn es mich beschäftige. Vielleicht interessiert dich jetzt, was ich herausfand.»
«Ja, natürlich – erzähl!»
Der Mann habe sich noch genau an Füglistaller erinnert, referierte er nun. Ja, erinnert. Füglistaller sei nämlich vor gut fünf Jahren gestorben. An Leberzirrhose. Sie hätten viel Mühe gehabt mit ihm. Trotzdem: ein gutmütiger Kerl, den er gemocht habe, ein Original, mit dem man auch immer wieder habe lachen können. In den letzten fünf Jahren seines Lebens sei er zum eindeutigen Sozialfall geworden. Fast zehn Jahre lang habe man ihn zuvor bei der Gemeinde beschäftigt. Angestellt für Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten, nachdem er seine Stelle bei der Baufirma verloren habe, die Frau sich von ihm habe scheiden lassen und mit den Kindern weggezogen sei. Aber schliesslich sei er auch da untragbar geworden, habe nur noch von der Sozialhilfe gelebt. Dreimal habe man ihn in eine Entziehungskur geschickt. Jedes Mal sei er rückfällig geworden, ein armer Kerl eigentlich, obwohl er immer Witze gemacht habe; gutwillig, aber willensschwach. Er sei immer ganz zerknirscht vor ihm gestanden im Büro und voller guter Vorsätze gegangen. Trotz dieser gemüthaften, fast sentimentalen Seite sei er aber kaum aus der Ruhe zu bringen gewesen. Nur einmal habe er im Jähzorn einen anderen Gemeindearbeiter verprügelt. Der habe ihn aber auch wirklich bis zur Weissglut gereizt.
Der Archivar hatte sich warm geredet. Er sah hinüber zu Nina. Hatte er sich etwa zu sehr in den Details verloren? Sie sah ihn lächelnd an, das Kinn auf die linke Hand gestützt. Die Anteilnahme dieses Amriswiler Beamten habe ihn gerührt. Eine seiner Bemerkungen habe ihn besonders beschäftigt: Der habe nämlich zuweilen das Gefühl gehabt, den Füglistaller bedrücke etwas. Mitten in einer seiner Renommiergeschichten habe er sagen können: «Weisst du, einen wie mich sollte man am besten erschiessen, ungespitzt in die Erde rammen, bis in die Hölle hinab.»
Und dabei habe er starr aus seinen glasigen Augen geblickt, als sähe er die Hölle schon vor sich. Wenn er, rückfällig geworden, zerknirscht wieder im Büro erschien, habe er mehr als einmal gemurmelt: «Siehst du, Hopfen und Malz verloren, mich wird eh der Teufel holen. Ich weiss genau, wo er mich hinunterstürzt.»
Nina fuhr mit dem linken Zeigefinger über die Lippen und sagte dann nachdenklich: «Ja, das ist ein Indiz, aber eben doch nur Indiz, kein Beweis und erst noch sehr indirekt vermittelt, fünf Jahre nach dem Tod des mutmasslichen Täters.» Aber Genaueres werde er kaum noch erfahren können.
Der Fruchtsalat war längst aufgegessen, der Wein ausgetrunken. Der Archivar war immer noch erfüllt von seiner Erzählung, die er nun doch losgeworden war. Natürlich sei es erstaunlich, dass der Beamte sich noch so genau an den Wortlaut von Füglistallers Sprüchen erinnern wollte. Er habe betont, dass ihm das Bild vom Hinuntergestürzt-Werden immer seltsam und unpassend vorgekommen sei. Füglistaller, auf dem Papier reformiert, sei nie in die Kirche gegangen und kaum mit Abbildungen von Höllenstürzen in Berührung gekommen. Und gerade dieses Verquere gebe ihm eine gewisse Gewähr, erklärte der Archivar, dass Füglistaller wirklich so gesprochen habe. Er selber habe natürlich sofort den schwindelnden Abgrund des Teufelstals vor Augen gehabt. Und sich den seltsam verdreht weit unten liegenden Adjutanten dazu gedacht. Ziegler habe er übrigens geheissen. Er habe sich die Zeitungsmeldung von dem Unfall – als das galt der Todessturz – und den kurzen Nachruf besorgt.
Es war kühler geworden unter der Pergola. Bald würden sie hineingehen.
«Gut, nehmen wir einmal an, es sei vorsätzliche Tötung gewesen», sagte Nina nach einer Weile. Sie sass da mit verschränkten Armen. Sie kenne sich ja nicht aus mit diesen juristischen Begriffen. Aber ganz ohne Vorsatz wäre Füglistaller wohl kaum zu diesem Nätschen oder wie hinaufgefahren und noch höher. Denn eine Kneipe gebe es da oben ja wohl kaum.
«Vorsätzliche Tötung: was würde das für dich bedeuten, im Hinblick auf dein damaliges Handeln?»
Der Archivar seufzte. Das wisse er selber nicht recht. Es gehe ihm ja nicht um ein abstraktes Prinzip, sondern um die Menschen, die beide inzwischen tot seien. Der eine vielleicht – wahrscheinlich – ermordet, der andere vielleicht – je nach Betrachtungsweise – durch indirekten Selbstmord ums Leben gekommen. Durch das Weinlaub hindurch sah man einzelne Sterne. Den Mord verhindern hätte er wohl nicht können. Er habe zwar die existentielle Notlage Füglistallers miterlebt. Aber eine solche Reaktion habe er im Entferntesten nicht vorausgesehen damals. Ausserdem sei Füglistaller am Samstag Morgen dann ja gleich weggefahren und nicht mehr zugänglich für allfällige beruhigende Gespräche. Nein, was ihn heute (und wohl schon damals) beschäftige, sei die Frage: Hat das kaum reflektierte, passive Decken Füglistallers diesem wirklich genützt? Hat es ihm nicht vielmehr geschadet? Hätte er eine (gewiss sehr lange) Gefängnisstrafe nicht als Befreiung empfunden? Zumindest hätte sie ihn von seinem Alkoholismus befreit. Und vielleicht wäre er zu einem weisen alten Mann geworden. Stattdessen hatte er sich nun zu Tode gesoffen. Ach was, da gebe es doch wahrhaftig näherliegende Unterlassungssünden, die er sich vorwerfen könnte, meinte Nina. Auch ein Füglistaller trage doch die Verantwortung für seine Taten und sein Leben selber. Er hätte sich ja stellen können. Wenn das Bedürfnis nach Busse stark genug gewesen wäre. Der Archivar nickte dankbar.
Nina hielt die verschränkten Arme eng an den Körper gepresst. Ja, es war kühler geworden.
Und das Schicksal dieses Steiner – Ziegler, korrigierte der Archivar –, ob ihn das nie beschäftigt habe? Der habe doch auch einen Anspruch auf Gerechtigkeit, habe vielleicht Frau und Kinder gehabt, für die das eine Tragödie gewesen sei.
«Soll ich dir eine Jacke holen?» fragte der Archivar.
«Nicht nötig», antwortete Nina. «Lange werden wir ja nicht mehr da sitzen. Ich bin müde.»
Der Archivar nickte und schob die Dessertschalen und Gläser zusammen. Nein, sagte er dann, an Ziegler habe er damals kaum gedacht. Seine ganze Sympathie habe Füglistaller gegolten. Das wundere ihn heute auch. Vielleicht sei er unter einem unbewussten Solidaritätsdruck gestanden: Einen Kameraden verrät man nicht an einen Vorgesetzten. Aber belastet habe ihn das nicht. Ziegler war tot. Daran hätte ein Jahrzehnte im Gefängnis hockender Füglistaller auch nichts geändert. Aus reiner Neugier habe er inzwischen erkundet, dass Ziegler eine Frau und einen Sohn gehabt habe, mit dem gleichen Vornamen Reto. So habe er es in der Todesanzeige in der Urner Zeitung vom 30. Juni 1975 gelesen, von der man ihm eine Kopie geschickt habe.
«Hätten die nicht ein Anrecht darauf zu wissen, dass ihr Mann und Vater damals ermordet worden ist?» fragte Nina.
«Was hätten sie davon?» Erstaunt erhob sich der Archivar und ergriff das Geschirr, das noch auf dem Tisch stand. «Es würde ihnen höchstens das längst etablierte Lebensarrangement durcheinander bringen, wenn sie überhaupt noch leben.»
Nina stand ebenfalls auf: «Die Wahrheit hätten sie halt. Oder doch das, was du für die Wahrheit hältst.»
«Eben», sagte der Archivar leichthin. Sie gingen hinein.
«Ach, du hast den ganzen Abwasch ja schon gemacht!» stellte Nina fest. «Dann ist ja jetzt alles aufgeräumt und in bester Ordnung!»
«Ja», lachte der Archivar, «mindestens für den Moment. Schlaf gut!»
2
Langsam schritt er auf dem knarrenden Parkett der niedrigen Bauernstube von Vitrine zu Vitrine: kleine Kristalle, grosse Kristalle, transparente, grünliche, bläuliche, sogar fast schwarze. Die meisten kamen aus dem Furkagebiet, nichts vom Gemsstock, Teufelstal, Nätschen. Eigentlich war ihm dieser Ziegler doch wirklich egal. Er hatte keinen Moment an ihn gedacht, als er sich zu diesem Ausflug nach Andermatt entschloss; an Füglistaller schon, natürlich, an die Angina-pectoris-Patientin auch und an die Sommerwanderung mit Nina. Und nun drängte dieser geschniegelte Hobbystrahler sich schon wieder auf. Er blickte durch eines der kleinen, mehrfach unterteilten Fenster auf den kleinen Platz: eine Art Ausbuchtung der Hauptgasse, der Gotthardstrasse. Es dämmerte schon, war ja auch erst Anfang Februar. Die Fenster des ehrwürdigen Hotels «Sonne» vis-à-vis schimmerten einladend. Er würde aber nicht hier übernachten, sondern mit dem letzten Zug zurückfahren, hatte er beschlossen. Seine Neugier war befriedigt. Und von diesem Ziegler wollte er sowieso nichts mehr wissen. Ausserdem kam er sich etwas deplatziert vor als blosser Wanderer zwischen all diesen in riesigen Schuhblöcken scheppernd wie Golems herumtappenden Sportlern. Das Geräusch der sich aneinander reibenden glatten Kunststoffanzüge war ihm immer noch im Ohr. Sorgfältig renoviert, dieses Suworowhaus (schon wieder eines), bemerkte er. In die Fenster waren tatsächlich sechs kleinere Scheiben eingefügt. Von aussen war ihm das Talmuseum vorgekommen wie ein überdimensionierter, bunt bemalter Bauernschrank. Der Mann stand ihm wieder lebendig vor Augen, seit er den Sohn gesehen hatte, genauer: seit er ihn sprechen gehört hatte. Er betrat den nächsten Raum und sah sich, umgeben von ausgestopften Kleintieren und Vögeln, nach Schilten versetzt. Nina hätte sie – mindestens zum Teil – gekannt. Er musste die Schilder lesen. Die Brille hatte er eh schon auf. Eigentlich hatte er das Talmuseum betreten, um das Bild dieses Ziegler loszuwerden, nicht um ihm wieder zu begegnen.
Nichtsahnend hatte er sich dem Sportgeschäft «Montanara» genähert. Auf diese Adresse lauteten die Gutscheine, die Nina von Lea zum Geburtstag bekommen hatte. Natürlich hätte er auch telefonieren können, hätte keinen Samstag dranzugeben brauchen. Aber manchmal war er eben neugierig und immer wanderlustig. Nicht wahr, Nina. Er hatte das Ferienhaus in Hospental sehen wollen, das Ferienhaus dieser Sofie, in dem Lea und Lajos manchmal eine Woche im Winter verbrachten. Deshalb war er hergefahren, nicht wegen der Schneeschuhe.
Dann hatte ihn dieser Schriftzug auf der verglasten Ladentür stutzig gemacht: «Reto Ziegler» stand da. Den Namen kannte er doch von der Todesanzeige. Er ging dann trotzdem hinein. Es musste ja nicht der sein. Es gab viele Zieglers auf der Welt. Er sah sich um zwischen den Ständern mit Windjacken, schneidig sich aneinander reibenden glatten Anzügen, Schuhen und weiteren Utensilien für verschiedenste sportliche Betätigungen, die er nicht kannte – wie die ausgestopften Tiere, die er eben musterte. So sahen die also aus. Wiesel, Dachs, Murmeltier, Maulwurf: die Namen kannte er allerdings. Bei diesem Scating, Boarding, Blading war er sich weniger sicher.
Im nächsten Raum blitzte ihm der Kirchenschatz von St. Peter und Paul in Andermatt entgegen. Ein nettes junges Mädchen hatte ihn dann schüchtern gefragt, ob sie ihm etwas zeigen dürfe. Ja, man könne hier schon geführte Schneeschuhwanderungen buchen. Sie eilte zu einem der Verkaufstische und holte ihm einen Prospekt. Er betrachtete ihn, etwa so interessiert wie jetzt das etwas naive Ölporträt. Es stellte den bärtigen Pater Bernhard Christen dar. General des Kapuzinerordens war der gewesen. Die Andermatter hatte es mit dem Militärischen. Diese Stimme dann: sonor, samtig, singend, aber messerscharf artikulierend. «Fräulein Danioth, würden Sie bitte gleich die neue Sendung Sonnenbrillen einordnen.»
Wie elektrisiert hatte sich der Archivar umgedreht. Lässig die Hand auf der Klinke, aber straff: so war ein Herr aus einem Hinterzimmer halb in den Laden getreten: hellgrauer Massanzug, schwarzes, straff nach hinten gekämmtes Haar, glatte, gebräunte Gesichtshaut. Die Gestalt schien ihm etwas zu korpulent, das Haar etwas zu dünn, hinten zu einem Rossschwänzchen gebunden, wahrscheinlich um die beginnende Glatze zu verdecken. Er musste ja auch älter sein als sein Vater damals. Es gab keinen Zweifel. Das «Jawohl, Herr Ziegler» des errötenden Fräulein Danioth hätte es nicht mehr gebraucht.
«Zu Befehl, Herr Adjutant», hatten sie jeweils sagen müssen. Er hatte sich freundlich bedankt. Und das Geschäft schnell verlassen.
Um auf andere Gedanken zu kommen, hatte er kurzerhand das Museum betreten. Die Ahnentafel der Baumeisterfamilie Schmid von Ursern war unterhaltsamer als das Porträt des Ordensgenerals, aufgeteilt in verschiedene Felder wie die kleinen Fenster des Museumsgebäudes, wie seine bemalte Holzfassade, der Bauernschrank. In jedem stand zentral in eleganter Pose ein Vertreter der Architektendynastie mit Dreispitz und Spitzenkragen, Pluderhose und Talar. Jeder hielt in der linken Hand einen entrollten Gebäudegrundriss. Sie vertrieben das Bild, das der Ordensgeneral in ihm evoziert hatte: den Eisenbahnwagen voller Soldaten, in den er geraten war auf seiner Fahrt von Realp nach Andermatt zurück, alle in gefleckten braunen Kampfanzügen. War da irgendein Anlass zu bewachen in Andermatt, hatte er sich gefragt, dass die da kamen – vom Wallis her, am Samstag: ein Manöver, ein Sportanlass? Ein Empfang des sehnlich erwarteten ägyptischen Talsanierers Sawiris oder der jährliche Russen-Besuch beim Suworowdenkmal, der russischen Enklave im Kanton Uri?
Die alten Bodenbretter knarrten, als er weiterging in den nächsten Raum zum Thema «Militaria». Wie denn nicht in Andermatt? Verschiedene Helme waren zu sehen, Geschütze, alte Uniformen. Als er vor gut dreissig Jahren zum ersten Mal hier herauf gefahren war, aber von Göschenen her, da hatte er auch eine Uniform getragen, in die er nicht hineinpasste – seinem Wesen nach, das auch noch kein sicherer Besitz war, weshalb er sich ganz in sich zurückzog, kaum etwas von sich zeigte, sodass nur die Uniform herumging und Dienst tat. Es war kein Kampfanzug gewesen wie bei denen im Eisenbahnwagen von eben. Junge, frische Gesichter waren das, mit ganz verschiedenen Zügen. Das sah er trotz der Uniformen. Bei den ihm zunächst Sitzenden waren die Wangen leicht gerötet, der Blick etwas wässrig. Entspannt hingen sie in den Sitzen, sprachen ein voll tönendes Italienisch, griffen immer wieder nachlässig zu einer Flasche Vermouth, die zwischen ihnen stand auf dem Fensterbrett mit dem Streckenplan der Matterhorn-Gotthard-Bahn. Verhalf ihnen das dazu, mit der Uniform eins zu werden? Oder eher dazu, sich von ihr abzusetzen? Sie hatten ja wohl auch heute noch Anschisse zu gewärtigen.
Er war der einzige Besucher im Talmuseum. Jedenfalls hörte er es sonst nirgends knarren. Wieder neue Vitrinen, vor denen er stand. Sie erinnerten an die hohe Zeit des Tourismus im Tal. Durchs kleine Fenster sah er: Es war Nacht geworden. Er würde nachher in aller Ruhe essen gehen, vielleicht in der «Sonne» oder sonst in einem der zahlreichen Gasthäuser, die noch übrig waren aus jener hohen Zeit und jetzt während der Skisaison wohl auch geöffnet. Dann würde er den letzten Zug nehmen nach Zürich, weg von diesem Ziegler.
Warum hatte Füglistaller wohl so viel getrunken damals? Um die Illusion möglichst lang festhalten, die mit der Uniform erlangte Persönlichkeit möglichst lang bewahren zu können, um zu vergessen, dass er sie mit der Uniform wieder würde ablegen müssen? Ziegler durfte die Uniform immer tragen, brauchte also nicht zu trinken. Aber an den wollte er jetzt nicht mehr denken, auch nicht an Füglistaller. Dass man sowas als ein «Dürfen» empfinden konnte …
Die 1866 fertig gestellten Passstrassen über Gotthard, Oberalp, Furka waren, las er, die Voraussetzung gewesen für die hohe Zeit, den Hotelboom, mehr als ein halbes Jahrhundert nach Suworow. Damals hatte man noch von der Säumerei gelebt im breiten Trogtal.
Wie hiess schon der Spruch beim Eingang der barokken Karls-Kapelle in Hospental? Irgendwas von der Entscheidung des Wanderers zwischen dem ewigen Rom und dem heiligen Köln. Aber gereimt. Er brachte es nicht mehr zusammen. Auch das Stichwort Wasserreservoir des Landes blitzte auf, das die Schlauen heute wieder betonten. Trinkwasser würde bald einmal ein teures Gut werden.
Plötzlich fiel ihm Theo Fasel ein, über den er mit Nina gesprochen hatte, als sie hier oben wanderten. Fasel habe über solche Dinge Bescheid gewusst: der alte Bund der Eidgenossen als Interessengemeinschaft derer, die an der Säumerei verdienten und so weiter. So habe er den Studierenden doziert damals auf der Reise. Dann hatte der Tourismus zwei schwere Stösse erlitten, wenn man ihm Leidensfähigkeit zubilligen mochte wie diese listenförmige Chronik an der Wand: zuerst den Bau des Bahntunnels und dann den des Autobahntunnels. Und seit auch die Bedeutung Andermatts als Truppenstandort gesunken war, kränkelte er eher noch mehr, der gute Tourismus, wenn der Archivar den Klagen der «Rössli»-Wirtin in Hospental glauben wollte. Immerhin hatte sie während der Winterferien ihr Haus voll: Stammgäste. Und Sawiris? Ja, von dem verspreche man sich jetzt viel. Man müsse halt abwarten. Sicher werde das auch wieder Nachteile mit sich bringen. Und sie da oben hätten ohnehin nicht viel davon. Der projektierte Golfplatz reiche nicht bis Hospental.
Der Archivar betrat den Raum «Alpwirtschaft». Auch hier knarrten die Dielen. Nur die Treppen knarrten nicht. Sie waren neu.
Ferienhäuser und -wohnungen gab es auch noch im Tal, hatte die «Rössli»-Wirtin erzählt. Die speisten dann häufig bei ihr, natürlich nicht die Häuser, das hatte er schon verstanden, genauso wenig wie der Tourismus litt. Es litten die Leute wie Frau Senn, die nichts zu tun hatte mit diesen hölzernen Bottichen für die Butterzubereitung auf der Alp in alter Zeit. Wegen eines solchen Ferienhauses hatte er ja hier Halt gemacht auf seiner Samstagswanderung von Andermatt nach Realp, immer die Sonne vor sich, die den Schnee gleissen machte. Sofies Haus musste das kleine am unteren Dorfeingang sein, das unterste jenseits der Gotthardreuss. Fast hätten sie es sehen können von ihrem Fenster aus: Nina und er damals im historischen Zimmer des Hotels «Gotthard».