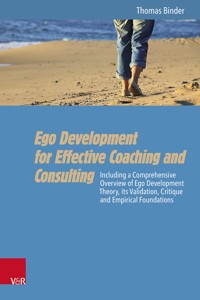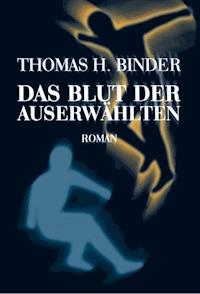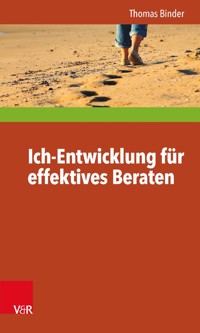
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Interdisziplinäre Beratungsforschung
- Sprache: Deutsch
Für eine erfolgreiche prozessorientierte Beratung bedarf es einer Reihe von nichtfachlichen Kompetenzen – so sehen es Forschung und Praxis. Thomas Binder untersucht, inwiefern diese Kompetenzanforderungen im Zusammenhang mit der Persönlichkeitsentwicklung stehen. Dafür bildet Loevingers Modell der Ich-Entwicklung, eines der besterforschten Modelle der Persönlichkeitsentwicklung, den Bezugsrahmen. Auf der Grundlage des aktuellen Forschungsstands zum Ich-Entwicklungsmodell analysiert Thomas Binder Zusammenhänge mit Beratungskompetenzen. Er untersucht Kompetenzanforderungen ausgewählter Beratungsverbände daraufhin, ob sich in ihnen Aspekte von Ich-Entwicklung zeigen. Zusätzlich analysiert er systematisch empirische Studien, in denen Ich-Entwicklung und beratungsrelevante Aspekte zusammen überprüft wurden. Die Ergebnisse zeigen einen klaren Zusammenhang zwischen Beratungskompetenzen und Ich-Entwicklung: Mit zunehmender Ich-Entwicklung kommt es zu einer höheren Beratungskompetenz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INTERDISZIPLINÄRE BERATUNGSFORSCHUNG
Herausgegeben von Stefan Busse, Rolf Haubl, Heidi Möller, Christiane Schiersmann
Band 11: Thomas BinderIch-Entwicklung für effektives Beraten
Thomas Binder
Ich-Entwicklung für effektives Beraten
Mit einem Vorwort von Susanne Cook-Greuter
Vandenhoeck & Ruprecht
Gefördert durch die Deutsche Gesellschaft für Supervision e.V. (DGSv).
Mit 26 Abbildungen und 32 Tabellen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
2., unveränderte Auflage 2019
© 2019, 2016 Vandenhoeck & Ruprecht, Robert-Bosch-Breite 10, D-37079 Göttingen, ein Imprint der Brill-Gruppe (Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)
Koninklijke Brill NV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Hotei, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau, V&R unipress und Wageningen Academic.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: photobac/shutterstock.com
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Erstellung: Lumina Datamatics, Grieshiem
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISBN 978-3-647-99317-1
Inhalt
Vorwort von Susanne Cook-Greuter
1 Einleitung, Relevanz und Überblick
1.1 Einleitung und Relevanz
1.2 Überblick über die Arbeit
2 Ich-Entwicklung
2.1 Detaillierte Darstellung des Ich-Entwicklungsmodells von Loevinger
2.1.1 Das Ich – ein Definitionsversuch
2.1.2 Die »Entdeckung« und Entwicklung des Modells
2.1.3 Stufen der Ich-Entwicklung
2.1.3.1 Die frühen Stufen der Ich-Entwicklung
2.1.3.2 Die mittleren Stufen der Ich-Entwicklung
2.1.3.3 Die späten Stufen der Ich-Entwicklung
2.1.4 Aspekte und Bereiche der Ich-Entwicklung
2.1.5 Ich-Entwicklung als Transformation
2.1.6 Ebenen der Entwicklung
2.1.6.1 Vorkonventionelle Ebene
2.1.6.2 Konventionelle Ebene
2.1.6.3 Postkonventionelle Ebene
2.1.7 Die Erweiterung der postkonventionellen Ebene nach Cook-Greuter
2.1.7.1 Die Neuinterpretation der Postkonventionellen Ebene
2.1.7.2 Die letzten beiden Stufen der Ich-Entwicklung nach Cook-Greuter
2.1.8 Exkurs: Kegans Subjekt-Objekt-Theorie der Entwicklung des Selbst
2.1.8.1 Die »Entdeckung« des Subjekt-Objekt-Modells
2.1.8.2 Kognition und Emotion als zwei Seiten der Entwicklung
2.1.8.3 Subjekt-Objekt-Beziehungen als Grundlage der Bedeutungsbildung
2.1.8.4 Der spiralförmige Prozess der Entwicklung des Selbst
2.1.8.5 Hauptstufen des Selbst
2.1.9 Stabilität und Veränderbarkeit von Ich-Entwicklung
2.1.9.1 Alter und Ich-Entwicklung
2.1.9.2 Das Erreichen eines stabilen Gleichgewichts der Ich-Entwicklung
2.1.9.3 Mechanismen der Stabilität und Veränderbarkeit von Persönlichkeit in Bezug auf Ich-Entwicklung
2.1.9.4 Fazit zur Veränderbarkeit von Ich-Entwicklung im Erwachsenenalter
2.1.10 Verteilung der Ich-Entwicklungsstufen im Erwachsenenalter
2.1.10.1 Loevinger-basierte Studien
2.1.10.2 Vergleich mit Studien zu Kegans Ich-Entwicklungsmodell
2.1.11 Ich-Entwicklung und Persönlichkeit
2.1.11.1 Begriffsklärung Persönlichkeit
2.1.11.2 Ich-Entwicklung und Eigenschaftsansätze der Persönlichkeit
2.1.11.3 Ich-Entwicklung im Rahmen integrativer Persönlichkeitsansätze
2.1.11.3.1 Ich-Entwicklung im Rahmen des Drei-Ebenen-Modells der Persönlichkeit von McAdams
2.1.11.3.2 Ich-Entwicklung im Rahmen der Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen von Kuhl
2.1.12 Kritik am Ich-Entwicklungsmodell von Loevinger
2.1.12.1 Fehlende Definition des Ichs und von Ich-Entwicklung
2.1.12.2 Infragestellen der Einheit des Ichs
2.1.12.3 Keine harte Strukturtheorie im Sinne Piagets
2.1.12.4 Kein Messverfahren, das Tiefenstruktur misst
2.1.12.5 Unzureichende Erklärung der Mechanismen von Ich-Entwicklung
2.1.12.6 Fehlende Berücksichtigung von Anpassungsleistungen
2.2 Empirische Überprüfung des Ich-Entwicklungs-Modells
2.2.1 Reliabilität
2.2.2 Validität
2.2.2.1 Diskriminante und inkrementelle Validität
2.2.2.1.1 Ich-Entwicklung und sozio-ökonomischer Status
2.2.2.1.2 Ich-Entwicklung und Intelligenz
2.2.2.1.3 Ich-Entwicklung und Sprachvermögen
2.2.2.2 Konvergente Validität
2.2.2.2.1 Ich-Entwicklung und andere Verfahren und Konzepte für Reife
2.2.2.2.2 Ich-Entwicklung und Verfahren zur Messung einzelner Aspekte
2.2.2.2.2.1 Charakter als Bereich von Ich-Entwicklung
2.2.2.2.2.2 Interpersoneller Stil als Bereich von Ich-Entwicklung
2.2.2.2.2.3 Bewusstseinsfokus als Bereich von Ich-Entwicklung
2.2.2.2.2.4 Kognitiver Stil als Bereich von Ich-Entwicklung
2.2.2.3 Die Einheit des Ichs
2.2.2.4 Sequentialität der Stufen
2.2.2.4.1 Querschnittsstudien
2.2.2.4.2 Längsschnittstudien
2.2.2.4.3 Interventionsstudien
2.2.2.4.4 Studien zur Asymmetrie des Verständnisses von Ich-Entwicklung
2.2.2.4.5 Untersuchungen zur Regelhaftigkeit von Antwortmustern
2.2.2.4.6 Biographieforschung anhand von Kriterien der Ich-Entwicklung
2.2.2.5 Kulturelle Universalität von Ich-Entwicklung
2.2.3 Fazit
3 Analysen zu Beratungskompetenz und Ich-Entwicklung
3.1 Fragestellungen
3.2 Begriffsklärung Beratung
3.3 Begriffsklärung Kompetenz
3.4 Inhaltliche Parallelen zwischen Kompetenzanforderungen an Berater und Aspekten der Ich-Entwicklung
3.4.1 Methodisches Vorgehen
3.4.1.1 Auswahl der Berufsverbände
3.4.1.2 Auswahl und Auswertung der Kompetenzanforderungen
3.4.2 Ergebnisse: Aspekte der Ich-Entwicklung in Kompetenzanforderungen von Beratungsverbänden
3.4.3 Beispielhafte Begründungen für inhaltliche Parallelen und vorauszusetzende Mindestniveaus an Ich-Entwicklung
3.4.4 Fazit
3.5 Empirische Zusammenhänge zwischen Beratungskompetenzen und Aspekten der Ich-Entwicklung
3.5.1 Studien innerhalb des Beratungskontexts
3.5.1.1 Studien mit Fokus auf Empathie
3.5.1.2 Studien mit Fokus auf Beratungskompetenz beziehungsweise Beratungseffektivität
3.5.1.3 Studien mit Fokus auf Passung zwischen Berater und Kunde
3.5.1.4 Studien mit Fokus auf eigenes Wohlbefinden und Selbstregulation
3.5.1.5 Studien mit Fokus auf Moral, ethische Einstellungen und Werte
3.5.2 Weitere relevante Studien außerhalb des Beratungskontexts
3.5.2.1 Studien mit Fokus auf Selbstkompetenz
3.5.2.2 Studien mit Fokus auf Umgang mit Komplexität
3.5.3 Fazit
4 Diskussion und Ausblick
4.1 Diskussion
4.1.1 Diskussion zum Modell der Ich-Entwicklung
4.1.2 Diskussion zum Zusammenhang zwischen Beratungskompetenz und Ich-Entwicklung
4.1.2.1 Inhaltliche Parallelen zwischen Kompetenzanforderungen an Berater und Aspekten der Ich-Entwicklung
4.1.2.2 Empirische Zusammenhänge zwischen Beratungskompetenzen und Aspekten der Ich-Entwicklung
4.2 Ausblick
4.2.1 Ausblick für die weitere Forschung
4.2.2 Ausblick für die Praxis
Literatur
Anhang
Anlage 1: Übersicht der Ich-Entwicklungsstufen (nach Binder, 2010)
Anlage 2: Interpersonal Understanding Scale (Spencer u. Spencer, 1993, S. 39)
Anlage 3: Zusammenfassung der empirischen Erhebung (vgl. Binder, 2014b)
Als ich ein Junge von 14 Jahren war,
war mein Vater so ignorant,
dass ich es kaum ertragen konnte,
den alten Mann um mich herum zu haben.
Aber als ich 21 wurde, war ich erstaunt,
wie viel er in den sieben Jahren gelernt hatte.
Mark Twain
(nach Loeb, 1996, S. 15, e. Ü.)
Vorwort
Als Forscherin, die Jahrzehnte im Bereich der Erwachsenenentwicklung tätig ist, hat man selten das Vergnügen, den klaren und eleganten Ausdruck eines jüngeren Kollegen und dessen intellektuellen Beitrag zum eigenen Forschungsgebiet zu rühmen. Thomas Binder und ich haben beide einen Großteil unseres Erwachsenenlebens fast unabhängig voneinander damit verbracht, die wegweisende Arbeit von Jane Loevinger zur Ich-Entwicklung zu erforschen, zu erweitern und für die Praxis nutzbar zu machen. Bei ihm ist dies durch sein großes Engagement und seine Neugier als Berater, Coach und Wissenschaftler gleichermaßen getrieben. Ich hoffe, dass seine Arbeit dazu beiträgt, dass Forscher, Berater und Führungskräfte immer mehr erkennen, dass in der vertikalen Entwicklung Erwachsener oft der Unterschied liegt, der einen Unterschied macht.
Das Modell der Ich-Entwicklung zeigt uns, wie Menschen sich über qualitativ unterschiedliche und aufeinander aufbauende Stufen im Laufe ihres Lebens entwickeln. Im Bereich der Erwachsenenentwicklung neigen die meisten Modelle dazu, kognitive Komplexität als einziges Merkmal von Reife zu bevorzugen. Ich nenne das gern »Aboutism«, weil man lernen kann, über (»about«) jedes Thema – einschließlich Selbstentwicklung und Moral – komplex zu denken, ohne dessen Kern zu verkörpern. Ich-Entwicklung ist hingegen ein den ganzen Menschen umfassendes Konzept. Es zeigt, welche Bedürfnisse Menschen haben, worauf sie achten, wie sie sich selbst definieren, mit anderen umgehen und wie sie denken und empfinden. Kurz, was sie auf dem langen und manchmal steinigen Weg menschlicher Entwicklung schon gemeistert haben und welche Grenzen noch vorhanden sind.
Mit seiner Arbeit legt Thomas Binder die weltweit umfassendste und gründlichste Untersuchung des Konzepts der Ich-Entwicklung vor: Er beschreibt es in seiner Entstehung, seinen vielfältigen Facetten, Kritikpunkten und Erweiterungen und vergleicht es mit anderen Persönlichkeitsmodellen. Zudem liefert er erstmals eine komplette Darstellung der empirischen Grundlagen des Ich-Entwicklungsmodells und des projektiven Testverfahrens, auf dem es beruht. Dazu analysiert er sorgfältig Hunderte von Studien, die Loevingers Ansatz aus allen möglichen Ecken der Psychometrie zu überprüfen oder anzufechten versuchten. Er untersucht die aufgeworfenen Fragen mit umfassendem psychometrischem Know-how und bietet aussagekräftige Daten, Diagramme und Argumente, um die vielfältigen Forschungsergebnisse einordnen zu können. So zeigt sich, dass das Ich-Entwicklungsmodell (und die dazugehörige Messmethodik) heutzutage als eines der bestgesicherten Stufenmodelle der Entwicklung gelten kann.
Auf dieser Grundlage nimmt er eine umfassende Analyse des Zusammenhangs zwischen Kompetenzanforderungen bei prozessorienterter Beratung und Aspekten der Ich-Entwicklung vor. Anschaulich zeigt sich hier, wie vielfältig diese mit vertikaler Entwicklung verknüpft sind. Ebenso weisen diese empirischen Analysen aber auch darauf hin, welches Mindestniveau an persönlicher Reife für effektive Beratung eigentlich erforderlich ist. Wie seine Schlussfolgerungen zeigen, kann ein großer Prozentsatz von Erwachsenen die dafür notwendigen Einsichten noch nicht erlangen und danach handeln.
Thomas Binders Buch kann viele weitere Gebiete wie Pädagogik, Therapie, Coaching, Management oder Führungskräfteentwicklung anregen, ihre Fragen auch unter einer Ich-Entwicklungsperspektive zu betrachten. Denn so wie sich unsere Außenwelt immer schneller verändert, steigen auch die Anforderungen an Erwachsene, urteilsfähiger zu sein und flexibler weitere, langfristigere und vielfältigere Blickwinkel einzunehmen. Ohne Beachtung der Wechselbeziehungen zwischen Personen, Gruppen, kulturellen Systemen und globalen Gegebenheiten können wir die ernsten Herausforderungen, denen wir als Menschheit gegenüberstehen, kaum meistern.
Mit seiner hingebungsvollen Arbeit weist Thomas Binder die anhaltende Kraft der Ich-Entwicklungstheorie zum Verständnis menschlichen Wachstums und Gedeihens nach und untermauert sie gekonnt. In seinem Ausblick zeigt er zudem, was dies im Beratungskontext für die Praxis bedeuten könnte. Ich wünsche ihm und diesem Werk, dass es noch viel mehr Bereiche und Menschen erreicht. Denn es weist wissenschaftlich fundiert und gut lesbar nach, dass Persönlichkeitsentwicklung längst keine »Esoterik« mehr ist, und zeigt, dass man persönliche Reife mittlerweile valide messen und auch gezielt fördern kann.
Susanne Cook-Greuter
1 Einleitung, Relevanz und Überblick
1.1 Einleitung und Relevanz
Ausgangspunkt dieser (gekürzten) Forschungsarbeit sind meine persönlichen Erfahrungen im Beratungs- und Ausbildungskontext. Seit 1995 arbeite ich als Organisationsberater, seit 2002 zudem als Supervisor und Coach sowie als fachlicher Leiter einer einjährigen Change Management-Ausbildung. Seit 2005 bin ich ebenfalls als Referent in weiteren Prozessberatungsausbildungen im Kontext systemischer Beratung und Organisationsentwicklung tätig. Seitdem beschäftigten mich immer wieder Fragen wie die folgenden:
– Worauf sind unterschiedliche Fähigkeitsniveaus der Ausbildungsteilnehmer1 zurückzuführen, vermittelte Ansätze und Instrumente effektiv in Beratungen einzusetzen?
– Woran liegt es, dass manche Berater an der Problembeschreibung des Klienten »festzukleben« scheinen, während andere mühelos die beschriebene Situation umdeuten können, zusätzliche Fragestellungen ins Spiel bringen und dadurch zu einer erheblich flexibleren Beratung imstande sind?
– Wie ist zu verstehen, dass Führungskräfte sehr unterschiedlich mit Feedback umgehen? Manche wünschen sich Rückmeldung, geraten aber selbst bei vorsichtigstem Formulieren leicht in Verteidigungshaltung. Andere scheinen unterschiedliche Perspektiven eher als Geschenk zu empfinden.
Diese Unterschiede schienen mir weniger durch Intelligenz oder Persönlichkeitseigenschaften – wie etwa die im Big Five-Modell der Persönlichkeit beschriebenen – bedingt zu sein. Vielmehr vermutete ich, dass sich dahinter eine Entwicklungskomponente verbarg, die mir aus meiner früheren Zeit als Projektmitarbeiter am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (MPIB) vertraut war. In dieser Zeit arbeitete ich im Forschungsbereich von Wolfgang Edelstein (z. B. Grundmann, Binder, Edelstein u. Krettenauer, 1998) und war mit Interviews, Interviewertraining und Scoring zu Kohlbergs Entwicklungsmodell moralischen Urteilens beschäftigt. Dort kam ich mit dem Ich-Entwicklungsmodell von Jane Loevinger in Kontakt, dessen Erhebungsinstrument im Rahmen einer Längsschnittstudie des MPIB in Island eingesetzt wurde (Edelstein u. Krettenauer, 2004). Ebenso lernte ich Augusto Blasi kennen, einen von Loevingers engsten ehemaligen Mitarbeitern, der im Rahmen seiner Aufenthalte auch Scorertrainings für dieses Instrument durchführte. Als Modell, das Stufen der Persönlichkeitsentwicklung (Loevinger, 1997) und nicht einzelne Entwicklungsaspekte wie Moral oder soziale Perspektivenübernahme beschreibt, schien mir das Ich-Entwicklungsmodell besonders geeignet, ein neues Licht auf meine Fragen zu werfen und sie dadurch beantworten zu helfen (Habecker u. Binder, 2014). Dies führte zu meinem Entschluss, diese Fragen für den Beratungskontext detailliert zu untersuchen.
Vergegenwärtigt man sich die Herausforderungen, die erfolgreiche Berater meistern müssen, weisen die dafür notwendigen Kompetenzen einige Parallelen zu Loevingers Ich-Entwicklungsmodell auf. Dies sei am Beispiel des Deutschen Berufsverbands für Coaching e. V. (DBVC) illustriert. In dessen Kompendium findet sich unter dem Abschnitt »Kompetenzprofil eines Coach« folgende Beschreibung der persönlichen Anforderungen (Wolf, 2009):
»Ein Coach muss in der Lage sein, sich selbst effektiv als Werkzeug in der Beratung einzusetzen – jenseits von Darstellungsdrang, aber auch jenseits von Selbstverleugnung. Dazu braucht er als überfachliche Qualifikation insbesondere eine realistische Selbsteinschätzung, emotionale Stabilität, ein gesundes Selbstwertgefühl, Verantwortungsbewusstsein, intellektuelle Beweglichkeit und Einfühlungsvermögen« (S. 36).
In der obigen Beschreibung des DBVC werden Aspekte von Impulskontrolle (»Darstellungsdrang«), interpersonellem Stil (»Verantwortungsbewusstsein«), Bewusstseinsfokus (»realistische Selbsteinschätzung«) und kognitiver Entwicklung (»intellektuelle Beweglichkeit«) berührt (siehe S. 38). All dies sind Bereiche, die sich in Loevingers Ich-Entwicklungsmodell wiederfinden – allerdings korrespondieren sie dort mit Qualitäten, die nach Loevingers Ich-Entwicklungsmodell mindestens auf der Eigenbestimmten Stufe (E6) anzusiedeln sind.
Zusammen mit meinen persönlichen Erfahrungen weckt dies Zweifel, ob die am Beispiel des DBVC aufgeführten Anforderungen von Beratern aufgrund ihres Entwicklungsniveaus mehrheitlich auch erreicht werden können: Denn die Mehrzahl der Erwachsenenbevölkerung in westlichen Gesellschaften erreicht kein Entwicklungsniveau, das einer vollen Eigenbestimmten Stufe (E6) der Ich-Entwicklung entspricht (Cohn, 1998). Vielmehr stabilisiert sich Ich-Entwicklung bis zur Mitte des zweiten Lebensjahrzehnts bei den meisten Erwachsenen auf der Rationalistischen Stufe (E5) (Loevinger, 1976; Westenberg u. Gjerde, 1999; Syed u. Seifge-Krenke, 2013). Daher könnten Berater trotz umfassender Weiterbildung in einen Zustand geraten, den Kegan (1996) in seiner Analyse von Anforderungen an Erwachsene als »in over our heads« bezeichnet: den eigenen Horizont überschreitend.
Den Bezugsrahmen dieser Arbeit bildet das Modell der Ich-Entwicklung von Loevinger, die sich selbst rückblickend beschreibt als »eine Psychologin, deren Arbeit am Rande von Psychometrie, Persönlichkeitstheorie und, wenn es sein musste, psychoanalytischer Theorie und Wissenschaftstheorie lag« (Loevinger, 2002, S. 195, e. Ü.). Ihr Modell ist gleichzeitig eine Persönlichkeitstheorie und ein entwicklungspsychologisches Stufenmodell (siehe S. 32). Es schlägt damit eine Brücke zwischen zwei Disziplinen, denn »Persönlichkeitstheorien fehlt oft das Verständnis von Entwicklung und Entwicklungstheorien das Verständnis individueller Unterschiede« (Westenberg, Blasi u. Cohn, 1998, S. 1, e. Ü.). Loevingers Modell ist ein entwicklungspsychologisches Modell, das dem Bereich der Stufentheorien zuzuordnen ist, in denen Entwicklung nicht kontinuierlich »›als allmählicher Übergang‹ mit kleinen Verhaltensveränderungen verstanden wird« (Garz, 2008, S. 8), sondern diskontinuierlich im Sinne qualitativer Entwicklungsschritte. Stufentheorien interpretieren Entwicklung nicht als intern angelegten Reifungsprozess oder als Reaktion auf die Umwelt, sondern als aktive Auseinandersetzung eines Menschen mit seiner Umwelt, der zumindest ab einer gewissen Entwicklungsstufe als »reflexiv handelndes Subjekt« (Hoff, 2003) zu sehen ist. Sie nehmen insofern einen »interaktionistischen Standpunkt« ein (Lerner, 2002, S. 372, e. Ü.).
Loevingers Modell scheint geeigneter als andere Entwicklungsmodelle, einen Beitrag zur Erklärung von Kompetenzunterschieden bei Beratern (oder auch Führungskräften) zu leisten. Denn es ist kein Bereichsmodell der Entwicklung (wie Kohlbergs Modell moralischen Urteilens), sondern das Ich wird darin als holistisches Konstrukt verstanden. Es ist auch kein rein kognitives Entwicklungsmodell, sondern »betrifft [auch] Impulse und Methoden, diese zu kontrollieren, persönliche Sorgen und Ambitionen, interpersonelle Einstellungen und soziale Werte« (Blasi, 1998, S. 15, e. Ü.). Das Ich-Entwicklungsmodell beinhaltet auch den Aspekt der Identitätsbildung (Kroger, 2004) – vor allem die Frage, was dem eigenen Ich als zugehörig empfunden wird und wie die Grenze zu anderen gezogen wird. Dieser Aspekt, den auch Kegan (1994) in seinem Modell der Ich-Entwicklung betont, ist gerade für Beratung wichtig – beispielsweise wenn es darum geht, unabhängig von (vermeintlichen) Erwartungen anderer zu agieren oder Abstand zu den eigenen Wirklichkeitskonstruktionen zu gewinnen, wie dies vor allem für späte (postkonventionelle) Stufen der Ich-Entwicklung kennzeichnend ist. Zudem wird Ich-Entwicklung von Kompetenzforschern selbst als ein Persönlichkeitsaspekt verstanden, der mit Kompetenz im Zusammenhang steht (Boyatzis, 1982, S. 33).
Berater haben es zudem oft mit Problemsituationen zu tun, die hohe Anforderungen an den Umgang mit Komplexität stellen. Dies verdeutlicht beispielsweise folgende Beschreibung der Supervisionstätigkeit aus einer Broschüre der Deutschen Gesellschaft für Supervision (DGSv) (Hausinger, 2011):
»Supervision arbeitet an den Schnittstellen Person – Tätigkeit – Rolle/Funktion – Organisation – Umwelt, Gesellschaft, das heißt, Supervision berücksichtigt differente Bezugssysteme mit ihren jeweiligen Logiken und Dynamiken. Deshalb weist Supervision einen mehrperspektivischen Ansatz auf. Anliegen werden sowohl aus verschiedenen Einzelperspektiven und im Detail betrachtet als auch im Gesamtkontext. In Supervision können somit das Allgemeine, das Spezielle und das Dahinderliegende zugleich berücksichtigt werden« (S. 9).
Beratungskontexte wie diese, die für prozessorientierte Beratungsformen wie Supervision, Coaching oder Organisationsentwicklung typisch sind, weisen somit viele Kennzeichen hoher Komplexität auf, wie sie beispielsweise von Dörner (2003) oder Wilke (2006) angesprochen werden:
– viele Einflussfaktoren,
– Vernetzung der einzelnen Elemente,
– eher schlecht definierte Probleme,
– hohe Folgewirkungen der Entscheidungen,
– Berücksichtigung unterschiedlicher Interessenlagen, Gefühle, Motive und Handlungsmuster.
Je umfassender und differenzierter Berater ihre Umwelt, sich selbst und ihre Rolle wahrnehmen, und je flexibler sie in solchen Kontexten agieren können, desto mehr sollte ihnen effektives Beraten möglich sein. Denn es gibt eine Reihe von »adaptiven Vorteile[n], die mit Funktionieren auf späteren Stufen der Ich-Entwicklung einhergehen« (Manners u. Durkin, 2000, S. 477, e. Ü.). Personen auf späten, sogenannten postkonventionellen, Stufen der Ich-Entwicklung zeichnen sich beispielsweise dadurch aus,
– dass sie komplexe soziale Situationen eher verstehen,
– leichter Perspektivwechsel vornehmen,
– Prozess und Ziel gleichzeitig im Auge behalten,
– aus Entweder-oder-Fragestellungen ein »sowohl-als-auch« machen
– und insgesamt eher eine Metaperspektive einnehmen können.
Aspekte wie diese werden in prozessorientierten Formen der Beratung als gängiges Repertoire professionellen Handelns beschrieben. Die Tatsache, dass nur 7 bis maximal 17 Prozent der Bevölkerung ein postkonventionelles Ich-Entwicklungsniveau erreichen (Torbert, 1991, 2003; Rooke u. Torbert, 2005; Cook-Greuter, 2010), legt eher die gegenteilige Vermutung nahe: dass dieses Repertoire für viele Berater in weiter Ferne liegt.
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Literatur zu Ich-Entwicklung in Hinblick auf deren Relevanz für Beratung strukturiert aufzuarbeiten und dazu in Bezug zu stellen. Damit wird der Frage nachgegangen, inwiefern es systematische Beziehungen zwischen Kompetenzanforderungen an Berater und Aspekten der Ich-Entwicklung gibt.
Im deutschsprachigen Raum gibt es kaum Forschung zu Ich-Entwicklung, obwohl kein geringerer als Habermas diese Forschungsrichtung schon frühzeitig in Deutschland aufgegriffen hatte (Döbert, Habermas u. Nunner-Winkler, 1977). Seitdem wurden nur vereinzelt deutsche Studien dazu durchgeführt (z. B. Vetter-Tesch, 1981; Soff, 1989; Hieber, 2000). Auch in theoretischen Werken wird Loevingers Ich-Entwicklungsmodell hierzulande nur am Rande, zum Beispiel im Lehrbuch zur Psychologie der Persönlichkeit (z. B. Asendorpf u. Neyer, 2012), oder gar nicht erwähnt, zum Beispiel in Greves (2000) Werk zur Psychologie des Selbst. Gerade weil letzeres ein grundlegendes Überblickswerk zu diesem Thema darstellt, ist dies erstaunlich. Eine Ausnahme ist der klinische Bereich, wo Loevingers Studien zum Beispiel im Lehrbuch »Klinische Entwicklungspsychologie« (Oerter, von Hagen, Röper u. Noam, 1999) explizit aufgegriffen werden.
Dass Loevingers Modell hierzulande so unbeachtet ist, steht im Kontrast zur internationalen Rezeption. Denn Loevingers Ich-Entwicklungsmodell wurde mittlerweile weltweit in Hunderten von empirischen Studien und theoretischen Publikationen aufgegriffen. 1993 – fast dreißig Jahre nach ihren ersten Veröffentlichungen dazu – widmete die Zeitschrift Psychological Inquiry Loevingers Ich-Entwicklungsmodell ein ganzes Themenheft und lud Forscher ein, sich daran zu beteiligen. Auch Loevinger selbst trieb über Jahrzehnte die Erforschung und Verfeinerung ihres Modells voran. So resümiert Kroger (2004, S. 124, e. Ü.), dass »sie eine der wenigen Sozialwissenschaftler war, die Identität oder ähnliche Phänomene erforschten, und die ihr Modell aus einer soliden empirischen Basis heraus entwickelten.«
Schon früh wurde Ich-Entwicklung auch als für Beratung relevantes Modell entdeckt (z. B. Swensen, 1980; Young-Eisendrath, 1982). Cebik (1985) zog beispielsweise für Supervisoren folgendes Fazit: »Fehler und Ineffektivität in den Fachrichtungen der psychischen Gesundheit könnten dadurch vermindert werden, dass die Ausbildung von Personen die eigene Ich-Entwicklungsstufe berücksichtigt« (S. 232, e. Ü.). Ebenso verwendeten viele Forscher Loevingers Ich-Entwicklungsmodell in empirischen Forschungen im Kontext von Counseling, Supervision oder Organisationsentwicklung. In diesen wurden zumeist einzelne Aspekte wie beispielsweise der Zusammenhang mit Empathie (z. B. Carlozzi, Gaa u. Liberman, 1983), Qualität des Interaktionsgeschehens zwischen Berater und Klient (Allen, 1980), Güte von Klientenbeschreibungen (Borders, Fong u. Neimeyer, 1986) oder Einstellungen gegenüber potenziellen Kunden (Sheaffer, Sias, Toriello u. Cubero, 2008) erforscht. In diesen Arbeiten findet sich zwar meist ein Abgleich mit Arbeiten zu ähnlichen Aspekten, es fehlt allerdings ein systematischer Vergleich und eine Zusammenstellung der Ergebnisse über die verschiedenen beratungsrelevanten Aspekte, die in empirischen Studien im Zusammenhang mit Ich-Entwicklung gefunden wurden. Auch ein späterer Überblick von Borders (1998) erfüllt dies nicht. Insofern besteht hier eine deutliche Forschungslücke.
Gerade in den letzten Jahren scheinen entwicklungspsychologische Stufenmodelle, insbesondere von Loevinger und Kegan, die sich auf Persönlichkeitsentwicklung insgesamt beziehen, verstärkt in der Praxis wahrgenommen zu werden. Dies betrifft vor allem den Kontext von Coaching, Beratung und Führungskräfteentwicklung (z. B. Torbert and Associates, 2004; Joiner u. Josephs, 2007; Bachkirova, 2010; McGuire u. Rhodes, 2009; Berger, 2012; Binder, 2010, 2014a). Insofern scheint eine strukturierte Aufarbeitung des Zusammenhangs von Ich-Entwicklung und Beratung nicht nur für die Forschung, sondern auch für die Praxis nützlich, zumal Ich-Entwicklung als zentraler Persönlichkeitsaspekt im deutschsprachigen Beratungskontext nach wie vor nahezu unbekannt ist.
1.2 Überblick über die Arbeit
Diese Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile. Das zweite Kapitel bietet eine aktuelle und umfassende Darstellung von Ich-Entwicklung, wie sie bisher in diesem Umfang nicht veröffentlicht wurde. Es gliedert sich in zwei Abschnitte: Der erste Abschnitt besteht in einem detaillierten Überblick zu Loevingers Ich-Entwicklungsmodell in all seinen relevanten Facetten. Im zweiten Abschnitt werden wichtige Studien zur empirischen Überprüfung von Loevingers Ich-Entwicklungsmodell systematisch zusammengestellt. Dieses Modell betrifft ein sehr umfassendes und schwer zu erschließendes Persönlichkeitskonstrukt. Es kommt vor, dass auch ausgewiesene Entwicklungsexperten das Modell in ihren Studien nicht adäquat einsetzen, beispielsweise indem unrealistische Interventionszeiträume gewählt werden. Daher werden die Studien in diesem Teil ausführlich besprochen. Schon an dieser Stelle wird das Thema in seinen unterschiedlichen Facetten so ausgelotet, dass mögliche Bezüge für den Bereich Beratung sichtbar werden können. Ebenso wird der gegenwärtige Stand der Forschung in einer Gesamtschau dargestellt, die in dieser ausführlichen Form auch in neueren Überblicksartikeln bisher nicht verfügbar ist (z. B. Manners u. Durkin, 2001; Westenberg, Hauser u. Cohn, 2004).
Das dritte Kapitel geht der Frage nach, ob ein Zusammenhang zwischen Ich-Entwicklung und effektivem Beraten besteht. Im ersten Abschnitt wird anhand von Kompetenzanforderungen ausgewählter Beratungsverbände untersucht, inwiefern es Parallelen zum Modell der Ich-Entwicklung gibt. Der zweite Abschnitt widmet sich dieser Fragestellung anhand empirischer Studien, in denen Ich-Entwicklung und für Beratung relevante Kompetenzaspekte zusammen erforscht wurden. Zu diesem Zweck wird ein Studienüberblick gegeben, der die dazu verfügbaren Studien nach Themenclustern ordnet (z. B. Ich-Entwicklung und Umgang mit Komplexität) und deren Vorgehen und Ergebnisse kommentiert.
Im vierten Kapitel dieser Arbeit werden die Ergebnisse vor dem Hintergrund des bisherigen Forschungsstands diskutiert. Zudem wird ein Ausblick gegeben, in dem die Konsequenzen, die sich aus dieser Arbeit ergeben, diskutiert werden: Einerseits werden Forschungslücken und -fragen erörtert, die sich bei der Auseinandersetzung mit dem Ich-Entwicklungsmodel und der dazu verfügbaren Forschung zeigten. Andererseits wird auf die praktischen Konsequenzen eingegangen, die sich aus den Ergebnissen dieser Arbeit für Beratung und Beratungsweiterbildungen ergeben.
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Bezeichnungen von Menschen in dieser Arbeit nur die männliche Form verwendet. Denn ein ständiger Wechsel zwischen weiblicher und männlicher Sprachform wird beim Lesen oft als umständlich empfunden. Damit geht keine Bevorzugung oder Geringschätzung eines Geschlechts einher. In allen diesen Fällen sind weibliche und männliche Personen gleichermaßen geschätzt.
2 Ich-Entwicklung
2.1 Detaillierte Darstellung des Ich-Entwicklungsmodells von Loevinger
2.1.1 Das Ich – ein Definitionsversuch
Ich – was ist das? Im Alltag benutzen wir dieses Wort meist, ohne groß darüber nachzudenken. »Ich« zu benutzen, erscheint uns als das Selbstverständlichste der Welt, beispielsweise wenn wir Sätze wie die folgenden vervollständigen:
– Ich denke, dass …
– Wenn ich kritisiert werde …
– Ich will, dass …
– Ich bin …
In all diesen Sätzen kommt ein handelnder Agent zum Ausdruck, der sich zur Welt positioniert, auf sie reagiert oder sie interpretiert. Doch wer agiert und reagiert dabei eigentlich? Und inwiefern ist das, worauf das Ich reagiert, von gerade diesem »Ich« abhängig, also: seiner spezifischen Struktur beziehungsweise dem Entwicklungsniveau dieser Struktur? Und kann man diese Struktur mit der Persönlichkeit eines Menschen gleichsetzen? Verfolgt man diese Gedanken weiter, dann betritt man ein Feld, das Philosophen, Mystiker, Religionsstifter und Soziologen seit Jahrhunderten beschäftigt. Auch Psychologen befassen sich seit gut einhundert Jahren damit, seit einigen Jahrzehnten besonders im Rahmen empirischer Forschung.
Beschäftigt man sich mit dem Ich, kann man schon in der Alltagssprache viele ähnliche Begriffe entdecken, etwa Ego, Selbst, Identität oder Persönlichkeit. Spätestens wenn man den Bereich der Psychologie betritt, erlebt man eine nahezu babylonische Sprachverwirrung: Selbstkonzept, Selbstbewusstsein, Ich-Bewusstheit, Selbstimage, Ich, Über-Ich, Ich-Stärke, Ich-Kontrolle, Ich-Funktionen und vieles mehr. Taucht man tiefer in die Begriffswelt des Ichs ein, bemerkt man, dass es nicht nur eine Vielzahl von ähnlichen Begriffen gibt, sondern dass ein und derselbe Begriff ganz anders gebraucht oder von einem Autor in komplett gegensätzlichem Sinne verstanden wird wie von einem anderen Autor. Als Young-Eisendrath und Hall (1987) im Jahre 1983 eine kleine Konferenz zum Thema »Selbst« organisieren wollten, überraschten sie bereits die mehr als 350 Anmeldungen von Forschern und Praktikern. Alle schienen jedoch von etwas anderem zu sprechen – und vor allem: »Niemand teilte eine gemeinsame Sprache« (S. xi, e. Ü.). Besonders in der psychoanalytischen Literatur zeigt sich dies deutlich (Redfearn, 1987), seit Freud das Ich mit seinem Strukturmodell (Es, Ich, Über-Ich) auch mehr in den psychoanalytischen Behandlungsfokus rückte (Eagle, 1991). Doch im Vergleich all dieser unterschiedlichen alltäglichen und psychologischen Termini scheint das Ich eine Sonderrolle einzunehmen. Was das Ich ist und wodurch es sich von anderen Aspekten der Persönlichkeit unterscheidet, bringt am besten William James in seinem berühmten Kapitel über das Selbst auf den Punkt (1892/1963). Die darunter stehende Abbildung 1 verdeutlicht dies.
»Das Mich und das Ich – was auch immer ich gerade denke, bin ich mir immer zur gleichen Zeit meiner selbst bewusst, meiner persönlichen Existenz. Zur gleichen Zeit bin ich es, der bewusst ist; so dass das ganze Selbst von mir, als ob es zweiseitig wäre, zum Teil erkannt und zum Teil erkennend, zum Teil Objekt und zum Teil Subjekt, zwei Aspekte sind, die voneinander unterschieden sein müssen. Der Kürze halber können wir das eine das Mich und das andere das Ich nennen« (S. 166, e. Ü.).
Abbildung 1: Zwei Seiten des Ichs: Subjekt und Objekt
James’ essenzielle Unterscheidung zwischen dem Ich und dem Mich wurde in der psychologischen Forschung oft nicht wahrgenommen oder vermischt (McAdams, 1996a, 1996b). Meist wurde nur die Objektseite (das Mich) oder ein Teil davon erforscht und die erkennende Seite (das Ich als Subjekt) ausgeklammert, wie beispielsweise in Eigenschaftsansätzen der Persönlichkeit (siehe S. 92).
In konstruktivistischen Entwicklungsansätzen hingegen ist das erkennende Subjekt seit den bahnbrechenden Arbeiten von Piaget (1932) das Hauptforschungsgebiet. Dieser sah sich selbst als Epistemologe (Erkenntnistheoretiker), den vor allem die Frage interessierte, wie ein Mensch überhaupt zu Wissen über die Welt gelangt und wie sich dessen »Erkenntnisapparat« entwickelt. Dies führte zu umfangreichen Studien, in denen erforscht wurde, wie ein Mensch über Jahre hinweg beispielsweise so komplexe Fähigkeiten wie das Verständnis von Zahlen, Mengen oder Kausalität erlangt. Dieser Prozess gipfelt darin, dass die meisten Menschen im Alter von etwa 20 Jahren das entwickelt haben, was Piaget eine funktionsfähige Formallogik nennt.
Doch der Erkenntnisapparat ist nur ein Teil von James’ »Ich«, wenn auch ein zentraler. Wenn ein Mensch »Ich« sagt, beinhaltet dies meist noch weitere Aspekte wie zum Beispiel Wünsche oder Ziele. Und es kommt dabei immer auch eine Art Haltung zur Welt zum Ausdruck. Insofern kann das Ich nicht auf den reinen Erkenntnisapparat des Menschen beschränkt werden, da dessen Denken und Handeln immer auch eine Intention beinhaltet. Nach Blasi (1988, S. 232, e. Ü.) ist »sein Glauben, Sehnen, Kontrollieren oder Hoffen nicht eine Komponente unter vielen, sondern durchdringt jeden Aspekt des Handelns und gibt ihm eine Einheit«. Diese Aspekte standen bei Piaget eher im Hintergrund. Er erkannte aber die Thematik und setzte sich an verschiedenen Stellen mit dem Selbst beziehungsweise dem Ich auseinander (Broughton, 1987). Auch er sah darin mehr als nur einen Erkenntnisapparat: »Es ist wie das Zentrum der eigenen Aktivität« (Piaget, 1967, S. 65, e. Ü.).
Wenn das Ich das erkennende Subjekt und auch das Zentrum der eigenen Aktivität ist, stellt sich die Frage, wie dieses Ich in seiner Gesamtheit »funktioniert« beziehungsweise was das Ich im Ganzen eigentlich ausmacht. Dieser Frage ging seit den 1960er Jahren Loevinger nach, indem sie das Ich empirisch erforschte. Dabei hatte sie sich das am Anfang gar nicht vorgenommen (siehe S. 26). Sie stolperte stattdessen zufällig in ihren Forschungen über Muster in ihren Daten, die sie mit dem klassischen (linearen) Paradigma von Einstellungs- und Eigenschaftstheorien nicht erklären konnte. Es fiel ihr vor allem auf, dass sich die untersuchten Personen nicht nur in der Komplexität des Denkens wie bei Piaget unterschieden. Sie zeigten auch große Unterschiede darin, wie sie beispielsweise ihre eigenen Impulse kontrollieren konnten. Aufgrund der großen Breite an miteinander verwobenen Aspekten, die auf unterschiedlichen Entwicklungsniveaus vorkamen, nannte sie diese Variable »Ich-Entwicklung«. Sie selbst sah so gut wie keinen Unterschied zur Bezeichnung »Selbst« (Loevinger, 1983, 1984a; Loevinger u. Blasi, 1991) und benutzte Ich und Selbst zum Teil identisch, im Gegensatz zu Jung (Adam, 2011).
Als Psychometrikerin kam es ihr darauf an, dieses »Ich« als Konstrukt zu erfassen, zu verstehen und valide messen zu können. Daher wehrte sie sich dagegen, das Ich beziehungsweise Ich-Entwicklung zu definieren (1983, S. 344–345, e. Ü.): »Ich bleibe dabei, es [das Ich] kann nicht und braucht auch nicht definiert zu werden. Es braucht nur aufgezeigt zu werden. Ich-Entwicklung ist das, was passiert, wenn eine Person von Impulsivität zu Selbst-Schutz zu Konformität etc. wächst.« Loevingers Konzeption des Ichs steht in Ergänzung, aber auch im Kontrast zu anderen Ansätzen. Vor allem in vielen psychoanalytischen Theorien wird das Ich anders konzeptualisiert (Mertens, 2010). Ein Beispiel ist das oben erwähnte Strukturmodell von Freud und die bekannte Einteilung in seine drei Instanzen Es (Triebe/Lustprinzip), Ich (Bewusstsein/Realitätsprinzip) und Über-Ich (Ansprüche/Moralische Instanz). Ein weiteres Beispiel ist die spätere psychoanalytische Ich-Psychologie (z. B. Hartmann, Rapaport), die in Folge von Anna Freuds Klassiker »Das Ich und die Abwehrmechanismen« (1936/2012) entstand. Dabei wurde das Ich als ein System von einzelnen Ich-Funktionen verstanden (z. B. wahrnehmen, denken, entscheiden).
Als Naturwissenschaftlerin waren Loevinger solche postulierten Instanzen oder Funktionen prinzipiell suspekt (Loevinger, 1983). Vor allem widersprachen sie dem, was sie in den von ihr erhobenen Forschungsdaten als eine Gesamtheit des Ichs auffand. Diese Daten bildeten offensichtlich ein Bündel von vielen Aspekten, die miteinander im Zusammenhang standen und für jede Entwicklungsstufe des Ichs ein »strukturiertes Ganzes« ergaben. Insofern verstand sie das Ich als Einheit, das man aus vielen einzelnen Aspekten entschlüsseln kann, wenn man das Muster versteht, was das Ich ausmacht: »Ich bin überzeugt, dass das Selbst, Ego, Ich oder Mich in einer gewissen Art real ist und nicht nur durch unsere Definition entstanden ist. Mein Ziel ist es, zu verstehen, wie ein Mensch durch das Leben navigiert, und nicht, künstlich abgegrenzte Einheiten zu schaffen« (Loevinger, 1984a, S. 50, e. Ü.). Wie sie dieses Ich versteht und es im Kontrast zu psychoanalytischen Konzeptionen sieht, beschreibt sie wie folgt:
»Das Ich ist vor allem ein Prozess und nicht ein Ding. Das Ich ist in gewisser Weise wie ein Gyroskop [Kreiselkompass], dessen aufrechte Position durch die Rotation aufrechterhalten wird. Oder, um eine andere Metapher zu benutzen: Das Ich ähnelt einem Bogen. Es gibt einen Spruch in der Architektur, der sagt: ›Der Bogen schläft nie‹. Das bedeutet, dass die Gewichte und Gegengewichte des Bogens seine Form aufrechterhalten und das Gebäude stützen. Piaget benutzt dafür den Ausdruck ›mobiles Equilibrium‹ – je beweglicher, desto stabiler. Das Streben danach, das Erleben zu meistern, zu integrieren und ihm Sinn zu verleihen, ist nicht eine Ich-Funktion unter vielen, sondern die Essenz des Ichs« (Loevinger, 1969, S. 85, e. Ü.).
McAdams (1996b) versteht das Ich ganz ähnlich und beschreibt es mit dem Kunstwort und Verb »selfing«, was man mit »ein Selbst erzeugen« übersetzen kann: »Selfing ist das Ich. Selfing ist der Prozess, die Erfahrung als die eigene zu bestimmen. Im und durch das Selfing weiß eine Person implizit, dass er oder sie als Quelle, als Handelnder, als Wurzel der Kausalität in der Welt existiert – unterschieden von anderen Quellen, Handelnden und Wurzeln der Kausalität« (S. 383, e. Ü.). Das Ich ist demnach eindeutig auf der Subjektseite von James’ Einteilung anzuordnen und ein Prozess, der sich in jeder Äußerung zeigt und die Gedanken und Erfahrungen eines Menschen organisiert. Dies entspricht etwa der Einteilung, die auch Funk (1994, S. 12) mit seiner Unterscheidung zwischen »Ich als Prozess« und »Ich als Repräsentation-Individualisation« (das Ich als Objekt) trifft. Er wendet sich damit eindeutig gegen Theorien, die das Ich in verschiedene Ichs oder Selbste aufteilen. Denn nach James (1892/1963, S. 182 ff.) muss so etwas wie eine Einheit des Bewusstseinsstroms bestehen, um eine Erfahrung mit der nächsten verknüpfen zu können. Oder, wie Loevinger (1987b, S. 92, e. Ü.) es ausdrückt: »Ich mag zwölf Selbste haben, die im Krieg miteinander stehen, aber wenn ich morgen aufwache, dann mit den gleichen zwölf Selbsten beschäftigt mit dem gleichen Krieg.«
Zusammengefasst ist die Frage also, wie das Ich mit Erfahrungen, ob innerer oder äußerer Art, umgeht, diese interpretiert und ihnen Sinn verleiht. Nach Perry (1970) ist es genau das, was jeder Organismus macht: Organisieren. Im Falle des Menschen ist dieser Prozess das Organisieren von Bedeutung. Dazu stellt das Ich einen Bedeutungsrahmen zur Verfügung (Kegan, 1980, 1994). Cook-Greuter (1994) bringt dies auf den Punkt:
»Das Bedürfnis nach einem stimmigen Sinngehalt scheint fundamental und eine Triebkraft im menschlichen Leben zu sein. Wann immer wir nicht richtig sicher sind, weil wir uns jenseits des Bereichs unseres gegenwärtigen Verstehens befinden, fühlen sich die meisten von uns ängstlich. Wir möchten eine Auflösung und Selbstgewissheit. Eine der Hauptfunktionen des Ichs ist es, diese Auflösung sicherzustellen und einen schlüssigen Sinn zu produzieren« (S. 120, e. Ü.).
Beschäftigt man sich also mit Persönlichkeit und ihrem Einfluss auf relevante Bereiche des Lebens, scheint das Ich eine zentrale Rolle zu spielen. Denn »das Ich ist der Direktor der Persönlichkeit, das durch seine integrativen Kräfte in der Lage ist, das Mich zu schaffen und so auch die [eigene] Identität zu konstruieren« (McAdams, 1985, S. 129, e. Ü.). Das Ich ist allerdings nicht mit der Persönlichkeit insgesamt identisch (siehe S. 91). Es ist auch nicht mit einzelnen Ich-Funktionen (z. B. Blatt u. Bermann, 1984), spezifischen Abwehrmechanismen (z. B. Cramer, 1999; Levit, 1993) oder Copingstrategien zum Schutz des Selbst (z. B. Harter, 1988) zu verwechseln, die damit zweifellos im Zusammenhang stehen (z. B. Labouvie-Vief, Hakim-Larson u. Hobart, 1987).
Zu Beginn dieses Abschnitts sind vier Satzanfänge aufgeführt. Jeder Mensch wird diese Sätze auf die ihm eigene Art und Weise ergänzen. Zwei davon entstammen Loevingers Erhebungsinstrument, mit dem man Ich-Entwicklung messen kann. Obwohl Tausende Menschen solche Sätze auf nahezu tausend verschiedene Arten fortführen, konnte Loevinger zeigen, dass sich darin die Strukturen des Ichs verbergen. Und die Analyse dieser Antworten gibt Auskunft darüber, wie weit das Ich der Antwortenden entwickelt ist. Hunderte empirische Studien zeigen mittlerweile, dass die jeweilige Struktur des Ichs bedeutsame Auswirkungen darauf hat, wie Menschen mit zentralen Fragen, Themen, Aufgaben und Bereichen ihres Lebens umgehen (können) – sowohl beruflich als auch privat. Nach dem Lesen dieses Abschnitts fragt man sich vielleicht: »Wie würde Ich antworten?«
2.1.2 Die »Entdeckung« und Entwicklung des Modells
Erstaunlich ist, dass das Modell der Ich-Entwicklung am Anfang aus keinem bewussten Forschungsprogramm entstand, sondern eher »nebenbei« entdeckt wurde. Denn am Anfang stand keine Theorie, sondern reine Daten. So betonte Loevinger immer: »Unsere Konzeption ist durch unsere Daten entwickelt worden« (1984a, S. 56, e. Ü.). Dieses Entdecken und Entwickeln hatte allerdings viel mit ihrer Art und Weise, mit Daten umzugehen, sowie ihrer Methodik der Instrumentenentwicklung zu tun. Loevinger (1993a, 1993b) verstand Theoriebildung als ausgewiesene Psychometrikerin immer als rekursiven Prozess. Denn sie nutzte die von ihr erhobenen Daten nicht nur zum Testen, sondern auch zum Entdecken, Entwickeln, Modifizieren und Revidieren ihres Modells der Ich-Entwicklung (Loevinger, 1957, 1978). Dieser methodische Ansatz ermöglichte ihr letztlich, zu erkennen, dass sie bei ihren frühen Forschungen offensichtlich auf einen im Hintergrund wirkenden Aspekt, wie Ich-Entwicklung, gestoßen war. Und er ermöglichte die stetige Weiterentwicklung des Konzepts, das im Laufe ihres Forschungsprogramms zahlreiche kleinere und größere Veränderungen erfuhr (Loevinger u. Cohn, 1998).
Anfang der sechziger Jahre arbeitete Loevinger zunächst in einem Forschungsprojekt zur Einstellung von Frauen zu Familienproblemen. Dazu konstruierte sie die sogenannte »Family Problems Scale« (FPS) (Loevinger, Sweet, Ossorio u. LaPerriere, 1962). Die FPS bestand anfangs aus insgesamt 213 Aussagen zu unterschiedlichsten familiären Problemsituationen, die sich auf tägliche Schwierigkeiten als auch auf Schwierigkeiten über den gesamten Lebenszyklus hinweg bezogen. Zusätzlich beinhaltete die FPS Aussagen, mit denen gängige Theorien in Bezug auf Einstellungen zu Familie und damit zusammenhängenden Persönlichkeitsaspekten abgedeckt wurden (Loevinger u. Sweet, 1961). Die Aussagen der FPS waren jeweils als Gegensatzpaare vorgegeben, wobei beide Antwortvarianten sozial akzeptabel formuliert waren, um mögliche Abwehrreaktionen zu vermeiden (z. B. »Mit einem Kind, das seine Mutter hasst, stimmt etwas nicht.« vs. »Die meisten Kinder haben Zeiten, in denen sie ihre Mutter hassen.«).
Bei der statistischen Auswertung zeigten sich keine der von den Forschern vermuteten Muster (z. B. Akzeptanz der weiblichen Rolle oder Hinweise auf psychosexuelle Phasen nach Erikson), sondern vor allem ein Cluster von Aussagen, die offensichtlich etwas wie die Eigenschaft »Straforientierung versus Erlaubnisorientierung« erfassten. Interessanterweise war dieses Cluster von Aussagen aber nicht eindeutig zu interpretieren, sondern es zeigten sich andere als von ihr vermutete Zusammenhänge. Beispielsweise stimmten vorwiegend die eher straforientierten Mütter der Aussage »Ein Vater sollte der beste Kumpel seines Sohnes sein« zu (statt der gegenteiligen Aussage »Ein Vater sollte nicht versuchen, der beste Kumpel seines Sohnes zu sein«). Loevinger und ihr Forschungsteam folgten aber nicht dem verbreiteten methodischen Vorgehen, sich auf inhaltlich gut zu interpretierende Aussagen eines Clusters zu beschränken und schwer interpretierbare Aussagen zu eliminieren, um so zu einer homogenen Skala zu gelangen. Stattdessen verfolgten sie genau diese vermeintlichen Widersprüche und versuchten die Gemeinsamkeiten, die sie in ihren Daten trotzdem fanden, zu beschreiben. Beispielsweise charakterisierten sie eine Frau, die eine hohe Ausprägung dieses Clusters hatte, wie folgt (Loevinger et al., 1962):
»Sie hat eine strafende und kontrollierende Einstellung in Bezug auf viele Bereiche der Kindeserziehung; sie hat eine geringe Fähigkeit, das innere Erleben ihres Kindes zu konzeptionalisieren; zugleich hat sie eine Sicht auf das Familienleben, die sowohl hierarchisch als auch gefühlvoll scheint. … Sie hat eine starre Konzeption der sozialen Rolle einer Frau; einiges Misstrauen gegenüber anderen Menschen mit einer damit einhergehenden Ängstlichkeit; einen geordneten, planmäßigen Ansatz in ihrem täglichen Verhalten; und vielleicht einen etwas trüben Blick bezüglich der biologischen Funktion einer Frau« (S. 113, e. Ü.).
Beim Vergleich mit anderen Studien und Konzepten fiel Loevinger auf, dass diese Charakterisierung hohe Ähnlichkeit mit dem im Berkeley-Kreis um Adorno entwickelten Konzept der »Autoritären Persönlichkeit« aufwies (Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson u. Sanford, 1950). Dies war umso erstaunlicher, weil die Forschung mit der FPS auf familiäre Probleme im häuslichen Umfeld ausgerichtet war, während die Forschung von Adorno politisch orientiert war. Zudem studierte Loevingers Team Mädchen und Frauen, während bei Adornos Forschungen meist männliche Teilnehmer untersucht worden waren. Es zeigte sich aber beispielsweise bei beiden Forschungen, dass autoritäre Personen kaum über die Fähigkeit verfügten, inneres Erleben auszudrücken. Aufgrund der gefundenen Cluster und der Ähnlichkeiten zum Konzept der »Autoritären Persönlichkeit« ging Loevinger nun davon aus, dass sich hinter dem erfassten Merkmal ein umfangreicherer Persönlichkeitsapekt verbarg als zunächst angenommen.
Auf dieser Grundlage entwickelte sie den Fragebogen zur »Authoritarian Family Ideology« (AFI) (Ernhart u. Loevinger, 1969), mit dem ihr Team weitere Forschungen unternahm. Beim Vergleich mit klinischen Beobachtungen problembehafteter Mütter fielen dem Forscherteam Muster auf, die inhaltlich nicht in ihre bisherige Theorie passten. Denn ein Teil dieser Frauen wies eine Persönlichkeitsstruktur auf, die chaotisch und unstrukturiert schien, die ihre Impulse kaum kontrollieren konnten und sich Autoritäten eher verweigerte. Daher waren diese Frauen nirgendwo auf dem Kontinuum entlang der beiden Pole »autoritär-obrigkeitshörig« vs. »demokratisch-flexibel« einzuordnen. So lag die Vermutung nahe, dass sich die durch den AFI-Fragebogen gemessene Eigenschaft nicht linear verhält, sondern extremer Autoritarismus eher ein Mittelpunkt und nicht ein Endpunkt dieser Variable ist. Sie schien also nicht bipolar zu sein, sondern eine Sequenz von Meilensteinen, was ein Hinweis auf eine Entwicklungssequenz ist. »Diese Einsicht war ein Wendepunkt in meiner intellektuellen Geschichte, die mich von einer Psychometrikerin zu einer Entwicklungspsychologin machte, von einer Eigenschaftstheoretikerin zu einer Strukturalistin« (Loevinger, 1978, S. 7, e. Ü.).
Um diese Annahme zu überprüfen, wurde der AFI-Fragebogen in weiteren Studien mit größeren und unterschiedlichen Stichproben angewandt. In diesen war die ganze Bandbreite an Altersklassen, Erfahrungshintergründen im Umgang mit Kindern, religiösen Orientierungen und Ausbildungsabschlüssen abgedeckt. Bei den statistischen Auswertungen zeigten sich, wie bei einer Entwicklungsvariablen zu erwarten, signifikante Zusammenhänge mit Alter, Erfahrung und Ausbildungsabschluss (LaPerriere, 1962). Autoritarismus verhielt sich in diesen Zusammenhängen nicht linear, sondern kurvilinear. Wenn man diese Variable beispielsweise zusammen mit der Variable Alter untersucht, steigt der Wert zunächst an, erreicht einen Höhepunkt (maximale Ausprägung von Autoritarismus) und sinkt dann wieder ab. Eine Variable hingegen, die keine Meilensteinsequenz ist, verhält sich meist linear. Die folgende Abbildung 2 illustriert lineare und kurvilineare Beziehungen von Ich-Entwicklung anhand der Beispiele kognitiver Komplexität und Konformismus.
Abbildung 2: Lineare und kurvilineare Zusammenhänge am Beispiel von Ich-Entwicklung, kognitiver Komplexität und Konformismus
Loevinger hatte es, wie es schien, mit einem schwer greifbaren Syndrom zu tun, das eine Vielzahl von unterschiedlichen Aspekten umfasste, die so bisher nicht zusammen betrachtet worden waren. Der bisher im Fokus stehende Aspekt »Autoritarismus« deckte offensichtlich nur einen Teil der Variable ab, so dass der bisherige Begriff nicht mehr geeignet schien. Zugleich handelte es sich bei der mit dem AFI-Fragebogen gemessenen Variable um eine Meilensteinsequenz, die Zusammenhänge mit anderen Variablen aufwies und somit einen Entwicklungscharakter nahelegte. Aus diesen Gründen entschloss sich das Forschungsteam zu einer Umbenennung: »Es schien, dass kein geringerer Begriff als ›Ich-Entwicklung‹ diese Variable [adäquat] umfasste« (Loevinger, 1978, S. 11, e.Ü). Das war umso mehr gerechtfertigt, da die gefundenen Aspekte in ganz unterschiedlichen Kontexten vollkommen unabhängig vom ursprünglich erforschten Familienkontext auftraten. Offensichtlich hatte Loevingers offen erkundendes und immer wieder Widersprüchen nachgehendes Vorgehen diese Entdeckung erst ermöglicht:
»Die kurvilineare Beziehung zwischen den Meilensteinen und dem darunter liegenden Entwicklungskontinuum hat eine große praktische Konsequenz. Ein Psychologe kann intensiv Verhaltenstypen studieren, die eigentlich Manifestationen von Ich-Entwicklung sind und endlose Jahre rigoros quantitativ vorgehen, ohne auch nur einen Schimmer der Variable Ich-Entwicklung zu bekommen« (Loevinger, 1973, S. 16, e. Ü.).
Um diese ihnen noch diffus erscheinende Variable Ich-Entwicklung besser zu verstehen, entwickelte das Forscherteam um Loevinger einen ersten Satzergänzungstest (SCT), den es gleichzeitig mit dem AFI-Fragebogen einsetzte. Zu dieser Zeit wurden sie auf eine Veröffentlichung von Sullivan, Grant und Grant (1957) aufmerksam, die ebenfalls mit offenen Satzergänzungen an einem Konzept zur interpersonellen Reife arbeiteten. Dieses Konzept war unabhängig von Loevingers Team mit Daten von männlichen Delinquenten entstanden, wies jedoch erstaunliche Parallelen auf. So lieferten Sullivan et al. eine erste Makrovalidierung des Modells der Ich-Entwicklung. Aus dem Konzept übernahm Loevinger dessen vier Stufen und deren Benennung (Impulsive, Conformist, Conscientious und Autonomous Stage) und begann darauf aufbauend, Ich-Entwicklung weiter zu konzeptionalisieren. Als Vorteil erwies sich, dass Sullivan et al. in ihrer Studie anhand klinischer Interviews eine Reihe von Indikatoren zur Klassifizierung ihrer vier Entwicklungsstufen herausgearbeitet hatten, die zur Beurteilung der einzelnen Satzergänzungen herangezogen werden konnten.
Bei der Anwendung ihres neuen Instruments in der Praxis merkten die mittlerweile mit der Entwicklungssequenz und deren Zeichen gut vertrauten Scorer jedoch bald, dass zwischen der Impulsiven und der Konformistischen Stufe eine Stufe zu fehlen schien: Immer wieder fielen ihnen Personen auf, die weniger impulsiv als Personen schienen, die der ersten Stufe zugeordnet waren, die aber auch nicht eindeutig der zweiten Stufe zuzuordnen waren. Zwar orientierten sich diese vorwiegend an eigenen kurzfristigen Vorteilen, hatten jedoch keine Regeln verinnerlicht und schienen sich eher selbst zu schützen. Diese bisher fehlende Stufe entsprach hingegen dem Delta-Code, der in Isaacs’ Theorie zur Beziehungsfähigkeit (1956) beschrieben war.
Auf ähnliche Weise verglich Loevinger ihr Modell mit weiteren Konzepten, in denen vergleichbare Entwicklungsaspekte unabhängig davon untersucht worden waren. Beispielsweise wies Pecks Modell der Charakterentwicklung (Peck u. Havingshurst, 1960) viele Parallelen zu ihrem Konzept auf. Dies führte zur ersten Veröffentlichung Loevingers, in der sie ihr Konzept der Ich-Entwicklung darstellte und begründete (1966, deutsch 1977). Für Loevinger war dies aber nur der Anfang der weiteren Erforschung von Ich-Entwicklung. Drei Jahrzehnte lang revidierte sie durch neue Daten immer wieder nicht haltbare Annahmen und verfeinerte den Satzergänzungstest sowie seine Auswertungskriterien immer weiter. Dann veröffentlichte sie ein erstes umfassendes Manual zur Auswertung (Loevinger u. Wessler, 1970; Loevinger, Wessler u. Redmore, 1970) und weitere sechs Jahre später ein Werk, in dem sie ihr Konzept der Ich-Entwicklung umfassend darlegte (Loevinger, 1976). Auch damit war ihr intensiver Forschungsprozess allerdings noch lange nicht abgeschlossen. Loevinger selbst beschrieb ihr Selbstverständnis einmal wie folgt: »Um eine Wissenschaftlerin zu sein, reicht es nicht aus, eine Theorie und Daten zu haben und auch nicht, eine gute Theorie und einwandfreie Daten zu haben. Das Kernstück des wissenschaftlichen Ansatzes ist eine schöpferische Kopplung zwischen diesen, also ein systematisches Programm zum Korrigieren, Revidieren und Erweitern der theoretischen Konzeptionen in Resonanz auf empirische Studien« (Loevinger, 1978, S. 2, e. Ü.). In den folgenden 20 Jahren verfolgten Loevinger und ihr Team ein solches Programm zur Erforschung von Ich-Entwicklung weiter. Bald schon überprüften sie das ursprünglich nur anhand von Frauen erforschte Konstrukt für beide Geschlechter und legten dazu ein weiteres Manual vor (Redmore, Loevinger u. Tamashiro, 1978). Ebenfalls nahm Loevinger umfangreiche Validierungsstudien vor (z. B. Loevinger, 1979a), die zu verbesserten Testversionen führten (Loevinger, 1985b). Im Laufe der nächsten 17 Jahre revidierte sie aufgrund ihrer weiteren Forschung einen Teil ihrer Stufenfolge im präkonventionellen Bereich und nummerierte ihre Stufenfolge einheitlich. Dies mündete in ein durch neuere Stichproben modifiziertes Auswertungssystem (Hy u. Loevinger, 1996). Mit 84 Jahren veröffentlichte sie ein Resümee mit einem Überblick ihrer etwa 40-jährigen Forschungsarbeit zu Ich-Entwicklung unter dem bezeichnenden Titel »Bekenntnisse einer Bilderstürmerin: Am Rande zu Hause« (Loevinger, 2002).
2.1.3 Stufen der Ich-Entwicklung
Das Besondere am Modell der Ich-Entwicklung von Loevinger ist, dass es zugleich eine Persönlichkeitstypologie und eine Entwicklungssequenz darstellt.
– Als Persönlichkeitstypologie beschreibt es typische Funktionsweisen beziehungsweise Muster von Persönlichkeit und wodurch sich diese auszeichnen (z. B. Gemeinschaftsorientierung, Eigenbestimmtheit).
– Als Entwicklungssequenz ordnet es diese Persönlichkeitstypen zu einer aufeinander aufbauenden Reihenfolge, die Menschen – wenn sich ihre Persönlichkeit entwickelt – durchlaufen.
Dass diese (und weitere) Besonderheiten von Ich-Entwicklung das Modell im Vergleich zu anderen Persönlichkeitsmodellen viel schwieriger zugänglich machen, bringt Loevinger (1976) selbst wie folgt zum Ausdruck:
»Eine Konzeption, in der Ich-Entwicklung sowohl eine Typologie als auch eine Entwicklungssequenz ist, bedeutet, dass sie [Ich-Entwicklung] eine Abstraktion ist. Sie kann nicht reduziert werden auf konkrete, beobachtbare Leistungen […]. Ich-Entwicklung steht in Beziehung zu und ist abgeleitet aus Beobachtungen, aber sie ist nicht direkt beobachtbar« (S. 57, e. Ü.).
Dennoch sprechen die Ergebnisse zahlreicher Forschungsstudien dafür, dass ein so umfangreiches Konstrukt wie Ich-Entwicklung tatsächlich zu existieren scheint (siehe S. 113). Auch scheint das jeweilige Entwicklungsniveau großen Einfluss auf viele Aspekte des Lebens zu haben, die mit zunehmender Reife immer besser bewältigt werden können (Kegan, 1996). Insofern ist das Konstrukt der Ich-Entwicklung eine Abstraktion, die für Loevinger (1984a) dennoch sehr real ist:
»Ich bin davon überzeugt, dass das Selbst, das Ego, das Ich oder das Mich in gewisser Weise real und nicht nur durch unsere Definition erschaffen sind. Meine Absicht ist es, zu verstehen, wie ein Mensch durch das Leben navigiert und nicht, künstlich abgegrenzte Einheiten zu erschaffen […] Was ich Ich-Entwicklung genannt habe, glaube ich, ist zurzeit die größte Näherung, zu der wir kommen können, wenn man versucht, die Entwicklungssequenz des Selbst oder seiner Hauptaspekte aufzuzeichnen« (S. 50, e. Ü.).
Um die von Loevinger skizzierten Stufen der Ich-Entwicklung zu verstehen, ist es notwendig, von konkreten Verhaltensweisen abstrahieren zu können (im Überblick siehe Anlage 1). Denn ein bestimmtes Ich-Entwicklungsniveau kann sich auf sehr unterschiedliche Art und Weise zeigen. Ein ganz in seinen Impulsen gefangenes Kind, für das die Impulsive Stufe normal ist, und der noch immer impulsabhängige Jugendliche oder Erwachsene, die normalerweise eine spätere Entwicklungsstufe erreicht haben, teilen zwar ein spezifisches Muster, das gemeinsam mit anderen Aspekten kennzeichnend für diese Stufe ist. Sie werden diese Verhaltensweisen aufgrund ihres Altersunterschiedes aber wahrscheinlich sehr unterschiedlich äußern. Daher muss eine wirklich altersunabhängig beschriebene Entwicklungssequenz, wie sie Loevinger herausgearbeitet hat, die einzelnen sie konstituierenden Aspekte notwendigerweise abstrakt fassen.
Ein Beispiel dafür liefert Haan, Stroud und Holsteins (1973) Studie zur Hippie-Kultur, die sich als Gegenentwurf zur konservativen US-Kultur der damaligen Zeit verstand. Die Studie von Haan et al. ergab, dass die meisten untersuchten Hippies auf der Gemeinschaftsbestimmten (E4) oder Rationalistischen Stufe (E5) verortet waren. Einer der zentralsten Aspekte der Gemeinschaftsbestimmten Stufe (E4) und der darauf folgenden Rationalistischen Stufe (E5) ist der Aspekt »Konformismus«. Die reine Betrachtung des antikonservativen Auftretens der Hippies würde wahrscheinlich nicht konformistisch erscheinen. Von einem entwicklungspsychologischen Standpunkt aus aber würde man sie dennoch als konformistisch einschätzen, wenn »Konformität, Nichtkonformität oder Antikomformität ein zentrales Thema in ihrem Leben darstellt« (Loevinger u. Blasi, 1976, S. 195, e. Ü.). Man könnte daher bei diesem Aspekt der Ich-Entwicklung eher von Meta-Konformität sprechen. Denn es geht nicht um die alltägliche Beobachtung konformistischen oder antikonformistischen Verhaltens, sondern um die dahinter liegende Ich-Struktur.
Im Folgenden werden die einzelnen Ich-Entwicklungsstufen anhand ihrer wesentlichen Charakteristika kurz beschrieben, um so einen Überblick über die Entwicklungssequenz zu ermöglichen (vgl. Loevinger, 1976; Hy u. Loevinger, 1996; Westenberg et al., 2004). Die Stufenbezeichnungen sind neben den Nummerierungen (E2 bis E9) eine Orientierungshilfe, um ein wesentliches und hervorstechendes Merkmal der jeweiligen Stufe zu verdeutlichen. Loevinger (1976, S. 15) selbst warnte jedoch davor, ihre Stufenbezeichnungen wortwörtlich zu nehmen, da sie keinesfalls das gesamte Muster der jeweiligen Entwicklungsstufe erfassen würden. Auch bei anderen Entwicklungsstufen treten Aspekte der in der Stufenbenennung genannten Merkmale auf, allerdings nicht im gleichen Ausmaß. Für die Beschreibung der Stufen werden hier die Bezeichnungen von Binder (2007a, 2010; Binder u. Kay, 2008) gewählt, das heißt die Begriffe, wie sie im Ich-Entwicklungs-Profil (www.I-E-Profil.de) verwendet werden. Die Bezeichnungen der Stufen im Ich-Entwicklungs-Profil lehnen sich an Loevingers Stufenbezeichnungen an, sind aber aus zwei Gründen verändert:
1. Einige von Loevingers Bezeichnungen sind nicht verständlich genug und erfassen nicht das Wesentliche der jeweiligen Stufe.
2. Manche Stufenbezeichnungen werden von Menschen auf dieser Entwicklungsstufe möglicherweise schwer als Beschreibung akzeptiert.
Die Entwicklungsstufe E8, von Loevinger als Autonome Stufe bezeichnet, ist ein Beispiel dafür. Diese Bezeichnung erweckt oft die Assoziation von (im übertragenen Sinne) »auf eigenen Füßen stehen«/»selbstständig sein«, was eher ein zentrales Merkmal der Entwicklungsstufe E6 ist (im Sinne eines unabhängigen Ichs). Loevinger wählte diese Bezeichnung, um auf den Aspekt »Respekt vor dem Bedürfnis Anderer nach Selbstbestimmung« hinzuweisen. In ihrer letzten Revision erkannte sie die missverständliche Bezeichnung, obwohl sie bei ihrem eingeführten Terminus blieb: »Erikson (1950) benutzte den Begriff autonom für die Phase, die hier als selbst-schützend [E3] bezeichnet wird […]. Hier ist der Begriff Autonomie für eine Stufe am anderen Ende der Skala reserviert« (Hy u. Loevinger, 1996, S. 6, e.Ü). Der zweite Kritikpunkt bezieht sich auf die Anwendung des Entwicklungsmodells. Loevinger berücksichtigte diesen Aspekt nicht, da sie reine Forschung betrieb, die Ergebnisse den Forschungsteilnehmern also nicht zurückmeldete. Dieser Punkt ist aber wichtig, wenn man mit diesem Modell praktisch arbeitet, sei es im Coaching, in der Führungskräfteentwicklung oder in der Diagnostik. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Die Entwicklungsstufe E4 wird bei Loevinger als »konformistisch« bezeichnet und hat somit einen eher negativen Klang. Im Ich-Entwicklungs-Profil wird diese Stufe neutraler als »gemeinschaftsorientiert« bezeichnet, womit sie von Menschen auf dieser Stufe leichter angenommen werden kann. Bei anderen Stufenbezeichnungen wurde ähnlich verfahren (z. B. »selbstorientiert« statt »opportunistisch«). Dies soll auch vermeiden, dass Stufenbezeichnungen als Etikettierungen von Menschen (z. B. Experte, Stratege) verwendet werden, wie es bei den von Torbert für seine praktischen Forschungen verwendeten Begriffen der Fall zu sein scheint (z. B. Torbert, 1987a).
2.1.3.1 Die frühen Stufen der Ich-Entwicklung
Wenn ein Mensch auf die Welt kommt, hat er im eigentlichen Sinne noch kein eigenes Ich. Loevinger bezeichnet diesen Zustand als Präsozial-symbiotische Stufe (E1), erläutert diesen jedoch nicht näher, da diese Stufe nicht im Geltungsbereich ihres Ich-Entwicklungsmodells liegt. Hier kennt ein Säugling noch nicht den Unterschied zwischen sich und der Umwelt und auch nicht zwischen belebten und unbelebten Elementen: »Das Kind kann beispielsweise nicht zwischen der Quelle des Unwohlseins durch zu helles Licht und der durch Hunger unterscheiden« (Kegan, 2003, S. 85). Erst später lernt der Säugling, sich selbst als getrennt von der Umwelt wahrzunehmen und entdeckt, dass es eine stabile Welt von Objekten gibt (Objektpermanenz). Und er lernt, die Mutter von der Umgebung zu unterscheiden, wobei er noch eine symbiotische Beziehung zur Mutter hat. Erst am Ende dieser Stufe kann man von einem eigenen Ich sprechen, wobei der Spracherwerb offensichtlich eine starke Rolle spielt. Im Gegensatz zur Konzeption von Loevinger wird in der psychoanalytischen Literatur meist nur diese kurze Phase als Ich-Entwicklung bezeichnet.
Darauf folgt die Impulsive Stufe (E2) der Ich-Entwicklung, in der sich das Kind von der zentralen Bezugsperson immer mehr abgrenzt und seinen eigenen Willen ausübt. Physische Bedürfnisse und eigene Impulse werden ungehindert gezeigt. Es bleibt dabei in hohem Maße abhängig von anderen und ihnen gegenüber fordernd. Regeln werden noch nicht verstanden, als schlechtes Verhalten gilt, was bestraft wird. Andere Menschen werden danach eingeordnet, wie sie den eigenen Wünschen dienen. Daher wird die Einschätzung »gut« oder »schlecht« eher damit verwechselt, wie nett oder nicht nett das Gegenüber zu einem selbst ist. Emotionen sind noch undifferenziert und eher körperlicher Natur. Die Zeitorientierung ist noch ausschließlich auf das Hier und Jetzt bezogen.
Indem ein Mensch lernt, wie Belohnung und Bestrafung funktionieren, erkennt er, dass es Regeln gibt. Die Selbstorientierte Stufe (E3)