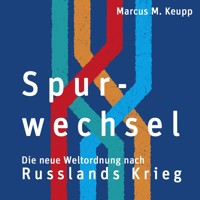24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Quadriga
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Ende der Geschichte ist erneut vertagt. Der Krieg ist zurück in Europa.
Die Ukraine ist erst der Anfang! Der russisch-ukrainische Krieg ist weit mehr als nur ein europäischer Regionalkrieg. Weltweit hat er die Nationalstaaten zu Spurwechseln gezwungen. Diese Dynamik verändert unsere Lebensrealität in einem bislang kaum vorstellbaren Ausmaß. Der Militärökonom Marcus M. Keupp analysiert diese erzwungene Neuordnung der Welt und erklärt, warum wir nicht nur vor einem neuen Kalten Krieg stehen, sondern vor einer welthistorischen Grundsatzfrage, die sich in diesen Tagen entscheidet.
So hat der russisch-ukrainische Krieg die Deutschlandfrage neu gestellt. Erstmals seit 1945 muss das deutsche Volk selbst entscheiden, wohin die Reise gehen soll. Kein großer Bruder in Moskau, kein alliierter Kontrollrat entscheidet mehr, wo die Grenzen des Handelns liegen. Man muss Position beziehen, erklären, wo man steht: Welche Weltanschauung vertritt man? Will man eine nationalistische oder pluralistische Gesellschaft sein, befürwortet man den autoritären Kollektivismus oder den liberalen Individualismus? Und steht man auf dem Boden des Völkerrechts oder liebäugelt man mit einer brutalen Weltordnung schrankenloser Macht? In dieser inneren Zerrissenheit spiegelt sich die welthistorische Dimension des Krieges.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumZitateVorwortIMPERIUMBruchstellenStabilisatorErlöserEURASIENSpezialoperationenMüdaraRevolutionswächterAuslaufmodellWiedergeburtDeutschlandfrageGÖTTERDÄMMERUNGWestfalenStörmanöverRückgratKatalysatorPersonen- und StichwortverzeichnisQuellen und AnmerkungenÜber dieses Buch
Die Ukraine ist erst der Anfang! Der russisch-ukrainische Krieg ist weit mehr als nur ein europäischer Regionalkrieg. Weltweit hat er die Nationalstaaten zu Spurwechseln gezwungen. Diese Dynamik verändert unsere Lebensrealität in einem bislang kaum vorstellbaren Ausmaß. Der Militärökonom Marcus M. Keupp analysiert diese erzwungene Neuordnung der Welt und erklärt, warum wir nicht nur vor einem neuen Kalten Krieg stehen, sondern vor einer welthistorischen Grundsatzfrage, die sich in diesen Tagen entscheidet.
Über den Autor
Marcus M. Keupp, geb. 1977, leitet die Dozentur Militärökonomie an der Militärakademie der ETH Zürich. Zuvor hat er Volks-und Betriebswirtschaftslehre sowie Politikwissenschaften an der Universität Mannheim und der Warwick Business School studiert. Er promovierte und habilitierte an der Universität St. Gallen.
Marcus M.Keupp
Spur-wechsel
Die neue Weltordnungnach Russlands Krieg
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2025 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln, Deutschland
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Die Verwendung des Werkes oder Teilen davon zum Training von Künstliche-Intelligenz-Technologien oder -Systemen ist untersagt.
Textredaktion: Burkard Miltenberger, Berlin
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Einband-/Umschlagmotiv: © FinePic, München
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-7435-2
quadriga-verlag.de
luebbe.de
lesejury.de
Шли столетья по России,бил надежды барабан.Не мечи людей косили –слава, злато и обман.
Что ни век – все те же нравы,ухищренья и дела…
– Булат Шалвович Окуджава, Считалочка для Беллы (1972)
Eine Wahrheit kann erst wirken,wenn der Empfänger für sie reif ist.Nicht an den Wahrheiten liegt es daher,wenn die Menschen noch so voller Unweisheit sind.
– Christian Morgenstern, Stufen (1922)
The most important political question on which modern times have to decide,is the policy that must now be pursued, in order to maintain the securityof Western Europe against the overgrown power of Russia.
– John Mitchell, Thoughts on tactics and military organization (1838)
Vorwort
Exegi monumentum aere perennius
– Horaz, Oden 3.30
Der Krieg, der Vater aller Dinge? Er hat die so stabil geglaubte Vorkriegswelt zerstört, doch ohne ihn wäre dieses Buch nicht entstanden. Scheinbar sichere Pfade sind verschwunden, ganz neue, für unmöglich gehaltene neu entstanden. Es ist an der Zeit, sich zu orientieren. Wer in der neuen Welt bestehen will, muss sie nüchtern und illusionslos anschauen – und das gilt insbesondere für den Blick nach Osten. Denn der Krieg ist größer als sein Kampfraum. Die heutige Zeit mag so manchem diffus erscheinen, aber nie waren die Wahlmöglichkeiten so klar, so ausschließlich. Die großen Grundsatzfragen sind immer noch offen. Weltanschauungen ringen miteinander, und wer sich behaupten will, muss die Sprache der Stärke sprechen. Nach dem Krieg ist vor dem Krieg: Diese Auseinandersetzung wird lange dauern.
Man muss viele Perspektiven verbinden, um den Krieg in seiner Gesamtheit zu verstehen. Daher habe ich versucht, Zusammenhänge fachübergreifend darzustellen. Komplexe Sachverhalte werden mitunter vereinfacht und in großen Bögen präsentiert – die Wissenschaft möge es mir nachsehen. Dennoch ist der Text tief in der wissenschaftlichen Literatur und der zeitgenössischen Analytik verankert. Der interessierte Leser findet alle Nachweise, Daten und Quellen in den Anmerkungen. Orts- und Personennamen werden gemäß den Konventionen der deutschsprachigen Presse geschrieben – auch wenn deren Transliterationen falsch sind, sowohl gegenüber kyrillischen als auch gegenüber turksprachigen Alphabeten. Der Name Борис Ельцин wird daher als Boris Jelzin geschrieben, obwohl man ihn eigentlich mit El’cin transliterieren müsste, und Weichheits- sowie Härtezeichen werden nicht mit Apostrophen ersetzt. Schwer zu übersetzende Begriffe sind im Original angegeben und umschrieben. Das ist mehr als nur linguistische Feinheit: Wir wissen immer noch sehr wenig von Sprache und Kultur des Ostens, von russischer Geschichte und imperialen Gedanken. Aber wer sich bereit machen will für die morgige Welt, darf nicht länger auf die Märchen von gestern vertrauen.
Standing on the shoulders of giants: So zu schreiben ist nur möglich, weil ich mich auf die Grundlagenwerke vieler herausragender Historiker, Landeskenner und technischer Experten stützen konnte. Bisher waren vor allem diejenigen zu hören, die zu allem eine Meinung, aber keine fachliche Kenntnis haben. Gerade deshalb ist faktenbasierte Analytik wichtig, und entsprechend muss das Buch vieles zertrümmern, was man als gesichert oder richtig angenommen hat. Doch ohne kreative Zerstörung gibt es keinen Neubeginn – und ohne umfassende Unterstützung keinen Erfolg. Ohne die unermüdliche Mitarbeit meiner Assistenten Maximilian Dambacher, Fabian Muhly, Christoph Schulze und Martin Bader, die Literatur aufbereitet, Quellen recherchiert und meine Entwürfe kritisch überprüft haben, wäre dieses Werk unmöglich gewesen. Stephan Meyer und Cindy Witt haben das Projekt mit sicherem Gespür begleitet, und Burkard Miltenberger hat dem Manuskript den letzten Schliff gegeben. Dennoch liegt die Verantwortung für den Text allein bei mir, und alle verbleibenden Fehler sind meine. Mein Dank gilt auch der Schweizer Armee. Korpskommandant Walser, Divisionär René Wellinger und Brigadier Hugo Roux haben mich bei der Entstehung dieses Werkes stets unterstützt und mir den Rücken gestärkt.
Ich lebe das strenuous life, wie Theodore Roosevelt es beschrieben hat: Es ist anstrengend, integrativ und interdisziplinär zu schreiben, aber man darf sich nie entmutigen lassen – dare mighty things. Und es ist riskant, politische Sachbücher zu verfassen. Weder folgt man ganz der wissenschaftlichen Konvention, noch kann man einfach journalistisch oder frei von Analytik schreiben. Das Werk bleibt eine Skizze, ein Versuch, komplexe und fluide Zusammenhänge zu bändigen. Leser und Fachkritik werden entscheiden, ob es nützlich und gelungen ist, wie gut es den unerbittlichen Zeitenlauf übersteht. Wenigen ist es vergönnt, dauerhaft in Erinnerung zu bleiben. Ich hoffe auf ein mildes Urteil.
Basel, im März 2025PD Dr. Marcus Matthias Keupp, Dipl.-Kfm.IMPERIUM
Bruchstellen
Von wegen Russland verstehen: Der blinde Fleck nach Osten hat eine lange Tradition. Man träumt von unendlichen Weiten, märchenhaften Reichtümern, ergeht sich in Friedensphantasien. Aber Russland ist ein Imperium, und genauso denkt und verhält es sich auch.
Dieser Blickwinkel erscheint vielen ungewohnt, weil die westeuropäischen Imperien maritim geprägt waren: die Schifffahrt und der Welthandel verbanden die spanischen, französischen, portugiesischen und niederländischen Kolonien genauso wie das britische Empire. Die Zaren hingegen unterwerfen ihre Nachbarn genauso wie die Osmanen und die Habsburger: auf dem Landweg. Ostwärts folgen sie der fruchtbaren Schwarzerde (чернозём), kolonisieren in Sibirien riesige, von indigenen Völkern besiedelte oder gänzlich menschenleere Räume, führen aber auch Kriege gegen hochentwickelte Staatswesen, stoßen östlich und westlich bis an die Meeresküsten vor. So mancher will auch heute nicht wahrhaben, dass Russland genauso gewaltsam entstanden ist wie das Osmanische Reich, hält es für einen Nationalstaat, obwohl es auch heute noch über mehr Ethnien regiert, als jemals in Österreich-Ungarn lebten.
Bis weit ins 17. Jahrhundert hinein ist russisch, ganz ähnlich wie deutsch, ein vager Sprach- und Kulturbegriff, eine unscharfe Raumvorstellung, aber keine politische Landesbezeichnung. Iwan III. nennt sich zwar erstmals Großfürst von Moskau, und in seiner europäischen Korrespondenz bezeichnet er sich bereits als Zar, obwohl erst knapp 100 Jahre später sein Enkel Iwan IV. – der Schreckliche – als solcher gekrönt wird. Aber ein Land namens Russland ist in Europa damals unbekannt: Die Chronisten der frühen Neuzeit nennen Iwans Herrschaftsraum moscovia, und davon abgeleitet bezeichnen sie seine Untertanen insgesamt – und nicht nur die Einwohner der Hauptstadt – als Moskowiter. Erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts beginnt man auch in Europa allmählich von Russland zu sprechen.1
Der Landesname ist somit eigentlich eine politische Erfindung, die weniger auf einer kontinuierlichen historischen Tradition beruht, sondern vielmehr eine nationale Identität begründen und territoriale Ansprüche legitimieren soll. Denn unter Rus-Land verstanden die Chronisten etwas ganz anderes, nämlich das seit dem 14. Jahrhundert polnisch-litauisch beherrschte Gebiet der historischen Rus, die sich zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer erstreckte. Diese im frühen Mittelalter gebildete Kulturgemeinschaft war kein zentralisierter Staat, sondern ein loser Verband regionaler Fürstentümer, in denen sich skandinavische Krieger und Händler mit altslawischen Siedlern vermischten. Gemeinsam kontrollierten sie die Handelswege zwischen dem Baltikum und Byzanz. Das heutige Russland ist jedoch keinesfalls der Nachfolger dieses Gebiets, wie die russische Staatspropaganda gern behauptet.
Vielmehr führte der Mongoleneinfall in Europa dazu, dass sich die Rus in zwei große Teilregionen trennte, die ganz unterschiedliche Entwicklungen nahmen. Ab 1237 begannen die aus Zentralasien vorstoßenden Mongolen, die Kiewer Rus zu überrennen. 1240 brennen sie Kiew nieder, womit die historische Rus als zusammenhängendes Gebilde endet. Schon zuvor hatten einzelne Fürsten ihren Sitz nach Nordosten verlagert, und weitere folgen, um den Mongolen auszuweichen. Unter Fürst Jurij Dolgoruki bildet sich in der Region um Susdal und Wladimir ein neues lokales Machtzentrum – 1147 wird erstmals ein kleiner befestigter Ort urkundlich erwähnt, den er (vermutlich) gründete: Moskau. Der Süden der alten Rus ist hingegen nach den Mongoleneinfällen zunehmend entvölkert und wirtschaftlich geschwächt. In dieses Machtvakuum stoßen die Großfürsten von Litauen vor. Über einen Zeitraum von rund 150 Jahren drängen sie die mongolische Herrschaft allmählich zurück. 1362, nach der Schlacht an den Blauen Wassern, beherrscht Algirdas bereits Kiew, und Vytautas (der Große) dehnt das Herrschaftsgebiet bis zum Schwarzen Meer aus. Die heutige Ukraine ist daher ebenso wenig ein direkter Nachfolger der historischen Rus, sondern vielmehr das Ergebnis eines komplexen politischen und kulturellen Prozesses, der von polnisch-litauischen Herrschaftsstrukturen, kosakischen Aufständen und der Interaktion mit Zentraleuropa und der russischen Politik geprägt war.2
Trotz ihrer gemeinsamen historischen Wurzeln nahmen die nördlichen und südlichen Fürstentümer völlig unterschiedliche Entwicklungen. Die nördliche Rus wird durch den polnisch-litauischen Sperrriegel vom übrigen Europa abgeschottet und nimmt daher nur begrenzt an der kulturellen Interaktion teil, zudem sie ständig nach Osten blicken muss: Denn die Mongolen ziehen nicht einfach ab, sondern unterwerfen die nördlichen Fürstentümer. Über zwei Jahrhunderte lang sind diese den Mongolen untertan und tributpflichtig. Erst nachdem Iwan III. 1478 das wohlhabende Nowgorod unterworfen hatte und daraufhin reich und selbstbewusst geworden war, verweigert er Ahmed Khan 1480 den Tribut. Die Auseinandersetzung auf diese Provokation hin endet kampflos: Die Goldene Horde zieht sich zurück, nachdem ihr Heer dem russischen am Fluss Ugra wochenlang untätig gegenübersteht. Damit beginnt die mongolische Herrschaft langsam zu erodieren, und die Kräfteverhältnisse verschieben sich. Schließlich stößt Iwan IV. nach Osten vor und beginnt 1552 mit der Eroberung des Khanats von Kasan eine beispiellose Expansion: Russland eignet sich nun über Jahrhunderte einen Großteil der Territorien an, die einst das mongolische Weltreich umfasst hatte. Und damit wird es selbst zum Vielvölkerreich.3
Um 1900 leben etwa 129 Millionen Menschen im russischen Kaiserreich, wobei die knapp 56 Millionen ethnischen Russen zu dieser Zeit eine Minderheit im eigenen Imperium sind, sie herrschen über rund 22 Millionen Ukrainer, acht Millionen Polen, sieben Millionen turkestanische Völker, fünf Millionen Belorussen, fünf Millionen Juden, je vier Millionen kaukasische Ethnien, Finnen und Tataren, sowie je eine Million Litauer, Letten, Esten und Deutsche – um nur die numerisch größten Völker zu nennen.4 Diese Verhältnisse bleiben erstaunlich stabil, nicht zuletzt aufgrund des starken Bevölkerungswachstums der zentralasiatischen Völker nach 1950: Auch 1989 lebt nur etwas mehr als die Hälfte aller Sowjetbürger in der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik (RSFSR).5 Und auch wenn die heutige Russländische Föderation zu etwa 80 Prozent von ethnischen Russen bewohnt wird, so teilen sich diese den Raum mit über 180 nichtrussischen Volksgruppen.6
Am Vorabend des Ersten Weltkriegs erstreckt sich dieser diffuse Vielvölkerverband über ganz Eurasien, grenzt westlich ans deutsche Kaiserreich, südlich an Persien und Afghanistan, östlich an China und Korea, herrscht über Sibirien und das Nordmeer bis zum Pol. Aber so erfolgreich die Eroberungszüge militärisch auch waren, so wenig haben sie eine vereinigende Nationalidee hervorgebracht. Die Völker nutzen Russisch zwar als lingua franca, die wenigsten fühlen sich dem Zarenreich jedoch innerlich verbunden. Sie sprechen zu Hause polnisch, jiddisch oder ukrainisch, identifizieren sich mit ihrem baltischen, finnisch-ugrischen, sibirischen Erbe. Viele kaukasische Völker sind muslimisch, so wie auch die turksprachigen Tataren und Baschkiren, und beides trifft auch auf Kasachen, Usbeken, Turkmenen und Kirgisen zu, die Tadschiken hingegen sprechen neupersisch (Farsi). Was verbindet sie, abgesehen von der Moskauer Oberherrschaft? Bis heute bleibt komplex und umstritten, was die russische Identität ausmacht, was das Adjektiv russisch eigentlich beschreibt, was die Staatsidee, die Nationalerzählung sein soll. Noch beim Übergang zur Moderne muss man resignierend feststellen: Seit der Zeit Peters des Großen und Katharina der Großen hat es ein Ding namens Russland nicht gegeben, es gab immer nur das russische Imperium.7 Und nach dem Untergang der Sowjetunion streitet man jahrelang über neue Flaggen und Staatssymbole, ändert den Text der sowjetischen Hymne, behält aber ihre Melodie bei. Über alle politischen Systeme und historischen Epochen hinweg haben die russischen Herrscher hartnäckig, aber letztlich erfolglos versucht, eine Nationalidee und eine Staatsarchitektur zu finden, die dem Imperium einen inneren, freiwillig getragenen Zusammenhalt verschafft. Dabei waren sie durchaus kreativ; es mangelt ihnen nicht an Ideen, warum das Imperium notwendig ist, warum es mehr sein soll als nur eine zusammengewürfelte Völkersammlung.8
Iwan III. sieht seine Herrschaft in der Kontinuität des oströmischen Reiches. Als es 1453 mit dem Fall Konstantinopels untergeht, übernimmt er von ihm das Symbol des Doppeladlers – von der sowjetischen Ära abgesehen bis heute das russische Staatswappen –, und er heiratet die Tochter des letzten byzantinischen Kaisers. Es bleibt offen, inwiefern er tatsächlich an die ursprünglich theologisch gemeinte Idee eines Dritten Rom glaubte, nach dem kein weiteres Weltreich mehr vorstellbar sei – aber sie eignet sich hervorragend, um die imperiale Expansion zu legitimieren: Wenn er nun fremde, früher mongolisch beherrschte Völker unterwirft, so deshalb, weil er sich zur Herrschaft erwählt fühlt.
Als Peter I. 1721 zum Kaiser proklamiert wird, stellt er ein Identitätskonzept vor, das nicht nur die russische, also ethnisch slawische und religiös orthodoxe Ethnie (русский), sondern alle Bewohner des Imperiums umfassen soll, auch und gerade wenn sie anderen Volksgruppen angehören (российский). Dieses Kunstwort wird bis heute verwendet, um die komplexe Verschränkung von Staat und Imperium, von russischen und nichtrussischen Ethnien zu beschreiben, auch die heutige Staatsbezeichnung der Russländischen Föderation (Российская Федерация) leitet sich davon ab.9 Das zugrundeliegende Konzept ist so simpel wie integrativ: Mögen sich die unterworfenen Volksgruppen auch ethnisch, sprachlich, religiös und kulturell unterscheiden, so bilden sie doch eine große Gemeinschaft, die der Zar als verbindende Klammer zentralistisch regiert.
Auch Katharina II. versucht sich an einer Nationalidee. Als sie 1767 erstmals die tatarische Hauptstadt Kasan besucht, schreibt sie so beeindruckt wie ernüchtert an Voltaire: In dieser Stadt sind zwanzig verschiedene Völker, die sich in keiner Weise gleichen, und doch muss ich ein Gewand für sie schneidern, das ihnen allen passt.10 Sie stellt ihre Eroberungsfeldzüge als zivilisationsstiftend, als Projekt der Aufklärung dar: Russland sei (von wem auch immer) beauftragt, seine einzigartige Kultur in die menschenleeren Weiten zu tragen und die unterdrückten, vormodern lebenden Völker zu entwickeln. Während ihr Ansatz rational ist, lässt Alexander I. sich von mystisch-religiösen Allmachtsphantasien leiten: Russland sei auserwählt, die slawischen Völker zu führen und zu beschützen. Auch Puschkin und Dostojewski vertreten solche Gedanken: Russland habe eine besondere Bestimmung, es sei spirituell und historisch zur Mission auserwählt und moralisch dazu verpflichtet.11
Von dort ist es nicht weit zu den imperialen Theoretikern des 19. Jahrhunderts, die östlich wie westlich siedelnde Völker als minderwertig betrachten und ihnen die Fähigkeit absprechen, moderne Staaten zu bilden. Dem russischen Imperium komme daher die mühevolle Aufgabe zu, sie aus rückständiger Dunkelheit ans zivilisierte Licht zu führen. Diese Idee ist nicht speziell russisch, sondern vielmehr typisch für koloniales Denken; die zwangsweise hergestellte Gemeinschaft wird als zivilisatorische Entwicklungsaufgabe umgedeutet: Take up the white man’s burden. Die Russen erscheinen gegenüber den unterworfenen Völkern als idealistische, etwas naive, aber gutmütige große Brüder, die die kleinen Geschwister opferreich ans Licht führen, wofür sich diese dankbar zu zeigen hätten: Russland sei ein Land, das sich selbst kolonisiert.12
Lenin verachtet den Imperialismus zwar ideologisch, realpolitisch will er aber nach 1917 nicht akzeptieren, dass das zaristische Imperium zerfällt. Mit der Idee der sowjetischen Gemeinschaftswohnung (коммуналка) versucht er eine innere Einheit herzustellen: Jedes Volk, jede Region darf ein eigenes Zimmer im gemeinschaftlichen Haushalt bewohnen und dort ein wenig Privatsphäre genießen, aber die Klammer des sowjetischen Unionsstaates verbindet sie alle. In den 1920er Jahren versucht Stalin – damals Volkskommissar für Nationalitätenfragen – ein verbindendes Konzept zu schaffen, das er als Verwurzelung (коренизация) bezeichnet: Lokale Kulturen und Sprachen sind erlaubt, werden sogar gefördert, aber nur solange sich alle Volksgruppen zur übergeordneten Einheit von Partei und Staat bekennen: National in der Form, sozialistisch im Inhalt.13
Als das Imperium nach 1991 erneut zu zerfallen droht, entwickelt Jelzin ein zugleich patriotisches und inklusives Identitätskonzept: Alle Einwohner seien, unabhängig von ihrer ethnischen oder nationalen Identität, gleichberechtigte Angehörige des Imperiums (россияне). Und schließlich propagiert Putin seit 2009 eine grenzenlose Zivilisation (русский мир), fällt dabei aber wieder in das Denken einer russischen Leitkultur zurück: Die russische Kulturgemeinschaft ende nicht an Nationalstaatsgrenzen; wo auch immer Russen lebten, sei Russland, und es schütze seine Volksangehörigen auch in anderen Staaten. Das Adjektiv russisch bezeichnet in seiner Vorstellung nicht nur eine Ethnie, sondern eine bewusste politische Kulturwahl: Egal, wo man lebt, welche Staatsangehörigkeit man hat – wer den russischen Pass annimmt, wird zum Russen, wird virtuell Teil des Imperiums. Jeder kann sich dieser Ideenwelt verschreiben, ob er früher im sowjetischen Imperium ansässig war oder nicht. Dennoch bleibt das Konzept letztlich nationalistisch und logisch inkonsistent. Die russische Ethnie nimmt in diesem Konzept eine quasi selbstverständliche Führungsrolle ein: Um zu dieser (imaginierten) Zivilisation zu gehören, muss man sich der Weltsicht, dem kulturellen Erbe und der Staatstradition des russischen Volkes verschreiben. Bezeichnenderweise wird das Konzept gerade nicht als российский мир, als Völkergemeinschaft, formuliert.14
Dennoch will keines dieser ideellen Konzepte so recht funktionieren: Stattdessen streben die einst unterworfenen Völker davon, sobald sich die Chance dazu bietet; und haben sie das Imperium einmal verlassen, wollen sie nicht zurück. Allein im 20. Jahrhundert ist es zweimal beinahe zerbrochen.
Die Bolschewiki versuchen im russischen Bürgerkrieg, die Völker auf ihre Seite zu ziehen, indem sie das Manifest der Völker Russlands veröffentlichen: Allen soll die freie Selbstbestimmung zugesprochen werden. Statt zaristische Repression zu erfahren, darf sich jeder nun frei entfalten – freilich innerhalb eines zentralistisch geführten Staatsverbands, der der kommunistischen Ideologie verpflichtet ist. Die Völker nehmen den Aufruf aber etwas zu wörtlich und verabschieden sich umgehend: Polen, die Ukraine, Estland, Lettland, Litauen, Georgien, Armenien, Aserbaidschan und Finnland brechen in kürzester Zeit weg und erklären sich zu unabhängigen Nationalstaaten. Aber nicht nur die Völker des äußeren Imperiums lösen sich, auch innerlich bricht es auseinander. Zahlreiche so kleinräumige wie kurzlebige Staaten entstehen: die Republik Uhtua in Karelien, die Volksrepublik der Krim, die Volksrepublik von Kuban, die kaukasische Bergrepublik sowie das nordkaukasische Emirat, die Republik Kars und die Republik Idel-Ural, um nur einige zu nennen. In Turkestan bricht 1918 der Basmatschi-Aufstand los, er folgt dem gescheiterten Versuch, das Khanat von Kokand wiederzuerrichten. Lokale Bauern wehren sich gegen die sowjetische Zwangskollektivierung, muslimische Geistliche widersetzen sich der atheistischen Ausrichtung der Bolschewiki, und der osmanische General Enver Pascha versucht, beide für die pantürkische Idee zu gewinnen und mit ihrer Hilfe ein Kalifat in Samarkand zu gründen – erst 1924 kontrolliert die Rote Armee das Gebiet wieder vollständig.15
Auch sonst hat die Armee im russischen Bürgerkrieg alle Hände voll zu tun, die entsprungenen Völker wieder einzufangen und zwangsweise ins kommunistische Paradies einzugliedern. Dabei geht sie zuerst gegen den Kaukasus, Zentralasien und die Ukraine vor, aus ganz pragmatischen Gründen – das neue Regime braucht die Ölversorgung, die Baumwolle, die Weizenfelder. Erst 1922, mit der Gründung der Sowjetunion, ist die mühevolle geographische Restauration des Zarenreichs abgeschlossen, aber sie gelingt nicht ganz: Finnland und die baltischen Staaten setzen sich militärisch gegen die Rote Armee durch und bewahren ihre Unabhängigkeit – erst 1940, als die Sowjetunion sich ökonomisch und militärisch konsolidiert hat, wird Stalin auch sie wieder gewaltsam einsammeln und Finnland, obwohl die Rote Armee im sowjetisch-finnischen Winterkrieg schwere Verluste erleidet, seine karelischen Provinzen entreißen.16
Die Desintegration wiederholt sich 1989: Die ökonomisch ruinierte und in Afghanistan geschlagene Sowjetunion ist nicht länger fähig und willens, die Unabhängigkeitsbestrebungen der Satellitenstaaten aufzuhalten. Bereits zwischen 1988 und 1990 schließen Polen, Ungarn und die Tschechoslowakei zahlreiche Handelsabkommen mit dem Westen, und 1989 brechen im gesamten Ostblock teils friedliche, teils gewaltsame Volksrevolutionen aus, die die moskautreuen Regime stürzen.
Die osteuropäischen Satellitenstaaten sind verloren, aber auch das innere Imperium beginnt sich aufzulösen, und Gorbatschow versucht erfolglos, es zusammenzuhalten. In Deutschland immer noch als Friedensbringer und Reformer verklärt, hatte er nicht minder imperiale Ansichten als seine Vorgänger: Wo mehr als 50 Prozent Russen wohnten, könne man nicht von Staaten sprechen; das Baltikum, Kasachstan und die Ukraine seien keine Nationen, sondern Minderheitenregionen – obwohl die sowjetische Siedlungspolitik dort millionenfach Russen angesiedelt und die Kasachen sogar zur Minderheit im eigenen Land gemacht hatte. Schon 1986 unterdrückt das sowjetische Militär auf Gorbatschows Weisung hin erste Unabhängigkeitsbestrebungen in Kasachstan, 1989 schießt es auf Demonstranten in Georgien, 1990 unterdrückt es ethnische Unruhen in Aserbaidschan. Mit einer 650 Kilometer langen Menschenkette demonstrieren die baltischen Völker 1989 für ihre Eigenstaatlichkeit, aber noch im Januar 1991 fordert Gorbatschow den litauischen Interimspräsidenten auf, die im Vorjahr erklärte Unabhängigkeit zurückzunehmen. Umsonst: Sein Projekt eines neuen sowjetischen Unionsvertrags scheitert, auch alle weiteren Sowjetrepubliken erklären im Laufe des Jahres 1991 ihren Austritt.17
Auch Jelzin strebte danach, den russischen Einfluss in den neuen Nationalstaaten, die 1990 und 1991 aus dem zerfallenden sowjetischen Imperium hervorgingen, aufrechtzuerhalten. Im Westen trotz seiner so geselligen wie unberechenbaren Art als liberaler Reformer hochgejubelt, unterstützte er 1992 die transnistrischen Separatisten in der Republik Moldau und griff in den georgischen Bürgerkrieg ein, um prorussische Fraktionen in Abchasien und Südossetien zu unterstützen. Das äußere Imperium hat er zwar verloren, die Rote Armee ist weder fähig noch willens, die Völker wieder gewaltsam zurück ins Imperium zu zwingen. Aber die neuen Nationalstaaten sollen sich dennoch politisch und wirtschaftlich auf Russland ausrichten. Die gleichzeitig mit der Auflösung der Sowjetunion gegründete Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS, eigentlich Содружество Независимых Государств) ist zwar formell egalitär, aber als postkoloniale Bindungsstruktur erdacht. Putin wird diese Idee ab 2014 mit der Gründung der Eurasischen Wirtschaftsunion vertiefen.
Gleichzeitig etabliert sich ab 1991 ein neuer Begriff: das nahe Ausland (ближнее зарубежье): Wer sich darin befinde, so die Idee, sei zwar formal souverän, müsse aber russische Interessen besonders berücksichtigen und seine politischen und Handelsbeziehungen auf Russland ausrichten. Diese Bindungstechnik ist nicht spezifisch russisch, sondern vielmehr typisch für koloniales Denken. Sie findet sich insbesondere im französischen Konzept der Françafrique, deren Kontrollstrukturen nach 1960 weitaus stärker ausgeprägt waren als diejenigen der GUS: Die ehemaligen Kolonien sind nun pro forma selbständig, aber ihre Wirtschaftsbeziehungen sind unverändert auf das koloniale Zentrum hin ausgerichtet, sie dürfen eine eigene Zentralbank haben, aber deren Reserven liegen sicherheitshalber in Paris, und die Währung ist an den Euro gekoppelt.
Nach dem Zusammenbruch des sowjetischen Wirtschaftsmodells haben die zentralasiatischen Staaten und der Kaukasus kaum eine andere Wahl, als sich der GUS anzuschließen, während im früheren äußeren Imperium die Idee postkolonialer Bindung nicht mehr durchsetzbar ist. Polen und die baltischen Staaten verwahren sich scharf gegen jeden Einflussversuch, und in direkten Gesprächen mit US-Präsident Clinton lotet der polnische Staatspräsident Lech Wałęsa schon 1993 den NATO-Beitritt aus – er will die temporäre Schwäche Russlands nutzen, um sich abzusichern, und ahnt bereits, dass ein wiedererstarktes Russland erneut expandieren könnte.18
Gorbatschow und Jelzin standen vor dem gleichen Problem wie die Bolschewiki: Das Imperium zerfällt, und wenn es den Völkern gelingt, erfolgreich auszuscheiden, wird es auseinanderbrechen. Zwar wird die RSFSR schon 1992 staatsrechtlich in die heutige Russländische Föderation überführt, aber innerlich ist dieses neue Gebilde alles andere als stabil. Sowohl das ölreiche Tatarstan wie auch das bitterarme, aber stolze Tschetschenien hatten sich 1990 für souverän erklärt, auch im hochindustrialisierten Baschkortostan und der ressourcenreichen Region Sacha (Jakutien) gibt es Bestrebungen, sich von der Zentralmacht zu lösen, genau wie im multiethnischen Dagestan. Nach dem ökonomischen Zusammenbruch der sowjetischen Wirtschaft verfügte Jelzin weder über die finanziellen noch die militärischen Mittel, um einen zentralen Herrschaftsanspruch überall gleichzeitig durchzusetzen.
Er greift daher gezwungenermaßen zum Vertragsföderalismus und schließt eine chaotische Vielfalt von Einzelvereinbarungen mit den Regionen ab. Dabei muss er weitreichende Zugeständnisse machen und widerwillig dulden, dass die Moskauer Zentralmacht regional moderiert wird. Die ethnischen Fragen werden dabei nicht gelöst, sondern wie in der Sowjetunion lediglich eingekapselt: Die autonomen Sowjetrepubliken (ASSR) innerhalb der RSFSR werden in bis heute bestehende russländische Republiken (российские республики) überführt und erhalten dabei umfassende regionale Autonomierechte. Auch die autonomen Oblaste (AO) innerhalb der RSFSR behalten weitgehend ihren regionalen Sonderstatus.
Wie die Bolschewiki muss auch Jelzin die rohstoffreichen Gebiete des Imperiums halten. Daher lässt er Tschetschenien zunächst ziehen und konzentriert sich auf Tatarstan – er braucht das Öl für die Staatseinnahmen. Tatarstan weiß darum und lässt sich seine Zustimmung teuer abkaufen. Es weigert sich, den neuen Föderationsvertrag zu unterschreiben, und führt stattdessen 1992 ein Referendum durch, in dem eine Mehrheit für die Unabhängigkeit stimmt. Erst nach langen Verhandlungen und vielen Zugeständnissen kann Jelzin es 1994 zur Unterschrift bewegen, und erst dann erklärt er, dass keine Gefahr für das Auseinanderbrechen der Föderation mehr bestehe. Nach dieser Konsolidierung greift Jelzin im ersten Tschetschenienkrieg (1994–1996) zu militärischer Gewalt, um das abtrünnige Kaukasusvolk zurück ins russische Imperium zu zwingen. Er hat keine andere Wahl: Ein unabhängiges Tschetschenien, das der russischen Armee erfolgreich standhält, hätte unwiderstehlichen Vorbildcharakter für Dagestan, für den ganzen Nordkaukasus. Aber er verliert den Krieg, erst Putin kann sich im zweiten Tschetschenienkrieg (1999–2001) durchsetzen, wobei die russische Armee die Hauptstadt Grosny zum zweiten Mal zerstört.
Letztlich wird jeder russische Herrscher auf dieses zentrifugale Problem zurückgeworfen: Freiwillig bleiben die Völker nicht im Imperium, es gleicht einem permanent unter Druck stehenden Kessel, dessen innere Dynamik sich zwar unterdrücken, bestenfalls eindämmen, nicht aber auflösen lässt. Und entweichen die Völker einmal, lassen sie sich nur mühsam oder gar nicht mehr zurückgewinnen. Es überrascht daher nicht, dass alle russischen Herrscher versucht haben, entweder die innere Dynamik zu kontrollieren oder ein eisernes Band um den Kessel zu schlagen: Bleiben die Völker schon nicht freiwillig zusammen, hält man sie eben an der langen Leine, bietet ihnen etwas Freilauf an – oder unterdrückt ihre Bestrebungen gewaltsam.
Bereits Alexander I. hatte mit einem Modell regionaler Selbstverwaltung experimentiert. Nachdem Finnland mit dem russisch-schwedischen Krieg von 1809 an ihn gefallen ist, wird es weder annektiert noch direkt aus Moskau regiert. Stattdessen lässt er sich zum finnischen Großfürsten proklamieren, schwört den Throneid, bestätigt die tradierten Rechte des finnischen Adels und gesteht ihm sogar weitreichendere Selbstverwaltungsrechte als unter der schwedischen Herrschaft zu.19 Diese Methodik, ethnische Eliten für das russische Imperium zu kooptieren, wendet auch Putin im heutigen Tschetschenien an. Ramzan Kadyrow – dessen Vater Akhmat im ersten Tschetschenienkrieg noch gegen Jelzin gekämpft hatte – darf lokal unumschränkt regieren, aber nur bei absoluter Loyalität zum Moskauer Herrscher, dem er auch Truppen für dessen Feldzug in der Ukraine zu stellen hat: ein modernes Feudalsystem.
Diese Modelle regionaler Autonomie bleiben aber die Ausnahme, denn sie schaffen keine Akzeptanz für die imperiale Ideen, die Völker bleiben für sich und der russischen Herrschaft innerlich unverbunden. Andere Herrschaftstechniken versuchen daher, die innere Identität aufzulösen, die Völker zu russifizieren: Wer sich innerlich als Russe empfindet, trägt die imperiale Idee mit und hat kein Verlangen mehr nach Eigenständigkeit, so die Überlegung.
Bereits Katharina II. bietet dem ukrainischen Adel die Aufstiegsassimilation an: Wer die russische Oberherrschaft loyal umsetzt und sich persönlich an der russischen Kultur orientiert, erhält Privilegien und Ämter, darf am glanzvollen Hof in St. Petersburg leben. Auch die Sowjetunion nutzt diese Technik, um die lokalen Eliten als Träger und Transmissionsriemen ihrer inneren Herrschaft einzusetzen. Wer zu den neuen Verwaltungseliten gehören will, muss die eigene kulturelle Identität unterordnen, russisch sprechen, zum Sowjetmenschen werden, der keine ethnischen, sondern nur noch ideologische Wurzeln hat und dankbar die Segnungen der russischen Leitkultur akzeptiert. Wer sich innerlich so umformt, darf Karriere in der Partei machen und, absolute Loyalität zur Zentralmacht vorausgesetzt, auch in die höchsten Staatsämter der Sowjetrepubliken aufsteigen. Auch die Rote Armee – propagandistisch als Armee der Völkerfreundschaft verbrämt – dient der Russifizierung: Es gab rein russische, aber keine rein ethnischen Regimenter; russisch geführte Einheiten hingegen assimilierten die Angehörigen anderer Ethnien.20
Auch diese Methoden sind nicht spezifisch russisch, sondern vielmehr typische Kolonialtechniken, wie sie insbesondere in Belgisch-Kongo mit dem Konzept der évolués umgesetzt wurden: Sobald die unterworfenen Völker hinreichend gebildet und zivilisiert sind, dürfen sie an der Staatsverwaltung teilnehmen – vorausgesetzt, sie übernehmen europäische Sitten und Verhaltensweisen. Aber während im Kongo nur einige Hundert évolués verfügbar sind, als die Belgier 1960 abziehen und das Land daraufhin im Chaos versinkt, wirkt sich die sowjetische Aufstiegsassimilation sogar dekolonisierend aus: Die zahlreichen und gut ausgebildeten neuen Eliten kehren mit der Auflösung der Sowjetunion 1991 in ihre Heimatländer zurück – aber nicht etwa, um dort im russischen Namen zu regieren, sondern um ihre neu entstandenen Nationalstaaten aufzubauen.21
Die Umgestaltung von Identitäten und Territorien durch gezielte Siedlungspolitik ist ein weiteres Beispiel für den russischen Versuch, die imperiale Herrschaft zu stabilisieren. Katharina II. gliedert große, mit dem Frieden von Küçük Kaynarca (1774) vom Osmanischen Reich eroberte Gebiete neu, dabei schafft sie auch das Gouvernement Taurien. Mit solchen, aus griechischen Sagen und längst verfallenen Siedlungen entlehnten Namen stellt sie Russland als natürlichen Erben der antiken Tradition dar, was ihre Herrschaft legitimieren soll; die Geschichte des Raumes wird dabei umgeschrieben: Ihre Planstadt Cherson etwa ist nach der antiken Siedlung Chersones benannt (die allerdings nicht am Dnipro, sondern auf der Krim lag). Sie verteilt ihre neuen Ländereien an den russischen Adel, der dort Bauern und Händler ansiedelt, womit sich die Bevölkerungsverhältnisse verändern. Insbesondere der Krim wird ihre räumliche Identität genommen, wenngleich die Krimtataren einstweilen dort weiter leben dürfen. Die Krim ist keineswegs heilige russische Erde, sondern zuvor jahrhundertelang ein muslimischer Vasallenstaat des Osmanischen Reiches, erst 1783 wird sie endgültig dem russischen Imperium eingegliedert.22 Unter Katharina II. beginnen auch kleine Militärvorposten wie Omsk, Irkutsk und Krasnojarsk, sich allmählich zu großen Provinzstädten zu entwickeln, die russisch besiedelt werden und die im Umland lebenden nichtrussischen Ethnien kontrollieren. Ab 1896 verbindet sie die Transsibirische Eisenbahn teilweise, ab 1916 vollständig bis zum Pazifik, womit auch Truppen schnell verlegt werden können.
Stalin betreibt die Neudefinition von Räumen und Identitäten mit extremer Gewalt, die zahllose Opfer fordert. Siedlungspolitik ist für ihn innere Sicherheitspolitik, eine Region erst dann politisch zuverlässig, wenn sie überwiegend von Russen bewohnt wird. Er deportiert 1944 nicht nur die Krimtataren, sondern auch die Balten und die Wolgadeutschen, die er sämtlich der Kollaboration mit der Wehrmacht verdächtigt, und dazu viele weitere Völker: Die Tschetschenen und Inguschen werden aus dem Kaukasus nach Zentralasien deportiert, auch die Krimtataren, Tscherkessen und Kalmücken werden massenhaft umgesiedelt. Zudem schafft die stalinistische Industriepolitik in großem Umfang russische Arbeiter nach Transnistrien und in die Ukraine, und auch für Stalins Nachfolger ist die Siedlungspolitik ein Instrument, um räumliche Herrschaftsansprüche zu begründen: Zwischen 1945 und 1990 werden Hunderttausende Russen auf der Krim angesiedelt, womit sich in der Bevölkerung der Eindruck verfestigt, sie sei schon immer russisch gewesen.
Aber weder Umsiedlung noch Geschichtsklitterung, weder die Eisenbahn noch großzügige Aufstiegsangebote entfalten dauerhafte Wirkung, selbst die gewaltsamste Herrschaftstechnik wirkt nur oberflächlich: Sie hindert die Völker zwar daran, das Imperium zu verlassen, nimmt ihren Angehörigen den Raum, mitunter das Leben, nicht aber die Identität. Diese bleibt auch im Exil erhalten, und als die Völker mit der beginnenden Entstalinisierung in ihre Siedlungsgebiete zurückkehren dürfen, knüpfen sie umgehend wieder daran an.
Nicht einmal bei den großen russischen Minderheiten in Estland und Lettland trägt die Idee der russischen Welt – dort sind etwa 25 Prozent der Einwohner russische Muttersprachler, die estnische Stadt Narva etwa wird zu über 90 Prozent von ethnischen Russen bewohnt. Das liegt nicht zuletzt an den sozialen Realitäten: Man lebt am Ende doch lieber dort, wo die Renten höher und die öffentlichen Leistungen besser sind, wo wirtschaftliche Freiheit und freie Meinungsäußerung herrschen. Und auch wenn man sich nicht einbürgern lässt, ist das nicht gleichbedeutend mit der Unterstützung imperialer Vorstellungen. Die russische Diaspora im Baltikum verleugnet ihre Kultur nicht, ist aber politisch überwiegend loyal.23
Alle diese Ideen funktionieren hervorragend für die Herrschenden – sie können sich als Aufklärer und Zivilisatoren, als Träger einer überlegenen Kultur präsentieren. Den Beherrschten hingegen, die als unfertige, leitungsbedürftige Brüder gesehen werden, hat die imperiale Idee weniger anzubieten: Von ihnen wird verlangt, sich unterzuordnen, wenn nicht gar die eigene Kultur und Identität aufzugeben. Alle Integrationsideen scheitern letztlich an diesem inneren Widerspruch: Demokratische Gleichberechtigung und imperialer Herrschaftsanspruch sind logisch unvereinbar: Russland kann entweder ein Imperium oder eine Demokratie sein, aber nicht beides zugleich.24 Denn jede echte Föderalisierung und innere Demokratisierung des Imperiums würde auch eine starke Dezentralisierung und einen pluralistischen Staatsaufbau erfordern, der regionale Interessen austariert und demokratische Partizipation ermöglicht.
Dadurch würde der imperialen Idee jedoch die Grundlage entzogen: Das russische Volk wäre nur noch eines unter vielen, es könnte keinen Überlegenheits- oder Herrschaftsanspruch geltend machen. Die Knechtschaft der Völker ist der Preis für den Erhalt des Imperiums. Sie koexistieren zwar in einem zentralistisch beherrschten Staatsverband, aber eine Willensnation bilden sie nicht, keines ist dem Imperium aus freien Stücken beigetreten. Gerade die stalinistische Nationalitätenpolitik verdeutlicht dieses Problem: Sie erlaubt kulturelle Selbstbestimmung, 1925 erscheint sogar ein Wörterbuch des Ukrainischen. Aber gleichzeitig will sie eine repressive Zentralherrschaft durchsetzen und eine sowjetische Identität erzeugen. So bleiben die Versuche der russischen Staatslenker, die Völker innerlich so zu verbinden, dass sie das Imperium freiwillig mittragen, letztlich künstlich, die oktroyierte Identität bleibt intellektuell und abstrakt, erreicht die Menschen jedoch nicht. Alle diese Ideen und Konzepte sind letztlich nur ein dünner, nachträglich hinzugefügter Firnis, der die imperiale Zentralherrschaft, die erobernde Gewalt, nachträglich legitimieren soll. Somit bleibt das Nationalitätenproblem entweder eingefroren oder gewaltsam unterdrückt, aber letztlich ungelöst.
Auch die Schweiz und die USA sind ethnisch, sprachlich und kulturell heterogen, aber beide Staaten verstehen sich als Willensnationen mit starker demokratischer Tradition. Die USA waren seit ihrer Staatsgründung nie ein Schmelztiegel, und sie sind es auch heute nicht. Im Gegenteil behalten die Einwanderer ihre Bräuche, Sprachen und sozialen Strukturen noch lange bei. Bis ins frühe 20. Jahrhundert bildeten sie Parallelgesellschaften, die untereinander nicht auf Englisch, sondern in ihren Muttersprachen kommunizierten. Dennoch unterdrückt der Staat diese Vielfalt nicht, er versucht auch nicht, sie mit intellektuellen Konzepten zu übertünchen oder die Menschen zu anglifizieren, stattdessen sieht er die chaotisch erscheinende Diversität gerade als Stärke der Staatsidee. Und die Einwanderer verleugnen weder ihre Abstammung noch ihre Sprache, pflegen beide weiter, sehen sich aber auch als Teil einer neuen Gemeinschaft, in deren Fortschritts-, Freiheits- und Wohlstandsversprechen sie eine geteilte, alle ethnischen und sprachlichen Unterschiede überwindende Überzeugung finden.25
Die Schweiz entwickelte sich aus einer Vielzahl von Regionen mit unterschiedlichen Sprachen, Kulturen und Traditionen. Ihre föderale, dezentrale und partizipative Staatsarchitektur respektiert regionale Identitäten, schafft aber ein verbindendes nationales Bewusstsein. Der Begriff der Eidgenossenschaft ist durchaus wörtlich zu verstehen: als freiwilliger und feierlich bekräftigter Entschluss, gemeinsam ein Staatswesen zu tragen, das die regionalen Unterschiede integriert, ohne ihre Diversität zu verleugnen, das alle Staatsbürger gleichberechtigt am politischen Prozess teilhaben lässt.26 Beide Staatskonzepte beruhen letztlich auf einem positiven Integrationsversprechen: Wer die Staatsidee freiwillig mitträgt, kann sich selbst verwirklichen, ohne seine Identität oder Sprache aufgeben zu müssen, kann in Freiheit und Wohlstand leben, darf demokratisch an der Staatsentwicklung teilhaben. In der Schweiz wie auch den USA besteht daher ein gemeinsames und freiwilliges Streben, trotz aller kulturellen, sprachlichen und ethnischen Diversität zusammenzubleiben und den Staat gemeinsam zu tragen.
Das Imperium will hingegen mehr sein als nur eine zusammengewürfelte Sammlung unterworfener Völker und eroberter Räume, obwohl imperialer Herrschaftsanspruch und freiwillige Partizipation logisch unvereinbar sind. Die vielbeschworene Einheit existiert daher nur auf dem Papier; man ist eben gerade nicht die unzertrennliche Union freier Republiken (Союз нерушимый республик свободных), von der die sowjetische Hymne sang, sondern ein gewaltsam entstandenes Konstrukt, das weder innerlich frei noch äußerlich unzertrennlich ist. Das Imperium bleibt bei aller Zentralisierung der politischen Mechanik und Herrschaftsgewalt innerlich fragmentiert und ideell unverbunden, es fehlt ihm an innerer Überzeugungskraft. Die Herrschaftsgewalt, der unfreiwillige Beitritt der Völker, bleibt unüberwindbar.
Somit kann die imperiale Idee jederzeit bestritten werden. Und tatsächlich muss sie sich im Wettbewerb mit alternativen Staatsideen bewähren, die Freiheit und Selbstbestimmung ohne imperiale Herrschaft versprechen und daher zentrifugal wirken. Sie sind gefährlicher als jeder äußere Feind, denn sie destabilisieren den imperialen Staatsaufbau von innen. Die größten Feinde des russischen Imperiums sind daher nicht die USA oder die NATO, sondern der ethnische Nationalismus und der politische Islam.
Je repressiver die zaristische und sowjetische Zentralmacht versuchte, die tradierten Kulturen, Sprachen und Religionen zu verbieten, zu assimilieren oder schlichtweg auszurotten, desto mehr stärkte sie das Bewusstsein der unterworfenen Völker für ihre eigene Identität. Die Polen erheben sich 1830 und erneut 1863 gegen die repressive Herrschaft der Zaren – die polnische, tief in der Nationalgeschichte, der komplexen Sprache und dem Katholizismus begründete Identität verweigert sich jeder Assimilation. Und je mehr die angrenzenden Imperien versuchen, Polen von der Landkarte zu radieren, desto hartnäckiger klammert es sich an seine Kultur. Auch die sowjetischen Herrscher erfahren dies, als die Regierung Jaruzelski ab 1981 mit Billigung aus Moskau das Kriegsrecht ausruft, um die Gewerkschaftsbewegung zu unterdrücken, die nicht nur bessere Arbeitsbedingungen, sondern auch vermehrt innere Freiheiten einfordert.
Auch im Westen des Zarenreichs dient die russische Sprache dazu, die lokale Bevölkerung zu assimilieren – sie soll nicht nur lingua franca für den Alltag, sondern Identifikationsmerkmal sein. Der Erfolg ist begrenzt, man muss zwar nun in offiziellen Angelegenheiten russisch sprechen, gibt aber innerlich und zu Hause die eigene Identität nicht auf.27 Nikolaus II. unterzeichnet 1899 das Februarmanifest, mit dem die bisher liberale Selbstverwaltung Finnlands endet: Nun soll es russifiziert werden. Gesetze werden nun direkt aus Moskau erlassen, Finnen sind in der zaristischen Armee wehrpflichtig, und Russisch wird zwingend Bildungs- und Verwaltungssprache – als der Generalgouverneur Bobrikow diese Politik gegen breite zivilgesellschaftliche Proteste durchsetzen will, wird er von einem jungen Finnen ermordet.
Auch die Ukrainer widersetzen sich und betonen ihre nationale Kultur, sie dichten, singen und publizieren in ukrainischer Sprache, was Alexander II. als staatsgefährdend empfindet. Mit dem Emser Erlass von 1876 verbietet er den öffentlichen Gebrauch der ukrainischen Sprache, nachdem der kleinrussische Dialekt in Wissenschaft und Schule bereits 1863 verboten worden war. Aber die ethnische Identität umfasst mehr als nur die Sprache. Viele Ukrainer mögen zwar Russisch als Muttersprache sprechen, aber sie empfinden sich deshalb genauso wenig als Russen, wie französisch- oder italienischsprachige Schweizer sich als Franzosen oder Italiener verstehen.
Putins forcierte Russifizierung in den besetzten Gebieten der Ukraine geht daher weiter, sie strebt danach, die Identität vollständig auszulöschen. Plakate verkünden: Mit Russland in die Zukunft! Und das heißt: Wer keinen russischen Pass annimmt, gilt als Ausländer und kann nach Russland umgesiedelt werden. Auch Rente, Gewerbeschein und Gesundheitsversorgung gibt es nur noch mit russischem Pass, Schulbücher erscheinen nur noch in russischer Sprache, und gelehrt wird die Staatspropaganda – ein Vorgeschmack darauf, was die gesamte Ukraine erwartet, wenn sie den Krieg verlieren sollte. Aber so, wie sich die freie Ukraine dieser Russifizierung verweigert und für ihre Eigenstaatlichkeit kämpft, so sind die Assimilationsversuche auch in vielen anderen Regionen fehlgeschlagen. Wenn außerhalb ihrer Region erwerbstätige Dagestani auf der Zugfahrt erzählen: Ich fahre nach Russland arbeiten – dann entwerten sie mit diesem einfachen Satz ganze Jahrhunderte imperialer Assimilationsversuche.28
Noch gefährlicher für die imperiale Idee als der ethnische Nationalismus ist der politische Islam. Wenn muslimische Geistliche bei Putins offiziellen Reden im Publikum sitzen und damit den Eindruck einer multireligiösen Gemeinschaft vermitteln, ist das zwar eine schöne Inszenierung, aber nicht die gesellschaftliche und politische Realität. Im Gegenteil herrscht in der russischen Politik ein starkes Misstrauen gegen den politischen Islam und dessen Sprengkraft.
Im Kaukasus erinnert man sich immer noch lebhaft an Imam Schamil, der den zaristischen Truppen jahrelang erfolgreich Widerstand leistete. Dagestan, das von einer Vielzahl unterschiedlicher Volksgruppen besiedelt ist, die mindestens 20 verschiedene Sprachen sprechen, bleibt bis heute eine unruhige Provinz. Die Bevölkerung protestierte nicht nur gegen die Mobilisierung im September 2022, sie schaut auch auf das benachbarte Aserbaidschan, das wirtschaftlich deutlich erfolgreicher ist. Kurz nachdem Putin im Oktober 2023 eine Rede über interreligiöse und interethnische Toleranz gehalten hatte, stürmte ein antisemitischer Mob den Flughafen von Machatschkala. Und die Sowjetunion fällt 1979 nicht zuletzt deshalb in Afghanistan ein, weil sie den politischen Islam fürchtet: Gelänge es den Mudschaheddin, das kommunistische Regime in Kabul zu beseitigen, könnte das ganz Zentralasien zu erneuten Aufständen bewegen – insbesondere, weil die Bevölkerung der zentralasiatischen Sowjetrepubliken stärker wuchs als diejenige der RSFSR; die Mehrheitsverhältnisse begannen sich zu verschieben.29
Sobald ein Volk diese Ideen verwirklicht und einen eigenen Nationalstaat (oder ein eigenes Kalifat) gründet, negiert es auch den imperialen Herrschaftsanspruch. Beide Bewegungen wirken daher zentrifugal: Man benötigt keinen großen Bruder, der das eigene Schicksal gütig lenkt; das angeblich grenzenlose Russland endet am nationalen Schlagbaum. Nichts muss Russland daher mehr fürchten, als das Schicksal der habsburgischen und osmanischen Imperien zu erleiden, an den Zentrifugalkräften eines Vielvölkerstaates zu zerbrechen. Jedes Volk, das aus dem Imperium ausscheidet, rührt gleich in mehrfacher Hinsicht an diese Schwachstelle.
Zunächst entzieht jeder Austritt dem Imperium wirtschaftliche und menschliche Ressourcen. Russland hat heute weniger als halb so viele Einwohner wie die Sowjetunion vor ihrer Auflösung. Es kontrolliert nicht länger die usbekischen Baumwollplantagen, das kasachische Uran, die ukrainischen Weizen- und Sonnenblumenfelder. Knapp 30 Millionen Menschen in der Russländischen Föderation gehören nichtrussischen Ethnien und Kulturen an – und viele davon leben in den rohstoffreichsten Gebieten östlich des Ural. Dieser Landesteil ist dreimal größer als der westlich des Ural gelegene, wo zwar nur 20 Prozent der Gesamtbevölkerung leben, aber 80 Prozent des russischen Goldes geschürft sowie gegenüber den westlichen Gebieten ein Vielfaches an Industrie- und Edelmetallen gefördert wird. Und während die westlich gelegenen Ölfelder allmählich erschöpft sind und die Fördermengen sinken, produziert der Föderationsbezirk Ural zwei Drittel des Erdöls und über 80 Prozent des Erdgases. In den 1970er Jahren nimmt die Sowjetunion lange unterbrochene Bauarbeiten an der Baikal-Amur-Magistrale wieder auf, um große mineralische Lagerstätten in Sibirien und dem Fernen Osten zu erschließen. Der wirtschaftliche Erfolg dieser Eisenbahnstrecke bleibt zwar aus, doch mit steigenden Rohstoffpreisen nutzt Putin sie nun gewinnbringend.
Nicht Moskau und St. Petersburg erzielen das größte regionale Bruttoinlandsprodukt (BIP), sondern die autonomen Bezirke (округа) Nenets, Chanty-Mansisk, Tschuchotka sowie die Republiken Komi, Burjatien und Sacha (Jakutien) – alle benannt nach den Völkern, die dort leben. Die Zaren ahnten nichts von den gewaltigen Rohstoffvorkommen, als sie diese Regionen unterwarfen, aber heute werden sie von den politisch kontrollierten Staatskonzernen ausgebeutet. Aber warum sollten die dort lebenden Völker ihre Ressourcen nicht selbst kontrollieren und die Einnahmen für sich behalten?30
Der Verlust dieses wirtschaftlichen Potenzials wäre umso schmerzhafter, wenn das ausgeschiedene Volk auch ohne Russland wirtschaftlich erfolgreich sein sollte. Denn nichts ist für einen Kolonisator demütigender, als zu sehen, dass es der ehemaligen Kolonie besser geht als unter seiner Herrschaft. Der Austritt wird damit zur dreifachen Provokation: Er entlarvt die imperiale Herrschaft als wirtschaftliche Ausbeutung, zeigt auf, dass man ohne sie erfolgreicher ist, und er macht den neuen Staat zum Leuchtturm, der ins Rest-Imperium zurückstrahlt, zur ständigen Provokation direkt an der Grenze: Schaut, wie gut es uns geht, ihr könntet auch so leben. Das kaufkraftbereinigte BIP pro Kopf von Litauen und Estland lag 2021 mehr als 15 Prozent über dem russischen, dasjenige von Lettland weniger als zehn Prozent darunter – obwohl diese Länder rohstoffarm sind und nur über einen Bruchteil der russischen Landesfläche und Bevölkerung verfügen. Aber sie entwickelten Geschäftsmodelle, die ihnen Wettbewerbsvorteile und damit Wohlstand verschaffen, und sind in den europäischen Binnenmarkt integriert.31
Schwerer als der wirtschaftliche wiegt jedoch der ideelle Verlust, die Negation der imperialen Idee: Jeder Austritt ist auch eine Abstimmung mit den Füßen, ein verlorener Ideenwettbewerb, eine narzisstische Kränkung, die an der Vorstellung einer zivilisatorischen Überlegenheit und Berufung kratzt: Ihr seid nicht überlegen, nicht auserwählt, wir brauchen euch nicht. Das Imperium reagiert darauf zunächst mit Larmoyanz: Wir haben euch entwickelt, ans Licht der Zivilisation geführt, und nun verlasst ihr uns, ihr Undankbaren!
Gerade weil das Imperium sich als Kulturbringer versteht, empfindet es jeden, der sich von dieser Idee abwendet, als undankbar, ja geisteskrank – wenn nicht gar von ausländischen Agenten verführt. Puschkin hat diesem beleidigten Vorwurf ein literarisches Denkmal gesetzt: Und der wilde Schrei des Krieges schwieg: Alles vom russischen Schwerte beherrscht. Stolze kaukasische Söhne, ihr habt gekämpft, seid qualvoll gestorben, doch unser Blut errettete euch nicht (…) der Kaukasus verrät seine Urgroßväter.32 Diese Larmoyanz ist jedoch nicht nur ein russisches Phänomen, sondern ein typischer kolonialer Reflex. Auch Charles de Gaulle zeigte sich 1958 nach seinem Staatsstreich verärgert und enttäuscht, als Guinea sich für unabhängig erklärt und auch andere nord- und westafrikanische Völker sich weigern, der geplanten communauté française beizutreten: Frankreich hat euch ans Licht der modernen Zivilisation geführt, und nun lasst ihr uns im Stich.33
Aber Frankreich ist auch ohne seine Kolonien immer noch eine laizistische Republik mit klarem Nationalbegriff, und Großbritannien hat auch ohne das Empire eine tiefgründige Verfassungs- und Kulturgeschichte sowie eine nationale Identität. Es schmerzt zwar, die wirtschaftlichen Ausbeutungsgebiete und Absatzmärkte zu verlieren, aber man lässt sie schließlich ziehen – unwillig, zähneknirschend, mitunter erst nach erfolglosen Kolonialkriegen –, aber büßt deshalb nicht die eigene Staats- und Nationalidee ein. In Russland erodiert jedoch mit dem Territorium auch die fragile Identität des Imperiums. Jede geographische ist somit auch eine ideelle Schrumpfung, denn sie negiert die imperiale Staatsidee, weist Russland schmerzhaft auf sein ewiges Grundproblem hin: die unvollständige Nationalidee, das Fehlen eines integrativen Modells.34 Wenn sich die einst unterworfenen Völker wieder verabschieden, ist ein imperialer Staat nicht mehr vorstellbar. Denn die Moskauer Zentralmacht und die von ihr kontrollierten Gebiete können ohne einander nicht bestehen, sie sind unauflöslich in der imperialen Staatsidee verwoben. Diese lässt sich nicht mit westlichen Nationalstaatsbegriffen fassen, sie klammert sich an die Vorstellung von Berufung, von zivilisatorischem Auftrag, von Größe um ihrer selbst willen, ist weder räumlich noch ethnisch klar abgegrenzt. Russland bleibt ein niemals fertiges und niemals fertigzustellendes Projekt, ein Baukasten fortwährender Selbstergänzung, ewig auf der Suche nach sich selbst, ewig unvollendet.
Die Kränkung eines Austritts liegt vor allem darin, dass ein Volk es wagt, die Verschränkung von Zentralmacht und beherrschtem Gebiet aufzubrechen, das Imperium nicht zu denken. Damit delegitimiert es den Herrschaftsanspruch, zeigt auf, dass die jahrhundertelange Expansion weder gottgewollt noch historisch notwendig war, dass das Imperium weder einen Siedlungs- noch Bildungsauftrag hat, sondern nur temporäre Gewaltherrschaft ausübt, dass es nicht höherwertig ist, sondern nur geographisch günstige Verhältnisse, das Machtvakuum des zerfallenden mongolischen Weltreichs, ausnutzen konnte – und dass es daher genauso zerfallen kann, wie es entstanden ist. Selbst die russische Sprache wäre dann nicht mehr lange lingua franca, bald würden sich Türkisch und Mandarin als neue eurasische Verkehrssprachen durchsetzen. Nach dem Verlust der staatlichen Hülle, dem Abschied aller unterworfenen Völker würde man lediglich wieder dort stehen, wo Iwan III. einst begann, bevor er Nowgorod unterwarf: in der Provinz hinter dem Wald (залесье), dessen slawisch-orthodoxe Ethnie zwar homogen, aber welthistorisch und wirtschaftlich unbedeutend ist.
Angesichts dieser existenziellen Bedrohung ist die Reaktion logisch und unmissverständlich: Wenn der Austritt das Imperium wirtschaftlich und ideell negiert, muss er verhindert werden. Wachsen kann das Imperium jederzeit, schrumpfen darf es nicht. Und deshalb wird jedes Gebiet, das sich erdreistet zu gehen, immer wieder zurückgeholt – entweder sofort oder, wenn das Imperium temporär geschwächt ist, sobald wieder Ressourcen verfügbar sind. Daher reagiert das Imperium 1990 genauso wie 1918: Was fortstrebt, wird wieder eingefangen. Auch Putin ist nur eine personelle Repräsentanz dieser imperialen Reflexe: Was einst bei uns war, ist immer noch unser. Es greift daher zu kurz, Putins Politik als neo-imperial zu bezeichnen. Russland ist seit 1552 ein Imperium und hat nie aufgehört, es zu sein.
Die Spezialoperation in der Ukraine ist daher weit mehr als ein territorialer Revisionskrieg, und sie ist auch nicht Putins persönliches Projekt. Es geht nicht nur um die Rückeroberung angeblich historisch russischer Gebiete, sondern um die imperiale Identität selbst. Russland muss verhindern, dass ein großes, wirtschaftlich erfolgreiches Gegenmodell direkt an der Grenze entsteht, das sich in einem militärischen Abwehrkampf dem imperialen Einfluss entzogen hat. Eine souveräne, erfolgreiche Ukraine ist die ultimative Verneinung der imperialen Idee: ein slawischer Staat, der ohne autokratische Führerfiguren auskommt, nicht expansiv, dafür aber demokratisch und rechtsstaatlich ist, in dem eine große jüdische Minderheit friedlich mit sowohl orthodoxen als auch katholischen Christen lebt, in dem kyrillisch geschrieben, aber westlich gedacht wird, in der ganz unterschiedliche Völker leben, die aber freiwillig eine gemeinsame Staatsidee tragen. Somit würde ebenso die russische Umdeutung ihres Territoriums und ihrer Identität negiert: Wir sind nicht Neurussland, wir sprechen nicht kleinrussisch.
Und auch wirtschaftlich könnte die Ukraine erfolgreich sein, sie ist nicht darauf angewiesen, ihre Wirtschaftsbeziehungen auf Russland auszurichten. Bereits vor dem Krieg gingen rund 40 Prozent der ukrainischen Warenexporte in die EU