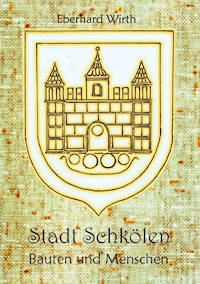
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das vorliegende präsentiert in unvergleichlicher Weise Stadtgeschichte und -entwicklung mit den baulichen Werken insbesondere der Burg, den Stadtmauern und Wegeanbindungen sowie der Klosterentwicklung von Schkölen/Thüringen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 101
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danksagung an die Helfer
Für die Zuarbeit zu diesem Büchlein danke ich den Schkölenern und dortigen Hauseigentümern, besonders den Zulieferern für Text und Bild. sowie allen, die an der Buchgestaltung mitgewirkt haben.
Inhalt:
Entwicklung der Stadt
Kirchen
Der Bergfried der Burg
Die Wehrtürme der Burg
Die mittelalterliche Stadtmauer
Alte Häuser in der Stadt
Persönlichkeiten der Stadt
Straßen und Wege um Schkölen
Quellenangaben,
Dr. Max Wilcke:
„Zeitzer Heimat“ und
Ausarbeitung Eckart Fricke, Haan
Juliane Richard Peter:
Zuarbeit von Sylvio Nimmler,
Nachlass von J. R. Peter,
Information Dora Wirth
Volkmar Leisring:
Chr. Ulrici, Probsteiakten,
Horst Leisering Marktlohe
Fritz Schmidt:
Inge Voigt, Schkölen
Paul Friedrich, Zeitz
Ernst Ortlepp:
„Ortlepp Gesellschaft“ Zeitz,
J.R. Peter, Chr. Ulrici
Karl Theodor Albert Liebner:
Dr. Johannes Hübner, Berlin
Gottfried und George Pfeiffer:
Chr. Ulrici, Probsteiakten
Alfred Kästner:
„Gesch. u. Altertumsverein Zeitz“
Harald Menz
Johann Christian Neumann:
Chr. Ulrici, Probsteiakten
Christiane Wilhelmine Stange:
Chr. Ulrici, „Ostthür.Ztg.“
Frau Bioly, Stadtarchiv Dresden,
Probsteiakten
Ferdinand Aug. Harnisch:
Chr. Ulrici, Probsteiakten, Arch.
Otto Harnisch Bln., Joachim Hermann Unkel/Rh., Dr. Joh. Hübner,
Bln., Stadtverw. Schkölen, Frau
Titscher, Landesarchiv Bln., Frau
Bötticher, Inge Voigt, Ehrfr. Boczaga
Arthur Vollrath:
Bernhard Vollrath, Renate Vollrath,
R. Wänke, Käthe Sigusch, Probsteiakten
Adolf Emil Ulrici:
Stadtverw. Schkölen, Frau Titscher,
Holger Langrock, Bensheim,
Helene Priese „Schkölener Anzeiger“, Ute Reglitzky, Schalby
Johann Karl Lehmann:
Chr. Ulrici, Museum Luckau,
Andrea Schaller, Naumburg
Ernst Reinhardt:
Probsteiakten, Festschrift 1958,
„Zwischen Saale und Elster“,
G. Holland
Martin Sommer:
Probsteiakten,
Torsten Kühn, Zeitz
Hartwig Neumann:
Festungsbau-Kunst und Technik
(Deutsche Wehrbauarchitektur
19./20.Jh.) (ISBN 3-8289-0395-9)
Schauen wir auf die Gegebenheiten und die Urentwicklung unseres Ortes:
Unser Land, die sanften Hügel um Schkölen, werden in weitem Bogen gefasst von der Saale, die von Jena bis Weißenfels einen großen Viertelkreis um Schkölen macht und die Verkehrsadern auf sich zieht. So wundert man sich, dass es auf der Fläche noch nennenswerte Ansiedlungen gibt. Die hier nur sanften Erhebungen entwässern durch Bäche unauffällig, meist über das Wethautal nach Nordosten und meiden so lange wie möglich die Saale. Nur wie zufällig zeichnet sich ein Bergkamm zwischen zwei Tälern ab - seit Jahrhunderten von der Schkölener Kirche gekrönt: das gute Stück von Schkölen. Kalkstein ist das Grundgebirge unter unserem Ort, in Nachbarschaft mit Kies und Ton aus anderen Erdzeitaltern. Als Ziel der Flucht in Notzeiten bauten sich hier Slawen ein Versteck, die kleinen Dörfer des Wethaugebietes wollten dann hier Schutz finden.
Die obere Fläche, heute vom Sportplatz bis zum Markt wurde durch querverlaufende Gräben in Einzelflächen zerschnitten: Zuerst östlich vom Sportplatz, wovon ein Stück des Weges am Stadtpark verschüttet ist, dann zwischen Schule und Friedhof, gut als Straßeneinschnitt sichtbar, nun wieder wenig auffällig von der Wasserstelle des Friedhofs zum Stadtparkeingang, von dort aber noch zu bemerken, dann noch eine Vertiefung am Friedhofszugang (auf der nördlichen Seite von Nummer 3 gut zu sehen, auf der südlichen mit Schutt der Vorgängerkirche gefüllt) und als gepflasterte Straße zwischen Markt 1 und Oberburg, ehemals der Burggraben. Ein angenommener Feind hatte also fünf Hindernisse aus Graben und Wall zu erobern, bis er die kleine Oberburg auf der Insel einnehmen konnte. Diese große Burg war für viele Menschen und ihr Vieh als Zuflucht angelegt worden. Die Bewohner der kleinen Dörfer flüchteten hierher - die Slaven vom Wethaugau. Dazu gehörten die Bäche, die der Wethau zuflossen, also auch unser Mönchsbach und seine Zuflüsse, sicher auch jene Nachbarorte daneben, die damals existierten.
Die Befestigungen an den Bergseiten waren Erdwälle mit Holzpalisaden, quer zum Berg gab es die Gräben. Für die Verteidigung wurden viele Menschen gebraucht, die in friedlichen Zeiten in ihren Dörfern besser wohnten als auf der wasserlosen Hochfläche.
Nach der Zeit des slawischen Verstecks kam die Zeit der Zugehörigkeit zum deutschen Reich Ottos I, und da gleich als Reichsbesitzung - in Dornburg war eine Residenz des Kaisers. Er hatte keine Hauptstadt, sondern nur Haupt - Stätten, wo seine Hofleute längere Zeit wohnten. Hier musste für Essen und Trinken gesorgt sein, hier musste man warm und sicher wohnen können. Beschäftigen wir uns mit Essen und Trinken, so lieferten Dörfer in Thüringen die Lebensmittel und der Wald rechts der Saale Hirsche und Schweine. Die Bäume der Wälder lieferten die Wärme. Die Sicherheit war schon in Dornburg gegeben, auch später war die Burg noch recht fest. Im Umfeld aber wurde ein Sicherheitssystem aufgebaut: Der Zugang vom Süden im Saaletal wurde durch die Hausbergburgen bewacht, der im Norden schon durch die Camburg. Einzelburgen sicherten die Thüringer Westseite.
Und die Ostseite im Wald? - Da bot sich die nicht mehr gebrauchte Slawenburg auf dem Bergkamm an: man begann sie zu sanieren und besetzte sie mit Männern, die sowohl Krieger, Bauern als auch Jäger waren und auch Bauarbeiten machen mussten. Was die Slawen SCOLANI genannt hatten, der Schreiber des Kaisers dann IHHOLANI niederschrieb, das hatte nun einen Titel im Lande Dornburg und war Reichsort! Bei den Aufenthalten des Kaisers in Dornburg - Schkölen wird erst einmal nicht genannt es ist ja nicht eigenständig.
Von den Burgkommandanten oder Vögten mag Schkölen als Befestigung ausgebaut worden sein, es wird aber mit Dornburg zusammen an Wiprecht von Groitzsch verschenkt. Schkölen hat damit ab 1100 einen privaten Grundherrn. Der sorgt für weitere Besiedelung, sorgt für die angrenzende Fläche, dass sie eine Stadt wird. Jetzt sind mehr nur Kriegsmänner in Schkölen. Schkölen ist nun eine private Grundherrschaft und reiht sich in die Kette kleiner Burgen von Groitzsch nach Dornburg ein. Jetzt beginnt der Ausbau in Stein, zuerst der Turm auf der kleinen Insel und die Bebauung um den heutigen Markt. Der Zugang am heutigen Friedhofstor wurde durch ein festeres Gebäude (jetzt Kirchgasse 4) geschützt, die Wohnhäuser waren aus Holz. Da die kleine Turminsel nur für die Besatzung eine letzte Zuflucht war, fasste sie wenig Lebensmittel. In der Stadt wurden daher vor dem Zugang Speicher gebaut, fast eine Art Vorburg. Trotz aller Mühe war die Sicherung nicht für die Zukunft ausreichend.
Nach den Erbstreitigkeiten des „Thüringer Erbfolgekrieges“ erscheint ein Heinrich von Königsfeld in Schkölen. Bisher wurde kein örtlicher Verwalter, Vogt oder Burgkommandant je mit Namen genannt. Sie sind in der Geschichte verschwunden! Heinrich kommt aus der Rochlitzer Gegend, ist also ein Lehensmann der Markgrafen von Meißen. Von Nachkommen hören wir nichts, aber als nächste Besitzer werden von Kothewitz genannt. Vielleicht hat eine Tochter von Königsfeld einen Edlen von Kothewitz geehelicht? in diesen Jahren ist wohl das neue Stück Burg im Norden angebaut worden. Die starke Kemenate (heute nur noch Terrasse) und der östliche Seitenbau, beide Bauten auf der schon stehenden Außenmauer des nördlichen Burganbaus sind wohl ihr Verdienst. Der Zugang wurde an die Nordseite verlegt. Der Fußweg über den Graben wurde jedoch weiter beibehalten und das in der Stadt vorgelagerte Grundstück blieb weiter in Burgbesitz. So erhielt sich die „gotische Pforte“ bis heute.
Burg Schkölen in der Gegenwart
Die Bauten der Burg
Die Schkölener Burg 2000
Der östliche Seitenbau, sicher später im oberen Teil verändert zur Försterwohnung, war wohl im Erdgeschoss Stallung und im Obergeschoss Knechte- und Mägdewohnung, ist heute das einzige Burggebäude. Am Eingang sieht man an der Mauerstärke, dass dies die einstige Außenmauer der Unterburg war, die Rundbogentür ist nachträglich eingebrochen worden. Der vorgelagerte östliche Zwinger führt geradewegs auf das nicht mehr vorhandene Tor zur Oberburg. Dadurch muss der Südostturm zu einem „halben Rundturm“ werden, er hat eng gedrängt drei Schießluken.
1 Haupttor
2 Gotische Pforte zur Stadt
3 westlicher Graben
4 jetzt: Ostzugang/Fenster
5 Aufgang zur Terrasse
6 Umgang auf der Mauer
7 Keller unter Kemenate
8 Mauer Oberburg
9 Turmfundament
10 Dächer der Wehrtürme
11 Kemenate
12 Hof Unterburg
13 Kapelle
Ob zwischen Oberburg und dem Giebel des Seitenbaues noch ein Sperrtor zum Schutz des Hofes bestanden hat, ist heute nicht mehr sichtbar.
Mit dem langsamen Wiederaufbau der örtlichen Herrschaft bringt es auch die Burg zur langsamen Genesung. Die Burgherren sind Herren der Stadt und einiger Dörfer, aber weiter reicht die Burgherrschaft nicht. Die Burg ist nun Eigenschutz der Burgherrenfamilie, die wiederum ist dem Markgrafen von Meißen dienstverpflichtet.
Die Oberburg und der Bergfried
Die Turmhügelburg ist zur Oberburg geworden. Aus dem anfänglichen Holzturm wurde ein starker Bergfried. Er ist uns in einer Zeichnung überliefert, die E. Ulrici im Archiv anfertigte. Der Turm blieb auch bei der Ummauerung der Burg mit Bastionen bestehen. Erst später wurde er - wohl der guten Steine wegen - abgetragen. Die Oberburg war ursprünglich kleiner als jetzt und hatte wenig Platz für weitere Bauten. Der kleine Bau, der im Fundament ausgegraben wurde, wird die Kapelle beinhaltet haben. Da Kirchen und Kapellen den Altar nach Osten gerichtet hatten, ergibt sich logisch eine Teilung, die annehmen lässt, dass noch ein Wohngemach für den Burgherren vorhanden war. Des Weiteren wird im Turm selbst, der über den Wehrgang erreichbar war, ein Geschoss bewohnbar gewesen sein.
Der Zugang zur Burg war in alter Zeit von der Stadt her etwa an der jetzigen „gotischen Pforte“ Er wurde an der Nordseite des Turmhügels bis zum jetzigen„halben Bastionsturm“ geführt, wo östlich der Kapelle das Tor stand.
Als das Kastell im Norden angebaut wurde, verlegte man den Zugang nach Norden und musste um die Burg herumlaufen, wenn man von der Stadt kam. Mit der Umwallung und den Bastionen entstand die „gotische Pforte“, wozu dann eine kleine Tür zur Oberburg erforderlich wurde.
Kemenate - Querschnitt
Vor dem kleineren Bau ergab sich der Zugang, der von Norden an der Burgostseite entlang führte. Er endete vor dem Tor der Oberburg. Ein Tor zum Hof der Unterburg, also am Giebel des kleinen Baues ist evt. auch noch vorhanden gewesen. So konnte ein eingedrungener Feind in diesem Zwinger noch bekämpft werden.
Die Umwallung von 1540
Die jüngsten Befestigungen, zur Abwehr von Geschütz gedacht, haben sich am eindrucksvollsten erhalten. An der Nordseite am Zugang stehen die Bastionstürme am engsten. Ein weiterer Bastionsturm wurde vor die alte Mauer im Südwesten gesetzt. Hier ist noch der alte Mauerverlauf in der Oberburg zu erkennen. Etwa im Südosten ist eine „halbe Bastion“ vorgebaut, weil der Zugang zur Oberburg freigehalten werden musste. Der Zugang zu diesem „halben Turm“ ist von der Oberburg zu denken.
Südwestturm, rechts Überbrückung zur alten Mauer
Bei der baulichen Bearbeitung wurde auch die Zugbrücke neu hergestellt. Sie folgte den örtlichen Gegebenheiten und kommt ohne Umlenkrollen aus. Die „Gotische Pforte“ soll noch zur Zugbrücke vervollkommnet werden.
Außenanlagen
Um die Nord- und Ostseite der Burg wurde ein Erdwall gelegt, um feindliche Kugeln aufzufangen. Nur der (teils unterirdische) Bachlauf gibt noch etwa die Linienführung an. An den zwei Stadtseiten war ein Vorfeld nicht gegeben. Hier steht auch das Steintor der Stadt, das im Modell nur angedeutet wurde.
Wahrscheinlich war ein Großbrand 1536 der Auslöser für erneuten, verbesserten Wiederaufbau. Mit einer neuen Umwallung dicht vor der bisherigen Außenmauer wird etwa 1540 versucht, die Burg der neuen Geschütztechnik anzupassen. Starke Erdwälle nach Norden und Osten entstehen, die neue Burgmauer erhält Eckbastionen.
Die alte Umfassung der Oberburg verschwindet. Diesen Ausbau etwa um 1580 zeigt das Modell der Burg. Der Erfolg ist nur gering. Nur nach Norden und Osten gibt es Schussfeld und Wallschutz. Die Stadt, einmal in der Hand des Feindes, kann zur überhöhten Feindbastion werden. Auch bleibt die Enge in der Burg: einen Wirtschaftshof kann man nicht anlegen. Die Stadt selbst kann nicht nachgerüstet werden. Aus der Zehntscheune jenseits des Grabens entsteht das Gut.
Bald wird die Burg als Sitz der Gutsherren aufgegeben und als Steinbruch genutzt. Ein Gebäude dient dem Gutsförster als Wohnsitz, die Turmdächer geben das Bauholz, um das Gut aufzubauen. Schutt füllt die Oberburg aus, auf den Mauern wächst Gebüsch. Vom Hauptgebäude der Unterburg bleibt nur der Keller.
Die wohl in reichseigener Zeit ummauerte Stadt Schkölen hatte zwei Tore und zwei kleinere Pforten. Sie war zum Mönchsbach gewachsen und konnte nun nur jenseits des Baches erweitert werden. Die Möglichkeiten waren also eng. Die Burg orientierte sich entgegengesetzt und begann mit der Zehntscheune nach Norden, mit den Leibeigenen nach Nordwesten zu greifen. Das





























