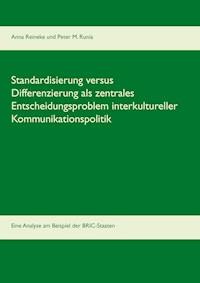
Standardisierung versus Differenzierung als zentrales Entscheidungsproblem interkultureller Kommunikationspolitik E-Book
Anna Reineke
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Marketing in Theorie und Praxis - Beiträge zur angewandten Marketingforschung und -konzeption
- Sprache: Deutsch
Band 1 der Reihe "Marketing in Theorie und Praxis" beschäftigt sich mit der Thematik des Interkulturellen Managements und bezieht sich hier auf die zunehmende Internationalisierung und Globalisierung. Hintergrund sind die komplexen Beziehungsgeflechte, welche die Wirtschaft und somit die Markt- und Wettbewerbssituationen heute und in der Zukunft prägen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort der Herausgeber
Mit der Schriftenreihe „Marketing in Theorie und Praxis – Beiträge zur angewandten Marketingforschung und -konzeption“ beleuchten die Herausgeber aktuelle Themenfelder und Forschungsgebiete aus der Marketingdisziplin. Entgegen aller Schlagworte und oft als Paradigmenwechsel titulierten Strömungen im Marketing stellen die Herausgeber das konzeptionelle Marketing im Sinne des Marketingprozesses in den Vordergrund der Diskussion.
Die in dieser Schriftenreihe erscheinenden Beiträge orientieren sich daher an dieser Grundlage. Der Marketingprozess mit seinen Phasen Marketinganalyse, Marketingziele, Marketingstrategien, Marketinginstrumente und Marketingkontrolle bietet eine solide Basis für Fragestellungen in allen institutionellen Bereichen des Marketing: Konsumgütermarketing, Industriegütermarketing, Dienstleistungsmarketing, Handelsmarketing und Non-Profit-Marketing. In der Bearbeitung der jeweiligen Aufgabenstellungen finden sich hier die theoretischen und praktischen Ansätze zur Problemlösung.
In Band 1 beschäftigen sich die Autoren mit der Thematik des Interkulturellen Managements und beziehen sich hier auf die zunehmende Internationalisierung und Globalisierung. Hintergrund sind die komplexen Beziehungsgeflechte, welche die Wirtschaft und somit die Markt- und Wettbewerbssituationen heute und in der Zukunft prägen.
im Oktober 2015
Peter M. Runia & Frank Wahl
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Ausgangslage und Problemstellung
1.2 Zielsetzung
1.3 Struktur der Arbeit
2. Kulturelle Grundlagen
2.1 Der Kulturbegriff
2.2 Interkulturalität
2.3 Interkulturelle Kompetenz
2.4 Interkulturelle Kommunikation
2.4.1 Der Kommunikationsprozess
2.4.2 Unterschiedliche Kommunikationsarten
2.4.2.1 Verbale Kommunikation
2.4.2.2 Para-verbale Kommunikation
2.4.2.3 Non-verbale Kommunikation
3. Interkulturelle Kommunikationspolitik
3.1 Bedeutung der Kommunikation im interkulturellen Marketing-Mix
3.2 Grundlagen der interkulturellen Kommunikationspolitik
3.3 Integrierte Kommunikation
3.4 Erklärungsansätze menschlicher Reizwahrnehmung
3.5 Möglichkeiten der Kommunikationsmittelgestaltung
3.6 Instrumente der interkulturellen Kommunikationspolitik
4. Interkulturelle Kommunikationspolitik zwischen lokaler Anpassung und globaler Standardisierung
4.1 Standardisierung versus Differenzierung
4.1.1 Standardisierungsstrategie
4.1.2 Differenzierungsstrategie
4.1.3 Internationale Dachkampagnenstrategie
4.2 Determinanten der Übertragbarkeit von Kommunikationskonzepten
4.3 Zusammenfassende Betrachtung
5. Kulturstandards der BRIC-Staaten
5.1 Vorstellung ausgewählter Kulturtheorien
5.1.1 Kulturstandards
5.1.2 Stand der Forschung
5.1.3 Eigene Auswahl geeigneter Kulturstandards
5.2 Vergleichende Länderstudien
5.2.1 Die brasilianische Kultur
5.2.2 Die russische Kultur
5.2.3 Die indische Kultur
5.2.4 Die chinesische Kultur
5.3 Zusammenfassende Gegenüberstellung der BRIC-Kulturen
5.4 Kritische Würdigung der Kulturstandards
6. Handlungsempfehlungen für den Standardisierungs- und Differenzierungsgrad kommunikationspolitischer Maßnahmen
6.1 Komponenten eines Kulturprofils
6.2 Empirische Vorgehensweise
6.3 Handlungsempfehlung für deutsche Messeanbieter
6.3.1 Massenkommunikation
6.3.2 Face-to-Face-Kommunikation
6.4 Potenziale und Grenzen der Standardisierung und Differenzierung
7. Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
B2B
Business to Business
B2C
Business to Consumer
BMWI
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
bzw.
beziehungsweise
CC
Corporate Communications
CD
Corporate Design
CI
Corporate Identity
ebd.
ebenda
et al.
und andere
f.
folgende
ff.
fortfolgende
Hrsg.
Herausgeber
S.
Seite
UAP
Unique Advertising Proposition
USP
Unique Selling Proposition
VAE
Vereinigte Arabische Emirate
Vgl.
Vergleiche
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1:
Drei Ebenen der Einzigartigkeit in der mentalen Programmierung des Menschen
Abbildung 2:
Das Eisbergmodell
Abbildung 3:
Die Dynamik kultureller Überschneidungssituationen
Abbildung 4:
Interkulturelle Kompetenz als allgemeine Handlungskompetenz mit interkulturellem Vorzeichen
Abbildung 5:
Der Kommunikationsprozess
Abbildung 6:
Ebenen der Kommunikation
Abbildung 7:
Low-Context- und High-Context-Kulturen
Abbildung 8:
Aufnahme der unterschiedlichen Kommunikationsarten
Abbildung 9:
Nation und Kultur als Bezugsgröße des internationalen Marketings
Abbildung 10:
Die klassischen Marketinginstrumente (4P's) im Marketingmix
Abbildung 11:
Das Corporate Identity Konzept
Abbildung 12:
Formen der integrierten Kommunikation
Abbildung 13:
Das S-O-R-Modell
Abbildung 14:
Paradigma der Kommunikation
Abbildung 15:
Kommunikationsinstrumente
Abbildung 16:
Merkmalsdimensionen
Abbildung 17:
Standardisierung und Differenzierung internationaler Kampagnen
Abbildung 18:
Determinanten der Übertragbarkeit von Kommunikationskonzepten
Abbildung 19:
Ausgestaltungsmöglichkeiten von Kommunikationsmaßnahmen
Abbildung 20:
Kulturvergleichende Studien
Abbildung 21:
Gegenüberstellung der BRIC-Staaten
Abbildung 22:
Komponenten eines Kulturprofils
Abbildung 23:
Standardisierung versus Differenzierung von Massen- und Face-to-Face-Kommunikation
1. Einleitung
1.1 Ausgangslage und Problemstellung
Immer mehr Arbeiten, die sich mit der Thematik des Interkulturellen Managements beschäftigen, deuten eingangs verstärkt auf die zunehmende Internationalisierung und Globalisierung, die die Wirtschaft und somit die Markt- und Wettbewerbssituationen für Unternehmen erschweren. Zu den ausschlaggebenden Trends des 21. Jahrhunderts gehören neben Kooperationsabkommen und Unternehmenszusammenschlüssen auch Tochtergesellschaften im Ausland, internationale Joint Ventures sowie Übernahmen über nationale Grenzen hinweg. Zwar sind diese Entwicklungen noch existent, trotzdem ist weltweiter Wettbewerb in der heutigen Zeit keine Ausnahmeerscheinung mehr.1
Unternehmen agieren durch das Aufnehmen grenzüberschreitender Geschäftstätigkeiten verstärkt im Kontext heterogener und von Dynamik geprägter Umwelten. Sie stoßen dabei auf Integrationsprobleme sowie auf Sprach- und Kulturgrenzen, die eine hohe Komplexität sämtlicher Geschäftsprozesse verursachen.2 Daher spiegelt sich der Alltag vieler global agierender Unternehmen zunehmend vor dem Hintergrund eines erforderlichen Verständnisses von anderen Kulturkreisen und den Umgangsformen mit ihnen wider.3
„Anticipating and understanding cultural differences and being able to adapt the way you communicate accordingly is the foundation of any successful international business. (…) If we want to be successful, we have to be able to do business in diverse cultural and linguistic environments."4
Diese Entwicklungen bedingen, dass heutige Management-Aufgaben um Kenntnisse hinsichtlich des sensiblen Umgangs mit Menschen fremder Kulturen und Mentalitäten erweitert werden müssen. Denn die Überwindung kultureller Differenzen entscheidet oftmals über Erfolg oder Misserfolg der Zusammenarbeit und ist daher von hoher Bedeutung.5
Es stellt sich folglich nicht die Frage, ob und inwieweit Unternehmen international handeln, sondern geht es vielmehr darum, zu erforschen, welche konkreten Herausforderungen die internationale Marketingaktivität mit sich bringt. Aus diesem Grund sehen die Verfasser des vorliegenden Werkes einen Anreiz, sich intensiver mit dem Optimierungspotenzial von Kommunikationsmaßnahmen zu befassen. Denn vor dem Hintergrund kulturbedingter Unterschiede sind heutzutage stets Entscheidungen dahingehend zu treffen, inwiefern gewisse Marketingkonzepte auf ausländische Märkte übertragbar sind oder sie auf die jeweiligen Märkte angepasst werden müssen.6 Dem interkulturellen Marketing wird somit eine erhöhte Bedeutung zuteil, sich mit der Entscheidung nach Standardisierung oder Differenzierung im Hinblick auf die internationale Marktbearbeitung zu befassen.7
Die Problematik, vor deren Hintergrund die Fragestellung der vorliegenden Monographie aufbaut, liegt zum einen in der bislang nur sehr wenig und zum Teil recht widersprüchlich erforschten Diskussion mit wenig hilfreichen Handlungsempfehlungen. So fehlen vielen Unternehmen oftmals Kenntnisse über kulturelle Hintergründe, um strategisch wert-volle Entscheidungen hinsichtlich der Standardisierbarkeit von Kommunikationsmaßnahmen treffen zu können. Zum anderen wird die Relevanz des Themas mit mangelnden Überlegungen seitens der praktischen Vorgehensweise in international agierenden Unternehmen begründet. Viel zu oft scheitern teure Kommunikationsmaßnahmen im Ausland, weil aufgrund ungenügender interkultureller Kompetenz keine differenzierten und auf die Zielkultur abgestimmten Werbemaßnahmen kreiert wurden. Exemplarisch wird dabei eine deutsche Messegesellschaft in die Überlegungen mit einbezogen.
1.2 Zielsetzung
Die bereits getätigten Aussagen haben gezeigt, dass in Zeiten der Globalisierung zwangsläufig auch das Marketing internationalisiert und somit interkulturalisiert wird. Dadurch, dass in der Regel mehrere Märkte zeitgleich bearbeitet werden müssen, wird das Entscheidungsproblem Standardisierung oder Differenzierung ins Zentrum jeglicher Entscheidungen gestellt.
Im Mittelpunkt der Diskussion um das globale Marketing steht die Frage nach der interkulturellen Kommunikation, weshalb sich der Fokus der folgenden Ausführungen speziell auf die Komponente der Kommunikationspolitik konzentriert. Interkulturalität erschwert Kommunikation stellt in diesem Kontext die zu untersuchende These dar. Es ergibt sich demnach die kontroverse Frage, inwieweit es sinnvoll ist, eine global undif-ferenzierte Kommunikationspolitik oder eine international differenzierte Kommunikatonsstrategie umzusetzen.
Das Ziel des Buches stellt letztlich eine Handlungsempfehlung dar, die als Entscheidungsgrundlage dafür dient, für welche Kultur und bezogen auf welche Wahrneh-mungs- und Verhaltensebene von Kommunikationsmaßnahmen eine Standardisierung bzw. Differenzierung zu empfehlen ist. Als praktische Orientierungshilfe und exemplarische Basis findet das Beispiel eines deutschen Messeanbieters Anwendung. Die Handlungsempfehlung wird jedoch auch für andere Branchen Gültigkeit haben.
Durch das Gegenüberstellen verschiedener kulturspezifischer Verhaltens- und Handlungsweisen soll abgeleitet werden, wo gegebenenfalls Unterschiede oder Parallelen im Hinblick auf verschiedene Kulturen liegen und wie das unterschiedliche (Kommuni-kations-)Verhalten begründet wird. Der Fokus liegt dabei auf den BRIC-Staaten.
Damit ein weitgehend vollständiges Kulturprofil erstellt werden kann, wird in einem nächsten Schritt zum einen die Massenkommunikation und zum anderen die Face-to-Face-Kommunikation betrachtet, die sich jeweils auf unterschiedliche Wahrnehmungsund Verhaltensebenen beziehen. Es wird schematisch dargestellt, wann ein Unternehmen eher individuelle, differenzierte Maßnahmen ergreifen sollte bzw. hinsichtlich welcher Ebenen bei den Kulturen keine großen Unterschiede liegen und diese somit standardisiert werden können. Als Begründungsvorlage dienen die zuvor herausgestellten Kulturstandards sowie die kulturabhängigen Erkenntnisse der Wahrnehmung.
Für die Praxis soll dadurch eine Sensibilität für die Thematik geschaffen werden, damit kommunikationspolitische Entscheidungen künftig zielgruppenspezifischer geplant und umgesetzt werden können.
1.3 Struktur der Arbeit
Wie eingangs beschrieben, werden in dieser Arbeit kulturelle Unterschiede zwischen den BRIC-Staaten und Deutschland herausgearbeitet, um darauf aufbauend eine Handlungsempfehlung für eine erfolgreiche interkulturelle Kommunikationspolitik zu entwickeln. Zur Erarbeitung der Thematik ist die vorgelegte Monographie grob in sieben Teile gegliedert:
Um die im ersten Kapitel beschriebene Ausgangssituation thematisch zu vertiefen, soll der zweite Teil ein Grundverständnis für die Thematik der Interkulturalität vermitteln, indem Grundlagen und Schlüsselbegriffe erörtert werden. In diesem Kapitel geht es darum, eine Sensibilität für die Bedeutung kultureller Faktoren im Allgemeinen und vor allem in Bezug auf die interkulturelle Kommunikation zu schaffen.
Der nachfolgende Punkt widmet sich dem internationalen Marketing und speziell der interkulturellen Kommunikationspolitik. Zudem dient dieses Kapitel dazu, konkrete Möglichkeiten der Kommunikationsmittelgestaltung in Verbindung mit den Erklärungsansätzen menschlicher Reizwahrnehmung zu vertiefen.
Das vierte Kapitel thematisiert die Entscheidungsproblematik der Standardisierung und Differenzierung. Zunächst werden die beiden Terminologien voneinander abgegrenzt, um darauf aufbauend verschiedene strategische Handlungsweisen für das internationale Marketing und die interkulturelle Kommunikation von Unternehmen zu thematisieren.
Im darauffolgenden, fünften Kapitel werden unterschiedliche Kulturtheorien vorgestellt. Auf Basis dessen werden die Kulturprofile der BRIC-Staaten anhand von Kulturstandards voneinander und von der deutschen Kultur abgegrenzt.
Damit die Standardisierungs- bzw. Differenzierungsfrage interkultureller Kommunikationspolitik abschließend in Bezug zu den Kulturen der BRIC-Staaten gesetzt werden kann, befasst sich das sechste Kapitel konkret mit dem Standardisierungs- und Differenzierungspotenzial der wahrnehmungsbeeinflussenden Kommunikationsinstrumente. Vor dem Hintergrund der herausgestellten psychologischen und kulturellen Basis der BRIC-Staaten sollen die Kommunikationsinstrumente gebündelt als Massen- oder Face-to-Face-Kommunikation untersucht werden, um zu erfassen, ob Standardisierungspotenziale vorliegen oder nicht.
Die daraus resultierenden Erkenntnisse sind als Handlungsempfehlung für Unternehmen zu verstehen, damit künftige Entscheidungen im Hinblick auf strategische Vorgehensweisen systematisiert und vereinfacht werden können und gleichzeitig interkulturelles Know-how vermittelt wird. Inwieweit kulturbedingte Komponenten in der Kommunikationspolitik berücksichtigt werden können, wird durch themenverwandte Studien und Modelle sowie durch Experteninterviews, die in die Handlungsempfehlung einfließen, verdeutlicht.
Zum Schluss werden die wesentlichen Erkenntnisse durch ein Fazit und einen kurzen Ausblick auf das Entwicklungspotenzial zusammengefasst.
1 Vgl. Upitz (2013), S.1.
2 Vgl. Bruhn; Stauss (2005), S.10; Rothlauf (2012), S.2.
3 Vgl. Yun Kim (2009), S.53 ff.
4 Carté; Fox (2008), S.XI.
5 Vgl. Experteninterview 1; Berninghausen; Kuenzer (2007), S.5; Vogler (2012), S.70 ff.
6 Vgl. Fuchs; Unger (2007), S.630.
7 Vgl. Meffert et al. (2010), S.9 f.
2. Kulturelle Grundlagen
2.1 Der Kulturbegriff
Dass verschiedene Kulturen zu unterschiedlichen Handlungen neigen, wird durch die weit verbreitete Aussage andere Länder, andere Sitten bereits verdeutlicht.8 Der Kulturbegriff entzieht sich jedoch bis heute jeglicher universeller Definition. Das liegt darin begründet, dass es sich bei Kultur um ein interdisziplinäres Phänomen handelt, welches mehrere Wissenschaftsrichtungen tangiert.9 Viel zu oft wurde der Begriff auf verschiedenste Art und Weise neu interpretiert und definiert.10 Aufgrund seiner, in der Literatur sehr umfassend diskutierten und teils umstrittenen Bedeutung, ist es daher fraglich, ob ein weiterer Versuch einer Begriffsdefinition seitens der Autoren dieser Monographie nicht die herrschende Uneinigkeit über den Kulturbegriff noch verstärken würde. Es erscheint eher ratsam, Grundmuster anzusprechen, die einen Überblick über die Materie erlauben.
Im Folgenden geht es demnach nicht darum, die Verschiedenheit der bestehenden Interpretationen von Kultur aufzuzeigen. Vielmehr soll ein grundlegendes Feingefühl für den Kulturbegriff geschaffen werden, welches im Hinblick auf den weiteren Verlauf der Untersuchung ein stimmiges Grundverständnis vermitteln soll. Denn die Bedeutung von Kultur ist erst dann greifbar, wenn diesbezüglich ein tieferes Verständnis erlangt wird, indem die Inhalte erfasst und veranschaulicht werden.11 Doch worum geht es bei dem Konstrukt Kultur nun genau?
Kultur ist kein statisches Gebilde und lässt sich als grundlegendes, durch permanente Veränderungen geprägtes Konzept verstehen, welches die Angehörigen der jeweiligen Kultur beeinflusst.12 Da die Kultur (teilweise) mit Menschen desselben sozialen Umfeldes geteilt wird, lässt sie sich als kollektives Phänomen beschreiben.13 Demnach lassen sich in jeder Kultur Eigenheiten in Form eines gewissen Zeichen-, Wissens- und Orientierungssystems erkennen. Diese definieren für die Mitglieder einer Kultur die Zugehörigkeit zur Gruppe und enthalten zur Identifikation gewisse Gewohnheiten und Zeichen wie Sprache, Mimik und Gestik, Kleidung oder bestimmte Rituale.14
Eine der bekanntesten und in diesem Kontext sehr passenden Definitionen geht auf Geert Hofstede zurück. Er bezeichnet Kultur als „kollektive Programmierung des Geistes, die die Mitglieder einer Gruppe oder Kategorie von Menschen von einer anderen unterscheidet”.15 Kultur ist demzufolge durch Muster16 des Denkens, Fühlens und Handelns gekennzeichnet, welche sich jeder Mensch im Laufe des Lebens angeeignet hat.17 Die Quelle dieser inneren Muster liegt folglich im sozialen Umfeld, denn die Programmierung beginnt in der Familie und setzt sich in den Bereichen Partnerschaft, Schule, Arbeitsplatz, Nachbarschaft, und Gesellschaft fort. Hofstede geht also davon aus, dass Kultur nicht angeboren, sondern erleb- und erlernbar ist.18
Bislang ist in der Forschung noch kein Konsens darüber gefunden worden, welche Bausteine und Dimensionen eine Kultur nachhaltig prägen. Um ein gutes Grundverständnis für die Thematik zu liefern, greift das vorliegende Buch auf die nachfolgende Darstellungsform zurück:
Abbildung 1: Drei Ebenen der Einzigartigkeit in der mentalen Programmierung des Menschen
Quelle: Eigene Abbildung nach: Hofstede; Hofstede (2011), S.5.
Im Gegensatz zur Kultur bezeichnet die menschliche Natur alles Universelle, was den Menschen gemein ist. Natürliche Phänomene entsprechen den Grundzügen emotionaler Fähigkeiten wie das Empfinden von Angst, Zorn, Freude, Liebe, Scham oder Trauer. Der Naturbegriff schließt folglich alles ein, was vererbt wird und nicht durch den Sozialisationsprozess entsteht.19
Die Darstellung der Emotionen ist dagegen das Resultat der Einflüsse durch die Kultur.20 Denn wie bereits angeführt, leitet sich Kultur aus unserem sozialen Umfeld ab und wird nicht vererbt. Was wir durch unser soziales Umfeld erlernen sind gruppenspezifische Werte, Normen, Sprache, Religion, Sitte sowie Welt- und Menschenbilder.21
Die höchste Ebene ist die Persönlichkeit eines Individuums. Sie enthält sowohl erlernte als auch vererbte Verhaltensweisen und wird aufgrund ihrer Einzigartigkeit mit keinem anderen Menschen geteilt.22
Eine Kultur nimmt keine Rücksicht auf Landesgrenzen, sondern manifestiert sich dort, wo gleiche Handlungsweisen erkennbar sind.23 Sie kann demnach sowohl in geographischen Großräumen (Europäische Kultur) als auch in Regionen (Bayrische Kultur), in Religionsgemeinschaften (Islamische Kultur), in Gruppen von Jugendlichen (Sub-Kulturen wie beispielsweise Punk) oder auch in Generationen (Kultur der 68er-Generation) entstehen.24 Trotzdem sollte an dieser Stelle betont werden, dass die individuelle Identität niemals in einer einzigen Kulturformation aufgeht.25 So kann ein Individuum zugleich Deutscher sein, aber einen russischen Migrationshintergrund haben oder zur Technoszene gehören und zeitgleich zur Berufsgruppe der Wirtschaftsprüfer.
„Die Kulturen haben de facto nicht mehr die unterstellte Form der Homogenität und Separiertheit. Sie haben vielmehr eine neuartige Form angenommen (...), weil sie durch die traditionellen Kulturgrenzen wie selbstverständlich hindurchgeht.“26
In der heutigen Zeit scheitert der traditionelle Begriff von Kultur immer mehr an der inneren Differenziertheit und Komplexität der modernen Kulturen.27 Aus diesem Grund sollte die von vielen als selbstverständlich hingenommene Behauptung, alle Kulturen seien in sich homogen, in Frage gestellt werden. Denn heute sind Kulturen vielmehr miteinander verflochten, was dazu führt, dass im Innenverhältnis einer Kultur gleichermaßen Fremdheiten existieren wie im Außenverhältnis zu anderen Kulturen.28 Wird demnach von in sich abgeschlossenen und unveränderbaren Universen ausgegangen, so ist diese Annahme fernab von der Realität. Vielmehr ist Kultur als offenes, dynamisch-veränderbares Orientierungssystem zu sehen, welches Raum für Überlappungsund Austauschprozesse mit anderen Kulturen bietet.29 Daher sind in der Praxis soweit wie möglich auch das Individuum und die unterschiedlichen Lebensformen zu betrachten.
Diese Publikation hat ihre Grenzen jedoch darin, jegliche Ausprägungen und Sub-Kulturen untersuchen zu können. Aus diesem Grund sei für den weiteren Verlauf der Untersuchung zu betonen, dass lediglich Länder-Kulturen voneinander abgegrenzt werden und keine Rücksicht auf den Aspekt der Multikulturalität innerhalb einer Kultur genommen wird.
Als weitere bekannte bildhafte Beschreibung von Kultur lässt sich das sogenannte Eisberg-Modell zur Vertiefung der Materie heranziehen, bei dem vereinfacht zwei Ebenen von Kultur angenommen werden:
Abbildung 2: Das Eisbergmodell
Quelle: Eigene Abbildung nach: Walker et al. (2003), S.40.
Das Eisbergmodell verdeutlicht, dass einige Kulturbereiche „über der Wasseroberfläche" liegen und demnach mit allen fünf Sinnen wahrnehmbar sind.30 Dazu gehören Elemente wie Sprache, Kleidung, Artefakte, Musik, Tanz, Literatur, Architektur, Speisen, Gesten und Sitten. Der Großteil, das Fundament des Eisbergs, bleibt allerdings „unter der Wasseroberfläche" verborgen und ist für Menschen, die mit der jeweiligen Kultur nicht vertraut sind, nicht direkt sichtbar. Dazu gehören neben Grundannahmen und tief verankerten Normen und Werte auch der Umgang mit Raum und Zeit, Macht und Emotionen sowie die Auffassungen über Schönheit, Sünde, Logik und Wirklichkeit sowie die Vorstellung von Ehre, Gerechtigkeit, Identität, Freundschaft und Arbeit.31 Erst durch das Wissen um die verborgenen Elemente kann letztlich eine fremde Kultur verstanden werden.
2.2 Interkulturalität
„Kultur ist für die Menschen wie das Wasser für die Fische: Das Wasser bleibt unbemerkt, solange der Fisch darin bleibt. Befindet er sich außerhalb seiner gewohnten Lebenswelt, spürt er auf schmerzliche Weise die Folgen seiner Bewegung.“32
Diese Metapher von Kultur zeigt auf, dass der Mensch die Existenz von Kultur als ebenso selbstverständlich ansieht wie der Fisch das Wasser. Erst außerhalb seiner vertrauten Umgebung wird ihm bewusst, dass in der Fremde andere Verhaltensweisen und Denkmuster vorherrschen, die nicht zum eigenen Handlungsmuster passen. Wenn er den Willen dazu hat, kann er sich dem neuen Umfeld anpassen, jedoch funktioniert dies nicht sofort und ohne Bemühungen.
Anhand dieses bildhaften Vergleichs lässt sich ableiten, dass Menschen oftmals unabsichtlich davon ausgehen, dass ihre Werte, ihr Denken und ihre Verhaltensweisen allgemein gültig seien.33 Sie sind durch den regelmäßigen Umgang mit den Mitgliedern der eigenen Kultur geprägt und empfinden ihr eigenes Verhalten als einzig „normal", richtig und selbstverständlich.34 Erst durch das Kennenlernen fremdkultureller Wertesysteme und dem damit einhergehenden Heraustreten aus der eigenen Kultur, erkennt das Individuum die Eigenheiten und Kennzeichen seiner Kultur.35
Wird über die Zusammenhänge mit kulturellem Bezug gesprochen, fallen häufig Begriffe wie interkulturell oder Interkulturalität.36 Durch die Betrachtung des Präfixes inter wird bereits deutlich, dass ein relationaler Bezug hergestellt wird. Denn aus dem lateinischen übersetzt bedeutet das Wort inter so viel wie zwischen. Als interkulturell lässt sich demzufolge alles bezeichnen, was sich zwischen den Interaktionspartnern mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund ereignet. Im Mittelpunkt steht dabei die Überbrückung kultureller Ungleichheiten.37 Als intrakulturell werden dagegen alle Phänomene innerhalb einer Kultur verstanden.38
Mittels der folgenden Abbildung soll der Prozess des Entstehens einer neuen Interkultur demonstriert werden:
Abbildung 3: Die Dynamik kultureller Überschneidungssituationen
Quelle: Eigene Abbildung nach: Thomas (2005a), S.46; Yousefi (2011), S.70.
Treffen zwei Kulturen aufeinander, so handeln beide Parteien üblicherweise zunächst gemäß ihres eigenkulturellen Verständnisses und sind der Überzeugung, dass sie „richtig“ agieren und ihr Gegenüber im Irrtum ist.39 In solch einer Situation haben die beiden Gesprächspartner noch nicht die Empfindung, dass sie Teil einer kulturellen Überschneidungssituation sind, die wiederum interkulturelle Verhaltensweisen bedingt.40 Das Bewusstsein einer interkulturellen Überschneidungssituation entsteht erst dann, wenn es zu interdependenten Beziehungen kommt und das Fremde (Fremdkultur) für das Eigene (Eigenkultur) wichtig wird.41 Durch den Begriff Interkultur wird demnach das synergetische Dritte bezeichnet. Dabei handelt es sich um eine Zwischenwelt, die entsteht, wenn beide Kulturen miteinander in Interaktion treten.42
Eine Interkultur entspricht keiner der beiden Kulturen vollkommen und ist ebenso wenig durch ein 50:50-Verhältnis der eigen- und fremdkulturellen Merkmale geprägt. Das liegt darin begründet, dass Interkulturen stets neu erzeugt werden und sie somit einen Prozesscharakter haben, der die Handlungsausgänge nicht vorhersehen kann. Vielmehr schaffen die beteiligten Individuen durch ihr Verhalten Synergie-Effekte, die je nach Grad der Einflussnahme verschiedene Ausprägungen von Identität hervorrufen.43 Im Sinne eines klassischen Lerneffekts kann demzufolge eine ganz neue Qualität (C) entstehen, die weder Kultur A noch Kultur B allein erlangt hätten.44
Interkulturalität lässt sich folglich als das Ergebnis von Kommunikation und Handeln zwischen verschiedenen Kulturen beschreiben, die aufgrund mangelnder Bekanntheit von Differenzen Fremdheitserfahrungen machen und sich trotz der kulturellen Unterschiedlichkeit gegenseitig beeinflussen.45
2.3 Interkulturelle Kompetenz
Begegnen sich Menschen aus verschiedenen Kulturen, dann stellt diese Kontaktsituation eine erhöhte Anforderung an die Kommunikation und Interaktion der beteiligten Parteien dar, was nicht selten zu Missverständnissen führt.46 Sofern sich die Interaktionspartner jedoch ihrer unterschiedlichen kulturellen Orientierungssysteme bewusst sind, können ebenso wertvolle Chancen und Mehrwerte entstehen. Allerdings wird auf beiden Seiten dafür eine gewisse interkulturelle Kompetenz vorausgesetzt.47 Diese stellt mittlerweile zweifellos eine interdisziplinäre Schlüsselkompetenz dar, um einen konstruktiven Umgang mit kultureller Heterogenität vorzeigen zu können.48
Nach Hatzer und Layes wird die interkulturelle Handlungskompetenz als die Fähigkeit definiert, kulturbedingte Einflussfaktoren hinsichtlich des Denkens, Wahrnehmens, Empfindens, Urteilens und Handelns sowohl bei sich selbst als auch bei anderen feststellen, respektieren und produktiv nutzen zu können. Nur so kann ein Toleranzempfinden gegenüber Inkompatibilitäten und eine synergieträchtige Form der Zusammenarbeit und des Zusammenlebens entwickelt werden.49
Zusammengefasst geht es demnach um die Fähigkeiten, Einstellungen und Kenntnisse, in kulturellen Überschneidungssituationen erfolgreich und angemessen agieren und reagieren zu können.50
Zu den Grundvoraussetzungen interkultureller Kompetenz gehören Persönlichkeitsmerkmale wie Selbstvertrauen, Empathie, Kommunikationsfähigkeit und ein hohes Maß an Ambiguitätstoleranz. Bereits im monokulturellen Kontext sind diese Leistungen für viele Menschen nicht selbstverständlich und scheitern oftmals schon im gegenseitigen Verständnis der Geschlechter oder darin, sich in die Lage eines anderen hineinzuversetzen. So stellt die erforderliche empathische Leistung in der internationalen Zusammenarbeit eine erschwerte Voraussetzung dar.51
Es herrscht in der vorhandenen Literatur weitestgehend Einigkeit darin, dass die interkulturelle Handlungskompetenz aus drei Teilkonstrukten besteht, die miteinander in Relation gesetzt werden. Grundlegend wird neben der kognitiven Kompetenz auch von der affektiven- und verhaltensbezogenen Kompetenz gesprochen.52 An dieser Stelle sei zu betonen, dass der Einklang der nachfolgenden Teilkompetenzen ebenfalls die Voraussetzung für erfolgreiches Handeln im intrakulturellen Bereich darstellt.53
Die kognitive Kompetenz zielt auf die Ebene des Denkens und Wissens ab und enthält die wesentlichen Erkenntnisse hinsichtlich anderer Länder und Kulturen. Im Fokus stehen die Entwicklung realistischer Erwartungen und der Aufbau von Wissen im Hinblick auf die Existenz kulturbedingter Unterschiede, die Funktionsweisen von Kultur und mögliche Auswirkungen interkultureller Zusammentreffen. Ferner gehört die Komponente der Selbstreflektion, demnach das eigenkulturelle Verständnis über die eigenen Verhaltensweisen, Einstellungen und Werte zur kognitiven Kompetenz.54
Die affektive Kompetenz spricht die Gefühlsebene an, bei der es um die Einstellungen gegenüber fremden Kulturen geht.55 Es ergibt sich die Frage nach dem Grad der Am-biguitätstoleranz, also inwieweit das jeweilige Individuum mit Widersprüchen zwischen seinem eigenen Wertesystem und dem seines Gegenübers zurechtkommt. Verfügen Menschen über eine hohe Ambiguitätstoleranz, so lassen sich diese nicht leicht irritieren und sind in der Lage, Abweichungen von der scheinbaren Normalität zu akzeptieren. So erkennen sie nicht eindeutige Zustände als Herausforderung an ihre Problemlösungsfähigkeiten an. Personen mit einem geringen Grad an Ambiguitätstoleranz verfallen eher in Stress und Unwohlsein, wenn es zu einer unkontrollierbar erscheinenden Situation kommt.56
Neben der kognitiven und affektiven Kompetenz gibt es ein drittes Grundelement interkultureller Kompetenz: Die pragmatisch-kommunikative bzw. verhaltensbezogene Kompetenz. Dabei geht es um die Fähigkeiten im Hinblick auf die Kommunikation und den damit verbundenen Einsatz angemessener kommunikativer Konfliktlösungsstrategien. Das Erlernen von üblichen Kommunikationsstrategien fremder Kulturen, wie beispielsweise Rituale beim Begrüßen, wird durch die kognitiven und affektiven Teilkomponenten motiviert und eventuell auch korrigiert.57
Abbildung 4: Interkulturelle Kompetenz als allgemeine Handlungskompetenz mit interkulturellem Vorzeichen
Quelle: Eigene Abbildung nach: Erll; Gymnich (2007), S.150; Schneider; Hirt (2007), S.137.
Abschließend kann festgehalten werden, dass unter der interkulturellen Kompetenz spezielle Befähigungen zu verstehen sind, die dabei helfen, Situationen mit Menschen aus fremden Kulturen erfolgreich zu bewältigen. Ziel ist es, sensibel, reflektiert und effektiv reagieren und entsprechend handeln zu können.
Die Ausführungen haben gezeigt, dass mit dieser Fähigkeit nicht nur das von außen ersichtliche Verhalten betrachtet wird, sondern auch Gefühle und Gedanken in den Vordergrund rücken, die einer Verhaltensweise vorausgehen, sie begleiten und auch rückwirkend betrachten.58 Es wird demnach eine Kombination von Wissen und Fähigkeiten angesprochen.
In der Praxis sind international agierende Unternehmen gezwungen, ihr Marketing nach den jeweilig fokussierten Kulturen auszurichten, um sicherstellen zu können, dass die gesendeten Signale auch in der gewünschten Weise verstanden werden. Dazu müssen Marketer59 über ein gewisses Maß an interkultureller Kompetenz verfügen.
2.4 Interkulturelle Kommunikation
Hinterfragt der Betrachter den Forschungsgegenstand der interkulturellen Kommunikation, so liegt es nahe, diesen mit dem Gebrauch von Fremdsprachen in Verbindung zu bringen. Dessen ungeachtet ist an dieser Stelle jedoch zu betonen, dass zur Kommunikation ebenso außersprachliche Elemente zählen und es demzufolge keinesfalls nur um Fremdsprachen an sich geht.60
Kommunikation betrifft jeden. So ist diese die Basis jeglicher interkultureller Begegnungen; ob bei Verhandlungen, bei der Führung von Mitarbeitern, im Marketing oder im Alltag.61 Um einen konstruktiven Umgang mit bestehenden Diversitäten hinsichtlich unterschiedlicher Religionen, ethnischer Hintergründe und Hierarchieebenen führen zu können, ist eine erfolgreiche interkulturelle Kommunikation unverzichtbar.62
Der Begriff Kommunikation lässt sich vom lateinischen Wort communicare ableiten, was so viel bedeutet wie mitteilen, gemeinsam machen oder vereinigen. Neben dem informellen Charakter (mitteilen) wird somit auch die soziale Seite (gemeinsam machen) von Kommunikation verdeutlicht.63 Kommunikation bedingt demnach, dass etwas geteilt beziehungsweise ausgetauscht wird.





























