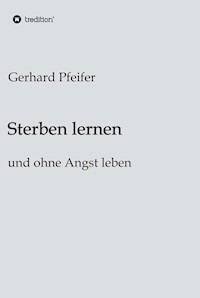
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Warum haben wir Angst vor Sterben und Tod? Und wie können wir diese Angst überwinden? Antworten darauf sucht dieses Buch, das seine Leser intensiv in die Suche einbezieht. Abschließende Antworten gibt es nicht, denn diese Suche ist eine Aufgabe, vor der jeder Mensch sein Leben lang steht. Ein Weg aus der Angst wird aber erkennbar: Auch wenn man nur einmal stirbt, so haben wir doch die Möglichkeit, im Leben sterben zu lernen. Wem das gelingt, der überwindet die Angst vor Sterben und Tod und ist frei: "Wer zu sterben gelernt hat, Sklave zu sein hat er verlernt" (Seneca im 26. Brief an Lucilius).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
www.tredition.de
Warum haben wir Angst vor Sterben und Tod? Und wie können wir diese Angst überwinden? Antworten darauf sucht dieses Buch, das seine Leser intensiv in die Suche einbezieht. Abschließende Antworten gibt es nicht, denn diese Suche ist eine Aufgabe, vor der jeder Mensch sein Leben lang steht.
Ein Weg aus der Angst wird aber erkennbar: Auch wenn man nur einmal stirbt, so haben wir doch die Möglichkeit, im Leben sterben zu lernen. Wem das gelingt, der überwindet die Angst vor Sterben und Tod und ist frei: „Wer zu sterben gelernt hat, Sklave zu sein hat er verlernt“ (Seneca im 26. Brief an Lucilius).
Gerhard Pfeifer
Sterben lernen
und ohne Angst leben
www.tredition.de
© 2015 Gerhard Pfeifer
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback
978-3-7323-4382-9
Hardcover
978-3-7323-4383-6
e-Book
978-3-7323-4384-3
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
Ziel der Schrift
Begriffliche Klärungen
Sterben und Tod der anderen
Mein Sterben und mein Tod
Warum Angst vor Sterben und Tod?
Bewältigungsmöglichkeiten für die Angst
Der Glaube an die Wiederauferstehung nach dem Tod
Hoffen auf den Tod
Suizid
Sterben lernen
Zum Schluss
Literaturhinweise
Ziel der Schrift
Diese Schrift beschäftigt sich mit der Angst der Menschen vor Sterben und Tod. Alle Menschen haben in unterschiedlicher Ausprägung diese Angst, weil sie ein notwendiger Teil des menschlichen Lebens ist, wie wir weiter unten sehen werden. Es gibt natürlich immer wieder Menschen, die ganz entschieden erklären, keine Angst vor Sterben und Tod zu haben und die auch ohne Scheu mit diesem Thema umgehen. Aber da ist Skepsis angezeigt. Meist ist eine solche Haltung nur aufgesetzt, was man erkennt, wenn man das Gespräch vertieft. Im Übrigen wäre eine verlässliche Beurteilung nur möglich, wenn bei den Betroffenen das Sterben auch aktuell ansteht und nicht nur hypothetisch über ein in (vermeintlich) weiter Ferne liegendes Ereignis gesprochen wird. Und es gibt auch durch Krankheit und Leiden gezeichnete Menschen, die sterben wollen. Aber in diesen Fällen wird man davon ausgehen können, dass die Verzweiflung dieser Menschen ihre Angst überwunden hat.
Die Angst der Menschen vor Sterben und Tod ist zwar notwendiger Teil ihres Lebens, zugleich aber auch eine schwere, den Menschen auferlegte Last, unter der sie leiden. Denn die Angst legt sich oft wie ein grauer Schleier über das Leben, auch wenn es noch gänzlich unbedroht erscheint. Sie nimmt zu, wenn die Menschen älter werden und Sterben und Tod immer mehr ins Blickfeld kommen. Die Angst relativiert menschliche Taten mit solch harmlosen Fragen wie „Wozu? Warum?“. Seit jeher versuchen die Menschen deshalb, sich dieser Last zu entledigen. Da sie in dieser Welt sterben müssen, aber nicht sterben wollen, haben sie sich eine andere Welt erdacht, in der gelebt, aber nicht gestorben wird. Dieser Gedanke beruhigt zwar ihre Angst, beleidigt aber zugleich ihr Denken, das Leben und Nicht-Sterben-Müssen für unvereinbar erklärt. Dieser Widerspruch ist für die Menschen nicht auflösbar, es bedarf dazu einer Kraft, die das für menschliches Verständnis Unvereinbare (leben zu können und nicht sterben zu müssen) doch vereinbar macht. Für die Auflösung der Angst hängt dann alles davon ab, dass es diese allmächtige Kraft wirklich gibt. Sie zu bestätigen, ist Ziel aller Religionen, die dieses Ziel mit überwältigendem Glanz, mit hingebungsvoller Liebe, aber auch mit Strenge oder sogar Grausamkeit verfolgen. Niemand darf daran zweifeln, dass es diese Kraft gibt. Und doch zweifeln die Menschen immer wieder und stehen dann der Angst mit leeren Händen gegenüber, sodass sie als vermeintlich einzige Möglichkeit zur Bewältigung der Angst jeden Gedanken an Sterben und Tod aus ihrem Leben verbannen.
Diese Schrift soll die Menschen anregen, sich Gedanken über ein Thema zu machen, das üblicherweise ausgeklammert bleibt, nämlich Gedanken zum Thema Sterben und Tod. Das geschieht in der Hoffnung, die Menschen durch eine Beschäftigung mit diesem Thema dazu zu befähigen, ihre Angst vor Sterben und Tod zu bewältigen.
Das Thema ist in der Gesellschaft ausgesprochen unbeliebt. Wenn doch darüber gesprochen wird oder gesprochen werden muss, erfolgt in aller Regel eine Umdeutung. Sterben und Tod werden als reale Gefahren vorgeführt, vor denen man sich zwar fürchtet, denen man aber nur mit geeigneten Maßnahmen begegnen muss, um die Furcht aufzulösen. Diese Haltung ist nachvollziehbar. Schließlich leben wir in einer Gesellschaft, die sich die Erde untertan machen will. Der Tod widersetzt sich diesem Herrschaftsanspruch allerdings hartnäckig, indem er die Lebenszeit der Menschen einfach zeitlich begrenzt. Alle Herrschaft eines Menschen zerrinnt ihm mit dem Tod wie Schnee in der Sonne. Der Tod ist deshalb eine Gefahr, gegen die zu kämpfen ist.
Jede menschliche Gesellschaft hat dazu einen Medizinbetrieb installiert, der davon lebt, dass wir Sterben und Tod als reale Gefahren wahrnehmen. Es werden Vorsorge (die Gefahr beizeiten entdecken, um sich gegen sie zu wappnen) und eingreifende Behandlungen angeboten. Immer aber entlarvt sich der Versuch, die Angst als Furcht umzudeuten, wenn regelmäßig festgestellt wird, dass die Krankheit entweder zu spät entdeckt wurde (mit der Implikation, bei früherer Entdeckung wäre sie heilbar gewesen) oder dass sie (ein Schuldvorwurf) bei gesunder Lebensführung zu vermeiden gewesen wäre. Und wenn der Mensch trotz frühzeitiger Entdeckung der Krankheit und trotz gesunder Lebensweise doch stirbt (wie es regelmäßig geschieht), so wird erklärt, dass die Krankheit noch nicht heilbar ist (zur Beruhigung der Überlebenden: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Heilmittel entdeckt wird).
Entscheidend ist es für den Medizinbetrieb, lediglich Furcht vor einer Krankheit (mit der Drohung, daran zu sterben), aber keine Todesangst aufkommen zu lassen. Denn Todesangst führt in diesem Selbstverständnis des Medizinbetriebes in den Abgrund, weil es für sie keine medizinische Behandlung gibt und geben kann, wie aus den Ausführungen weiter unten deutlich werden wird.
Was also ist unsere Todesangst? Wenn wir uns prüfen, so werden wir feststellen, dass auch in einem Zustand guter Gesundheit und Leistungsfähigkeit Gedanken an das eigene Sterben und den eigenen Tod von einer eigentümlichen Betroffenheit begleitet sind. Die Betroffenheit besteht, auch wenn eine reale, uns bedrohende Gefahr nicht erkennbar ist. Sie wird als eine unbestimmte Drohung empfunden, die Angst macht.
Nun kann man natürlich fragen, warum man sich über eine Unvermeidlichkeit wie den Tod Gedanken machen soll. Auf den Tag folgt unvermeidlich die Nacht, das Fest wird notwendigerweise einmal enden, irgendwann ist die Reise vorbei. Jeder vernünftige Mensch erklärt auf eine entsprechende Frage, genau zu wissen, dass alle Menschen sterblich sind, Sterben und Tod also ganz natürliche Stationen in jedem Leben darstellen.
Aber die Gedanken an Sterben und Tod sind von anderer Art als die bedauernde Feststellung, dass auch das schönste Fest endet. Sterben und Tod sind insofern ein besonderes Thema, als das Thema irgendwann jeden beschäftigen wird und sich doch keiner damit beschäftigen will.
Über diesem Thema liegt ein gesellschaftliches Tabu. Sie können jemanden fragen, wann er heiraten wird, vielleicht auch noch, wann das erste Kind kommt. Sie können jedoch niemand fragen, wann er sterben wird (auch wenn der Gesundheitszustand erkennbar schlecht ist). Allenfalls spricht man darüber mit jemandem, dem man in tiefer Freundschaft verbunden ist, nicht jedoch mit guten Bekannten. Ja, es ist geradezu ein Zeichen tiefer Verbundenheit, wenn man mit jemandem über dieses Thema sprechen kann. Die Menschen wollen alles Mögliche, sterben will niemand. Es erscheint auch ganz undenkbar, dass jemand erklärt, er freue sich darauf, bald zu sterben (es sei denn, Krankheit und Leiden hätten seine Angst überwunden). Die schlimmste Strafe ist die Todesstrafe, der gegenüber eine jahrzehntelange Haft als Begnadigung empfunden wird.
Natürlich kann man über die mit dem Tod zusammenhängenden rechtlichen Fragen mit einem Notar sprechen, aber dann bleibt alle gefühlsmäßige Beteiligung ausgeschlossen. Wenn Sie jedoch Gefühle zulassen, dann sind die Gedanken an Sterben und Tod regelmäßig begleitet von Scheu und ängstlichem Erschauern.
Das Thema Sterben und Tod wird von den Menschen in der Regel beiseitegeschoben, irgendwo verwahrt, wo es aus dem Gesichtskreis geraten soll. Allerdings bleibt das Bewusstsein, dass die Sache unerledigt ist. Gelegentlich wird vielleicht ein scheuer Blick darauf geworfen, denn die Sache kann jederzeit akut werden.
Jeder Mensch kann in jedem Augenblick seines Lebens sterben. Bereits durch die Geburt, oder, wenn Sie wollen, durch die Zeugung, wird diese Möglichkeit begründet. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie zu einem genau bestimmten künftigen Zeitpunkt (beispielsweise am Neujahrstag in vier Jahren) sterben, mag sehr gering sein (unter den gegenwärtigen Bedingungen unserer Zivilisation). Sie nimmt mit zunehmendem Alter und bei verschiedenen Aktivitäten zu. Dabei gilt aber unumstößlich: Früher oder später wird aus dieser Möglichkeit unvermeidlich Realität. Sie sehen das eindrucksvoll an der Rechnung, mit der sich die Menschen in den verschiedenen Lebensaltern diese Möglichkeit vor Augen führen. Anfangs wird in Jahrzehnten gerechnet, später in Jahren, schließlich in Monaten und Wochen, zum Schluss in Tagen und Stunden. Als Greis bekommen Sie keinen Kredit mehr, weil Sie das fast aufgebraucht haben, was in einer Konsumgesellschaft letztlich zählt, nämlich die Ihnen üblicherweise zugemessene Lebenszeit.
Da jeder jeden Augenblick sterben kann (wenngleich die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist), sollte jeder Mensch im Idealfall so leben, als könnte jeder Augenblick seines Lebens der letzte sein. Er sollte auf ein Ereignis vorbereitet sein, vor dem er Angst hat. Schließlich bereiten sich die Menschen ja auch intensiv auf viel weniger bedeutsame Abschnitte ihres Lebens vor. Da die Wahrscheinlichkeit gering ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt zu sterben, das Leben also lange dauern kann (in der Rechnung der Menschen), sollte die Vorbereitung natürlich nicht so erfolgen, dass ein Zustand ängstlich-angespannter Erwartung eintritt, der das Leben belastet. Die notwendige Vorbereitung auf Sterben und Tod sollte vielmehr zu einem Zustand der Gelassenheit führen, in dem Sterben und Tod als unvermeidliche Begleiter des Lebens gesehen werden, als eine Art Maßstab für unsere Hoffnungen und Wünsche, die so nie enttäuscht werden können.
Nun werden einige sicher einwenden, das sei zu viel verlangt. Wer in der Gesellschaft aktiv tätig sei, könne nicht in ständiger Erwartung von Sterben und Tod leben und dabei gelassen bleiben. Das mag für die meisten Menschen zutreffen. Es wird in den Geschichtsbüchern aber immer wieder von Menschen berichtet, die ihr Wissen um Sterben und Tod regelmäßig und gelassen als Maßstab an ihr Leben legten und gleichwohl im Leben aktiv waren. Vermutlich werden Sie auch in Ihrer näheren und weiteren Umgebung Menschen finden, die zumindest näherungsweise so leben. Sie sollten gezielt nach solchen Menschen und dem Gespräch mit ihnen suchen. Denn ein so bestimmtes Leben ist das Ziel, dem wir uns zumindest nähern wollen, auch wenn es als Dauerzustand vielleicht unerreichbar ist.
Wie könnten wir uns diesem Ziel nähern? Sterben und Tod kann man nicht üben, so wie man vielleicht Fertigkeiten wie Skifahren übt. Man stirbt nur einmal. Wir können uns dem Ziel also nur gedanklich nähern (wobei die gedankliche Annäherung dann später auch praktische Auswirkungen in unserer Lebensführung haben kann). Wir werden alle Gesichtspunkte zu Sterben und Tod bedenken, auch wenn die Aufstellungen dazu vielleicht trivial erscheinen. Es werden sicher nicht alle möglichen Gesichtspunkte sein und einige von Ihnen werden weitere Gesichtspunkte dazu vorbringen. Das ist ausgesprochen erwünscht.
Wer denkt über Sterben und Tod nach? Sterben und Tod sind in jungen Jahren nur in Ausnahmefällen ein Thema. Junge Menschen leben und können sich (jedenfalls in der Regel) nur vorstellen, darüber nachzudenken, wie sie besser, erfolgreicher, schöner oder glücklicher leben könnten. Erst mit zunehmendem Alter kommt den Menschen Sterben und Tod in den Blick. Krankheiten stellen sich ein, in der Familie und im Bekanntenkreis wird gestorben. Langsam beginnt sich der wolkenlose Himmel zu verschleiern. Die Unbeschwertheit verfliegt, eine Nachdenklichkeit stellt sich ein, die sich langsam verdichtet.
Ich werde Ihnen Gedanken zum Thema Sterben und Tod vorstellen und erwarte mir von Ihnen Kritik, die ganz entschieden und auch vernichtend sein kann, umso besser. Ziel der Schrift ist es also vor allem auch, Sie, den Leser, einzubeziehen. Sie sollten Stellung nehmen, Passagen streichen, umformulieren und vor allem einige Passagen weiter- und fortschreiben. Im Idealfall streichen Sie ganze Absätze durch und schreiben in die frei gewordenen Stellen Ihre eigenen Gedanken. Besonders wichtig ist es dabei, dass Sie sich nicht um geschliffene Formulierungen sorgen, sondern so schreiben, wie Sie gerade denken, auch wenn Ihnen Ihre Gedanken vorläufig und vielleicht auch unbeholfen erscheinen. Sie sollten dabei auch nie vergessen, Ihre Gefühle zu reflektieren, sich diesen also nicht einfach zu überlassen, denn Sie sollen ja durch Nachdenken über Ihre Gefühle hinauskommen. Im Idealfall würden Sie dann Autor eines Buches, das sich mit dem eigenen Sterben und dem eigenen Tod beschäftigt. Dieses Buch wäre dann eine lebenslange Aufgabe für Sie und würde wohl je nach Lebensphase immer wieder umgeschrieben.
Das Buch setzt keine philosophischen oder medizinischen Kenntnisse voraus. Es wendet sich an interessierte Leser, die für dieses Thema offen sind. Es bewegt sich im normalen Erfahrungsbereich jedes Menschen und den üblichen Strukturen unseres Denkens. Einige Ausflüge in den Bereich der Parapsychologie sollten gestattet sein. Der Leser kann sie nach Belieben erweitern und vertiefen.
Dieses Buch wird nicht auf Möglichkeiten und Grenzen palliativer Medizin eingehen. Dass ein Sterben ohne Schmerzen möglich ist, ist vielmehr die Voraussetzung, auf der dieses Buch aufbaut. Gegenstand des Buches sind die Ängste, die trotz Versprechungen der Palliativmedizin bleiben. Damit ist nicht die Angst gemeint, die sich in lebensbedrohlichen Situationen unwillkürlich einstellt und die eine physiologische Bedeutung im Sinne einer Warnfunktion hat. Gemeint ist die Angst, die bei den meisten Menschen entsteht, wenn sie durch die Umstände (wie lebensbedrohliche Erkrankungen) gezwungen werden, an ihr eigenes Sterben und den eigenen Tod zu denken. Diese Angst ist oft von einem Gefühl der Unheimlichkeit begleitet. Sie ist immer abgrenzbar von Niedergeschlagenheit und Verzweiflung beim Sterben geliebter Menschen, wobei diese Gefühle oft viel aufwühlender sein können als die Auseinandersetzung mit dem eigenen Sterben und dem eigenen Tod. Doch werde ich darauf hier nur am Rande eingehen können, um nicht zu weit von dem eigentlichen Anliegen abschweifen zu müssen. Denn Ziel der Schrift ist, Menschen in die Lage zu versetzen, die Angst vor dem eigenen Sterben und dem eigenen Tod so zu überwinden, dass diese keine Gewalt mehr über sie hat.
Der griechische Dichter Sophokles hat in dem Drama „Ödipus auf Kolonos“ denjenigen als den glücklichsten Menschen bezeichnet, der nie geboren wurde, und glücklich den genannt, der schon gestorben ist. Als ein Lebender haben Sie dieses Glück nicht. Sie wurden ins Leben „geworfen“ (wie es ein deutscher Philosoph bezeichnet hat) und wurden zu dem, der Sie jetzt sind, erst im Leben und durch das Leben, das Sie durchstehen müssen. Ihre einzige Chance, es trotz aller Widrigkeiten zu ertragen, besteht darin, dass Sie Ihr Leben verstehen, und dazu ist ein Verständnis von Sterben und Tod unabdingbare Voraussetzung.
Der Versuch, Sterben und Tod zu verstehen, könnte mit Fragen beginnen wie „Warum sterbe ich?“ oder auch „Warum muss ich sterben?“. Wenn Sie diese Fragen beschäftigen, überlegen Sie, an wen Sie sie stellen und wie sie beantwortet werden sollen. Es sind keine Fragen vom Typ „Warum bin ich durch die Prüfung gefallen?“. Diese Frage wird an den Prüfer gerichtet, der dazu kompetent Auskunft geben kann. Mit der Frage „Warum muss ich sterben?“ ist das schwieriger. Ein gläubiger Mensch fragt Gott, der ihm – vielleicht über die Kirche – antwortet. Bei den anderen Menschen ist es problematisch. An wen könnten sie diese Frage stellen? Man könnte daran denken, Ärzte zu fragen. Schließlich sind sie zuständig für den menschlichen Körper. Sie werden in der Regel auch eine Antwort bekommen, zum Beispiel derart, dass eine Krankheit vorliegt, gegen die es noch (das wird meist betont) keine wirksame Medizin gibt. Diese Antwort (die dem Denkschema der meisten Ärzte entspricht) wird Sie kaum zufriedenstellen. Denn das wissen Sie ja schon: dass Sie sterben müssen und dass es immer irgendeine Krankheit gibt, an der Sie schließlich sterben werden. Wie die Ärzte diese letzte und nicht mehr behandelbare Krankheit dann nennen, ist insofern belanglos. Möglicherweise meint die Frage „Warum muss ich sterben?“ etwas ganz anderes. Aber was?
Vielleicht kommt man weiter, wenn man sich klarmacht, dass die Frage „Warum muss ich sterben?“ eigentlich der Ergänzung bedarf. Als sterblicher Mensch, der Sie sind, müssen Sie sterben, weil Sie leben. Nur ein Lebender kann überhaupt sterben. Die notwendige Ergänzung wäre insofern „Warum lebe ich?“. Für diese Frage gibt es vielleicht einen Adressaten: Ihre Eltern. Aber was könnten die Eltern sagen? Die Antwort „Wir wollten Dich“ wäre etwas vermessen im Hinblick darauf, dass Sie, so wie Sie sind, gar nicht gewollt sein konnten. Denn zu dem, was Sie sind, wurden Sie erst. Die einzig mögliche Antwort kann also nur sein: „Wir wollten ein Kind. Du lebst, weil Du gezeugt wurdest.“ Das aber ist auch etwas, das Sie schon wissen.
Jetzt könnte man die Frage „Warum lebe ich?“ etwas anders wenden. Vielleicht meinten Sie ja: „Hat mein Leben einen Sinn?“. Wieder müssen Sie überlegen, an wen Sie diese Frage richten. Sie werden feststellen, dass die Antworten ganz unterschiedlich ausfallen, je nachdem, an wen Sie die Frage richten. Als gläubiger Mensch richten Sie auch diese Frage wieder an Gott und erhalten von ihm oder von der Kirche eine Antwort, die Sie als gläubiger Mensch nicht weiter hinterfragen. Aber was ist mit den anderen Menschen? Wen könnten sie fragen? In Betracht kommen jetzt in erster Linie Philosophen, vielleicht auch Psychotherapeuten und natürlich gute Freunde. Sie werden die unterschiedlichsten Antworten bekommen, bis hin zu der Feststellung, dass die Frage sinnlos ist. Ihre Hoffnung, einen verbindlichen Sinn für das eigene Leben genannt zu bekommen, löst sich so auf. Denn wer könnte für seine Auskunft Verbindlichkeit beanspruchen? Die Kirche durch ihre Vertreter, vielleicht, das hängt davon ab, ob Sie gläubig sind. Aber Philosophen, Psychotherapeuten oder gute Freunde? Würden Sie deren Auskünfte (die unterschiedlicher nicht sein könnten und die sich zudem meist widersprechen, wenn die Frage nicht gleich ganz zurückgewiesen wird) überhaupt als verbindlich akzeptieren? Wohl kaum.
Es bleibt Ihnen nur die Erkenntnis, dass für ihr Leben nur Sie selbst den Sinn festlegen können, der dann aber eben nicht verbindlich ist im Sinne einer Ihnen von außen auferlegten Verbindlichkeit. Sie könnten als den Sinn Ihres Lebens zum Beispiel Erfolg bestimmen oder den Sinn Ihres Lebens darin sehen, eine gute, alles verstehende Mutter zu sein. Allerdings sind Entwicklungen nicht vorhersehbar. Sie könnten plötzlich daran zweifeln, ob der von Ihnen bestimmte Sinn richtig bestimmt war. Dann müssten Sie den Sinn Ihres Lebens neu bestimmen. Das kann dazu führen, dass Sie immer neue Korrekturen vornehmen müssen, vergleichbar dem Kapitän eines Schiffes, der in einem Unwetter keinen Hafen mehr ansteuern kann, sondern nur noch darauf bedacht ist, nicht unterzugehen.
Der Versuch, Sterben und Tod über die Beantwortung von Fragen wie „Warum sterbe ich? Warum muss ich sterben? Warum lebe ich? Hat mein Leben einen Sinn?“ verstehen zu wollen, führt offensichtlich in die Irre. Das liegt daran, dass die Fragen so gestellt sind, als gäbe es eine Instanz, die verbindlich antworten könnte. Die aber gibt es nicht. Die Fragen sind nur äußerlich der Frage „Warum bin ich durch die Prüfung gefallen?“ vergleichbar, für deren Beantwortung es tatsächlich eine verbindliche Instanz gibt, nämlich den Prüfer. Beantwortbar sind die Fragen nur für Gläubige aller Art, die sich eine Instanz als verbindlich gesetzt haben, die sie nicht mehr infrage stellen. Sie erhalten dann eine verbindliche Antwort und wissen, warum sie sterben müssen, warum sie leben und welchen Sinn ihr Leben hat. Das gibt eine nicht zu unterschätzende Sicherheit, die nur dann gefährdet ist, wenn der Gläubige etwaige Zweifel nicht überwinden kann.
Dieses Buch wird nicht wiederholen, was Gläubige verschiedener Religionen für sich als verbindlich festgesetzt haben. Es ist für die Menschen geschrieben, die mit Zweifeln leben oder leben müssen (wenn man den Zustand eines Gläubigen als einen wünschenswerten Zustand ansieht). Sie können sich einem Verstehen von Sterben und Tod allenfalls auf Umwegen nähern. Diese Annäherung kann nur so aussehen, dass wir Erfahrungen, Kenntnisse und Gedanken zu Sterben und Tod sammeln. Wir werden versuchen, das möglichst umfassend zu tun. Wir erhalten dann eine Sammlung hoffentlich sinnvoller Aussagen und Sätze zu Sterben und Tod, eine Art Kompendium zu diesem Thema. Es wird vermutlich viel Triviales dabei sein, aber das liegt auch an Ihnen. Sie sind aufgefordert, sich dem Thema von ganz ungewohnten Seiten zu nähern und dabei auch Experimente zu wagen. Trotz aller Bemühungen wird eine Vollständigkeit alles Denkbaren und Sagbaren zu diesem Thema nicht zu erreichen sein. Zögern Sie auch nicht, Vorstellungen wieder über Bord zu werfen. Dem Ziel, ein möglichst vollständiges Kompendium zu erreichen, kann das nur dienlich sein.
Mit einem Einwand müssen wir uns hier noch beschäftigen: Ist es überhaupt sinnvoll für die Menschen, ein Leben ohne Angst vor Sterben und Tod anzustreben (unabhängig von der Frage, ob dies überhaupt möglich ist)? Ist die Angst nicht Voraussetzung ist für das Gedeihen der Gesellschaft? Sind viele und für die Stabilität des Gemeinwesens bedeutsame soziale Beziehungen nicht letztlich darauf gegründet, dass alle Angst vor Sterben und Tod haben? Diese Angst hat zum Beispiel die wichtige Funktion, dass alle Anstrengungen unternommen werden, das Leben in der Gesellschaft sicherer zu gestalten. Das sorgt für ein Überleben der Gesellschaft und letztlich der Menschen überhaupt. Ohne eine solche Angst könnte eine Reihe für das Individuum und auch für die Gesellschaft wichtiger Schutzfunktionen entfallen, zum Beispiel sich nicht mit einer gefährlichen Krankheit anzustecken, gefährliche Situationen zu meiden oder auch für sich vorzusorgen. Die Individuen könnten versucht sein, ihre Interessen gewaltsam durchzusetzen. Angst, in einem derartigen Kampf getötet zu werden, hätten sie nicht. Ja, es wäre sogar fraglich, ob es eine Polizei in üblichem Verständnis in einer Gesellschaft ohne Angst vor Sterben und Tod überhaupt noch gäbe. Auf was wäre sie verpflichtet? Leben zu schützen, vor dessen Verlust niemand mehr Angst hat?
Wenn man diese Situationen konsequent weiterdenkt, kommt man zu dem Schluss, dass es eine menschliche Gesellschaft gar nicht geben kann, in der niemand mehr Angst vor Sterben und Tod hat. Ja, man könnte sogar fragen, ob es sich bei Wesen, die diese Angst nicht mehr kennen, überhaupt noch um Menschen handelt. Es wären nach unserem Verständnis eher Maschinen, für die dann gelten müsste, dass sie sich nicht mehr selbst bestimmen, sondern bestimmt werden. Und zwar von dem oder denen, die diese Angst kennen. Denn nur Menschen mit Angst vor Sterben und Tod fühlen sich aufgerufen, Leben gegen alle Feinde des Lebens durchzusetzen. Wäre allen Mitgliedern einer Gesellschaft egal, ob sie sterben, wäre die Gesellschaft am Ende. So gesehen hat die Angst vor Sterben und Tod eine durchaus vernünftige Funktion.
Sollte diese Angst also überhaupt überwunden werden? Diesem Einwand (dass wir die Angst vor Sterben und Tod in jeder Gesellschaft brauchen) ist letztlich einfach zu begegnen: Die Angst vor Sterben und Tod gehört zum Menschsein und wird den Menschen begleiten, solange er Mensch ist. Sie hat eine gesellschaftliche Funktion als notwendige Bedingung für unser Zusammenleben. Sie ist individuell gesehen aber für die meisten Menschen eine erhebliche Belastung, die sich bis zu einer Bedrohung steigern kann. Es wäre für die Menschen eine Entlastung, dieser Angst zumindest nicht hilflos ausgeliefert zu sein, auch wenn Angstfreiheit in Bezug auf die Gesellschaft kein wünschenswertes Ziel sein kann. Hier ergibt sich allerdings ein Dilemma, und zwar zwischen gesellschaftlichen Erfordernissen (Angst vor dem Tod als gesellschaftliches Regulativ) und individuellem Hoffen und Wünschen (auf Angstfreiheit). Der Auflösung dieses Dilemmas hat sich dieses Buch auch verschrieben.
Wir werden uns mit dem Ablauf von Sterben beschäftigen und zu klären versuchen, was wir eigentlich meinen, wenn wir vom Tod sprechen. Sodann werden wir die entscheidende Frage stellen, warum die Menschen überhaupt Angst vor Sterben und Tod haben. Eine derartige Angst ist ja keineswegs selbstverständlich. Sie wäre nur dann ohne Weiteres nachvollziehbar, wenn Sterben gleichzusetzen wäre mit Schmerzen und langem Leiden. Diese Befürchtung kann die Palliativmedizin den Menschen, wenn auch nicht vollständig, so doch weitgehend nehmen. Die Angst vor dem Sterben und dem Tod bleibt aber, sodass wir andere Gründe für die Angst finden müssen. Nur dann haben wir die Chance, in der Bearbeitung dieser Gründe die Angst zu bewältigen. Schließlich werden wir weitere denkbare Möglichkeiten der Angstbewältigung durchgehen und uns auch vor Augen führen, wie die Angst literarisch und in der Kunst bewältigt worden ist. Hilfreich könnte es dabei auch sein, zu sehen, wie „große“ Menschen gestorben sind. Und zum Abschluss werde ich Ihnen noch Gedanken vorstellen, wie man Sterben lernen kann, wobei dieses Lernen natürlich kein Üben im üblichen Sinne ist, denn man stirbt nur einmal.
Noch etwas sollten Sie immer im Blick behalten: Vielleicht gibt es ja hinter allem Denkbarem und Sagbarem zu diesem Thema noch etwas Unsagbares, das nur als eine Art Ahnung aufscheint, aber das Eigentliche ist, das Sterben und Tod erst verstehbar macht, eine Art letzte Begründung. Und das damit die letzte Bedingung wäre, um uns die Angst vor dem Sterben und dem Tod zu nehmen. Bekümmern Sie sich also intensiv um diese mögliche Ahnung, indem Sie Ihre Gedanken beim Lesen immer wieder abschweifen und ungewohnte Wege gehen lassen. Ich habe dazu immer wieder Gedanken aufgeführt, die Sie zu derartiger Ahnung anregen sollen.
Bei den folgenden Ausführungen sollte Sie schließlich immer der folgende Gesichtspunkt begleiten: Nur weil wir Menschen sind, haben wir Angst vor dem Tod, also Angst auch dann, wenn das Leben nicht unmittelbar bedroht ist, sondern uns nur die Endlichkeit unseres Lebens beschäftigt. Bei den Tieren ist das anders. Soweit wir etwas über die Tiere wissen (und im Wesentlichen erschließen wir es aus ihrem Verhalten), zeigen sie Angstreaktionen nur bei akuter Bedrohung. Wir haben keine Hinweise dafür, dass die Tiere die Endlichkeit ihres Lebens beschäftigt. Das, was uns von den Tieren unterscheidet, also unser selbstreflexives Denken, begründet unsere Todesangst. Also kann auch nur unser Denken uns die Möglichkeit geben, die Todesangst zu überwinden, wenn wir Menschen bleiben wollen. Andere Wege, etwa die Zufuhr chemischer Stoffe mit Wirkung auf das Gehirn (zum Beispiel Alkohol oder Psychopharmaka), sind allenfalls für eine ganz begrenzte Zeit in der Lage, die Todesangst aufzulösen, immer aber um den Preis einer Beeinträchtigung auch unseres Denkens (also einer, wenn auch begrenzten, Beeinträchtigung unseres Menschseins). Eine dauerhafte Lösung der Todesangst ist mit derartigen Stoffen nur um den Preis möglich, auf das Menschsein zu verzichten. Denn das Menschsein mit der Möglichkeit selbstreflexiven Denkens und die Todesangst gehören untrennbar zusammen. Menschen mit einer Krankheit, wie zum Beispiel einer fortgeschrittenen Demenz, verlieren zwar ihre Angst vor dem Tod (bei fehlendem Bewusstsein der eigenen Endlichkeit), zugleich aber auch die Möglichkeiten selbstreflexiven Denkens. Ganz kleine Kinder, die noch nicht selbstreflexiv denken, kennen diese Angst ebenfalls nicht.
Begriffliche Klärungen
Leben
Sie leben, weil Ihr Herz schlägt und das Blut durch die Adern treibt und weil Sie wahrnehmen (sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken) und denken können. Sie betrachten es als Ihr Leben, das mit der Geburt (oder, wenn Sie wollen, auch mit der Zeugung) begonnen hat.
Was ist Leben? Definitionen sind in der Tat problematisch, weil die verschiedenen Fachgebiete (Biologie, Medizin, Philosophie usw.) spezielle Lebensbegriffe haben. Allen gemeinsam aber könnte die Feststellung sein, dass Leben vor allem die Fähigkeit und der Drang des bereits Belebten (also der Menschen, Tiere und Pflanzen) zur Reproduktion seiner selbst ist. Und dass Leben sich des Unbelebten bemächtigt, um sich weiter auszubreiten. Es erleidet dabei aber immer wieder Rückschläge, indem Belebtes zugrunde geht und wieder zu Unbelebtem wird. Diese Rückschläge führen aber zu keiner endgültigen Vernichtung des Lebens, weil es sich immer wieder des Unbelebten bemächtigt, um sich über einfache Anfänge mit dann steigender Komplexität immer wieder zu entfalten, wenngleich die Zeiträume menschliches Maß übersteigen.
Was Sie Ihr (individuelles) Leben nennen, ist in dieser Sichtweise nur ein Teil von Leben (allgemein), das von einem Menschen auf den anderen lediglich weitergeben wird, von dem unklar ist, wann und wo es entstanden ist, und das mit Ihrem individuellen Tod natürlich nicht an ein Ende gekommen ist. Sie sind demnach eine zufällige Manifestation, auf die es letztlich gar nicht ankommt.
Das aber will die menschliche Vernunft nicht hinnehmen. Sie hat in der Menschheitsgeschichte eine Entwicklung durchlaufen hin zu einer Autonomie, die den Trägern der Vernunft (also den Menschen) einen immer höheren Wert zugewiesen hat. Die Annahme, dass die individuellen menschlichen Lebewesen lediglich zufällige Manifestationen von Leben als solchem sind, würde den Wert des Individuums infrage stellen, der erst dann gesichert ist, wenn menschliches Leben als individuelles Leben mit einem individuellen Anfang und einem individuellen Ende verstanden wird. Dieses Verständnis menschlichen Leben ist uns heute so selbstverständlich, dass es uns als naturgegeben erscheint.
Sterben
Was heißt eigentlich Sterben? Wer ist wann ein Sterbender? Der von den Angehörigen herbeigerufene Hausarzt erklärt: „Ich kann nichts mehr für ihn tun. Er stirbt.“ In der Klinik wird dem Patienten nach der wiederholten erfolglosen Chemotherapie erklärt: „Unsere Möglichkeiten sind erschöpft“, vielleicht noch mit einem Zusatz für die beiseitegenommenen Angehörigen: „Es kann noch einige Monate gehen.“ In der Arztpraxis werden dem Patienten die Befunde erläutert: „Ihre Leberwerte sind kritisch. Keine akute Gefahr. Aber im Verlauf der nächsten Jahre ist ein Leberversagen möglich. Sie wissen, was das heißt.“ Die Eltern des neugeborenen Kindes erfahren, dass der Herzfehler des Kindes nicht operabel ist und das Kind „nicht alt“ werden wird. Mit einiger Berechtigung könnten Sie in allen diesen Fällen von Sterbenden reden, denn ihnen allen gemeinsam ist, dass die verbleibende Lebenszeit auf einen überschaubaren Bereich begrenzt ist oder von den Ärzten für begrenzt erklärt wird. Das aber ist der wirklich einzige Unterschied zu den übrigen Menschen, die wir nicht als Sterbende bezeichnen. Über die Dauer ihrer verbleibenden Lebenszeit ist noch nichts definitiv gesagt, wobei die Betonung auf „noch“ liegt, denn es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch über sie der Spruch erfolgt. Insofern sind wir alle Sterbende, weil wir alle auf den Tod hin leben. Eigentlich stirbt man seit der Zeugung. Es ist nur konventionelle Vereinbarung, dass man erst dann ein Sterbender ist, wenn der Zeitraum bis zum Tod überschaubar wird. Eine solche konventionelle Vorstellung vom Sterben wird in der Kunst und in Reportagen noch einmal komprimiert auf die dramatischen Minuten, wenn Rettung nicht mehr möglich, aber der Tod noch nicht eingetreten ist.
Medizinisch bezeichnet man die letzte Lebensphase unmittelbar vor dem Tod als Agonie, deren Dauer durchaus unterschiedlich ist. Sie kann zwischen Minuten und Tagen schwanken. Lediglich bei gewaltsamen Todesfällen (Enthauptung, Sturz aus großer Höhe) kann die Agonie ganz kurz (Sekunden) sein. Die Agonie ist ein Prozess, in dem alle Stoffwechselprozesse und Lebensvorgänge nachlassen, begleitet von einem Schwinden des Bewusstseins. Bereits in dieser Sterbephase wird häufig schon der spätere Madenfraß vorbereitet, indem Fliegeneier an feuchten Körperstellen wie Augenwinkeln, Nasen- und Mundöffnung und offenen Wunden abgelegt werden. Durch einen Ausfall der Steuerungsfunktion des Gehirns können unwillkürliche und unkoordinierte Bewegungen auftreten, manchmal begleitet von unverständlichen Lautäußerungen; Vorgänge, die oft als Todeskampf (der nicht vorliegt, weil das Bewusstsein schon geschwunden ist) fehlgedeutet werden. Der unmittelbar bevorstehende Tod kündigt sich durch ein Erschlaffen der Muskeln und ein Erlöschen der Muskeldehnungsreflexe an.
Tod
Was ist der Tod? Zunächst zu der spontanen Sicht der Menschen, die ja von ihm betroffen sind. Unsere Sprache sagt „der Tod“. Sie sagt: „Ich bin dem Tod begegnet. Ich bin ihm entkommen, er hat mich verschont. Auf alle wartet der Tod. Alle fürchten ihn.“ Wenn man nachfragt, wird erklärt, dass man den Tod selbst nicht gesehen hat, man hat seine Nähe gespürt. Und woran? An einer Angst, einer Beklemmung.
Unsere Sprache personifiziert also den Tod, der männlich ist (im Gegensatz zur Geburt, die weiblich ist) und den unsere Maler dann als einen Knochenmann darstellen, um unserem Bedürfnis nach einem Bild zu entsprechen. Allerdings ist ihm auch in dieser Gestalt noch nie jemand begegnet. Alle sind sich aber einig, dass es „ihn“ gibt. Und wer „ihn“ sieht, verschwindet aus der Gemeinschaft der Lebenden. Manchmal wird auch erklärt: „Der Tod ereilte ihn.“ Das wäre dann die Vorstellung, der Sterbende werde „abgeholt“ oder fliehend vom Tod „eingeholt“.
Was ist also damit gemeint: „der Tod“? Im weitesten Sinne ist der Tod das Ende des Lebens, sozusagen das Pendant zur Geburt, mit der das Leben beginnt. Beschrieben wird damit eine Zustandsänderung, der Schalter wird umgelegt von „lebend“ auf „tot“. Wer vom Tod spricht, der spricht damit gleichzeitig auch vom Leben, denn notwendige Bedingung für das Totsein war das vorausgehende Lebendigsein. Der Tod ist kein Gegenstand wie andere in der Welt. Man kann den Tod nicht beschreiben. Beschreiben könnte man das von uns beobachtbare Sterben oder den Toten. Da eine Beschreibung des Todes als etwas Bestimmtem nicht möglich ist, haftet dem Begriff etwas Rätselhaftes an.
Kann man den Tod verstehen? Nun ist der Tod zwar „das Ende“, aber nicht von irgendetwas, sondern des menschlichen Lebens. Wir registrieren, vielleicht etwas bedauernd, den Tod von Nachbarn und Fremden. Ein uns anrührendes Problem entsteht eigentlich erst dann, wenn uns klar wird, dass der Tod als Ende auch das Ende unseres eigenen Lebens und des Lebens der uns nahestehenden Menschen ist. Wenn wir uns prüfen, stellen wir fest: Wir wollen auf der Welt sein, unter den Menschen und zusammen mit den Menschen, die wir lieben. Wir wollen denken können, gestalten, uns freuen und notfalls auch leiden. Das ist das Kostbarste, was wir haben. Unser Tod und der Tod der geliebten Menschen (und nicht der Tod von Fremden) beendet das alles. Und das macht uns Angst. Die Angst vor dem Sterben und dem Tod ist also eine Angst vor dem Ende des Lebens.
Die Menschen wollen leben. Sie wollen es, auch wenn das Leben schwer ist und vielleicht nichts als Schmerzen und Entbehrungen bereithält. Dass einige wenige Verzweifelte sterben wollen, ändert an dieser grundsätzlichen Feststellung nichts. Warum wollen die Menschen leben, oder besser: warum dieser Wille zum Leben? Man könnte sich eine Reihe von Gründen zurechtlegen, auf die ich weiter unten bei der Besprechung der Gründe näher eingehen werde, aus denen Menschen Angst vor Sterben und Tod haben könnten. Man könnte sich aber auch fragen, ob der Wille zum Leben nicht notwendiger Bestandteil des Lebens ist. Keine Pflanze und kein Tier gibt einfach auf, wenn die Lebensbedingungen schlecht sind. Sehen Sie sich an, welche Wege und Umwege eine Pflanze wächst, um ans Licht als notwendige Bedingung für ihr Leben zu kommen, und welche Kämpfe Tiere bestehen, um an Futter zu gelangen. Man könnte sich weiter fragen, ob der Wille zum Leben nicht einfach in der Folge der Generationen weitergegeben wird. Und schließlich könnte man sich fragen, ob es nicht überhaupt ein Wille (zum Leben) ist, der das Leben hervorbringt und dem der Tod dann beständig widerspricht.





























