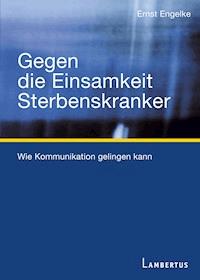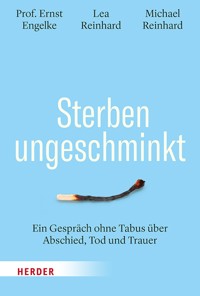
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Sterben und Trauern gehören zum Leben dazu. Aber wer ist schon bereit, sich persönlich damit zu befassen? In einem Generationengespräch sprechen die Journalistin Lea Reinhard (34) und der Journalist Michael Reinhard (65) mit dem Mitbegründer der Hospiz- und Palliativbewegung Professor Ernst Engelke (82) offen darüber. Sie wenden sich dem Alltag von Sterbenskranken, ihrem Erleben und Verhalten zu und fragen, wie die Kommunikation mit Sterbenskranken und ihre Begleitung gelingen kann. Die Belastungen sowie die oft widersprüchlichen Gefühle der Angehörigen kommen zur Sprache, ebenso die Wege, wie Menschen mit Verlust und Trauer umgehen. Auch die gesellschaftlichen Dimensionen und die brisante Frage des assistierten Suizids werden nicht ausgespart. Das Buch lädt dazu ein, sich den Themen Sterben und Trauern aufrichtig zu nähern und sich darin gegenseitig zu stützen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2025
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Finken & Bumiller, Stuttgart
Umschlagmotiv: © schankz / shutterstock
Satz: Barbara Herrmann, Freiburg
E-Book-Konvertierung: Newgen Publishing Europe
ISBN Print 978-3-451-02428-3
ISBN E-Book (E-Pub) 978-3-451-84428-7
Inhalt
Vorgespräch
1 Warum das Lieblingswort von Sterbenskranken „Scheiße“ ist …
2 „Ich komme aus dem Heulen nicht mehr raus“ – Sterbenskranke und ihr Alltag
3 Zwischen Hoffnung und Abschied: Begegnungen am Lebensende
4 „Manchmal wünsche ich mir, dass er bald stirbt.“
5 Delikater Trost: Wie eine Dose Wurst das Trauern lindern kann!
6 Premiumsterben in Deutschland: Der Traum vom guten Ende
7 Ärzte sind auch nur Menschen: Profis am Sterbebett
8 Glücksfeen oder Weißhexen: Das wahre Gesicht des Pflegealltags
9 Suizid als Lebensende? Die Antworten sind kontrovers
Nachgespräch
Literatur
Vorgespräch
In diesem Vorgespräch wird in das Buch eingeführt und die Gesprächsteilnehmer werden vorgestellt.
Lea: Über Sterben, Tod und Trauer gibt es schon reichlich Bücher. Jetzt auch noch dieses hier. Warum lohnt es sich aus deiner Sicht, Ernst, unser Buch zu lesen?
Ernst: Alle wissen, dass sie sterben werden. Wer aber ist schon bereit, sich persönlich damit zu befassen? Mit anderen offen darüber zu reden? Diese persönliche Ausgrenzung des ungeliebten Themas macht letztlich einsam. Unser Dreigenerationen-Gespräch soll den Mut fördern, mit anderen Menschen ganz persönlich über Sterben und Trauern zu sprechen; meiner Meinung nach ein entscheidender Schritt gegen die Einsamkeit, über die so viele Menschen klagen.
Lea: Die Einladung von meinem Vater zu diesem offenen Gespräch mit dir, Ernst, kam für mich mit meinen 34 Jahren als junge Frau und Mutter eher überraschend. Über Sterben und Trauern hatte ich noch nicht öffentlich gesprochen oder geschrieben. Doch als Journalistin bin ich neugierig geworden, und wir drei haben uns dann zu den Gesprächen getroffen und sie als Podcast veröffentlicht.
Michael: Wir haben uns kennengelernt und angefreundet, Ernst, als ich Chefredakteur der Main Post in Würzburg war. Damals haben wir gemeinsam Informationsveranstaltungen gegen den Pflegenotstand organisiert. Dabei habe ich deine persönlichen Erfahrungen und professionellen Kenntnisse aus mehr als 50 Jahren Engagement in der Hospiz- und Palliativbewegung schätzen gelernt. Gemeinsam haben wir dann die Idee für einen Podcast entwickelt. Daraus ist unser Dreigenerationen-Gespräch geworden. Wir haben uns darin einer Fülle von Themen zugewandt. Gesprochen haben wir beispielsweise über den Alltag von Sterbenskranken, deren oft von Metaphern geprägter Sprache, über den Traum vom guten Tod und die oft schwierige Realität sowie die herausfordernde Situation von Ärzten und Pflegekräften.
Lea: Das Feedback unserer Zuhörerinnen und Zuhörer zum Podcast Sterben & Trauern ist überwältigend. Mit einer so großen Resonanz hatten wir nicht gerechnet. Vielleicht liegt der Erfolg unter anderem auch darin, dass es sich bei Sterben & Trauern um einen eindringlichen und zugleich entlastenden Podcast handelt.
Michael: Ernst, du selbst bist in mehr als 50 Jahren deiner beruflichen Tätigkeit unglaublich vielen kranken Menschen begegnet und hast Sterbenskranke begleitet und unterstützt – sowohl im Alltag als auch wissenschaftlich. Außerdem trainierst du mit Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegekräften, wie Gespräche mit sterbenskranken Menschen gelingen können. Wie bist du dazu gekommen?
Ernst: Ich habe mir mein Studium als Krankenpfleger verdient. Angefangen habe ich 1962 in einer psychiatrischen Klinik. Gleich am ersten Tag musste ich einen sterbenden Patienten begleiten. Ich bin darauf nicht vorbereitet gewesen und auch nachher hat sich niemand um mich gekümmert. Dieses Erlebnis hat mich sehr geprägt. Drei Fragen aus diesem Erlebnis haben mich mein Leben lang begleitet. Die erste Frage: Was erleben Menschen, die sterbenskrank sind und sterben? Die zweite Frage: Wie kann man Menschen, die sterbenskrank sind und sterben, begleiten? Und die dritte Frage: Wie kann man Menschen begleiten, die Sterbenskranke begleiten?
Lea: Hast du darauf im Laufe der Jahre Antworten gefunden?
Ernst: Ja, und zwar durch die Begegnungen mit sterbenskranken und sterbenden Menschen sowie mit deren Angehörigen. Und natürlich auch durch den Austausch mit Pflegenden und Ärzten. Diese Antworten sind auch Gegenstand unserer Gespräche.
Michael: Du hast wie kaum ein anderer Erfahrung im Umgang mit Sterbenskranken. Schon in deiner Dissertation hast du dich mit dem Thema Sterben beschäftigt.
Ernst: Mich hat vor allem interessiert: Was erleben Menschen, die sterbenskrank sind? Wie verhalten sie sich? Welcher Trost kommt bei ihnen an? Ich habe 153 Gedächtnisprotokolle von 70 Klinikseelsorgern über ihre Sterbegespräche sozialwissenschaftlich ausgewertet. Sodann habe ich erforscht, was in den Texten und Gebeten der katholischen Kirche Sterbenskranken vermittelt wird. Die Ergebnisse beider Studien habe ich miteinander verglichen. Ich musste feststellen, dass die kirchlichen Texte das Erleben der Kranken ignorieren und es keine Verständigung gab. Und diese Erkenntnis hat mich dazu bewogen, mich weiterhin in dem Feld zu engagieren, sterbenskranke Menschen zu begleiten, aber auch darüber zu reflektieren und zu forschen. Und so habe ich das bis heute gemacht.
Michael: Du giltst auch als Mitbegründer der Hospiz- und Palliativbewegung in Deutschland. Wie ist es dazu gekommen?
Ernst: Grundlage dafür war meine Dissertation, die als eine der grundlegenden Forschungen zum Erleben und Verhalten von Sterbenskranken angesehen wird. Zudem habe ich 1975 schon an einer Fernsehsendung im ZDF zum Thema mitgewirkt und 1976 einen Kongress dazu mitveranstaltet.
Lea: Du hast sogar mal einen Kindergarten geleitet. Auf den ersten Blick passt das nicht wirklich zu deiner Beschäftigung mit Sterbenskranken, oder?
Ernst: Ja, aber nur auf den ersten Blick. Ich hatte durch meine Tätigkeit mehrere Erschöpfungszustände. Dadurch kam ich auf die Idee, als Ausgleich im Kindergartenbereich tätig zu werden. Zumal wir selbst damals schon Kinder hatten. Über 25 Jahre habe ich in dem Ort, in dem ich lebe, als Vorsitzender des Trägervereins einen Kindergarten geleitet. Die Kinder waren ein sehr guter Ausgleich zu den Sterbenden.
Lea: Das kann ich mir vorstellen.
Ernst: Ich kann übrigens nur jedem empfehlen, der sehr stark und dauernd mit Sterbenskranken zu tun hat, sich einen Ausgleich dazu zu suchen!
Michael: Wer glaubt, jetzt schon alles über deine breitgefächerten beruflichen Aktivitäten zu wissen, der irrt. Du warst auch Professor für Soziale Arbeit.
Ernst: Ja, das war nach meiner Arbeit als Klinikseelsorger. Ich wollte gerne mit jungen Menschen über die sozialen Bedingungen des Lebens sprechen und ihnen vermitteln, wie man Menschen in Notsituationen, und zwar in sehr vielfältigen Notsituationen, unterstützen kann. Ich bin 27 Jahre lang Professor für Soziale Arbeit gewesen. Mit der Pensionierung habe ich wieder angefangen, mich verstärkt um die Begleitung von Menschen, die sterbenskrank sind, zu kümmern. Ich habe in der Palliativakademie und im Palliativzentrum des Juliusspitals in Würzburg mitgearbeitet und mittlerweile vier Palliativstationen und zwei Hospize mit aufgebaut, in mehreren Altenpflegeeinrichtungen Menschen begleitet und Teams supervidiert.
Lea: Und du bildest auch Pflegekräfte sowie Ärztinnen und Ärzte dahingehend aus, dass sie mit sterbenskranken und sterbenden Menschen noch besser kommunizieren können.
Ernst: Ja, dabei habe ich immer drei Ziele: Ich möchte entlasten, indem ich Wissen über das Leben und Verhalten von Sterbenskranken vermittle. Ich möchte die Kommunikationsfähigkeiten, die die Einzelnen haben, stärken und optimieren. Ich möchte weitergeben, dass es für die Begleitung sterbenskranker Menschen kein Richtig und kein Falsch gibt, sondern nur ein der Situation angemessenes Verhalten.
Michael: In diesem Sinn haben wir auch unsere Dreigenerationen-Gespräche zu Sterben, Abschied, Tod und Trauer geführt und sie in unserem Podcast „Sterben & Trauern“ veröffentlicht (zu finden unter: https://open.spotify.com/show/0FeZQaDy7sbqKMewwB1n1y und auch bei Google unter: „Sterben & Trauern“ Podcast).
Lea: Für dieses Buch haben wir diese Gespräche transkribiert und vertiefend überarbeitet und erweitert. Wir hoffen, auf diesem Weg noch mehr Menschen zu erreichen und zu unterstützen.
1 Warum das Lieblingswort von Sterbenskranken „Scheiße“ ist …
In diesem Gespräch befassen wir uns mit den grundlegenden Aspekten des Sterbens und des Trauerns. Wir beleuchten, wie diese Themen in unserer Gesellschaft wahrgenommen werden und in welchem historischen und gesellschaftlichen Kontext Sterben und Trauern stattfinden.
Lea: Die meisten Menschen versuchen alles, was mit Sterben und Tod zu tun hat, zu verdrängen. Die Angst vor der eigenen Sterblichkeit ist einfach zu groß, als dass man daran auch noch erinnert werden wollte. Sterben und Tod gehören aber zu unserem Leben dazu, ob wir es wollen oder nicht. Ernst, wann hast du das letzte Mal übers Sterben nachgedacht?
Ernst: Ich habe erst kürzlich wieder einen ganzen Tag lang mit 24 Ärztinnen und Ärzten über die Begleitung von sterbenskranken Menschen gesprochen. Dabei habe ich mit ihnen darüber nachgedacht, welche Möglichkeiten es gibt, mit sterbenskranken Menschen angemessen zu kommunizieren. Grundlage dafür sind Begegnungen mit Sterbenskranken und Sterbenden und die Reflexion dieser Begegnungen sowie die einschlägige Fachliteratur.
Lea: Was genau ist denn der Unterschied zwischen sterbenskrank und sterbend?
Ernst: Sterbenskrank ist für mich jemand, der erfahren oder erkannt hat oder die Diagnose bekommen hat, eine Krankheit zu haben, die sein nahes Lebensende anzeigt, der also vom eigenen Tod in absehbarer Zeit bedroht sein könnte. Sterbend ist jemand, der sterbenskrank ist und sich in den letzten Stunden oder in den letzten zwei, drei Tagen seines Lebens befindet. Ob nun sterbenskrank oder sterbend, wir müssen uns dann immer mit einer gefährlichen Bedrohung unserer Existenz auseinandersetzen.
Lea: Die häufigsten Todesursachen in Deutschland sind Herz- und Kreislauf-Erkrankungen, gefolgt von Krebs. Es kann jeden von uns treffen, zu jeder Zeit, ganz plötzlich sterbenskrank zu werden oder zu sterben. Wie gehen die Menschen, erkrankte und gesunde, aus deiner Sicht mit diesem Wissen um?
Ernst: Erkrankte und gesunde Menschen unterscheiden sich im Umgang mit dem Sterben beträchtlich voneinander. Ich wähle eine Metapher, um den unterschiedlichen Umgang zu veranschaulichen: Ein Schachspieler und ein Damespieler spielen nach ihren je eigenen Regeln am selben Brett miteinander. Der Schachspieler hat einen König, eine Dame, zwei Türme, zwei Läufer, zwei Springer, acht Bauern und damit fast unendlich viele Möglichkeiten, sich zu bewegen. Der Damespieler dagegen hat als Spielsteine nur runde Scheiben, schwarz oder weiß, und kann seine Steine nur vorwärts ziehen, ist also enorm eingegrenzt, während der Schachspieler seine Figuren variabel bewegen kann. Das Zusammenspiel kann nicht gelingen.
In der Metapher: Die gesunden Menschen spielen Schach und die kranken Menschen Dame. Wenn beide nun miteinander je nach ihren eigenen Regeln spielen, bedeutet das, dass sie sich nicht verständigen können. Wenn sie sich verständigen möchten, müssen die Schachspieler, also die gesunden Menschen, ihr Spiel an die Möglichkeiten der Damespieler und deren Spielregeln anpassen. Sonst gibt es keine Verständigung.
Michael: Das setzt aber voraus, dass man sich mit der Frage des Sterbens intensiver beschäftigt.
Ernst: Dem Sterben können wir im Alltag letztlich nicht ausweichen. Die Frage ist nur, wie sehr wir vom Sterben persönlich getroffen sind. Gesellschaftlich gesehen heißt das für mich: 80 Prozent der Deutschen schauen, dass sie nichts mit Sterben und Tod zu tun haben; sie machen einen großen Bogen um Sterbenskranke, Pflegebedürftige und Sterbende. 20 Prozent sind jedoch persönlich getroffen und können nicht ausweichen. Das sind Menschen, die selbst krank und pflegebedürftig sind, und auch Menschen, die um einen Verstorbenen trauern. Dazu zähle ich auch alle Menschen, die, ob als Angehörige, Professionelle oder Ehrenamtliche, sterbenskranke und pflegebedürftige Menschen begleiten und versorgen. Diese 20 Prozent sind täglich damit beschäftigt, oft für andere, die sich nicht kümmern, manchmal extrem häufig und intensiv, zum Beispiel auf Palliativstationen.
Lea: Du beschäftigst dich seit vielen Jahrzehnten mit dem Thema Sterben. Hat sich innerhalb dieses Zeitraums etwas auffallend verändert?
Ernst: Nein, nach meinem Empfinden nicht. Ich bin mittlerweile der Auffassung, dass transkulturell und transepochal das Phänomen dasselbe ist. Ich greife meine Metapher mit dem Schachspieler und dem Damespieler auf. Diese Metapher steht für den Umgang mit Sterben und Tod in allen Kulturen und Epochen, freilich in vielfältigen örtlichen Variationen. Es gibt zwar andere Auffassungen, wie sie beispielsweise der französische Soziologe Philippe Ariès in seinem Buch über die „Geschichte des Todes“ (1982) aufgeschrieben hat. Seine Hauptthese: Von Homer bis Tolstoi ist im Abendland die Grundeinstellung der Menschen zum Sterben nahezu unverändert geblieben. Der Tod war ein vertrauter Begleiter, ein Bestandteil des Lebens, akzeptiert und häufig als eine letzte Lebensphase der Erfüllung empfunden. Nach meinen Forschungen stimmt das einfach nicht. Ariès hat sehr einseitig die Quellen angeschaut und nur Gesunde berücksichtigt und nicht die Sterbenskranken. Ich habe in meinen Publikationen viele Beispiele dafür angegeben, dass die Menschen auch früher Sterben und Tod nicht akzeptiert haben, wie Ariès behauptet. Da könnte ich wirklich seitenlang Beispiele bringen. Ariès wird völlig unkritisch zitiert. Aber er sagt wohl das, was die Menschen – die Schachspieler – gern hören möchten. Schließlich sind sich einfügende Patienten pflegeleichte Patienten.
Michael: Wenn ich dich richtig verstehe, beginnt die intensive Auseinandersetzung mit Sterben und Tod erst dann, wenn ich unmittelbar damit konfrontiert bin. Etwa durch Krankheit, einen Unfall oder durch einen Suizid im engeren Umfeld.
Ernst: Dem stimme ich zu. Die Auseinandersetzung beginnt mit der persönlichen Berührung und durch die persönliche Berührung.
Lea: Besonders schlimm stelle ich mir vor, wenn ein Elternteil oder ein anderes Familienmitglied stirbt.
Ernst: Ja, das ist die extremste persönliche Berührung, die man sich normalerweise vorstellen kann. Dem kann sich niemand entziehen. Die 80 Prozent, die sich normalerweise nicht mit dem Thema Sterben und Tod befassen, müssen sich zwangsläufig damit beschäftigen, wenn Sterben und Tod plötzlich wie ein Blitz aus heiterem Himmel in ihr Leben einschlagen. Und dann ist die Frage: Wie gehe ich damit um, wenn ich getroffen worden bin? Und wie gehe ich mit den mir nahen Menschen um, die jetzt schwerkrank oder gar sterbenskrank sind? Und wie spreche ich mit den Angehörigen? Auf diese Fragen suche ich mein Leben lang passende Antworten.
Lea: Gehen jüngere Menschen damit anders um als ältere?
Ernst: Ich denke nein. Wir wissen heute, dass viele Faktoren den persönlichen Umgang mit Sterben und auch Trauern beeinflussen. Das sind zum Beispiel die Persönlichkeit, die Biografie, die persönlichen Beziehungen, die Verantwortung, die jemand hat, die Art und der Verlauf der Erkrankung, die Therapiemöglichkeiten, die Symptome, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und so weiter. Es wirken also so viele Faktoren zusammen, dass man nicht generell sagen kann, ob jüngere Menschen anders mit Sterben und auch Trauern umgehen als ältere Menschen.
Lea: Es gibt sicher viele Menschen, die keine direkten Berührungspunkte mit dem Sterben und dem Tod haben. Beschäftigen die sich aus deiner Erfahrung trotzdem mit diesem Thema oder ignorieren sie es lieber?
Ernst: Es gibt in Deutschland eigentlich keine Chance, sich nicht damit auseinanderzusetzen. Allein wenn ich daran denke, dass die Deutschen sich täglich durch Mord und Totschlag unterhalten lassen und Krimis ihre Lieblingsbücher sind. 3.500 Kriminalromane erscheinen pro Jahr. Mehr als 130 Krimireihen gibt es aktuell im deutschen Fernsehen. Jeder Fernsehzuschauer wird täglich mit dem Sterben und Tod – anderer Menschen – konfrontiert, wählt sogar diese Unterhaltung zur Entspannung und schützt sich auf seine eigene Weise, um persönlich nicht berührt zu werden, indem man zum Beispiel auf der Couch sitzt und bei Wein oder Bier und Snacks die Leistung der Schauspieler diskutiert. Dagegen wäre die Berührung beim Besuch eines sterbenskranken oder pflegebedürftigen Menschen, ob daheim oder im Heim, sofort gegeben, weil man dann ungeschützt dem Schmerz und dem Geruch des kranken Menschen ausgeliefert ist.
Michael: Du hast an vielen Sterbebetten gesessen. Hast du beobachtet, dass diejenigen, die sich zeitlebens mit dem Tod beschäftigt haben, leichter sterben?
Ernst: Ich nehme an, dass es nicht so ist. Demnach müssten Ärzte und Pflegekräfte leichter sterben. Das ist aber nicht der Fall, ich beobachte vielmehr das Gegenteil. Es ist nämlich ein großer Unterschied, ob jemand am Krankenbett sitzt oder selbst darin liegt, ob ich Schach spielen kann oder Dame spielen muss. Das Sterben ist für jeden, der selbst getroffen ist, eine unglaubliche existenzielle Zumutung. Ob man das Sterben so trainieren kann, dass man leichter stirbt, weiß ich nicht. Meiner Meinung nach gibt es letztlich kein Training dafür. Sich vom Leben endgültig trennen zu müssen, von den Menschen, die man liebt, von den Töchtern, von den Söhnen, von der Ehefrau, von den Eltern, von den Enkelkindern, von den Freunden: Wer möchte das? Das ist für jeden schmerzhaft. Über Sterben und Tod zu diskutieren und Sterbende zu begleiten ist das eine und das eigene Sterben zu erleben ist etwas ganz anderes.
Lea: Worin liegt der Unterschied, ob ich mich mit dem Sterben beschäftige oder mit dem Tod?
Ernst: Ich zitiere dafür einen sehr klugen Menschen, den Arzt und Philosophen Karl Jaspers. Jaspers sagt in seiner „Kleinen Schule des philosophischen Denkens“ (München 1997, S. 166): „Wenn von Tod und Unsterblichkeit gesprochen wird – wir wissen nichts“ und weil wir nichts wissen, ist das ein unglaubliches Feld der Spekulation. Wenn jemand sagt: Ich habe keine Angst vor dem Tod, was sagt er dann? Ich kenne niemanden, der sagt: Ich habe keine Angst vor dem Sterben. Das Sterben ist ein Prozess, und der Tod ist ein Abstraktum. Es wird unglaublich viel über den Tod diskutiert. Das kann man stundenlang tun und danach trotzdem gut schlafen. Aber wenn ich mit einem Sterbenskranken oder Sterbenden persönlich gesprochen und ihm zugehört habe und der hat mir sein Leben erzählt, von seinen Ängsten, Hoffnungen, Schmerzen und Tränen gesprochen, dann kann mir das den Schlaf rauben. Das ist für mich der Unterschied.
Michael: Das Sterben kann ich also unmittelbar erleben, während das, was darauf folgt, nämlich der Tod, für uns ein Mysterium ist und bleibt.
Ernst: Genau so sehe ich das. Der Tod bleibt ein Geheimnis und unser Leben ein Rätsel. Und ich sehe überhaupt keine Chance, diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Da helfen auch Nahtoderfahrungen nicht. Erst recht keine Geist- oder Geistererfahrungen, auf die sich beispielsweise die umstrittene Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross für ihre Aussagen über das Sterben und den Tod beruft (Elisabeth Kübler-Ross: Das Rad des Lebens. Autobiographie. München 2002, S. 261–335). Das sind letztlich Spekulationen, die oftmals die Begleitung Sterbenskranker erschweren können, selten erleichtern. Auch gläubige Menschen wissen nichts, sondern glauben an ein Leben nach dem Tod im Reich Gottes.
Michael: Du meinst, dass die Wirklichkeit des Sterbens wenig zu tun hat mit den meist verklärenden Nahtoderfahrungen?
Ernst: Der Begriff „Nahtoderfahrung“ klärt schon auf: Derjenige war nahe am Tod, aber eben noch nicht tot. Natürlich würde ich auch gern wissen, wohin die Reise am Ende geht.
Also ich denke an einen Arzt, 62 Jahre alt, Internist und Palliativmediziner. Ein sehr gebildeter Mensch, der neben der Arbeit in der Klinik noch Philosophie und Theologie studiert und sich sogar über Todesvorstellungen habilitiert hat. Und kurz vor seinem Tod sagte er, als er mit einer tödlichen Krankheit selbst auf der Palliativstation lag: „Am Ende bleibt nur noch Scheißen und Kotzen. Da hilft keine Philosophie, und da hilft auch keine Theologie.“
Lea: Unmissverständlicher und illusionsloser kann man es wohl nicht auf den Punkt bringen.
Michael: Ja, diese Aussage ist brutal und ernüchternd. Der sicher von vielen erhoffte „schöne Tod“ ist in der Regel wohl eine Illusion …
Lea: Der Arzt in dem von dir geschilderten Beispiel, Ernst, ist auf einer Palliativstation gestorben. Etwa die Hälfte der Deutschen möchte allerdings am liebsten in ihren eigenen vier Wänden sterben. Doch die Realität sieht anders aus. Der deutsche Hospiz- und Palliativverband hat 2022 in einer repräsentativen Umfrage herausgefunden, dass die meisten Menschen heute in Krankenhäusern und Pflegeheimen sterben und nur 34 Prozent daheim. Warum schafft das lediglich ein Drittel der Deutschen?
Ernst: Also der Wunsch, wo jemand sterben möchte, ist ein sehr differenziert zu behandelndes Thema. Die Bedingungen, unter denen Menschen heute leben, sind nicht unbedingt so, dass jemand zu Hause sterben kann oder zu Hause sterben möchte. Das betrifft sowohl die Wohnverhältnisse als auch die Art und Weise, wie Menschen miteinander leben. Das heißt, wir haben häufig die Situation, dass jemand zu Hause nicht sterben möchte, weil dort nicht die notwendige Versorgung und Begleitung gegeben sind oder aber auch, weil der Überlebende zum Beispiel nach dem Versterben keine Sterbewohnung haben möchte. Das heißt, es gibt auch Ablehnung und Hindernisse für das Zuhause-Sterben.
Lea: Keine Sterbewohnung haben zu wollen, kann ich verstehen.
Ernst: Natürlich. Und das andere ist, dass wir immer noch die Hoffnung haben, fast alle haben sie, dass im Krankenhaus doch noch etwas zu machen ist, denn die Bereitschaft, selbst zu sterben, ist nicht so groß, wie manche annehmen. Menschen wollen gewöhnlich nicht sterben, sondern am Leben bleiben. Und darum, bitte noch ins Krankenhaus, um noch eine möglichst optimale Begleitung und Therapie zu bekommen.
Michael: Das ist ein interessanter Aspekt, über den ich so noch gar nicht nachgedacht habe. Ich gehöre auch zu denjenigen, die am liebsten daheim sterben möchten, umgeben von der Familie und mir vertrauten lieben Menschen. Aber ich kann auch sehr gut verstehen, wenn sterbenskranke Menschen versuchen, nach dem letzten Strohhalm zu greifen – in diesem Fall ist es die ärztliche Kunst im Krankenhaus –, um dem Tod eventuell doch noch ein Schnippchen zu schlagen. Diese Hoffnung sollte aus meiner Sicht aber nicht dazu führen, dass Ärzte Maßnahmen ergreifen, die, wenn überhaupt, das Leben nur sehr kurz verlängern und das Leiden nicht lindern.
Ernst: Da muss man jetzt wieder genau zwischen dem Schachspieler und dem Damespieler unterscheiden. Der Schachspieler vertritt die Meinung, die du anführst. Der Damespieler sieht das anders. Er möchte in der Regel mindestens weiter Dame spielen. Und ihm ist es wichtig, dass er nicht heute stirbt, sondern frühestens morgen. Und morgen sagt er auch: Ich möchte heute nicht sterben, sondern frühestens morgen. Das ist die Grundsituation. Natürlich gibt es Differenzierungen dazu und Abweichungen. Aber das ist der Tenor, den ich als Schachspieler respektieren sollte. Insofern sind die Diskussionen über Maximaltherapien, die aus finanziellen Gründen verweigert werden sollen, Überlegungen der Schachspieler und nicht der Damespieler. Das sollte man berücksichtigen.
Michael: Du würdest also sagen, dass für viele Sterbenskranke das Krankenhaus gar nicht so eine schreckliche Vorstellung ist, weil sie es vor allem als einen Ort der letzten Hoffnung empfinden?
Ernst: Ja, so sehe ich das.
Lea: Ihr habt euch mit dem Sterben bestimmt schon häufiger auseinandergesetzt als ich. Das mag vor allem an meinem Alter liegen. Ich frage mich gerade, ob die Einstellung zum Tod mit dem Lebensalter zusammenhängt. Sterben junge Menschen beispielsweise anders als ältere?
Ernst: Ich ergänze das, was ich zuvor schon dazu gesagt habe, mit einer kleinen Geschichte. Vor kurzem ging durch die Medien, dass eine Ordensschwester ihren 110. Geburtstag gefeiert hat. Sie wurde gefragt, wie sie denn so gelebt hätte und wie lange sie noch leben möchte. Sie antwortete: „Ja, der Herrgott hat mich nicht geholt. Ich bete schon immer darum, dass der Herrgott mich holt.“ Das heißt scheinbar, sie möchte sterben. Und dann hat sie angefügt: „Ich habe mich in meinem ganzen Leben immer über Geburtstage mit einer Schnapszahl gefreut. Und es wäre doch ganz schön, wenn ich noch den 111. feiern könnte.“
Lea: Sie wollte also auf jeden Fall noch so lange weiterleben.
Ernst: Genau. Wir wollen in der Regel nicht heute sterben, sondern, wenn schon, dann morgen. Und morgen sagen wir dasselbe.
Lea: Und das gilt sicher für Jung und Alt, oder?
Ernst: So ist es!
Michael