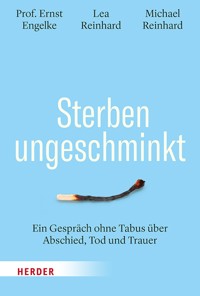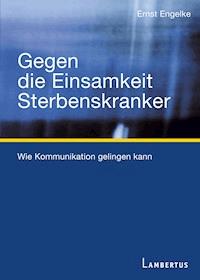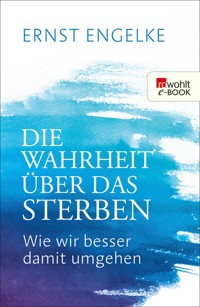Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lambertus
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die 8., aktualisierte Auflage wurde um zwei neue, inzwischen etablierte Theorieansätze erweitert. Dabei wurden folgende Autor:innen in das Standardwerk für die Soziale Arbeit neu aufgenommen: - Lena Dominelli: Die Weltgesellschaft sozial-ökologisch und gerecht gestalten durch Green Social Work - Silke Birgitta Gahleitner: Soziale Arbeit als Bildungs- und Beziehungsprofession Vorgestellt werden die Theorien von Thomas von Aquin, Juan Luis Vives, Jean Jacques Rousseau, Adam Smith, Johann Heinrich Pestalozzi, Thomas Robert Malthus, Johann Hinrich Wichern, Paul Natorp, Jane Addams, Christian Jasper Klumker, Alfred Adler, Alice Salomon, Gertrud Bäumer, Ilse von Arlt, Herman Nohl, Hans Muthesius, Hans Scherpner, Carel Bailey Germain und Alex Gitterman, Klaus Mollenhauer, Marianne Hege, Lutz Rössner, Karam Khella, Hans Thiersch, Silvia Staub-Bernasconi, Lothar Böhnisch, Margit Brückner, Lena Dominelli, Bernd Dewe und Hans-Uwe Otto, Rudolf Leiprecht und Paul Mecheril, Ulrich Deinet und Christian Reutlinger, Silke Birgitta Gahleitner, Björn Kraus sowie Dieter Röh. Die Kernaussagen der Theorien werden anhand einer einheitlichen Matrix historisch-biographisch erörtert. Aktualisierte Literaturempfehlungen bieten Anknüpfungspunkte zum vertiefenden Studium.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 976
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ernst Engelke, Stefan Borrmann, Christian Spatscheck
Theorien der Sozialen Arbeit
Eine Einführung
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
8., überarbeitete und erweiterte Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten
© 2025, Lambertus-Verlag GmbH
Karlstraße 40, 79104 Freiburg im Breisgau
www.lambertus.de, [email protected]
Umschlaggestaltung: Nathalie Kupfermann, Bollschweil
Druck: Elanders Waiblingen GmbH
ISBN 978-3-7841-3767-4
ISBN eBook 978-3-7841-3768-1
Inhalt
Vorwort zur 8. Auflage
Zur Einführung
Teil 1 – Vom Armutsideal bis zum Bauen von Hütten der Liebe
Frühe Theorien der Sozialen Arbeit
Einleitung
1Gott und den Nächsten lieben
Thomas von Aquin (1224 – 1274)
2Arme unterstützen und durch Fordern fördern
Juan Luis Vives (1492 – 1540)
3Zur reinen Natur zurück
Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778)
4Glück und Wohlstand für alle
Adam Smith (1723 – 1790)
5Für ein Leben in Armut erziehen
Johann Heinrich Pestalozzi (1746 – 1827)
6Das Entstehen von Armut verhindern
Thomas Robert Malthus (1766 – 1834)
7Hütten der Liebe bauen
Johann Hinrich Wichern (1808 – 1881)
Teil 2 – Von der Gemeinschaftserziehung bis zur Behebung der Not
Theorien der Sozialen Arbeit in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
Einleitung
1In, durch und zur Gemeinschaft erziehen
Paul Natorp (1854 – 1924)
2Frieden und soziale Gerechtigkeit herstellen
Jane Addams (1860 – 1935)
3Bevormunden und leiten
Christian Jasper Klumker (1868 – 1942)
4Erziehen und heilen
Alfred Adler (1870 – 1937)
5Frieden im Inneren und in der Welt gewinnen
Alice Salomon (1872 – 1948)
6Sich um gesellschaftlich notwendige Aufgaben kümmern
Gertrud Bäumer (1873 – 1954)
7Grundbedürfnisse befriedigen
Ilse von Arlt (1876 – 1960)
8Geistige Energien zur Behebung der Not wecken
Herman Nohl (1879 – 1960)
Teil 3 – Von der sozial-rassistischen Auslese bis zum gelingenden Alltag
Theorien der Sozialen Arbeit in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
Einleitung
1Sozial-rassistisch auslesen und ausschalten
Hans Muthesius (1885 – 1977)
2Persönlich fürsorgen
Hans Scherpner (1898 – 1959)
3Menschen in ihrer sozialen Umwelt entdecken und unterstützen Carel Bailey Germain (1916 – 1995) und
Alex Gitterman (1938 – 2024)
4Anleiten, erwachsen zu werden
Klaus Mollenhauer (1928 – 1998)
5Engagierter Dialog
Marianne Hege (*1931)
6Technologisch normalisieren
Lutz Rössner (1932 – 1995)
7Ausbeutung und Verelendung überwinden
Karam Khella (1934 – 2022)
8Einen gelingenderen Alltag ermöglichen
Hans Thiersch (*1935)
Teil 4 – Vom menschengerechten Handeln bis zur Gerechtigkeit und dem guten Leben
Theorien der Sozialen Arbeit zu Beginn des 21. Jahrhunderts
Einleitung
1Menschengerecht handeln
Silvia Staub-Bernasconi (*1936)
2Persönliche und gesellschaftliche Krisen bewältigen
Lothar Böhnisch (1944 – 2024)
3Geschlechterverhältnisse, Soziale Arbeit und Care
Margrit Brückner (*1946)
4Die Weltgesellschaft sozial-ökologisch und gerecht gestalten durch Green Social Work
Lena Dominelli (*1947)
5Wissen und Können relationieren Bernd Dewe (1950 – 2017) und
Hans-Uwe Otto (1940 – 2020)
6Diversitätsbewusste und rassismuskritische Soziale Arbeit Rudolf Leiprecht (*1955) und
Paul Mecheril (*1962)
7Soziale Räume aneignen und Entwicklung gestalten Ulrich Deinet (*1959) und
Christian Reutlinger (*1971)
8Soziale Arbeit als Bindungs- und Beziehungsprofession
Silke Birgitta Gahleitner (*1966)
9Erkennen und entscheiden zwischen Lebenswelt und Lebenslage
Björn Kraus (*1969)
10Gerechtigkeit und das gute Leben
Dieter Röh (*1971)
Zum Schluss
Literatur
Die Autoren
Personen- und Sachwortregister
Vorwort zur 8. Auflage
Im Jahr 1992 veröffentlichte Ernst Engelke im Lambertus-Verlag das Buch „Soziale Arbeit als Wissenschaft“. Dieses verbreitete sich schnell und prägte die Debatten um die Wissenschaft Soziale Arbeit. In den folgenden Jahren entwickelte er das Buch zu den beiden Bänden „Theorien der Sozialen Arbeit“ (erstmals erschienen 1998) und „Die Wissenschaft Soziale Arbeit“ (erstmals erschienen 2004) weiter – und über 45.000 Ausgaben (Stand 2024) der Bücher wurden seitdem verkauft. Seit 2008 werden diese beiden Bücher nun von uns als Autoren gemeinsam veröffentlicht und regelmäßig aktualisiert.
Für die nun vorliegende 8. Auflage war uns vor allem eine weitere inhaltliche Aktualisierung wichtig. Der Theoriediskurs in der Sozialen Arbeit entwickelt sich erfreulicherweise stetig weiter, dabei wurden auch neue Theorieansätze ausgearbeitet und mittlerweile etabliert. Neben inhaltlichen Aktualisierungen haben wir deshalb nach den fünf ergänzten Theorien der 7. Auflage nochmals zwei neue Theorien hinzugenommen. Zum einen den beziehungstheoretischen und sozialtherapeutischen Theorieansatz von Silke Gahleitner und zum anderen den sozialökologischen und gerechtigkeitsorientierten Ansatz von Lena Dominelli.
Das Buch bildet nun 33 Theorien der Sozialen Arbeit ab, die in vier Teilen dargestellt werden. Weiterhin beginnen die vier Teile mit je einer kommentierenden zeithistorischen Einleitung. Ebenso haben wir die bisherigen internen Kategorien bei der Darstellung der Theorien aus den vorhergehenden Auflagen beibehalten.
Wir danken unseren Freundinnen, Freunden, Kolleginnen und Kollegen, die uns bei der Neubearbeitung inhaltlich und persönlich unterstützt haben. Nicht zuletzt danken wir Sabine Winkler und dem Lambertus-Verlag für ihre kontinuierliche, anregende, tatkräftige und ausdauernde Unterstützung.
Würzburg, Landshut, Bremen, im Januar 2025
Ernst Engelke, Stefan Borrmann, Christian Spatscheck
Zur Einführung
Die Kenntnis wissenschaftlicher Theorien der Sozialen Arbeit gehört genauso zum Selbstverständnis und zur Grundlage professionellen Handelns von Sozialarbeiter:innen und Sozialpädagog:innen wie die Reflexion der eigenen Praxis anhand dieser Theorien. Außerdem wird heute nicht nur von Klient:innen, sondern auch von Kostenträgern erwartet, dass Sozialarbeiter:innen und Sozialpädagog:innen ihr Handeln mit wissenschaftlichen Theorien begründen können. In der Wissenschaft Soziale Arbeit1 gibt es wie in allen anderen Wissenschaften zahlreiche verschiedene Konzepte, Modelle und Theorien. In diesem Buch stellen wir Theorien vor, die unserer Auffassung nach für die heutige Soziale Arbeit relevant sind.
1 Theoriediskussion und Theoriebildung in der Sozialen Arbeit
In der Scientific Community sind die Auffassungen darüber kontrovers, welche Kriterien Theorien generell erfüllen müssen, damit sie als wissenschaftliche Theorien anerkannt werden können. Für die Soziale Arbeit kommt noch hinzu, dass allein schon der Inhalt des Begriffs „Soziale Arbeit“ sehr verschieden definiert werden kann und auch definiert wird. Spricht man nämlich von „Sozialer Arbeit“, dann kann damit Armenpflege, Caritas, Diakonie, Fürsorge, Jugendhilfe, Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Wohlfahrt usw. gemeint sein. „Soziale Arbeit“ ist ein über 100 Jahre alter Klammerbegriff für Tätigkeiten wie aktivieren, anleiten, ausgrenzen, ausmerzen, ausschalten, austauschen, befrieden, behandeln, belehren, beraten, bevormunden, binden, deuten, disziplinieren, emanzipieren, entwickeln, ermutigen, erziehen, fördern, fürsorgen, fürsprechen, helfen, kontrollieren, leiten, lehren, lieben, normalisieren, pflegen, rekonstruieren, rehabilitieren, resozialisieren, selektieren, sozialisieren, unterstützen, versichern, versorgen, verstehen, verwahren, züchten usw. Diese begriffliche Offenheit ist weder für die konkret-praktische noch für die theoretisch-wissenschaftliche Seite der Sozialen Arbeit als Profession besonders förderlich. In anderen Wissenschaften, selbst in klassischen, gibt es jedoch ähnliche offene Felder, auch wenn sie in der Regel selten ausdrücklich thematisiert werden, wie z. B. in der Psychologie und der Soziologie (vgl. Engelke/Spatscheck/Borrmann 2024).
Im deutschen Sprachraum hat diese Vielfalt daher zu mannigfaltigen Definitionen der Sozialen Arbeit und ihres Gegenstandsbereichs geführt (vgl. Klüsche 1999; Otto/Thiersch 2011; Thole 2012; Erath/Balkow 2016; Hammerschmidt/Aner 2022; Sandermann/Neumann 2022 u. a.). Welche Definition soll nun gelten? Welche Kriterien sollen bei der Entscheidung für eine Definition angewandt werden? Die Definition soll nach unserer Auffassung von möglichst vielen Mitgliedern der Scientific Community der Sozialen Arbeit in Deutschland und auch international anerkannt sein. Nur so kann sie ein weites Dach, unter dem möglichst viele Theorien versammelt werden können, sein. Wir orientieren uns deshalb an der Definition der Sozialen Arbeit, die von der International Federation of Social Workers (IFSW) und der International Association of Schools of Social Work (IASSW) im Jahr 2014 in Adelaide/Australien beschlossen wurde.
“Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledges, social work engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing. The above definition may be amplified at national and/or regional levels” (IFSW 2024a).
Die Soziale Arbeit kann national und international auf eine lange Tradition der Theorieentwicklung zurückblicken und verfügt über Erkenntnismethoden und Wissensbestände, die in Praxis und Lehre/Ausbildung der Sozialen Arbeit genutzt werden (vgl. Müller 1988a,b; Soydan 1999; National Association of Social Workers 1995a,b,c; 1997; Hering/Münchmeier 2014; Wendt 2016a,b; Payne 2020 u. a.). Historisch wie auch wissenschaftstheoretisch gesehen ist die Soziale Arbeit – wie alle Wissenschaften – keine autonome, sondern eine relativ autonome Wissenschaft. Wenn wir davon sprechen, dass die Soziale Arbeit als Wissenschaft relativ selbstständig ist, dann meinen wir damit, dass sie in ihrem Werdegang mit anderen Wissenschaften eng verbunden und auch inhaltlich mit anderen Wissenschaften verschränkt ist, insbesondere mit den Human-, Sozial-, Rechts- und Geisteswissenschaften (vgl. Engelke/Spatscheck/Borrmann 2024). Der Begriff „relativ“ ist hier also nicht als Abwertung zu verstehen, sondern hebt die Verbundenheit (relation) der Wissenschaften miteinander hervor. International ist es selbstverständlich, dass auch die klassischen Naturwissenschaften in diesem Sinne als relativ autonom angesehen werden (vgl. Mayr 1997). Hinsichtlich bestimmter Fragestellungen und ihrer Behandlung zeigen die Sozialwissenschaften sowohl untereinander als auch mit den Geisteswissenschaften enge Verknüpfungen und Gemeinsamkeiten. So werden z. B. in den Geistes- und Sozialwissenschaften dieselben Personen und Werke der griechischen Philosophie als Gründer bzw. als Wurzeln ihres „Stammbaums“ genannt. Sokrates, Platon und Aristoteles werden als Urväter beispielsweise der Philosophie (vgl. Störig 2016; u. a.), der Pädagogik (vgl. Reble 2009 u. a.), der Psychologie (vgl. Pongratz 1967 u. a.) und auch der Physik (vgl. Meÿenn 1997) angeführt. Das kann aber doch nur heißen: Jede dieser genannten Wissenschaften hat offene Grenzen und muss damit leben, dass sie sich von anderen Wissenschaften nicht trennscharf abgrenzen lässt. In jeder Wissenschaftsdisziplin gibt es außerdem pluriforme, heterogene und miteinander unvereinbare Auffassungen und Theorien – auch über ihr eigenes „Proprium“. Es muss deshalb nicht verwundern, dass die Auffassungen darüber und die Bewertungskriterien dafür, was Wissenschaft und was eine wissenschaftliche Theorie ist, auch innerhalb einzelner Wissenschaften verschieden sind und kontrovers diskutiert werden. Herkömmliche Wissenschaftssystematiken mit eindeutig markierbaren Abgrenzungen und Hierarchien sind daher äußerst fragwürdig (vgl. Wissenschaftsrat 2000). In diesem Sinne ist jede Wissenschaft relativ selbstständig und mit anderen Wissenschaften vielfach vernetzt und somit interdependent. Soziale Arbeit arbeitet als eine relativ selbstständige Wissenschaft mit anderen relativ selbstständigen Wissenschaften im Sinne gleichwertiger Partner zusammen, um der Entstehung sozialer Probleme vorzubeugen und bestehende soziale Probleme zu lösen oder zumindest zur Bewältigung dieser beizutragen. International bilden Wissenschaft, Praxis und Ausbildung zusammen eine Profession. In Deutschland ist das bei der Sozialen Arbeit nicht üblich, vielmehr werden die Praxis als Profession und die Wissenschaft als Disziplin voneinander getrennt oder einander gegenübergestellt (vgl. Thole 2012 u. a.). Wir folgen dem internationalen Vorgehen und für uns besteht die Profession Soziale Arbeit aus Wissenschaft, Praxis und Ausbildung (vgl. Engelke/Spatscheck/Borrmann 2024).
Die Soziale Arbeit als Wissenschaft existiert bereits seit Jahrhunderten in unterschiedlichen Gestalten (vgl. Soydan 1999 u. a.). Dabei sind in der jeweiligen Zeit recht unterschiedliche Sichtweisen und Ursachenanalysen der sozialen Probleme und verschiedene Handlungsstrategien zu deren Bewältigung erarbeitet und oft auch in der Praxis umgesetzt worden (Spatscheck/Borrmann 2021). Für die wissenschaftliche Durchdringung wie auch für die Lösung gegenwärtiger sozialer Probleme können die Lösungen früherer Generationen fruchtbringend herangezogen werden. Häufig belehrt uns die Geschichte nämlich über die Folgen bestimmter Sichtweisen und Handlungsstrategien; sie können uns heute als Warnung vor oder auch als Ermutigung für bestimmte Lösungswege dienen. Aus diesem Grund berücksichtigen wir Theorien, die immer noch von Bedeutung sind, vom späten Mittelalter bis in die Gegenwart. Bei genauer Betrachtung zeigt sich nämlich, dass die sozialen Probleme und die Ansätze, diese Probleme zu lösen, sich häufig über Jahrhunderte hinweg gleichen. Als Beispiel nennen wir den Umgang der Stadtverwaltungen im Mittelalter mit Bettler:innen und den Umgang der Länder mit Geflüchteten und Asylbewerber:innen heute.
2 Zur Auswahl der Theorien der Sozialen Arbeit
Angesichts der Fülle und Vielfalt von Theorien der Sozialen Arbeit in Geschichte und Gegenwart ist unsere Auswahl zu begründen und die Kriterien für die Auswahl sind zu benennen. Gerade auch in Lehrbüchern und Überblickswerken spielt die Frage der inhaltlichen Setzungen und der Ausschlüsse von bestimmten Diskursen eine besonders starke Rolle. Textproduktion läuft Gefahr, strukturell bedingten Konfliktlinien aus dem Weg zu gehen und Macht- und Herrschaftsverhältnisse zu reproduzieren (Eichinger/Smykalla 2023). Autor:innen stehen vor der Herausforderung, beim Verfassen ihrer Werke zu vermeiden, ihre Texte an „Ablagerungen“ entlang hegemonialer Diskurslinien auszurichten und dabei antihegemoniale Positionen auszublenden (May 2021).
Als Autoren versuchen wir, dieser Herausforderung vor allem dadurch gerecht zu werden, dass wir uns beim Schreiben immer wieder hinterfragen, wo wir dem inhaltlich schlüssigsten Argument folgen und wo wir uns gegenüber Inhalten kritisch positionieren oder weiter recherchieren sollten. Dabei suchen wir als Autorenteam auch bewusst den Kontakt und die Auseinandersetzung mit der Scientific Community, der Fachpraxis und der weiteren Öffentlichkeit, um unsere Thesen zu prüfen und weiterzuentwickeln. So hoffen wir, dem Anspruch einer wissenschaftlich begründeten und kriteriengeleiteten Reflexion gerecht zu werden, die im Sinne einer kritischen Positionierung auch der Wissensbildung und Emanzipation der beteiligten Akteur:innen dienen soll. In diesem Sinne freuen uns hier auch auf kritische Prüfung unserer Thesen und eine weitere Auseinandersetzung im Fachdiskurs der Sozialen Arbeit.
Gleichzeitig ist das Zusammenstellen von Theorien der Sozialen Arbeit kein neues Unterfangen, sondern blickt auf eine längere Tradition zurück. Wir möchten an zwei Beispielen kurz zeigen, wie man Theorien aufgrund bestimmter Kriterien für eine solche Darstellung auswählen kann: Bereits 1932 hat Alice Salomon ein Buch mit dem Titel „Soziale Führer“ veröffentlicht, das sie so begründet: „Die Berührung mit sozialen Führern, ihrer Persönlichkeit, ihren Werken, ihren Ideen führt zu einem tieferen Verstehen von Menschheitsaufgaben, die zwar über die Jahrhunderte wechselnde Formen annehmen, aber in ihrem letzten Kern ewig und unveränderlich sind. Sie führt zu einem tieferen Verstehen der Pflicht zu gegenseitiger Hilfe und zum Wirken für ein Reich sozialer Gerechtigkeit in dieser irdischen Welt“ (Salomon 1932, 5). Salomon will zwar in erster Linie „Praktiker des sozialen Idealismus, nicht Theoretiker“ darstellen, doch hebt sie für die Praktiker:innen ausdrücklich hervor, dass diese auch über eine Theorie zur sozialen Frage verfügen (vgl. a. a. O.). Diese Theorien stellt Salomon in ihrem Buch auch jeweils dar. Mit ihrer Auswahl sozialer Führer:innen möchte Salomon einerseits die Mannigfaltigkeit der Weltanschauungen der sozialen Führer:innen zeigen und andererseits Männer und Frauen verschiedener Länder und Arbeitsgebiete berücksichtigen.
Die von ihr Ausgewählten sind: Franz von Assisi, Robert Owen, Florence Nightingale, Johann Hinrich Wichern, Wilhelm Emmanuel von Ketteler, Otto von Bismarck, Ferdinand Lassalle, Ernst Abbe, Lew Tolstoi, Henry George und Jane Addams. Franz von Assisi (1181–1226) ist ausgewählt, um zu zeigen, dass soziale Nöte auch im 13. Jahrhundert vorhanden waren und dass das Führertum auf sozialem Gebiet vor allem „aus der Fähigkeit erwächst, sich in selbstständiger Weise mit den gesellschaftlichen Zuständen auseinanderzusetzen“ (vgl. Salomon 1932, 6). Bismarck hat sie genannt, weil er nach ihrer Auffassung in der Sozialversicherung ein großes, unvergängliches soziales Werk hinterlassen hat (vgl. a. a. O.).
Anders ist Michael Winkler (1993) vorgegangen. Er spricht bei seiner Auswahl von Theorien der Sozialpädagogik von „Klassikern“; damit knüpft er an Hans Scheuerls Bände „Klassiker der Pädagogik“ (1979) an (vgl. Dollinger 2006a). Als Kriterien für die Aufnahme in den Kreis der „Klassiker der Sozialpädagogik“ nennt Winkler:
a)Sie spielen nach außen für die soziale Gemeinschaft einer Profession oder einer Disziplin eine Rolle beim Markieren von Claims gegenüber anderen Disziplinen bzw. Professionen;
b)sie haben nach innen die Funktion, eine Identität als Profession oder Disziplin zu stiften;
c)sie begrenzen den für eine Profession oder Disziplin verbindlichen Gegenstandsbereich;
d)sie bringen paradigmatisch gültige Tatbestände zum Ausdruck;
e)sie ermöglichen eine Distanzierung gegenüber den gegenwärtigen sozialen Problemen;
f)sie prägen den Denkstil, indem sie Wege bahnen, auf welche Gedanken hin organisiert und interpretiert werden (vgl. Winkler 1993, 178 ff.).
Autor:innen, die „aufgrund ihrer Werke die Klassik der Sozialpädagogik“ ausmachen, sind für Winkler: Platon, Jean-Jacques Rousseau, Johann Gottlieb Fichte, Johann Heinrich Pestalozzi, Johann Hinrich Wichern, Don Bosco, Adolf Kolping, Karl Mager, Adolf Diesterweg, Paul Natorp, Arthur Buchenau, Otto Willmann, Paul Bergemann, Aloys Fischer, Christian Jasper Klumker, Wilhelm Polligkeit, Hans Scherpner, Gertrud Bäumer, Herman Nohl, Erich Weniger, Karl Wilker, Curt W. Bondy, Anton Makarenko, Carl Mennicke, Georg Kerschensteiner, August Aichhorn, Siegfried Bernfeld, Maria Montessori, Erving Goffman, Michel Foucault, Klaus Mollenhauer, Walter Hornstein, Hans Thiersch und andere (vgl. a. a. O., 182 ff.).
Mit Variationen werden von Rünger (1964), Vahsen (1975), Böttcher (1975), Lukas (1979), Marburger (1981), Schmidt (1981), Wollenweber (1983a,b), Buchkremer (1995), Staub-Bernasconi (1995a; 2007), Thiersch (1996a), Mühlum (1997), Thole/Galuske/Gängler (1998), Erath (2006), Wendt (2016a,b), May 2010, Niemeyer (2010), Hamburger (2011), Schilling/Zeller (2012), Erath/Balkow (2016), Hammerschmidt/Aner 2022, Sandermann/Neumann 2022, Lambers (2023) und anderen in etwa dieselben Personen als bedeutsam für die Theoriebildung in der Sozialen Arbeit benannt. Im deutschsprachigen Raum hat sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts ohne besondere Absprachen ein Kanon von Autor:innen herausgebildet, die für die Entwicklung der Sozialen Arbeit in Theorie und Praxis als wichtig und einflussreich angesehen werden. Dieser Kanon ist für uns der Fundus, aus dem wir die in diesem Buch dargestellten Theorien und Theoretiker:innen ausgewählt haben. Zugleich haben wir aber auch Autor:innen neu aufgenommen, die in den letzten Jahren eigene Theorien der Sozialen Arbeit veröffentlicht haben und in den gegenwärtigen Diskussionen über Theorien der Sozialen Arbeit beachtet werden.
Mit der Frage, wann eine Theorie als wissenschaftliche Theorie gelten kann, ist eine kaum einvernehmlich zu lösende Problematik aufgeworfen. Denn Wissenschaftsund Theoriedefinitionen gibt es in Hülle und Fülle, nicht aber eine verbindliche und allgemein akzeptierte Definition, aus der sich verbindliche Kriterien ableiten lassen. Zudem nennen Autor:innen selten ausdrücklich ihre Kriterien dafür, welche Aussagen sie unter welchen Voraussetzungen als wissenschaftlich ansehen. Das jeweilige Wissenschafts- und Theorieverständnis hängt von persönlich gesetzten, aber oftmals nicht explizit ausformulierten wissenschaftstheoretischen Prämissen ab. Was für den einen eine wissenschaftliche Theorie ist, ist für den anderen nicht mehr als eine Alltagsweisheit. Was hier als wissenschaftlich qualifiziert wird, wird dort als populärwissenschaftlich abqualifiziert.
Wissenschaftlich nennen wir das gezielte, systematische, reflektierte und kritische Bemühen um Erkenntnisgewinnung, das über das alltägliche Bemühen um Wissen hinausgeht (vgl. Mittelstraß 1996, 717–724). Mit diesem weiten Verständnis von Wissenschaft möchten wir – im Kontext dieses Buches – eine Definition vorgeben, die ein gemeinsamer Nenner für unterschiedliche Wissenschaftsverständnisse sein kann und die genügend Raum für weitere Spezifizierungen und Differenzierungen bietet. Zu beachten ist, ob mit Wissenschaft der Prozess der Erkenntnisgewinnung oder der Wissensbestand gemeint ist (vgl. Engelke/Spatscheck/Borrmann 2024).
Soziale Arbeit ist für uns eine Handlungswissenschaft, die natürlich zu den Sozialwissenschaften gehört, mit philosophischen, empirischen, normativen und rationalen Handlungstheorien. Sozialwissenschaftliche Theorien sollen nach unserem Verständnis Ist-Situationen erklären und Soll-Vorstellungen möglich machen sowie ein Verständnis für historische Prozesse und Zusammenhänge schaffen. Theorien der Sozialen Arbeit gelten für uns dann als wissenschaftliche Theorien, wenn sie folgende formale Kriterien erfüllen:
a)Der Gegenstand, auf den sich die Theorie bezieht, ist definiert und repräsentiert nicht nur einen Teilbereich der Wissenschaft.
b)Die gewählten wissenschaftstheoretischen Zugänge und die wissenschaftlichen Erkenntnismethoden (Metatheorien) sind benannt.
c)Zum Gegenstand der Theorie werden überprüfbare Aussagen gemacht.
d)Die Aussagen sind untereinander zu Theorien (Aussagesystemen) verbunden.
e)Es ist ein gewisser Grad der Abgeschlossenheit des Aussagenverbundes (Objekttheorie) erreicht (vgl. Mittelstraß 1996, 259–290).
Die von uns für dieses Buch ausgewählten Theorien beziehen sich im Großen und Ganzen auf den Gegenstandsbereich, wie er in der Definition der IFSW beschrieben ist, in Kurzform auf „soziale Probleme und ihre Lösungen“. Mit dieser Definition wird berücksichtigt, dass sich der Gegenstandsbereich der Sozialen Arbeit unter dem Einfluss wechselnder Lebensbedingungen im Laufe der Geschichte verändert und auch die Kriterien dafür, was jeweils als „sozial problematisch“ angesehen wurde und wird, sich ändern.
Die von uns ausgewählten Theorien sind keine geschlossenen „Welttheorien für soziale Probleme und ihre Lösungen“, sondern Theorien mit unterschiedlichen Reichweiten. Die Theoretiker:innen haben ihre wissenschaftstheoretischen Grundlagen nicht immer dezidiert benannt. So kann man sie doch zumeist, wenn auch bisweilen mit Vorbehalt, den Ausführungen entnehmen. Die Autor:innen stehen auch für Denkrichtungen oder „Schulen“ ihrer Zeit. Es fällt auf, dass in den letzten Jahren vermehrt nicht nur ein:e Autor:in, sondern zwei und mehrere Autor:innen die jeweilige Theorie verfasst haben.
3 Die Darstellung der Theorien in ihrem historisch-biografischen Kontext
Theorien einer Wissenschaft – als Einführung in ein weites und komplexes Feld – können nach verschiedenen Aspekten zusammengestellt werden. Malcolm Payne (2020), Joyce Lishman (2007) und Francis J. Turner (2011) unterscheiden z. B. die Theorien in psychodynamische, verhaltenstheoretische, systemisch-ökologische, sozialpsychologische, kognitive und humanistische Ansätze oder Modelle. Andere Autor:innen wiederum klassifizieren die Theorien nach den ihnen zugrunde liegenden wissenschaftlichen Erkenntnismethoden; so werden transzendentalphilosophische, geisteswissenschaftliche, hermeneutische, kritisch-rationale, dialektisch-kritische und marxistische Ansätze und Theorien unterschieden (vgl. Lukas 1979; Schmidt 1981; Marburger 1981 u. a.). Wir haben keine derartige Klassifizierung vorgenommen, sondern sind historisch vorgegangen und haben die Theorien nach dem Geburtsjahr der Autor:innen zusammengestellt.
Theorien sind in der Regel eine Antwort auf die Herausforderungen ihrer Zeit. Zu ihrem besseren Verständnis stellen wir sie deshalb in ihrem historisch-biografischen Kontext dar und gehen dabei nach der historisch-kritischen Methode vor. In den gängigen Zusammenstellungen von Theorien der Sozialen Arbeit werden zwar die Autor:innen der betreffenden Theorien mit ihren Lebensdaten vorgestellt, für gewöhnlich wird aber nichts weiter über ihren historischen und biografischen Kontext, in dem diese Theorien entstanden sind, mitgeteilt. In der Wissenschaftspsychologie und -soziologie wird zunehmend auf die Zusammenhänge und Abhängigkeiten der Theoriebildung vom persönlichen Lebenskontext der Autor:innen und vom politischen, wirtschaftlichen und kulturellen, also auf den historischen Kontext ihres wissenschaftlichen Arbeitens aufmerksam gemacht, selbst bei naturwissenschaftlichen Theorien (vgl. Meÿenn 1997).
„Da die Wissenschaftsentwicklung … wesentlich von der jeweiligen Struktur der kognitiven Gegebenheiten abhängt, dürfen institutionelle, vor allem auch soziokulturelle Bedingungen im Hinblick auf ihre inhaltliche Ausgestaltung nicht vernachlässigt werden. Wissenschaftliche Methoden, Begriffssysteme und Interpretationsschemata unterliegen historischen Veränderungen“ (Mittelstraß 1996, 736).
Wissenschaftliche Theorien „fallen nicht vom Himmel“, sondern sind Lebensprodukte.“ … the essence of the history of science is biographical and one wants to know the total person to whom a new theory is due if the genesis of his ideas is to be understood. These ideas do not always arise from objective nature but rather from the idiosyncratic viewpoint of unique individuals” L. Pearce Williams zit. nach Meÿenn 1997, 7). Ein beeindruckendes Beispiel hierfür finden wir bei Sigmund Freud.
Im Mittelpunkt seiner Theorie der Psychoanalyse stand beim jungen, gesunden Freud der Sexualtrieb (libido). Seine Erlebnisse im Ersten Weltkrieg haben ihn erschüttert und ihn die Bedeutung der Aggression erkennen lassen. „Erst das Ausmaß an Zerstörung, wie der Weltkrieg sie mit sich brachte, ließ Freud in der Aggression einen eigenen Trieb, einen Destruktionstrieb, annehmen“ (Wyss 1977, 83). Unter dem Eindruck des Krieges und seiner eigenen Krebserkrankung – der starke Pfeifenraucher Freud wurde über 30 Mal im Mund- und Kieferbereich operiert – widmete sich der alternde Freud ab 1920 verstärkt dem Destruktionstrieb, bezeichnete ihn als Gegenspieler des Sexualtriebs und gab ihm den Namen Todestrieb (thanatos).
Dass auch Wissenschaftler:innen Alltagstheorien entwickeln, die aus den persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen ihres alltäglichen Lebens resultieren, ist unseres Erachtens genauso unzweifelhaft wie der Tatbestand, dass wissenschaftliche Theorien mit den Alltagstheorien und den persönlichen Lebenserfahrungen der Autor:innen zusammenhängen. Es wäre zu überprüfen, ob eine sozialwissenschaftliche Theorie letztlich nichts anderes als eine Weiterführung, Vertiefung, Systematisierung und nachprüfbare Begründung des Alltags- und Berufswissens der Autor:innen ist (vgl. Mühlum u. a. 1997).
Aus den genannten Gründen werden wir neben den bei Theoriedarstellungen üblichen Kategorien (Wissenschaftsverständnis, Forschungsgegenstand/-interesse, Inhalt und Bedeutung der Theorie) im Rahmen des hier Möglichen auch den historischen und den biografischen Kontext kurz skizzieren, in dem die Theorien entstanden sind. Eingeleitet wird jede Darstellung mit einem für den Autor/die Autorin unserer Meinung nach charakteristischen Zitat.
Der Leitfaden, nach dem die einzelnen Theorien vorgestellt werden, besteht aus folgenden Kategorien:
(1) Historischer Kontext: Der zeitgeschichtliche Rahmen der Theorie, die soziokulturellen und ökonomischen Bedingungen, die sozialen Probleme, die vorherrschende Wissenschaftsauffassung.2
(2) Biografischer Kontext: Wichtige Lebensdaten, soziokulturelle Einbindung sowie Zugang zu Macht und Einfluss.
(3) Forschungsgegenstand und -interesse: Der Gegenstandsbereich, Ziele und erkenntnisleitendes Interesse.
(4) Wissenschaftsverständnis: Das Wirklichkeits- und Wissenschaftsverständnis, die Erkenntnis- und Forschungsmethoden sowie die Denktradition, in der die Theorie steht.
(5) Theorie: Art und Inhalt der Theorie mit den Grundannahmen, Zielen und Werten.
(6) Bedeutung für die Soziale Arbeit: Rezeption, Verbreitung und Einfluss der Theorie zur Zeit der Erstveröffentlichung und heute.
(7) Literaturempfehlungen: Wichtige Publikationen zur Vertiefung der Theorie.
4 Die Auswahl der Theorien und die Gliederung des Buches
Die ausgewählten Theorien werden in vier Gruppen und in der Reihenfolge der Geburtsjahrgänge der Autor:innen dargestellt.
Der erste Teil „Vom Armutsideal bis zum Bauen von Hütten der Liebe“ besteht hauptsächlich aus frühen vorwissenschaftlichen Programmen, Konzepten und Theorien. Sie stehen stellvertretend für verschiedene Arten des Umgangs mit sozialen Problemen (Armut, Krankheit, Behinderung, Alter usw.) in der europäischen Geschichte der Sozialen Arbeit vom 13. bis zum 19. Jahrhundert. Im Mittelalter wurden soziale Probleme vor allem im Rahmen der Theologie und der Philosophie behandelt. Bald danach wurde die Reflexion sozialer Probleme von der Theologie getrennt und erfolgte in anderen, aus der Philosophie sich herausdifferenzierenden und neu gebildeten Wissenschaftsdisziplinen. Diese Entwicklung repräsentieren im ersten Teil des Buches Thomas von Aquin (1224–1274), Juan Luis Vives (1492–1540), Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827), Adam Smith (1723–1790), Thomas Robert Malthus (1766–1834) und Johann Hinrich Wichern (1808–1881). Die Rückbesinnung auf die historischen Wurzeln und die damit verbundene historische Vergewisserung, dass Soziale Arbeit als Wissenschaft und Praxis eine lange Tradition hat, können Fixierungen auf Tagesfragen verhindern und das Selbstbewusstsein der Profession stärken.
Der zweite Teil „Von der Gemeinschaftserziehung bis zur Behebung der Not“ enthält Theorien der Sozialen Arbeit aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In diesem Teil stellen wir bis auf eine Ausnahme nur Theorien aus dem deutschsprachigen Raum dar. Sie zeigen bereits eine deutliche Weiterentwicklung der Sozialen Arbeit als Wissenschaft. Die Theorien sind primär Berufstheorien oder stehen schon als wissenschaftliche Theorie im Zusammenhang mit der Professionalisierung der Sozialen Arbeit und der Ausbildung für die Soziale Arbeit. Die anderen Autor:innen stehen für primär psychologisch, wirtschaftlich, pädagogisch, feministisch, politisch und anthropologisch orientierte Theorieansätze der Sozialen Arbeit. Als Repräsentant:innen haben wir ausgewählt: Paul Natorp (1854–1924), Jane Addams (1860–1935), Christian Jasper Klumker (1868–1942), Alfred Adler (1870–1937), Alice Salomon (1872–1948), Gertrud Bäumer (1873–1954), Ilse von Arlt (1876–1960) und Herman Nohl (1879–1960).
Der dritte Teil „Von der sozial-rassistischen Auslese bis zum gelingenderen Alltag“ enthält Theorien der Sozialen Arbeit aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese Theorien erfüllen in etwa die Ansprüche, die heute allgemein an eine wissenschaftliche Theorie gestellt werden. Die ausgewählten Theorien repräsentieren wichtige unterschiedliche wissenschaftstheoretische Ansätze der Theoriebildung, beziehen sich auf den Gegenstandsbereich der Sozialen Arbeit insgesamt und beschränken sich nicht auf Teilgebiete Sozialer Arbeit (z. B. auf Heimerziehung oder Bewährungshilfe). In diesem Teil stellen wir vor: Hans Muthesius (1885–1977), Hans Scherpner (1898–1959), Carel Bailey Germain (1916–1995) mit Alex Gitterman (1938–2024), Klaus Mollenhauer (1928–1998), Marianne Hege (*1931), Lutz Rössner (1932–1995), Karam Khella (1934–2022) sowie Hans Thiersch (*1935).
Der vierte Teil „Vom menschengerechten Handeln bis zur Gerechtigkeit und dem guten Leben” enthält relevante Theorien der Sozialen Arbeit zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Die Autor:innen dieser Theorien befassen sich verstärkt mit den gegenwärtigen Veränderungen der Gesellschaft, die durch Digitalisierung, Automatisierung, Kommerzialisierung, Autonomiestreben, Migration und Individualisierung entstehen und neue soziale Probleme generieren. Die Autor:innen verstehen ihre Theorien ausdrücklich als Theorien der Sozialen Arbeit. Ausgewählt haben wir: Silvia Staub-Bernasconi (*1936), Lothar Böhnisch (1944–2024), Margrit Brückner (*1946), Lena Dominelli (*1947), Bernd Dewe (1950–2017) mit Hans-Uwe Otto (1940–2020), Rudolf Leiprecht (*1955) mit Paul Mecheril (* 1962), Ulrich Deinet (*1959) mit Christian Reutlinger (*1971), Silke Birgitta Gahleitner (*1966), Björn Kraus (*1969) und Dieter Röh (*1971).
5 Selbstkritische Anmerkungen
Zweck und Ziel dieses Buches führen dazu, dass es eher einem groben Holzschnitt als einer feinen Federzeichnung gleicht. Komplexes wird vereinfacht, Differenzierungen werden vernachlässigt und Details werden weggelassen, um didaktische Absichten zu erfüllen und dem vorgegebenen Rahmen gerecht zu werden.
Über unsere Auswahl der Theorien lässt sich streiten. Der zur Verfügung stehende Buchumfang hat uns zu einer Auswahl gezwungen. Auf wichtige und interessante deutschsprachige Vertreter:innen haben wir verzichten müssen, so etwa auf Friedrich E. Schleiermacher (1768–1834) und Karl H. Marx (1818–1883). Theorien zu sozialen Problemen und ihren Lösungen z. B. aus England, Finnland, Frankreich, Italien, Norwegen, Polen, Russland, Schweden, Spanien, Ungarn usw. mussten wir weitgehend unberücksichtigt lassen (vgl. Puhl/Maas 1997; Hering/Waaldijk 2002; Erath 2011 u. a.), ganz zu schweigen von Theorien, Modellen, Ansätzen und Konzeptionen außerhalb Europas (vgl. Graham 2002; Turner 2011; Payne 2020; Healy 2022 u. a.). Angesichts der Globalisierung der sozialen Probleme wäre es hilfreich und notwendig, auch andere europäische und außereuropäische Theoretiker:innen mit ihren Theorien zur Sozialen Arbeit in eine solche Darstellung einzubeziehen (vgl. IFSW 2024b). Auch bei der Beschränkung auf deutschsprachige Theoretiker:innen konnten wir wichtige Theoretiker:innen der Sozialen Arbeit nicht berücksichtigen, z. B. Max Weber (1864–1920), Aloys Fischer (1880–1937), Carl Mennicke (1887–1958), Hans Pfaffenberger (1922–2012), C. Wolfgang Müller (1928–2021) oder Hermann Giesecke (1932–2021). Auch wurde aus dem gleichen Grund die Auswahl der Theoretiker:innen von Auflage zu Auflage dieses Buches immer wieder verändert. So kann ein Blick in ältere Ausgaben dieses Buches zusätzliche Theorien erschließen.
Unsere Auswahl spiegelt die Geschlechterproblematik in der Sozialen Arbeit wider: Nur wenige Autorinnen und deutlich mehr Autoren von Theorien der Sozialen Arbeit. Auch in der Sozialen Arbeit gibt es einen Gender Bias: Männer nehmen die führenden Positionen in der Theoriebildung, in der Leitung der Praxis und auch in der Lehre/Ausbildung ein, während Frauen noch immer stärker die alltägliche Arbeit in der Praxis ausführen. Dies spiegelt sich auch in den einschlägigen Lehrbüchern über Theorien wider — einschließlich dem vorliegenden Band (vgl. Eichinger/Smykalla 2023).
Vierzig Jahre hat es gedauert, ehe sich deutsche Vertreter:innen der Sozialen Arbeit angemessen mit der Sozialen Arbeit während der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland von 1933 bis 1945 befasst haben. Das Dritte Reich wurde aus der Geschichte der Sozialen Arbeit schlichtweg mit der These ausgeklammert: Die Entwicklung der Sozialen Arbeit wurde in Deutschland durch die Machtübernahme Hitlers 1933 jäh unterbrochen und setzte nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches 1945 wieder neu ein (vgl. Schmidt 1981, 44 f.; Schilling/Zeller 2012, 46). Den Wendepunkt vom Verschweigen zur offensiven Erforschung und selbstkritischen Auseinandersetzung markiert das Erscheinen des von Hans-Uwe Otto und Heinz Sünker herausgegebenen Sammelbandes „Soziale Arbeit und Faschismus“ im Jahre 1986. Die drei Fragen: „Wie wurde die Theorie der Sozialen Arbeit in die Einheitsideologie des Dritten Reiches eingewoben? Was trat an die Stelle der im engeren Sinne sozialpädagogischen Praxis? Wie verstrickten sich das Wohlfahrts-, Fürsorge- und Fürsorgeerziehungssystem und ihre ProtagonistInnen in den totalitären Staat?“ müssen beantwortet werden (vgl. Buchkremer 1995; Kappeler 2006; Amthor 2017). Soziale Arbeit gehörte in der Gestalt von „Volkspflege“ mit ihren Institutionen und Handlungsfeldern, Organisationsformen und Programmatiken zur nationalsozialistischen Gesellschaft (vgl. Sünker 1996, 511). Viele Millionen Deutsche haben Adolf Hitlers sozialrassistische Ideen – die eine lange europäische Tradition haben (vgl. Kappeler 1994; 1999) – und Programme übernommen. Zu den Vertreter:innen der deutschen Fürsorger:innen, Sozialpädagog:innen und Sozialpolitiker:innen, die in der Zeit von 1932 bis 1945 sozial-rassistische Thesen mehr oder weniger stark vertreten haben, gehören Ernst Krieck (1882–1947), Hans Muthesius (1885–1977), Helene Wessel (1898–1969), Franz-Josef Wuermeling (1900–1986) und andere; und auch Christian Jasper Klumker, Alice Salomon, Herman Nohl, Gertrud Bäumer, Aloys Fischer und Hans Scherpner sind nicht frei davon (vgl. Wollenweber 1983a; Cogoy/Kluge/Meckler 1989; Kappeler 1999; 2000; 2006 u. a.). Wir haben Muthesius für dieses Buch ausgewählt, weil er vor und nach dem Dritten Reich eine hervorragende Rolle im „Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge“ gespielt und lange Zeit – auch international – als eine Leitfigur der deutschen Sozialen Arbeit gegolten hat. Damit steht er stellvertretend für die Kontinuitäten vor, während und nach dem Nationalsozialismus. In diesem Buch berücksichtigen wir primär, wie sich Muthesius in Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit an die nationalsozialistische Rassenideologie angeschlossen hat; andere Aspekte seines Lebenswerkes und seiner Auffassungen müssen hier vernachlässigt werden (vgl. Orthbandt 1985; Schrapper 1993; Kappeler 2000; 2006 u. a.). Adolf Hitler (1889–1945) selbst als Vertreter einer sozial-rassistischen Theorie der Sozialen Arbeit anzuführen, bietet zu leicht die Möglichkeit, sich von sozialrassistischen Theorien und Taten in der Sozialen Arbeit zu distanzieren, sie einem „Unmenschen“ zuzuschreiben und die eigenen Neigungen zu verdrängen.
Fraglich ist es für uns, ob sich alle von uns ausgewählten Autor:innen überhaupt damit einverstanden erklärt hätten, als Autor:in einer Theorie der Sozialen Arbeit bezeichnet zu werden. Diese Frage muss zumeist unbeantwortet bleiben. Wir können nur darauf verweisen, dass es auch in anderen Wissenschaften üblich ist, Autor:innen in die eigene Theoriegeschichte einzubeziehen, die sich zu Lebzeiten nicht ausdrücklich zu dieser Wissenschaft bekannt haben und auch nicht bekennen konnten, weil es diese damals in der heutigen Gestalt noch nicht gegeben hat.
Wir sind uns bewusst, dass unser Unternehmen, 33 Theorien auf wenigen Seiten darzustellen, sehr couragiert ist, und unsere Darstellungen kritisch gesehen werden können. Die umfangreichen Publikationen beispielsweise von Smith, Rousseau, Pestalozzi, Wichern, Mollenhauer und anderen enthalten auch sich ausschließende Aussagen. Insofern können auch andere Darstellungen als unsere mit Quellenangaben belegt werden. Fehlende Kenntnisse und unzulängliche Rezeption unsererseits können bei der Materialfülle trotz unseres Bemühens um Sorgfalt und Genauigkeit zu verzerrten oder fehlerhaften Darstellungen geführt haben. Unsere ausführlichen Quellen- und Literaturangaben sollen auch der Überprüfung unserer Ausführungen dienen.
Nur selten werden von den Autor:innen alle Thesen in einem Werk systematisch zusammengefasst und zu einer in sich geschlossenen Theorie verbunden (vgl. Rössner S. 292 ff.). Häufig haben Autor:innen mehrere Werke geschrieben, in denen sie ihre Theorie(n) entwickeln; in den verschiedenen Werken behandeln sie nur verschiedene (Teil-)Aspekte ihrer Theorie (vgl. Thiersch S. 315 ff.). Manche Theorien kann man nur verstehen, wenn man die Gegenposition kennt, mit der sich die Autor:innen auseinandersetzen und die sie widerlegen möchten (vgl. Klumker S. 144 ff. und Malthus S. 85 ff.). Bisweilen werden zudem von Werk zu Werk Positionen gründlich geändert (vgl. Mollenhauer S. 267 ff.). Mitunter werden frühere Thesen später durch neue Erkenntnisse ausgeweitet (vgl. Staub-Bernasconi S. 336 ff.).
Wir beschreiben die Theorien aus unserer Sicht und hoffen, dass wir dem Selbstverständnis der Autor:innen gerecht geworden sind. Bei der Darstellung der Theorien haben wir uns bemüht, möglichst nahe an der Sprache und den Denkfiguren der jeweiligen Autor:innen zu bleiben. Viele Autor:innen haben jedoch in ihrer Theorie eine eigene Sprachwelt geschaffen, neue Fachbegriffe entwickelt oder bekannten Begriffen einen neuen Inhalt gegeben; wie z. B. bei „Lebenswelt“, „Konstruktivismus“, „Hilfe“ und „Profession“. Bei manchen Theorien wäre ein Glossar zum besseren Verständnis hilfreich.
Manche Titel für die Theorien und auch die Darstellungen der Theorien selbst geben die bei den Theorien real vorhandenen Wendungen, Widersprüche und Brüche nur unzureichend wieder. Wir haben aufgrund der Quellen und unter Zuhilfenahme der Sekundärliteratur versucht, ein durchgehendes Anliegen des/der Autor:in zu ermitteln und dafür eine dementsprechende Überschrift zu finden. Wir sind uns bewusst, dass eine Festlegung auf ein einziges, zentrales Thema den Autor:innen und ihren Anliegen nur bedingt gerecht wird.
Vor allem bei den neueren Theorien stehen wir vor der Herausforderung, dass diese oft in Zusammenarbeit von weit mehr als einer oder zwei Personen erstellt und weiterentwickelt werden. Hier haben wir versucht, prägende Hauptpersonen zu benennen und weitere relevante Beteiligte in ergänzenden Zitaten und Quellenangaben mit zu benennen.
Auf eine ausdrückliche kritische Kommentierung und Würdigung der einzelnen Theorien haben wir verzichtet. Das bedeutet nicht, dass wir die Theorien nicht kritisch sehen und reflektieren. Vorrangig ist es für uns, die Autor:innen mit ihren Theorien möglichst original zu Wort kommen zu lassen. Wenn wir die Bedeutung der einzelnen Theorien für die Soziale Arbeit (vgl. Punkt 6 im oben dargestellten Leitfaden) erörtern, dann gehen damit selbstverständlich unsere eigenen Sichtweisen und die Einschätzungen unseres Umfeldes mit ein. Wir haben zwar versucht, uns möglichst auf nachprüfbare Kriterien (wie z. B. Anzahl, Auflagenhöhe und Verbreitung der Publikationen, Beachtung in der Fachliteratur, Häufigkeit der Nennung in Literaturverzeichnissen usw.) zu stützen. Es liegen jedoch fast keine sozialwissenschaftlichen Anforderungen genügenden Erhebungen zur Rezeption und Wirkungsgeschichte von Theorien der Sozialen Arbeit in der Praxis und der Ausbildung vor (vgl. auch Brielmaier 2019). Unser Bemühen um eine möglichst originalgetreue Darstellung mit entsprechenden Zitaten bedeutet nicht, dass wir die vorgetragenen Thesen teilen. Wir sehen unsere Aufgabe darin, in diesem Studienbuch konzentriert eine Auswahl von Theorien der Sozialen Arbeit, die für die gegenwärtige Soziale Arbeit relevant sind, zu vermitteln. Die kritische Würdigung und Bewertung der einzelnen Theorien überlassen wir den Leser:innen (Anregungen dazu siehe Engelke/Spatscheck/Borrmann 2024).
1Die Bezeichnung „Soziale Arbeit“ verwenden wir als Begriff, der die historischen und aktuellen Traditionen von Armenpflege, Fürsorge, Caritas, Diakonie, Jugendhilfe, Wohlfahrtspflege, Sozialarbeit und Sozialpädagogik umfasst. Aus sprachlichen Gründen benutzen wir gelegentlich Sozialarbeit synonym für Soziale Arbeit; insbesondere dann, wenn ein Adjektiv erforderlich ist, wählen wir sozialarbeiterisch. In der Sozialen Arbeit Tätige bezeichnen wir als Sozialarbeiter:innen, beziehen dabei aber auch Sozialpädagog:innen, Gemeinwesenarbeiter:innen, Fürsorger:innen usw. mit ein.
2Bei der Darstellung des historischen Kontextes haben wir uns vornehmlich auf Zeitungsarchive und die Geschichtsbücher von Grundmann 1988, Kinder/Hilgemann 2005 u. a. gestützt.
Teil 1
Vom Armutsideal bis zum Bauen von Hütten der Liebe
Frühe Theorien der Sozialen Arbeit
Einleitung
Wir Menschen sehen uns selbst im Unterschied zu anderen Lebewesen als vernunftbegabte und unserer selbst bewusste Lebewesen an. Als vernünftige Menschen müssten wir eigentlich aus unserer eigenen Geschichte und der Geschichte anderer Menschen lernen. Doch dies tun wir nicht immer, auch nicht im Bereich der Sozialen Arbeit. Selten wird die Geschichte der Menschheit erforscht, um zu erfahren, wie früher jeweils mit sozialen Problemen umgegangen worden ist. Genauso selten befassen wir uns mit den theoretischen wie auch praktischen Lösungsversuchen unserer Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, um daraus für unsere Zeit zu lernen. Wir scheinen eher auf die Gegenwart fixiert zu sein und vernachlässigen darüber unsere Einbindung in die Geschichte. Oft wird davon ausgegangen, dass unsere heutige Situation und die gegenwärtige Art und Weise, über soziale Probleme nachzudenken, einmalig seien. Unsere Lebenssituation hat es zwar so, wie sie jetzt ist und wahrgenommen wird, noch nie zuvor gegeben, dennoch ist sie nicht völlig neu. Wenn wir nach dem Neuen fragen, dann sollten wir immer auch das Alte sehen. Dann würden wir auch sehen, dass das Alte nie so alt gewesen und das Neue nie so neu gewesen ist, wie es scheint (Hans-Georg Gadamer). Die Gegenwart ist immer das Ergebnis vorangegangener Ereignisse. Die Vergangenheit vergeht nicht, sondern wirkt in die Gegenwart und in die Zukunft weiter. Probleme, die sich in der Gegenwart stellen, folgen oftmals nicht zuletzt aus früher praktizierten Problemlösungen.
Wenn man in der Sozialen Arbeit aus der Vergangenheit für die Gegenwart lernen will, ist zu fragen, bei welcher Zeitepoche man bei einem solchen Rückblick anfangen soll. Hierüber gibt es, je nachdem, wie Soziale Arbeit definiert wird, kontroverse Auffassungen. Ein weiter Konsens besteht unter Theoretiker:innen der Sozialen Arbeit allerdings darin, dass die berufliche Soziale Arbeit mit der vom Frühkapitalismus produzierten Massenarmut ihren Anfang genommen hat (vgl. z. B. Mollenhauer 1959/1987; Staub-Bernasconi 1986; Böhnisch/Schröer 2011). Aufgrund dieser Festlegung gehen viele Autor:innen vom 19. Jahrhundert als Beginn der Sozialen Arbeit als Wissenschaft und Praxis aus. Wir schließen uns allerdings der davon abweichenden Auffassung an, dass bereits mit dem Wandel vom Mittelalter zur Neuzeit (um 1450 bis 1500), näherhin mit der beginnenden Urbanisierung und sich verändernden Produktionsbedingungen, entscheidende Bedingungen für gegenwärtige soziale Probleme und damit auch für die berufliche Soziale Arbeit als Antwort auf diese Probleme in Europa entstanden sind (vgl. z. B. Scherpner 1974; Mollenhauer 1987). Die Auflösung der hochmittelalterlichen Gesellschaftsordnung führte zu frühen Formen des Kapitalismus und der Industrialisierung. Die Wurzeln heutiger Sozialer Arbeit in Theorie und Praxis reichen – aus unserer Sicht – daher bis in das hohe Mittelalter (Mitte des 12. bis Mitte des 13. Jahrhunderts) bzw. in den Beginn des Spätmittelalters im 14. Jahrhundert zurIndück (vgl. Sachße/Tennstedt 1980). Im 12. Jahrhundert wurden außerdem die europäischen Universitäten gegründet, an denen von Anfang an auch soziale Fragen bedacht worden sind (vgl. S. 27 ff.).
Ausgewählt haben wir sieben Autoren aus verschiedenen Ländern (Deutsches Reich, England, Frankreich, Italien, Schottland, Spanien/Niederlande, Schweiz) und aus unterschiedlichen Wissenschaften (Theologie, Philosophie, Pädagogik, Nationalökonomie, Recht, Medizin, Politik). Alle haben sich in ihrer Zeit mit der Lösung sozialer Probleme befasst und/oder waren aktiv daran beteiligt. Ihre Theorien und Programme haben für den europäischen Raum insgesamt wichtige Impulse für die Praxis der Sozialen Arbeit und für die Reflexion dieser Praxis gegeben. Die von uns getroffene Auswahl zeigt zugleich die disziplinären Orte, an denen in Europa Theorien zur Sozialen Arbeit entwickelt worden sind. Der Zeithorizont reicht vom hohen Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert. Wir haben den zeitlichen und territorialen Kontext, in dem die Autoren gelebt haben, jeweils zu Beginn der Darstellung ihrer Theorien in der gebotenen Kürze beschrieben.
Auch wenn sich die hier vorgestellten Autoren nicht persönlich gekannt haben, haben untereinander vielfältige Verbindungen und Bezüge aufeinander bestanden. So hat z. B. Vives (vgl. S. 39 ff.) die philosophischen und theologischen Lehrbücher von Thomas von Aquin (vgl. S. 27 ff.) sehr gut gekannt und sich in seinen eigenen Arbeiten auch auf sie bezogen. Pestalozzi (vgl. S. 73 ff.) hat die Thesen Rousseaus (vgl. S. 50 ff.) zeitweise völlig übernommen und als Ausdruck seiner Verehrung seinen einzigen Sohn nach Rousseau benannt. Wichern (vgl. S. 96 ff.) kannte die Auffassungen von Pestalozzi. Smith (vgl. S. 62 ff.) hat die Arbeiten Rousseaus studiert und dessen Gedanken geschätzt und bei seiner eigenen Theoriebildung berücksichtigt. Malthus (vgl. S. 85 ff.) kannte als Zeitgenosse – mit denselben Studienfächern wie Smith – selbstverständlich die Werke von Smith und hat sich auch auf sie bezogen; beide haben in ihren Arbeiten – sehr verschieden – die Armengesetzgebung in Großbritannien kommentiert und bewertet sowie mit ihren Theorien auch beeinflusst.
Die hier vorgestellten „Theorien Sozialer Arbeit“ sind von ihren Autoren nicht ausdrücklich als „Theorien der Sozialen Arbeit“ verstanden und vorgelegt worden. Man kann und sollte sie aher aus heutiger Sicht als vorwissenschaftliche Theorien oder – wenn man das Wissenschaftsverständnis der jeweiligen Epoche zugrunde legt – als Teiltheorien im Rahmen von Gesamttheorien oder auch nur als sozialpolitische Programme ansehen. Im Übrigen betrachten wir die Texte der sieben Autoren mit ihren Reflexionen und Vorschlägen zur Bewältigung sozialer Probleme als eine umfangreiche Material- und Ideensammlung, die die heutige wissenschaftliche Theorieentwicklung der Sozialen Arbeit und die Bemühungen, soziale Probleme zu bewältigen, unterstützen und bereichern kann.
1 Gott und den Nächsten lieben
Thomas von Aquin (1224 – 1274)
Thomas von Aquin ist, „versucht man ihn in unsere Gegenwart zu versetzen, klassische Apo, ein Aussteiger, ein Achtundsechziger – und er blieb einer, trotz übelster Verleumdungen, Drohungen, Boykotte“ (Heinrich Böll 1984, 41).
1.1 Historischer Kontext
Die Epoche, in der Thomas von Aquin lebt, bezeichnet die Geschichtswissenschaft als das „hohe Mittelalter“, das etwa von der Mitte des 11. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts dauert. Mit dem 11. Jahrhundert beginnt in ganz Europa ein enormer wirtschaftlicher Aufschwung. Günstige klimatische Voraussetzungen erhöhen die landwirtschaftliche Produktion. Sie geht einher mit einem deutlichen Bevölkerungswachstum und der Erschließung neuer bewirtschafteter Flächen durch Rodung von Wäldern. Die Durchsetzung der Dreifelderwirtschaft ermöglicht eine Steigerung des Ertrags der bewirtschafteten Flächen. Gleichermaßen Grundlage und Folge der wirtschaftlichen Blüte in Europa während des Hochmittelalters sind die Ausdehnung des Handels und des Handwerks. Die Ausweitung der handwerklichen Produktion, das Entstehen gewerblicher Märkte und die Ausdehnung des Fernhandels bilden die Grundlage für Stadtneugründungen und für das Aufblühen der Städte (z. B. die „Hanse“ ab Mitte des 13. Jahrhunderts). Damit gehen eine Ausdifferenzierung der Aufgaben und der Befugnisse der Verwaltung, des Handels und des Handwerks und eine zunehmende Autonomie der Stadt und der Stadtbevölkerung (Patrizier, Zunftangehörige, Kaufleute von den feudalen Besitz- und Rechtsverhältnissen der Stadtherren einher. Die Marktrechte werden zu Stadtrechten. Im Sozialgefüge des hohen Mittelalters stellen die Städte das vorwärtsdrängende Element dar. Denn im ländlichen Bereich bleiben die feudalen Grundstrukturen und die ständische Ordnung trotz aller Änderungen erhalten: Das wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche System wird zwar noch wesentlich von der (Adels-)Herrschaft über Grund und Boden bestimmt, doch zu dieser Ausstattung des Adels als herrschender Schicht mit Landbesitz und damit verbundenen politischen, militärischen und gerichtshoheitlichen Vorrechten kommt im Hochmittelalter die zunehmende Feudalisierung von Ämtern. Ministeriale steigen damit aus der Schicht der Abhängigen zu edelfreien Rittern auf. Die Grundherrschaft (neben Adligen auch Bischöfe und Klöster) über Land und Leute sowie die genossenschaftlichen Ordnungen in den Gemeinden konstituieren sehr unterschiedliche dingliche und persönliche lehensrechtliche Bindungen (Treueverhältnis) zwischen den Beteiligten. Mit der Auflösung des alten Fronhofsystems (Villikation) werden die Untertanen zu Grundholden, die ihre Abgaben an den Grundherrn in Form von Zins- und Grundrenten vornehmen.
Kriege und Schlachten zerstören immer wieder ganze Landstriche und verursachen Leid und Not. Missernten, Hungersnöte, Seuchen, Feuer- und Wasserkatastrophen verursachen Armut, Elend und Tod. Die Abhängigen und Untertanen werden trotz Besserung der Lebensverhältnisse ausgebeutet und bleiben politisch ohnmächtig. Den wenigen Herrschern und Reichen stehen viele Beherrschte und Arme gegenüber. Das sind hörige Bauern, besitzlose Tagelöhner, Angehörige „unehrlicher Berufe“ (Spielleute, Huren), Witwen, Waisen, „Krüppel“, Kranke und Alte (vgl. Sachße/Tennstedt 1980, 23–30). Wo Bedürftige sozial und rechtlich in einen grundherrschaftlichen Familienverband oder in eine zünftig verfasste Handwerkerorganisation eingebunden sind, finden sie dort auch organisierte Hilfen. Den anderen bleibt nur die Unterstützung durch private „Liebestätigkeit“. Für kranke und alte Notleidende unterhalten die Kirche und die Orden in den Städten Hospize.
Thomas verbringt sein Leben überwiegend in Italien und Frankreich; im Deutschen Reich hält er sich nur während seiner Studienzeit in Köln länger auf. Zu Beginn des Hochmittelalters befindet sich das deutsche Kaisertum auf dem Höhepunkt der Macht. Das durch Reformen gestärkte Papsttum will nicht nur den politischen Einfluss der weltlichen Herrscher auf kirchliche Angelegenheiten zurückdrängen, sondern strebt selbst nach Weltherrschaft. Der Konflikt schwächt den deutschen Kaiser; ab Mitte des 13. Jahrhunderts verliert das Kaisertum beständig Macht an die Landesfürsten und Städte. Innerkirchlich schließen sich Gläubige im 13. Jahrhundert im Zuge einer Reformbewegung zur Vertiefung der Frömmigkeit zu (Bettel-)Orden zusammen und geloben, arm zu leben. Wegen der weltlichen Herrschaftsansprüche der Kirche wenden sich aber auch viele Gläubige von ihr ab und gründen eigene Glaubensgemeinschaften (z. B. die Katharer, Albigenser), um den evangelischen Idealen – vor allem dem Armutsideal – zu folgen. Die kirchliche Inquisition bekämpft mit Bann, Klosterhaft und Todesstrafe jede Form von „Häresie“ und „Sektierertum“. In dieser Zeit werden mehrere neue Orden gegründet, unter anderen auch die Dominikaner, denen sich der junge Thomas anschließt.
Bereits 100 Jahre früher ist die Unterwerfung der Slawen im Ostteil des Reiches weitgehend abgeschlossen (Ostkolonisation). In Italien erwerben die Städte in Nord- und Mittelitalien im Zuge der Auseinandersetzung des Papstes mit dem deutschen Kaiser zunehmend Autonomie. Von großer wirtschaftlicher Bedeutung für sie sind die Kreuzzüge, die das abendländische Christentum vom Ende des 11. bis Ende des 13. Jahrhunderts zur Befreiung des „Heiligen Landes“ aus den Händen des sich ausbreitenden Islams durchführt. Die Städte werden vielfach von ehrgeizigen Machthabern beherrscht, die den Einfluss der Stadt auf das Umland ausweiten, die wirtschaftliche Entwicklung fördern, die politische Ordnung demokratisieren. Das französische Königtum, das schon seit dem 10. und dann vor allem im 13. Jahrhundert an Macht gewinnt, schaltet die feudalen Partikulargewalten aus und wendet das Lehensrecht konsequent an, erweitert seine Krondomäne, reformiert die Verwaltung und betreibt eine offensive Städtepolitik.
An Kloster- und Kathedralschulen bilden sich Gemeinschaften von Lehrenden und Lernenden. Auf diese Weise werden in der Mitte des 12. Jahrhunderts die ersten Universitäten gegründet (Bologna, Paris). Die große Mehrheit der Bevölkerung bleibt aber von jeglicher Bildung ausgeschlossen und kann weder schreiben noch lesen. Die Philosophie und die Theologie sind im Hochmittelalter die führenden Wissenschaftsdisziplinen. Mit der (Hoch-)Scholastik findet eine spezifische Form des wissenschaftlichen Argumentierens (Begründung der Glaubensinhalte) und der Systematisierung des Wissens ihren Höhepunkt. Diese wissenschaftlichen Bemühungen sind vor allem durch neue naturwissenschaftliche Themen hervorgerufen, die durch die Erforschung der Schriften des „heidnischen“ Philosophen Aristoteles (384–322 v. Chr.) und arabisch-islamischer und jüdischer Autoren (Medizin, Astronomie, Mathematik) aufgeworfen und in Kommentaren und Summen (das sind zusammenfassende und abschließende Systeme der Welterkenntnis) reflektiert werden. Es werden aber auch kritische Stimmen gegen an Autoritäten orientierte Wissenschaftsauffassungen laut; so fordert der englische Franziskaner Roger Bacon (um 1214–1292/1294) als Methode wissenschaftlichen Arbeitens das Zurückgehen auf die unmittelbare Erfahrung, das heißt auf die Beobachtung und Befragung der Natur mittels des Experiments, in dem er die Quelle allen wahren Weltwissens sieht.
1.2 Biografischer Kontext
Thomas von Aquin wird um die Jahreswende 1224/25 als Sohn des Grafen von Aquino, eines Verwandten der hohenstaufischen Kaiserfamilie, in der Nähe Neapels geboren (vgl. Chenu 1995; Forschner 2006; Schönberger 2012 u. a.). Mit fünf Jahren kommt er zur Erziehung zu den Benediktinern ins Kloster Monte Cassino. Als 14-Jähriger beginnt er an der Universität Neapel zunächst die freien Künste, dann Theologie zu studieren (1239–1244). Zum Entsetzen seiner reichen Familie und seiner Freunde entschließt sich der 17-jährige Thomas, in den gerade gegründeten Bettelorden der Dominikaner einzutreten, um Gott und der Wissenschaft in Armut zu dienen. Gegen den massiven Widerstand seiner Familie setzt er seinen Entschluss durch. Kurz nach dem Tod seines Vaters (1244) reist Thomas bereits als Ordensmitglied nach Paris, um dort seine Studien fortzusetzen. Mitglieder der Familie überfallen den Reisenden in der Toskana, entführen ihn, hindern ihn mit Gewalt daran, seinen gewählten Weg zu gehen, und setzen ihn in Haft. Da Thomas sich auch nach einem Jahr Haft nicht dem Willen der Familie beugt, lässt man ihn frei. Thomas nimmt sogleich sein Ordensleben wieder auf und macht sich erneut auf den Weg nach Paris.
An den Universitäten in Paris, dem damaligen Zentrum der europäischen Theologie, und in Köln vertieft Thomas seine Studien (1245–1252). Sein wissenschaftliches Interesse gilt vorrangig dem Werk des griechischen Philosophen Aristoteles, das er erforschen und für die Theologie aufarbeiten will. Die von Arabern und Juden nach Europa gebrachten Werke des „Materialisten“ Aristoteles werden von der Kirche als heidnisch abgelehnt und dürfen nicht gelehrt werden. Von 1252 an ist Thomas als theologischer Lehrer in Frankreich und Italien tätig; 1254 wird er Magister der Theologie. Mit seinem Kölner Lehrer und Ordensbruder Albertus Magnus (1200 –1280) verbindet ihn eine lebenslange Freundschaft. Den Höhepunkt seiner wissenschaftlichen Laufbahn erlebt Thomas bei seinem zweiten Aufenthalt in Paris von 1269 bis 1272. Während dieses Aufenthalts verfasst er auch seine „Summa theologica“ (Theologische Summe). In dieser Zeit wird Thomas in Europa als herausragender Gelehrter und Lehrer gefeiert und zugleich von Klerus und Professoren wegen seiner Lehren heftig bekämpft. Die letzten zwei Jahre seines Lebens verbringt er wieder lehrend in Neapel an der dortigen Ordensuniversität. Thomas wird nur 50 Jahre alt und stirbt am 7. März 1274 in dem Zisterzienserkloster Fossanova (Latium) auf einer Reise, die er wie alle seine Reisen zu Fuß und bettelnd durchführt, zum Konzil von Lyon.
Er hinterlässt zahlreiche philosophische und theologische Schriften. 1322 wird Thomas von der Kirche heiliggesprochen. Seine Auffassungen werden später in ihrer Radikalität „entschärft“ und weitgehend zur amtlichen Lehre (Scholastik) der römisch-katholischen Kirche.
1.3 Forschungsgegenstand und -interesse
Thomas von Aquin befasst sich in seinem umfangreichen schriftstellerischen Werk mit allen Fragen des Wissens und des Glaubens seiner Zeit. Fragend geht er an alles, was er sieht, hört und feststellt, heran und versucht, radikal denkend den Dingen auf den (göttlichen) Grund zu kommen. Auch Themen wie Armut, Almosen, Gesellschaftsordnung, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Nächstenliebe, Arbeitspflicht, Lebensunterhalt und Wohltätigkeit behandelt er vor allem im Rahmen seiner Sozialethik in der „Summa theologica“ sowie in seinen Schriften zur Rechts-, Staats- und Gesellschaftsphilosophie. Die Ausführungen sind stets in sein theologisches Weltverständnis eingebettet. Das ewige Heil des Menschen und sein eigenes ewiges Heil stehen im Mittelpunkt seines persönlichen Forschungsinteresses. Seine „Sozialarbeitstheorie“ ist daher als christliche Sozialethik praktisch orientiert und gibt normativ an, was Menschen tun müssen, damit sie ihr Lebensziel, die ewige Gemeinschaft mit Gott, erreichen.
1.4 Wissenschaftsverständnis
Die Theologie ist für Thomas von Aquin die höchste Form des Wissens. Sie ist Weisheit inmitten der Wissenschaften. Die Wissenschaften führen auf ihrer Ebene nur zu einer Weisheit auf der Stufe rationaler Gewissheit. Die Überlegenheit der theologischen Weisheit kommt für ihn daher, dass sie in der Hierarchie der Stufen des Wissens und der Hierarchie der Ursachen Gott zum Gegenstand hat, die höchste Ursache der Dinge in ihrem Werden wie in ihrer Zielstrebigkeit (vgl. Chenu 1995, 44 f.).
Thomas von Aquin ist fest davon überzeugt, dass das Sein als gesetzmäßig geordnete Realität vom Menschen vorgefunden wird und dass wir diese Realität mit unserem Verstand erkennen können. Die Gegenstandswelt, in der der Mensch lebt und die er wahrnimmt, ist eine Schöpfung Gottes. Mit der menschlichen Vernunft kann die Welt nicht ganz erkannt werden, sondern eben nur die gesetzmäßig geordnete Realität. Über dem Reich der philosophischen Erkenntnis erhebt sich das Reich der übernatürlichen Wahrheit. Dieser Bereich bleibt dem philosophischen Erkennen verborgen und ist nur durch Glauben zugänglich. Der dreieine Gott, die Menschwerdung und die Auferstehung Jesu sind die zentralen Glaubensgeheimnisse und von Gott selbst den Menschen geoffenbart; diese Geheimnisse können nur gläubig hingenommen werden. Vernünftiges Erkennen und gläubiges Aufnehmen widersprechen sich für Thomas nicht, da die Wahrheit nur eine ist und auf Gott zurückgeht. Die Welt ist Schöpfung Gottes und auf Jesus Christus als den höchsten Herrn bezogen.
Thomas versteht die Theologie auch als praktische Wissenschaft, die den Menschen zum Handeln anleitet. Ein Dreifaches ist dem Menschen zum Heile notwendig: „Zu wissen, was er glauben, zu wissen, wonach er verlangen, und zu wissen, was er tun soll“.
1.5 Theorie
In der Schöpfung hat Gott – nach Thomas – seine göttlichen Ideen realisiert. Die Welt ist für ihn daher ein Abbild Gottes und folglich insgesamt gut, weil Gott gut ist und nichts Schlechtes schaffen kann. Daraus ergibt sich für Thomas eine vollständige und heilige Ordnung des Seins. Diese Ordnung ist hierarchisch gestuft aufgebaut.
(1) Heilige Ordnung: Der Gedanke der heiligen Ordnung, in der sich die Welt befindet, beherrscht das gesamte Denken von Thomas. Im Universum ist nichts planlos oder chaotisch. Alles ist hingeordnet auf das höchste Ziel der Schöpfung, nämlich auf Gott. In der Hinordnung auf dieses Höchste gibt es dem Ziel nähere und fernere, höhere und niedrigere Positionen. Dadurch kommen in der Schöpfung Gradstufen und Maße, Gattungen und Arten zustande, die eine natürliche Ordnung schaffen.
Von Gott haben die Naturen, was sie als Naturen sind. Und sie sind darum nur insoweit fehlerhaft, als sie vom Planen des Meisters, der sie erdacht hat, abweichen. Diese Abweichung ist möglich, weil der Mensch über einen freien Willen verfügt (vgl. Thomas von Aquino 1985a, 276 f.). Wenn der Mensch seiner Vernunft folgt, die ihn ja den richtigen Weg erkennen lässt, ist er das edelste Wesen. Folgt er aber seiner Begierde und sündigt, dann wird er das wildeste Tier; denn in der menschlichen Natur steckt ein hohes Kraftpotenzial. Dieses muss in die rechten Bahnen geleitet werden. Das geschieht nach Thomas durch Gesetze und Strafandrohung; denn der Mensch neigt für ihn leicht zu Willkür und Begierde.
Der Mensch ist, wie Aristoteles schon formuliert hat, ein soziales Wesen und hat eine naturhafte Anlage zur Gemeinschaft (vgl. Thomas von Aquino 1985c, XCIX–CII). Vereinzelt wäre der Mensch dem Leben gar nicht gewachsen, da er nicht über die das Leben sichernden Instinkte verfügt wie ein Tier. Er muss sich mit seiner Vernunft helfen; das geschieht am besten in der Gemeinschaft aller Menschen, in der alle zur größtmöglichen Vollendung des Ganzen beitragen.
Das „Gemeinwohl“ geht deshalb für Thomas in jeder Weise dem Wohl des Individuums voraus und hat als Regel die göttliche Gerechtigkeit (vgl. a. a. O., CII–CVI). Der Einzelne hat sich der vorgegebenen Gemeinschaftsordnung in jedem Fall unterzuordnen. Dem gemeinsamen Ziel entspricht die gemeinsame (für alle gültige) Ordnung. Thomas akzeptiert die hierarchische Gesellschaftsordnung (Ständeordnung, Monarchie) seiner Zeit vollkommen als Ausdruck göttlicher Ordnung. Persönlich neigt er dazu, diese statische menschliche Gesellschaft vor allem im Bild der mittelalterlichen Stadt als einer rational durchformten Ordnung verwirklicht zu sehen.
Aufgabe des Staates ist es nach Thomas, seine Bürger:innen zu einem glücklichen und tugendhaften Leben zu führen. Der Staat hat nicht nur natürliche, sondern auch übernatürliche Aufgaben. So soll das religiöse Leben vom Staat gefördert werden, damit die Menschen ihr höchstes Ziel, nämlich die Glückseligkeit bei Gott, erreichen.
Aus diesen und weiteren anthropologischen und theologischen Grundannahmen leitet Thomas Theoreme für die „Soziale Arbeit“ ab: Die mittelalterliche Ständeordnung spiegelt für ihn die göttliche Ordnung wider. Sie ist zugleich eine Werteordnung und eine soziale Ordnung, ein Über- und Untereinander der Menschen in den Ständen, in die sie hineingeboren worden sind (vgl. Scherpner 1974, 23–42). Die obersten Stände sind in einer auf Gott bezogenen Ordnung für Thomas selbstverständlich die geistlichen Stände. Ihnen folgen die Stände der weltlichen Herrschaft. Sodann kommen die „bürgerlichen“ Stände. Und weit darunter die Armen. Die Armen sind für Thomas Menschen, die – weil sie nichts besitzen – mit den eigenen Händen für ihren Lebensunterhalt sorgen müssen. Unter der Schicht der Armen befindet sich noch die Schicht der Bedürftigen; das sind die Menschen, die nichts besitzen (Witwen, Waisen, „Krüppel“, Kranke, Alte usw.), dazu auch noch arbeitsunfähig sind und deshalb von Almosen (milden Gaben) leben müssen. Ganz außerhalb der Ordnung stehen die Ehrlosen; das sind Menschen, die gegen wichtige Gesetze der Gemeinschaft verstoßen haben (z. B. öffentliche Sünder:innen wie Dieb:innen, Ehebrecher:innen, Mörder:innen usw.); sie sind geächtet und heimatlos. Diese ökonomische, soziale und politische Ungleichheit der Menschen ist nach Thomas natürlich und ursprünglich von Gott so gewollt.
(2) Gottes- und Nächstenliebe: Zwei göttliche Gebote, die nach Thomas als Einheit zu betrachten sind, sind in seinem Denken für jeden Menschen von allerhöchster Bedeutung; weil sie sich auf Gott als den Endzweck des Lebens beziehen, hat sich ihnen auch der menschliche Verstand zu unterwerfen:
a)Das Gebot der Gottesliebe: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und aus deiner ganzen Stärke.
b)Das Gebot der Nächstenliebe: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
Beim Christen ist die Liebe zu Gott das Licht jeglichen Erkennens und – hinter allen Gründen, wie sie die inneren und äußeren Umstände dem Menschen vorlegen – die Regel für das gesamte Handeln. Nach Thomas schulden wir jedem Nächsten die Liebe, weil dieser uns Nächster ist sowohl nach dem natürlichen Ebenbild Gottes als auch nach der Fassenskraft für die Herrlichkeit (vgl. Thomas von Aquino 1985c, 200 ff.).
(3) Armut: Die Hinordnung des Menschen im Diesseits auf das Jenseits und die grundsätzliche Erwartung, dass das eigentliche Leben erst nach dem Tod beginnt, prägen die Auffassung von Thomas über die Arbeit und die Verpflichtung zur Arbeit. Vorrang im Leben der Gläubigen haben die Verehrung Gottes und das Bemühen um das Heil der Seele. Alles andere ist nachrangig, auch die Arbeit. Arbeit ist nicht in sich selbst wertvoll, sondern dient nur dem Erwerb des Lebensunterhalts. Die Verpflichtung zur Arbeit beruht eben auf der natürlichen Notwendigkeit, sich seinen Lebensunterhalt zu beschaffen. Da es ein natürliches Gesetz ist, dass der Mensch für seinen Lebensunterhalt sorgen muss, ist es für Thomas zugleich auch ein göttliches Gebot. Diese Verpflichtung gilt für alle, die nicht von eigenem Besitz oder der Unterstützung durch andere leben können. Die Arbeitspflicht gilt besonders für die Menschen, die überhaupt nichts besitzen, also für die Armen.
Die Arbeitsverpflichtung und die Wertschätzung der Arbeit als notwendiges Mittel, um sich zu ernähren, führen Thomas dazu, das Betteln aus Begierde nach einem müßigen Leben oder nach mühelosem Erwerb von Besitz zu verbieten. Berechtigt zum Betteln ist derjenige, der wirklich bedürftig ist und nicht mehr arbeiten kann oder dessen Arbeitseinkommen zum Lebensunterhalt nicht ausreicht. Thomas erlaubt das Betteln noch aus zwei weiteren Motiven: Betteln ist eine Möglichkeit für Christ:innen, sich in Demut zu üben, da Bettler:innen in der Öffentlichkeit missachtet werden. Betteln wird daher, wenn es aus religiösen Motiven heraus geschieht, erlaubt, z. B. für die Büßer auf den Kreuzzügen und selbstverständlich auch für die Mitglieder der Bettelorden. Betteln ist außerdem erlaubt, wenn es wegen nützlicher Zwecke geschieht. Gemeint ist damit z. B. das Betteln Einzelner oder von Gruppen für Einrichtungen des Gemeinwohls, wie bei Sammlungen für gemeinnützige Brücken oder Kirchbauten.
Für Thomas von Aquin erhalten Armut und Besitzlosigkeit vom Evangelium her eine besondere Bedeutung. Danach ist Armut sogar die Voraussetzung dafür, um überhaupt ins Himmelreich gelangen zu können:
„Selig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich“ (Matthäus 5,3) und „Ein Reicher wird schwer in das Himmelreich hineingelangen.
… Leichter kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr hindurch als ein Reicher in das Reich Gottes hinein“ (Matthäus 19,23 f.).
Die freiwillig um des Himmelreiches willen gewählte Armut ist eines der höchsten Ideale in der Lehre des Thomas von Aquin.
(4) Unterstützung der Armen: Diese Bewertung der Armut und der Armen macht es verständlich, dass Thomas sich nicht ausdrücklich und direkt mit der Lebenssituation der Armen befasst. Die Abschaffung der Armut und der Armen ist für ihn kein Thema und kann es aufgrund seiner Grundannahmen auch nicht sein. Gewissermaßen über einen Umweg werden sie jedoch Gegenstand auch seines Denkens: über seine These von der religiös-ethischen Verpflichtung, barmherzig zu sein, Gutes zu tun und Almosen zu geben (vgl. Thomas von Aquino 1985c, 150–166). Im Mittelpunkt dieser These stehen die Geber:innen, also die Habenden, und nicht die Empfänger:innen der Gaben, die Bedürftigen. Die Bedürftigen erfüllen lediglich eine wichtige Funktion beim Bemühen der Reichen, sich mit Gott zu verbinden, ihm zu dienen und so für ihr eigenes Seelenheil zu sorgen. Über die Empfänger:innen/Bedürftigen sagt Thomas nur aus, dass sie als Berechtigung zum Betteln auch wirklich in Not sein müssen und sich nicht selbst ernähren können. Er fordert in seinem Sinne radikal-konsequent, dass auch den öffentlichen Sünder:innen und Staatsfeind:innen geholfen werden muss, wenn sie in äußerster Not sind, damit auch sie nicht verhungern oder verdursten.
Thomas befasst sich auch mit der Frage: „Ist es einem erlaubt, wegen eines Notstands zu stehlen?“ Für Thomas werden die Dinge, die jemand im Überfluss hat, aus dem natürlichen Recht dem Unterhalt der Armen geschuldet: