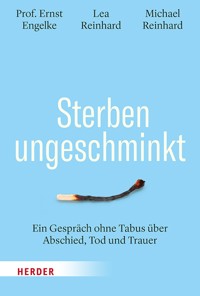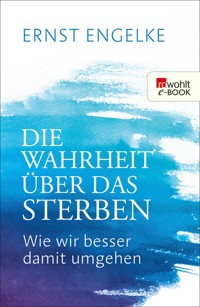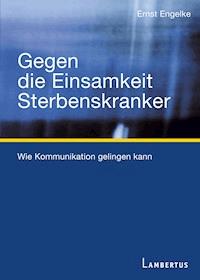
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lambertus
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wie kann Kommunikation am Ende des Lebens für alle am Sterbeprozess Beteiligten gelingen? Sterbenskranke erleben Krankheit, Leiden, Sterben und Tod anders als gesunde Menschen. Wahrhaft unterstützend können Menschen am Sterbebett für Sterbenskranke sein, wenn sie bereit und fähig sind, sich dem Unfassbaren auszusetzen und sich berühren zu lassen. Auf Grundlage seiner langjährigen Erfahrung in der Begegnung mit Kranken, Sterbenden und ihren Angehörigen, Ärzten und Pflegenden beschreibt der Autor alltagstaugliche Wege zur gegenseitigen Unterstützung und Verständigung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ernst Engelke
Gegen die EinsamkeitSterbenskranker
Wie Kommunikation gelingen kann
Für Alice,Hanna und Eva
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten
© 2012, Lambertus-Verlag, Freiburg im Breisgau
www.lambertus.de
Umschlaggestaltung: Nathalie Kupfermann, Bollschweil
Herstellung: Franz X. Stückle, Druck und Verlag, Ettenheim
ISBN: 978-3-7841-2111-6
eISBN: 978-3-7841-2747-7
Inhalt
Was mich bewegt, dieses Buch zu schreiben
Teil 1
Unterricht an Sterbebetten
1
Unser Verhältnis zu Sterben und Tod ist zwiespältig
2
Das Verhältnis unserer Vorfahren zu Sterben und Tod war auch zwiespältig
3
Die Lebenswirklichkeit Sterbenskranker korrigiert Klischees und Ideologien
4
Die Kraft der Kommunikation
5
Grundlagen und Grenzen dieses Buches
Teil 2
Erleben und Verhalten Sterbenskranker
1
„Ich hab’s befürchtet.“ – Sterbenskranke (er)kennen „die Wahrheit“
2
„Ich bin nicht bereit!“ – Die Rolle des Sterbenskranken wird abgelehnt
3
„Wie lange habe ich noch?“ – Zeitempfinden und Zeitpläne ändern sich
4
„So schnell gebe ich nicht auf!“ – Der Kampf gegen die Abwärtsspirale
5
„Endlich habe ich wieder Stuhlgang.“ – Elementare körperliche Bedürfnisse dominieren
6
„Auf und ab wechseln ständig.“ – Die Balance von Angst und Hoffnung ist labil
7
„Ich bin schrecklich allein.“ – Sterbenskranke beklagen ihre Einsamkeit
8
„Ich muss an mich denken.“ – Sterbenskranke verhalten sich ichbezogen
9
„Ich will meinen Vater nicht sehen.“ – Eigenarten und alte Probleme verstärken sich
10
„Ich finde mich nicht mehr zurecht.“ – In neuer Umgebung gibt es neue Probleme
11
„Nun hat meine letzte Reise begonnen.“ – Die Sprache Sterbenskranker ist kreativ und tiefgründig
12
„Das soll alles gewesen sein?“ – Das eigene Leben wird rückblickend bewertet
13
„Wenn ich nicht geraucht hätte, dann …“ – Subjektive Theorien sollen das Unbegreifliche erklären
14
„Ich komme aus dem Heulen nicht mehr raus.“ – Sterbenskranke sind immer auch Trauernde
15
„Ich würde noch sehr gern bei Euch bleiben.“ – Letzte Abschiede sind schwer
16
„Lasst mich sterben.“ – Ruhe und Frieden werden ersehnt
Teil 3
Erleben und Verhalten der Angehörigen und Freunde
1
„Ich weiß, was los ist – und du auch.“ – Die Konfrontation mit „der Wahrheit“
2
„Wir kämpfen gemeinsam.“ – Angehörige sind Co-Patienten
3
„Ich muss doch für ihn sorgen.“ – Übernahme von Verantwortung
4
„Für mich bleibt keine Zeit mehr.“ – Entbehrungen und Belastungen
5
„Sie will nichts von mir wissen.“ – Komplikationen und Konflikte
6
„Manchmal wünsche ich mir, dass er bald stirbt.“ – Ambivalenz der Gefühle
7
„Endlich ist sie erlöst.“ – Sterben und Tod können Trauer, aber auch Erleichterung und Freude auslösen
8
„Wir behalten Dich in unseren Herzen.“ – Die Lebenden bleiben mit den Toten verbunden
Teil 4
Erleben und Verhalten professioneller Helfer
1
„Helfen Sie mir!“ – Der Wunsch nach Heilung verbindet Kranke und „Profis“
2
„Wir sind immer für Sie da!“ – Selbstverständnis und Erwartungen der „Profis“
3
„Wir sind erwünscht und zugleich unerwünscht!“ – Das Verhältnis ist ambivalent
4
„Haben Sie Medizin studiert oder ich?“ – Problem- und Konfliktfelder gibt es reichlich
5
„Wie viel darf ein Sterbenskranker kosten?“ – Unmenschliche Lebens- und Arbeitsbedingungen
6
„Wir hatten heute vier Tote in fünf Stunden!“ – Die Überforderung ist strukturell bedingt
7
„Ich kann doch nicht mit jedem sterben.“ – „Profis“ sind auch (nur) Menschen
8
„Wie geht es Dir eigentlich?“ – Im multiprofessionellen Team zusammenarbeiten
Teil 5
Bausteine und Wege für eineangemessene Kommunikation
Begegnungen mit Sterbenskrankenals interaktives Geschehen
1Bausteine dialogischer Kommunikation
1.1Drei relevante Grundformen der Kommunikation
1.2Vielfältige Ausdrucks- und Mitteilungsmedien
1.3Jede Begegnung ist auch eine Konfrontation
1.4Emotionen sind immer beteiligt
1.5Nähe und Distanz gestalten
1.6Kommunikation ohne Worte
1.7Über das Zuhören
1.8Über Sprechen und Sprache
1.9Über das Fragen
1.10Über die Vielfalt, auf Fragen zu antworten
1.11Kommunikation in und mit Gruppen
1.12Kommunikation über die Kommunikation
2Modelle und Methoden
2.1Ein Modell für gezielte Gesprächsführung
2.2Die Metapher Schnellkochtopf
2.3Gespräche organisieren und strukturieren
2.4Verhandeln
2.5Konflikte erkennen und anerkennen
2.6Zwischen streitenden Parteien vermitteln
2.7Krisenintervention
2.8Familiengespräche am Krankenbett
2.9Rituale können Halt und Orientierung geben
3Religiös begründete Kommunikation
3.1Die Gemeinschaft der Hoffenden
3.2Beten – der Dialog mit „dem da oben“
3.3Stärkung durch religiöse Rituale und Riten
4Umgang mit speziellen Herausforderungen
4.1Schlechte Nachrichten mitteilen
4.2Angst und Hoffnung sind fest miteinander verbunden
4.3Klage und Zorn bejahen und ertragen
4.4Schweigen kann heilsam, aber auch belastend sein
4.5Üble Gerüche sind kaum auszuhalten
4.6Gedanken und Wünsche, Suizid zu begehen
4.7Verlieren und Trauern
4.8Die Würde der Sterbenskranken und der Pflegenden
5Merksätze und Empfehlungen
5.1Das Hier und Jetzt nutzen
5.2Akzeptieren, dass Sterbenskranke ihr Sterben nicht akzeptieren
5.3Wer ist mit „Wir“ gemeint?
5.4Was ich gesagt habe, weiß ich erst, wenn ich die Antwort kenne
5.5Auf das kleine Wort „aber“ achten
5.6Tabus sollten nur bedingt respektiert werden
5.7Hilfreiche Gespräche müssen nicht lange dauern
5.8Sidestep – der kleine Schritt aus dem Angriff
5.9Nicht jeder lässt sich gern anfassen
5.10Dolmetscher sind bisweilen notwendig
5.11Humor hat etwas Befreiendes
5.12Mit eigenen Geschichten geizen
Fragen nach der Begegnung mit Sterbenskranken
Teil 6
Trösten heißt treu sein
Anmerkungen
Literatur
Der Autor
„Jeder der gehtbelehrt uns ein wenigüber uns selber.Kostbarster Unterrichtan den Sterbebetten.“
Hilde Domin
Was mich bewegt, dieses Buch zu schreiben
„Jetzt habe ich ihn umgebracht!“ Diesen Schreck werde ich niemals vergessen. Es war mein erster Tag in der Klinik. Ich hatte eine Stelle als Hilfskrankenpfleger in einer psychiatrischen Klinik angenommen, um mein Studium zu finanzieren. Nie zuvor hatte ich Kranke gepflegt oder einen toten Menschen gesehen. In der Mittagspause sollte ich auf die Patienten im Wachsaal aufpassen. Die Pfleger zogen sich zum Kartenspiel in das Dienstzimmer zurück. Die Sonne schien auf die Betten der schlafenden Patienten. Alles war ruhig.
Neben dem Wachsaal war die „Gummizelle“. Ein Raum mit glatten Wänden, gestrichen mit grauer Ölfarbe. Ein einfaches Bett stand in dem Raum, sonst nichts. Nur von außen konnte der Raum verschlossen werden. Durch ein Guckloch in der Tür konnte man hineinschauen. In die „Gummizelle“ wurden „tobende Patienten“ eingesperrt. An diesem Tag aber lag dort im Bett still und teilnahmslos ein älterer Patient. Sein Gesicht war ausgemergelt und grau. Mehr wusste ich nicht über ihn.
Unerwartet kam auf einmal ein strenger Geruch aus der „Gummizelle“. Ich ging zu dem Patienten ans Bett und sprach ihn an. Er reagierte nicht. Vorsichtig hob ich seine Bettdecke, und jetzt kam mir der Geruch geballt entgegen: Der Mann lag in seinem Kot. „Den musst du jetzt sauber machen, das ist dein Job“, sagte ich mir. Meine Kollegen sollte ich nicht beim Kartenspiel stören. Also fing ich an, ihn allein zu waschen und neu zu betten. Ungeübt, wie ich nun einmal war, drehte ich den Mann hin und her, hob ihn an und schob ein frisches Stecklaken unter ihn. Der Mann ließ alles regungslos mit sich machen. Durchgeschwitzt und zufrieden setzte ich mich wieder auf meinen Stuhl.
Plötzlich röchelte der Mann und schnappte ganz eigenartig nach Luft. Heute weiß ich: es waren seine letzten Atemzüge. Ich ging sofort zu ihm hin und erschrak: Sein Unterkiefer war nach unten gesackt. Sein Mund stand offen und seine Augen starrten ins Leere. „Der ist tot. Und du hast ihn mit deinem Gezerre umgebracht“, schoss es mir durch den Kopf. Aufgeregt lief ich zu den Pflegern: „Ich glaube, ich habe eben Herrn M. umgebracht.“ Die Pfleger waren Sanitäter im Krieg gewesen und entsprechend abgebrüht. Sie schauten nur kurz von ihren Karten auf und meinten ungerührt: „Hat er es endlich geschafft? Geh wieder zurück. Wir spielen das Spiel noch zu Ende. Dann kommen wir.“ Und so geschah es. Nach ihrem Kartenspiel kamen sie und ich musste zusammen mit ihnen den Verstorbenen waschen, in den Leichenkeller bringen und in einen Sarg legen.
Diese Erfahrung hat mich tief berührt und nachhaltig geprägt. Seitdem möchte ich wissen: Was geht in sterbenskranken Menschen vor? Was wünschen sie sich? Wie kann man sich mit ihnen verständigen? Wie kann man sie unterstützen und begleiten? Was muss man lernen und wissen, um sie angemessen zu betreuen und zu pflegen? Wie können Angehörige, Ärzte und Pflegende bei dieser Aufgabe begleitet und unterstützt werden?
Kranken, sterbenden und trauernden Menschen bin ich in meinem Leben in verschiedenen Rollen begegnet, als Angehöriger, Freund, Kollege, Nachbar, Krankenseelsorger, Psychologe und Psychotherapeut. Viele Begegnungen sind mir noch gegenwärtig und wirken in mir nach. Die sterbenskranken Menschen ermutigen mich, mich ihrer Lebenswirklichkeit und der Lebenswirklichkeit ihrer Begleiter zu stellen, nicht zu beschönigen, wo nichts zu beschönigen ist. In diesem Buch möchte ich weitergeben, was ich aus diesen Begegnungen gelernt habe: Wie Kommunikation mit Sterbenskranken gelingen kann.
Teil 1
Unterricht an Sterbebetten
Die öffentliche Diskussion über Sterben und Tod wird derzeit überwiegend von Auffassungen und Klischees bestimmt wie:
•Sterben und Tod sind heute tabu.
•Früher wurden Sterben und Tod akzeptiert und die Menschen sind im Kreis ihrer Familie gestorben.
•Sterbenskranke kennen „die Wahrheit“ nicht und müssen erst darüber aufgeklärt werden.
•Sterbenskranke müssen ihr Sterben und ihren Tod akzeptieren.
Diese eingefahrenen Vorstellungen und Erwartungen lösen bei sterbenskranken Menschen sehr heftige Reaktionen aus:
„Man kann versuchen, die Verblödung, mit der Krankheit, Leiden, Sterben und Tod in unserer Gesellschaft diskutiert wird, wenigstens im Kleinen ein wenig aufzuhalten. Denn gequatscht wird ja ununterbrochen, das ist ja gar nicht zu fassen, wie viel Blödsinn geredet und geschrieben wird übers Dahinvegetieren, über die Würde, die angeblich verloren geht, wenn man nicht mehr alleine scheißen kann oder was weiß ich.“1
Was ist von den weit verbreiteten Auffassungen und Klischees über Sterben und Tod zu halten? Sind sie „blöd“, wie der sterbenskranke Christoph Schlingensief gesagt hat? Entsprechen sie der Wirklichkeit? Die ersten zwei Annahmen zur Haltung gegenüber Sterben und Tod erörtere ich in diesem Teil des Buches, mit den anderen befasse ich mich im weiteren Verlauf des Buches, vor allem in Teil 2. Es wird sich zeigen: Die eingefahrenen Haltungen sind angesichts der Wirklichkeit zu überdenken.
1Unser Verhältnis zu Sterben und Todist zwiespältig
Der Tod als die größte Bedrohung des Lebens sei tabuisiert, ganz und gar aus dem Leben ausgeblendet, hinter die Kulissen des gesellschaftlichen Lebens verlagert oder jedenfalls aus dem öffentlichen Leben ausgesondert. Mit diesen Thesen beginnen fast alle Publikationen, die sich mit Sterben und Tod befassen.
Sterben und Tod werden in unserer heutigen Gesellschaft aber nicht totgeschwiegen. Sie sind als Ereignisse und als Schatten für jeden allgegenwärtig. Immer wieder erkranken Menschen tödlich und sterben. Der Tod ist für jeden nahe. Wie nahe er ist und wie mit seiner Nähe umgegangen wird, ist unterschiedlich. Die Wörter „Sterben“ und „Tod“ werden im Alltag selbstverständlich und ständig benutzt. Sie können auch durch keine anderen Wörter ersetzt werden.
Sterben und Tod lassen sich nicht verdrängen, auch wenn es versucht wird. Vielmehr faszinieren und erschrecken sie uns. Sie fesseln uns auf seltsame, geheimnisvolle Weise und ängstigen uns bis ins Innerste. Unser Verhältnis zu Sterben und Tod ist zwiespältig. Im Alltag zeigt sich diese Spaltung so: Die Lust, sich durch Sterben und Tod medial zu zerstreuen, steht der Angst, durch Sterben und Tod persönlich berührt zu werden, gegenüber.
Falls Sie heute Abend das Fernsehgerät einschalten, können Sie sich – da bin ich mir ziemlich sicher – auf fast allen Kanälen durch das Sterben und den Tod eines oder mehrerer Menschen unterhalten lassen. Die hohen Einschaltquoten zeigen die Beliebtheit dieser Sendungen. Täglich werden Fernsehfilme aus dem Action-Thriller-Krimi-Genre zu den besten Sendezeiten angeboten. Übliche Titel sind: „Ich sterbe, du lebst.“ – „Rendezvous mit dem Tod.“ – „Der Tod fährt mit.“ – „Stirb, damit ich glücklich bin.“
Auch außerhalb dieser Sendungen sind Sterben und Tod in den Medien allgegenwärtig: Die Nachrichten- und Sondersendungen sind ebenfalls angefüllt mit Sterbenden und Toten. In Großaufnahmen wird gezeigt, wie Menschen erschossen, Sterbende aus Trümmern gezogen und Leichen nach einem Attentat weggeschafft werden. Wir können in unserem Wohnzimmer dem Sterben in der ganzen Welt zuschauen: Aids-kranke Kinder sterben in Südafrika, ein Machthaber wird im Irak erhängt, in Thailand und Japan tötet ein Tsunami Bewohner und Touristen, einstürzende Häuser erschlagen Menschen auf Haiti, im Indus ertrinken Familien und Dörfer, Feuerwehrleute verbrennen in Russland. Für manche Zeitgenossen reicht der Kitzel aus den Medien nicht aus. Sie wollen mehr, näher am Geschehen sein, die Realityshow. Sie fahren unverzüglich zur Unglücksstelle, um aus sicherer Entfernung die Katastrophe und den Kampf der Rettungskräfte um das Leben der Bedrohten mitzuerleben. Die Rettungsdienste beklagen zunehmend, dass die Gaffer sie bei ihrer Arbeit behindern. Appelle, von diesem Tourismus abzusehen, scheinen nur das Gegenteil zu bewirken.
Andererseits sorgen wir uns intensiv um unsere Gesundheit und wehren uns gegen unser Sterben-müssen.
Jeder von uns weiß nur zu gut, dass er jederzeit krank werden kann und dass alte Menschen dem Verfall und ihrem Ende ausgeliefert sind: Die Augen trüben sich, die Ohren werden taub, die Zähne fallen aus, die Hände zittern, die Beine tragen nicht mehr, die Schließmuskeln von Darm und Blase versagen ihre Dienste, das Gedächtnis schwindet. Über das „Kind im Manne“ schmunzeln wir, beim „Greis im Manne“ vergeht uns das Lachen.
Unser Engagement für unsere Gesundheit ist letztlich nichts anderes als unser Kampf gegen Sterben und Tod.
Von der Angst, alt und krank zu werden, profitieren viele: Die Gesundheitsindustrie lebt davon, und das nicht schlecht. In Deutschland gehen die Menschen so häufig zum Arzt wie in keinem anderen Land. Hohe Erwartungen gibt es an die moderne Medizin und die Ärzte. Der Umsatz der Pharma-Firmen beträgt jährlich mehrere Milliarden Euro. Die Medizin-Technologie wird zum Heilsversprechen. Zusätzlich werden alternative Medizin, Schamanentum, Heiler bemüht. Die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verantworteten Kampagnen gegen die so genannte „Vogelgrippe“ und gegen die „Schweinegrippe“ bezeugen: Die Angst vor dem Ausbruch tödlicher Pandemien und der Kampf gegen das Sterben herrschen weltweit.
Es liegt auf der Hand, dass wir uns, wenn wir schon sterben müssen, einen sanften Tod wünschen und uns der Gedanke an ein qualvolles Sterben Alpträume bereitet. Erörtert werden die Vor- und Nachteile eines plötzlichen Todes: Auf der Straße, im Bett vom Schlag getroffen – ein schöner Tod. Friedlich einschlafen. Ohne viele Worte und Aufhebens einschlummern.
Der Traum vom sanften Tod nährt die Euthanasiedebatte. Das Sterben soll den Vorstellungen von Ästhetik und Autonomie entsprechen: unversehrt, schmerzlos, rasch und selbstbestimmt. Deshalb wird diskutiert, „Euthanasie-Häuschen“ einzurichten, Orte, an die sich jemand zurückziehen kann, um sein Leben aktiv zu beenden.
Eine Sache ist es, sich durch Sterben und Tod im Fernsehen unterhalten zu lassen. Eine völlig andere Sache ist es dagegen, mit Sterbenskranken selbst zusammen zu sein, ihnen persönlich zu begegnen und sich von ihnen berühren zu lassen. Die Mehrzahl der Menschen vermeidet diese Begegnungen und Berührungen. Zwei Beispiele für diese Haltung: In den letzten Jahren haben mehrere angesehene Autoren ihre Tagebücher aus der Zeit ihrer Krebserkrankung veröffentlicht.2 Die sterbenskranken Autoren kommen anscheinend schon mit ihren Büchern vielen Menschen zu nahe. Der Titel einer Besprechung der Tagebücher bringt die Abwehr auf den Punkt: „Euer Krebs kotzt mich an!“ Das zweite Beispiel: Ein deutscher Bundesgesundheitsminister machte 2011 im Rahmen der Debatte um die Pflegeeinrichtungen die Aussage, dass er selbst nicht ins Altenheim möchte. Für sein „Bekenntnis“ erhielt er in den Medien viel Zustimmung. Er hatte offenkundig für viele gesprochen. Unsichtbare Zäune umgeben Altenheime und Pflegestationen. Wer geht schon „freiwillig“ in ein Alten- oder Pflegeheim? Da kann das Altenheim eine noch so herausragende Bewertung bekommen. Selbst Besuche werden vermieden.
Wir meiden die Nähe zu verfallenden und sterbenden Menschen und wehren uns dagegen, selbst pflegebedürftig zu werden und zu erstarren. Deshalb überlassen wir sterbenskranke und pflegebedürftige Menschen für gewöhnlich „Profis“ in speziellen Einrichtungen. Höchste Ansprüche werden an die Pflegenden und die Einrichtungen gestellt nach dem Motto „Wir haben gezahlt und haben ein Recht …“. Hier wirken sich die Rahmenbedingungen moderner Gesellschaften, insbesondere die Ökonomisierung des Lebens, aus. Geld ist das generalisierte Hilfsmittel. In der Konsequenz wird nicht mehr von Kranken gesprochen, sondern von Kunden, die „etwas“ für ihr Geld haben wollen. Alte und Sterbenskranke werden folglich – wie ein Auto in eine Werkstatt – in ein Heim oder in ein Hospiz gegeben. Der Kundenservice soll es richten und Bescheid sagen, wenn der Service fertig ist: „Rufen Sie uns (erst) an, wenn die Oma fertig (verstorben) ist, aber nicht während der Nacht.“
Elementare, animalische Aspekte des menschlichen Lebens bringen fast ausnahmslos Gefahren für das Zusammenleben der Menschen und für den Einzelnen mit sich. Sie werden zunehmend hinter die Kulissen des Lebens verlagert. Der Tod als die größte bio-soziale Gefahr des Lebens wird möglichst weit weggeschoben. Für die Sterbenden bedeutet dies: Auch sie werden weggeschoben und isoliert. Ein Ergebnis dieser Berührungsangst ist die Einsamkeit der Sterbenden sowie die Überforderung und das Verlassen-Sein ihrer Angehörigen und der Pflegenden.3
Die heutige Palliativ- und Hospizbewegung ist eine Reaktion auf die veränderten Rahmenbedingungen für das Sterben in der modernen Gesellschaft. In der Mitte des 20. Jahrhunderts entstanden zur selben Zeit an verschiedenen Orten in den europäischen und angloamerikanischen Staaten Initiativen, die Lebensbedingungen und die Betreuung der Sterbenden und ihrer Angehörigen zu verbessern. Das gemeinsame Ziel der Initiatoren war „Gegen die Einsamkeit und die Schmerzen der Sterbenden“ aktiv zu werden.
2Das Verhältnis unserer Vorfahrenzu Sterben und Tod war auch zwiespältig
Angeblich sind in Europa früher die Menschen im Kreis ihrer Familie gestorben und hatten keine Angst vor dem Sterben. Der Tod wurde akzeptiert und er gehörte zum Leben dazu. – Stimmt das wirklich?
Der französische Historiker Philippe Ariès behauptet das jedenfalls in seiner Studie „Geschichte des Todes“ (1982): „Fast zwei Jahrtausende lang – von Homer bis Tolstoi – ist im Abendland die Grundeinstellung der Menschen zum Tod nahezu unverändert geblieben. Der Tod war ein vertrauter Begleiter, ein Bestandteil des Lebens, er wurde akzeptiert und häufig als eine letzte Lebensphase der Erfüllung empfunden. Seit dem 19. Jahrhundert hat sich ein entscheidender Wandel vollzogen. Der Tod ist für den heutigen Menschen Angst einflößend und unfassbar, und er ist außerdem in der modernen, leistungsorientierten Gesellschaft nicht eingeplant. Der Mensch stirbt nicht mehr umgeben von Familie und Freunden, sondern einsam und der Öffentlichkeit entzogen, um den ‚eigenen Tod‘ betrogen.“4
Die Thesen von Ariès sind beliebt und weit verbreitet. Die wissenschaftlich fundierte Kritik an diesen Thesen wird dagegen kaum wahrgenommen: „Romantischen Geistes sieht Ariès im Namen der besseren Vergangenheit mit Misstrauen auf die schlechtere Gegenwart. So reich sein Buch an historischen Belegen ist, seiner Auslese und Interpretation muss man mit großer Vorsicht begegnen. … Ruhiges Sterben in der Vergangenheit? Welche Einseitigkeit der historischen Perspektive!“5
Es gibt keinen vernünftigen Grund, die Vergangenheit zu idealisieren.6 In dem im Jahr 1404 erschienen Büchlein „Der Ackermann“, das zu den bedeutendsten Prosadichtungen des späten Mittelalters gehört, greift Ackermann den Tod an:
„Grimmiger Zerstörer aller Länder, schädlicher Verfolger aller Welt, grausamer Mörder aller Leute, Ihr Tod, Euch sei geflucht! … Angst, Not und Jammer verlassen Euch nicht, wo Ihr umgeht; Leid, Trübsal und Kummer, die geleiten Euch allenthalben. … Angst und Schrecken trennen sich von Euch nicht, Ihr seid, wo Ihr seid! Von mir und der Allgemeinheit sei über Euch wahrhaft Zeter geschrien mit gewundenen Händen.“7
Bei der „Geschichte des Todes“ von Ariès handelt es sich um eine Geschichtsschreibung aus der distanzierten Sicht gesunder Menschen. Das Erleben der Sterbenskranken und der Trauernden wird nicht berücksichtigt. Wenn sich die historische Forschung von der Übermacht der Traditionen und auch von der Macht der Ideologien freihält, kommt sie zu anderen Erkenntnissen. Dann findet sie auch aus dem 18. Jahrhundert Aussagen wie diese:
„Selbst der Tod, das allgemeine Schrecken der Natur, bey dessen Anblick jedes Gefühl der Freude, jede frohe Empfindung, jede keimende Hofnung, wie die Blume vom Winterfroste dahinwelkt, selbst der Tod wird in der Nähe der Tugend, von der wohlthätigen Hand der Phantasie geschmückt, zu einem Gegenstand der Liebe, des Wunsches und des freudigen Erwartens.“8
Die Menschen hatten zu allen Zeiten und in allen Kulturen zu Sterben und Tod ein zwiespältiges Verhältnis. Einerseits hat die Volksbelustigung durch öffentliche Tötungen eine lange historische Tradition. Bereits bei den Etruskern gab es Gladiatorenkämpfe, die das antike Rom aufgriff und zur Massenveranstaltung ausweitete. Im Mittelalter unterhielten öffentliche Hinrichtungen, Schauspiele und Opern ein begieriges Publikum. Zeitzeugen beschreiben, wie das ganze Dorf erwartungsvoll auf den Anger oder den Galgenberg spazierte, um sich das Schauspiel einer Hinrichtung nicht entgehen zu lassen. Diese Exekutionen waren äußerst grausam: Feindliche Soldaten wurden zum Beispiel an einem Pfahl über glühender Kohle angebunden. Die Füße verschmorten zuerst. Das Opfer musste riechen, wie sein eigenes Fleisch verbrannte, wenn es zuvor nicht in Ohnmacht fiel. – Als Strafe für Ketzerei wurden vor allem Frauen von der Stadtmauer oder einem Turm gestürzt. Diese Strafe wurde aber bald abgeschafft, weil sie nicht genügend zur Belustigung der Zuschauer beitrug. – Auf dem Marktplatz wurden Verurteilte nackt in einen eisernen Käfig eingesperrt und dieser wurde aufgehängt. Der Tod trat durch Verdursten oder Erfrieren ein. Die Überreste des Toten wurden noch eine Zeit lang in dem Käfig belassen, um die Bevölkerung der Stadt abzuschrecken, ähnliche Straftaten zu begehen.9
Mord und Totschlag wurden in den vergangenen Jahrhunderten auf den Bühnen der Theater und Opernhäuser genossen. In der Tragödie „Hamlet, Prinz von Dänemark“ (1601) von William Shakespeare (1564–1616) tötet Hamlet Polonius, Laertes und Claudius mit dem Schwert. Die Mutter Hamlets vergiftet sich. Und Hamlet suizidiert sich am Ende mit Gift. In den meisten Opern geht es um Liebe, Eifersucht, Intrigen, Ehebruch, Verrat mit Tod, Mord und Suizid. In der Oper „Othello“ (1887) von Giuseppe Verdi (1813–1901) erwürgt Othello seine Frau Desdemona aus Eifersucht und tötet sich anschließend selbst über ihrem Leichnam. Tristan wird in Richard Wagners (1813–1883) Oper „Tristan und Isolde“ (1865) im Kampf schwer verwundet. Sterbend eilt er Isolde, seiner Geliebten, entgegen. Isolde vermag das Übermaß ihres Schmerzes über den Tod von Tristan nicht zu ertragen und gleitet sterbend zu ihm auf die Erde.
Andererseits kämpften unsere Vorfahren ebenfalls gegen Krankheit, Altern und Tod. Die Geschichte der Medizin, der Pharmakologie und der Krankenpflege bezeugt dieses Ringen gegen Krank-werden und Sterben-müssen. Die Vorsorge und das Heilen von Krankheiten prägten auch bei unseren Vorfahren das alltägliche Leben. Noch heute nimmt die Äbtissin Hildegard von Bingen (1098–1179) mit ihren Lehren über Pflanzen und Krankheiten einen bedeutenden Platz in diesem Kampf ein. Ihre Abhandlungen über die Entstehung und Behandlung verschiedener Krankheiten sowie über die Beschaffenheit und Heilkraft verschiedener Pflanzen haben über die Jahrhunderte nicht an Bedeutung verloren. Ihre Werke zählen nach wie vor weiterhin zu den Standardwerken der Naturheilkunde. Sie verband das damalige Wissen über Krankheiten und Pflanzen aus der griechisch-lateinischen Tradition mit dem der Volksmedizin, entwickelte eigene Thesen über die Entstehung von Krankheiten und trug bereits bekannte Behandlungsmethoden aus verschiedenen Quellen zusammen.
Als der bayerische Pfarrer Sebastian Kneipp (1821–1897) an Tuberkulose erkrankt war, entdeckte er zufällig das Buch „Unterricht von der Heilkraft des frischen Wassers“ des Arztes Johann Siegmund Hahn (1696–1773). Angeregt von dem Buch badete er regelmäßig in der eiskalten Donau und wurde wieder gesund. Aufgrund seiner persönlichen Erfahrungen und einer tiefen Naturverbundenheit studierte Kneipp sein Leben lang alte Naturheilverfahren und entwickelte fünf Prinzipien: Heilkraft des Wassers – Vitalität durch Bewegung – Heilwirkung der Kräuter – Gesunde Ernährung – Harmonie von Körper und Geist. Seine Bücher „Meine Wasserkur“ und „So sollt ihr leben!“ sorgten dafür, dass die „Kneipp-Medizin“ sehr schnell europaweit verbreitet wurde.
Es war früher keineswegs selbstverständlich, im Kreis der Familie und im eigenen Bett friedlich einzuschlafen. Die Auffassung, dass die Menschen früher geborgen im Kreis ihrer Familie und im eigenen Bett gestorben seien, wird durch die historischen Fakten als Fantasiegebilde entlarvt. Ich frage: Wer hat je die unzählbaren Menschen befragt, die von der Pest oder der Spanischen Grippe in wenigen Tagen unter größten Schmerzen hinweggerafft worden sind? Wer hat je die vielen, vielen jungen Menschen befragt, die in den Kriegen – auch auf den Kreuzzügen – getötet wurden und in dem Morast der Kriegsschauplätze dieser Welt sterben mussten? Im Dreißigjährigen Krieg? In den Napoleonischen Kriegen? In den Bauernkriegen? Im Deutsch-französischen Krieg? Im Ersten und Zweiten Weltkrieg? Wer hat je die Millionen Menschen befragt, die auf den tödlichen Flüchtlingstrecks dieser Welt elendig und einsam „verreckt“, verhungert, erfroren sind? In den vorigen Jahrhunderten sind die meisten Menschen nicht daheim im eigenen Bett, sondern auf den Schlachtfeldern, beim Bau der Schlösser, Kirchen und Brücken, auf den Straßen und in den Wäldern sowie auf den Meeren der Welt gestorben.
Zudem waren bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts in den Großstädten Wohnungen knapp und die Wohnverhältnisse schlecht. Mehr als zehn Personen lebten mitunter in einem Raum. Auch in den Dörfern wohnten mehrere Menschen in einer Stube. Die Vorstellung, dass die Menschen früher ein eigenes Bett in einem eigenen Zimmer hatten und dort umgeben von ihrer Familie sterben konnten, ignoriert ebenfalls die historischen Fakten.10
Und wie stand es mit der „Geborgenheit im Kreis der Familie“? Dazu ein viel sagendes Beispiel: Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) pries den Tod als ein Element des Lebens und ein Tor zur Unsterblichkeit. Darüber konnte er sehr schön schreiben.11 Krankheit und Sterben verletzten allerdings sein ästhetisches Empfinden und störten ihn bei seiner Arbeit. Goethe zog sich jedes Mal ins Bett zurück, wenn es um die Begleitung sterbender Angehöriger und Freunde ging.12 Mehrfach hat Goethe diesen Rückzug selbst als Kriegslist bezeichnet und vielfach angewandt. Als seine Ehefrau, Christiane Vulpius, schwer erkrankte, schickte er sie zu bekannten Ärzten und auf Kur. Er selbst verreiste und begann eine Verbindung mit einer anderen Frau. Am 6. Juni 1816 starb Christiane Vulpius und ihr Ehemann schrieb in sein Tagebuch:
„Gut geschlafen und viel besser. Nahes Ende meiner Frau. Letzter fürchterlicher Kampf ihrer Natur. Sie verschied gegen Mittag. Leere und Totenstille in und außer mir. … Meine Frau um 12 Nachts ins Leichenhaus. Ich den ganzen Tag im Bett.“13
Johanna Schopenhauer14 beschrieb das Sterben von Goethes Frau:
„Die entsetzlichen Krämpfe, in denen sie acht Tage lag, waren so furchtbar anzusehen, dass ihre weibliche Bedienung, die zu Anfang um sie war, auch davon ergriffen ward, und fortgeschafft werden musste. Dies verbreitete allgemeinen Schrecken und niemand wagte, sich ihr zu nähern, man überließ sie fremden Weibern, reden konnte sie nicht, sie hatte sich die Zunge durchgebissen. … Allein, unter den Händen fühlloser Krankenwärterinnen, ist sie, fast ohne Pflege gestorben. Keine freundliche Hand hat ihr die Augen zugedrückt. Ihr eigener Sohn ist nicht zu bewegen gewesen, zu ihr zu gehen, und Goethe selbst wagte es nicht.“15
Wie wir wünschten sich auch unsere Vorfahren einen plötzlichen Tod und sie fürchteten sich sehr vor der ewigen Verdammnis. In einem weit verbreiteten Buch über das Sterben heißt es am Ende des 18. Jahrhunderts:
„Kurz vorher, ehe Cäsar auf dem Rathhause zu Rom ermordet wurde, war er in einer Gesellschaft, wo das Gespräch auf die verschiedenen Todesarten fiel. Man warf die Frage auf: Welches die beste wäre? indem eben Cäsar einige Briefe unterschrieb. Er hatte kaum die Frage gehört, so gab er zur Antwort: ‚Eine plötzliche Art des Todes ist die Beste!‘ Die Geschichte giebt uns mehr Beyspiele, dass die Helden, die dem Tode auf dem Schlachtfelde entgangen waren, vor dem Tode auf einem Sterbebette gezittert haben.“16
Der Königsberger Arzt Johann Jakob Woyth (1671–1709) hat 1701 ein kleines, handliches Lexikon mit dem Namen „Medicinische Schatz Kammer“ verfasst. Über den Tod heißt es darin:
„Mors, der Tod, ist die Scheidung der Seelen von dem Leibe, das Ende alles menschlichen Elends, der Anfang der ewigen Freude und wahren Ruhe, scheinet dennoch einigen, insonderheit den Gottlosen, grausam zu seyn, und solches aus Furcht der ewigen Verdammung, den Reichen wegen Hinterlassung ihrer Güther.“17
Die Furcht vor dem „Jüngsten Gericht“ eines strafenden Gottes und der Verurteilung zur ewigen Verdammnis plagte viele Menschen. Die Angst vor dem Sterben resultierte nicht zuletzt auch aus dieser Furcht.
Die Linderung des Leidens und die Unterstützung der Sterbenden war auch in früheren Jahrhunderten eine zentrale Aufgabe der Ärzte.
„Die Schmerzen wurden immer heftiger, der Kranke jammerte, und flehte die ganze Nacht um Linderung, oder Tod. Den 8 Julius schlug Göpfert die Anzapfung der Blase vor, … Man machte den Blasenstich und leerte fünf Pfund rothen dicken schlammigen Urins aus; darauf erfolgte eine erwünschte Erleichterung.“18
Palliativmedizin ist keine Errungenschaft der Gegenwart.19
3Die Lebenswirklichkeit Sterbenskrankerkorrigiert Klischees und Ideologien
Das zwiespältige Verhältnis zu Sterben und Tod führt zu falschen Annahmen und Klischees über das Leben und Erleben von sterbenskranken Menschen sowie zu Ideologien über Sterben und Tod. Klischees entstehen aufgrund mangelhafter Kommunikation. Sie zeigen überdeutlich, dass über sterbenskranke Menschen gesprochen wird, jedoch nicht mit ihnen. Gesunde Menschen sind normalerweise daran interessiert, dass Sterben und Tod viel von ihrem Schrecken genommen wird. Folglich theoretisieren, idyllisieren, idealisieren und glorifizieren sie Sterben und Tod, um sich so vor der rauen Realität des Sterbens zu schützen.
Selbstverständlich denken Philosophen, Theologen und Geistes- und Sozialwissenschaftler über Sterben und Tod nach. Das Geheimnis und das Phänomen Tod hat zum Beispiel der französische Philosoph Vladimir Jankélévitch (1903–1985) in seinem Hauptwerk „La mort“ (1977) analysiert und er versucht, den „Grenzfall Tod“ in seiner ganzen Banalität und Fremdheit, in seiner Widersprüchlichkeit und auch im Zusammenhang mit dem Nachdenken über den Tod in der Philosophiegeschichte zu erfassen. „Wenn man den Tod weder vorher noch während, noch nachher denken kann, wann ist er dann denkbar?“ fragt er. Eine seine Antworten ist:
„Der Tod ist, wenn man so will, die tiefe Wahrheit des Lebens, aber diese Wahrheit ist weder wesentlich, noch trifft sie den Kern, und sie ist auch keine intelligible Positivität, die der leiblichen Existenz die fehlende Beständigkeit geben könnte … Nein! Diese Wahrheit ist eher eine Gegenwahrheit, dieses Prinzip eher ein Gegenprinzip, das der undurchdringlichen Absurdität unserer Zunichtewerdung zugrunde liegt.“20
Offen bleibt, was diese Reflexionen für das Leben und die Begleitung Sterbenskranker nutzen.
Noch einmal anders wirken scharfzüngige Urteile über Sterbenskranke. Albert Camus lässt in seinem Roman „Die Pest“ den Jesuitenpater Paneloux die Frage der Bewohner der Stadt Oran, warum gerade ihre Stadt von der Pest befallen sei, gnadenlos beantworten.
„Meine Brüder, ihr seid im Unglück, meine Brüder, ihr habt es verdient!“21
Paneloux begründet sein Urteil damit, dass die Menschen in Oran nicht an Gott geglaubt und gesündigt hätten. Gott bestrafe sie dafür.
Der Arzt Rieux, Gegenspieler von Paneloux, kämpft gegen die tödliche Krankheit, versorgt die Sterbenden und kommentiert das Urteil des Paters:
„Paneloux ist ein Büchermensch. Er hat nicht genug sterben sehen und deshalb spricht er im Namen einer Wahrheit. Aber der geringste Priester, der auf dem Lande seine Gemeinde betreut und dem Atem eines Sterbenden gelauscht hat, denkt wie ich. Er wird dem Elend zu steuern suchen, ehe er es unternimmt, seine Vorzüge aufzuzeigen.“22
Gesunde Menschen lesen Texte, in denen Sterbende oder vom Tod bedrohte Menschen zu Wort kommen, selektiv. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist, wie Theologen mit der Bibel umgegangen sind und es auch heute oft noch tun. Eine gängige theologische Lehre, sie wird biblisch begründet, heißt zum Beispiel: Der Tod gehört zum Leben. Die Menschen haben Sterben und Tod zu akzeptieren. Die zahlreichen Texte der Bibel, die genau das Gegenteil zu dieser These sind, werden einfach nicht beachtet. Ignoriert wird zum Beispiel völlig: Jesus wollte nicht sterben und hat seinen Tod nicht bejaht. Der Evangelist Lukas – und auch die anderen Evangelisten – beschreiben die letzten Stunden Jesu im Kreis seiner Jünger. Kurz vor seiner Gefangennahme ging Jesus mit seinen Jüngern auf den Ölberg und trennte sich dann von seinen Jüngern. Er kniete nieder und betete:
„Vater, wenn Du willst, lass diesen Kelch an mir vorüber gehen. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe.“
Ein Engel vom Himmel erschien ihm und stärkte ihn. Als Jesus in Todesangst geriet, betete er noch inständiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. (Lukas 22, 39–44)
Gesunde Menschen muten sich selten zu, Sterbenskranke zu berühren und damit sich selbst zu begegnen. Beides wird abgewehrt. Mitunter sogar gerade dadurch, dass man ständig über das Sterben – über das der anderen, natürlich – spricht. Abstraktionen, Klischees, Idealisierungen und Sterben-Tod-Ideologien verhindern eine offene und ehrliche Kommunikation mit Sterbenskranken und sind ein Grund für deren Einsamkeit in unseren Tagen.23 Außerdem führen sie zu falschen Erwartungen, unnötigen Belastungen und unberechtigten Schuldgefühlen bei allen, die Sterbenskranke begleiten.
In Beratungsbüchern zur „Bewältigung der Endlichkeit“ und zum „Sterben lernen – Leben lernen“ wird ausgeführt, wie Sterbeprozesse – nach bestimmten Phasenmodellen – zu verlaufen haben, wie mit „der Wahrheit“ umzugehen sei und dass Sterbende in ihr Schicksal einwilligen sollen. Normative Vorgaben für die „Kunst des Sterbens“ sind nicht selten abwegig. Jeder soll seinen eigenen Tod sterben, heißt es da zum Beispiel. Aber wehe, erstirbt seinen eigenen Tod und richtet sich nicht nach den in der Palliativ- und Hospizbewegung verbreiteten Idealvorstellungen.
Die Bücher von Elisabeth Kübler-Ross (1926–2004) zu Sterben und Tod haben seit vielen Jahren einen hohen Kultstatus. An vielen Stellen verklärt sie Sterben und Tod.
„Man muss loslassen können. Wenn der Sterbende und seine Familie das akzeptieren, ist es das Schönste überhaupt.“24
Idealisierte Vorgaben stehen fast immer im Widerspruch zum konkreten Erleben der Sterbenskranken sowie den realen Möglichkeiten der Helfer und lösen Versagens- und Schuldgefühle aus. Unser Reden und Handeln mit Sterbenskranken sollte nicht durch eigensinnige Bilder und Vorstellungen vom Sterben geleitet werden. Wir haben uns an dem wirklichen Erleben und Verhalten der Sterbenskranken zu orientieren.
„Jede Wirklichkeit ist bilderstürmerisch.“25
Für Angehörige, Pflegende und Ärzte, aber auch für die Sterbenskranken selbst waren und sind diese Idealisierungen unerreichbar und wurden für viele zu einer erdrückenden Last. Selten sind allerdings die meisten Thesen einer Forscherin so unbarmherzig widerlegt worden, wie das Kübler-Ross am eigenen Leib erfahren musste. Die weltberühmte Sterbeforscherin und Publizistin musste bei ihrem eigenen Sterben erleben: Ihre Thesen zum schönen Tod und zur Akzeptanz des Sterbens haben nichts mit der Realität sterbender Menschen zu tun. Der Film von Stefan Haupt „Elisabeth Kübler-Ross – Dem Tod ins Gesicht sehen“ bezeugt das in eindrucksvoller und zugleich erschreckender Weise. Der Film zeigt: Die todkranke Sterbeforscherin hadert mit ihrem Schicksal, leidet unter ihrer Einsamkeit und protestiert heftig gegen ihr Leiden. Schlaganfälle, Lähmungen und große Schmerzen setzen ihr zu und sie ist allein. Sterbenskrank wehrt sie sich mit aller Kraft gegen den Tod.
Ihre zwei Minuten jüngere Drillingsschwester Erika Faust-Kübler wundert sich über ihre Schwester:
„Sie will noch bestimmen, wann sie gehen kann. Ich glaube, sie kann nicht loslassen. Sie ist einfach noch nicht bereit. Und irgendwie irritiert es mich auch. Sie hat so viel über Tod und Sterben geschrieben, es sogar verherrlicht. Jetzt, da ihre Zeit kommt, sagt sie: ‚Ich muss noch dies und das machen.‘“26
Die beiden Drillingsschwestern kritisieren die Thesen ihrer Schwester Elisabeth zum Sterben und vermuten, ein Esoteriker habe ihr vieles beigebracht. Sie halten das für Hokuspokus. Ihre Schwester sei auf einem gefährlichen Trip gewesen.
„Beth, hör auf mit dem spinnigen Zeug. Bleib auf dem Boden. Erzähl, was du weißt, aber nicht mehr.“27
Eine Sache ist es, als Gesunder über Sterben und Tod zu plaudern und zu diskutieren. Eine völlig andere Sache aber ist es, mit Sterbenden selbst zusammen zu sein, sich mit ihnen zu verständigen, sie zu berühren und sich von ihnen berühren zu lassen.
„Alles richtig zu machen gelang keinem von uns. Wenn ich etwas im Laufe von Ruth’ letzten Wochen gelernt habe, dann dass einem die Illusionen von einem friedlichen, würdevollen Tod und dem perfekten Familienabschied am Sterbebett mit ziemlicher Gewissheit geraubt werden. Wenn da noch irgendwelche Zipfel von Trost zu greifen sind, dann ist es ein überraschender Segen. Sterben ist gemein, hässlich und schmerzhaft; das ist ja auch eigentlich offenkundig, oder?“28
Wenn irgendein mir unbekannter Mensch stirbt, dann trifft mich das nicht sonderlich; aber wenn jemand, den ich gut kenne, stirbt, dann macht mir das sehr viel aus. Das Einmalige des sterbenden Freundes und das Ungeheure seines Sterbens fordern mich heraus und nehmen mir die Ruhe. Das persönlich erlebte Sterben ergreift mich. Über das „Phänomen Sterben“ kann ich stundenlang diskutieren, das Buch über „das Phänomen Tod“ raubt mir meinen Nachtschlaf nicht. Bin ich aber eine Stunde mit einem Sterbenden zusammen gewesen und habe mich ihm geöffnet, dann brauche ich selbst jemanden, „dem ich mein Herz ausschütten kann“. Allein kann ich die aufgebrochenen Fragen und Gefühle nicht aushalten. „Der Wunsch des Weisen ist ein Ohr, das sich ihm zuneigt“, heißt es im Buch der Weisheit. Ich wünsche mir jetzt keinen Diskussionspartner, sondern einen Menschen, der mir einfach zuhört, der mich annimmt, so wie ich bin, bei dem ich Wärme und Wertschätzung erfahre, der nicht abwehrt und wertet, sondern mich aussprechen lässt. Bei und mit diesem Gegenüber kann ich mich selbst wieder finden.29
In viel stärkerem Maße benötigen Sterbenskranke zuhörende und unterstützende Partner. Sie sind dankbar, wenn sich jemand zu einem aufrichtigen Gespräch bereitfindet und sie begleitet, auch wenn er ihnen letztlich nicht in die Einsamkeit des Sterbens folgen kann.
„In dem Moment wusste ich, dass sie wie Eurydike an die Unterwelt verloren war und dass Sterben in erster Linie absolute Einsamkeit bedeutet.“30
4Die Kraft der Kommunikation
Die Kommunikation zwischen gesunden und sterbenskranken Menschen erinnert bisweilen an ein Spiel, in dem die Spieler nach unterschiedlichen Regeln spielen.
Das Ziel einer gelingenden Kommunikation ist aber Verständigung untereinander. Der Begriff „Kommunikation“ stammt vom lateinischen Wort „communicare“ ab und bedeutet „teilen, mitteilen, teilnehmen lassen; gemeinsam machen, vereinigen; sich verständigen; Informationen austauschen“.31 Durch Verständigung und gemeinsames Handeln entsteht Gemeinschaft.
Kommunikation ist alltäglich und lebensnotwendig. Jeder Mensch wird in bestimmte Sozialstrukturen hineingeboren, lebt in einer bestimmten Zeit und in einer bestimmten Gruppe von Menschen und muss sich von Geburt an den Strukturen und Regeln seiner Gruppe anpassen. Diese Gruppe ist wiederum eine Gruppe unter den vielen Menschengruppen. Zusammen bilden sie die menschliche Gesellschaft. In diesem Zusammenhang entwickelt jeder Mensch seine ihm eigenen Kommunikationsformen.
Die Struktur, die Dynamik und die Zwänge menschlichen Zusammenlebens kann man nicht verstehen und erklären, wenn man jeden einzelnen Menschen für sich betrachtet. Das gelingt nur, wenn man von der Vielfalt der Menschen, von den unterschiedlichen Graden und Arten ihrer Abhängigkeit und Angewiesenheit aufeinander ausgeht. „Was wir als gesellschaftliche Zwänge bezeichnen, sind die Zwänge, die viele Menschen entsprechend ihrer eigenen gegenseitigen Abhängigkeit aufeinander ausüben.“32
Wo immer man hinblickt, stößt man auf die Interdependenz gesellschaftlicher, das heißt innerstaatlicher und zwischenstaatlicher Prozesse. Aus diesem Zusammenspiel ergeben sich auch die Rahmenbedingungen (Kommunikation, Werte, Personal, Zeit, Kosten, Medikamente) für das Sterben eines jeden einzelnen Menschen.
Für die Darstellung des Zusammenspiels, der Wechselbedingungen und -beziehungen, in denen Sterbenskranke leben, bietet sich ein Interdependenzmodell an: Sterbenskranke sind eingebunden in das Netz von Angehörigen und Freunden, Ärzten (Ärzteverbände), Pflegenden (Berufsverbände), Physiotherapeuten, Psychologen, Seelsorgern (Glaubensgemeinschaften), Hospizhelferinnen, Kliniken, Heimen, Hospizen, Krankenkassen, Rentenversicherungen, Pharmazeutischer Industrie, Apothekern, Rettungsdiensten. Im Brennpunkt dieses Geflechts steht zwar idealtypisch der Kranke. Es geht aber in gleicher Weise auch um die Belange aller anderen Beteiligten. Der Kranke wünscht, dass die professionellen Helfer ihm helfen, und die professionellen Helfer wollen ihm auch helfen. Dafür möchten sie aber auch „bezahlt“ werden, denn mit dem Helfen finanzieren sie ihren Lebensunterhalt.
Wenn in den Leitbildern von Kliniken und Heimen behauptet wird: „Der Patient steht immer im Mittelpunkt“, dann stimmt das in dieser Absolutheit keinesfalls. Vielmehr befindet sich jeder Patient in einem komplizierten sozialen Geflecht mit vielen Abhängigkeiten und Unwägbarkeiten. Kranke erleben das bisweilen so:
„Der Kranke ist dem System ausgeliefert, weil niemand in diesem System bereit ist, ernsthaft mit ihm zu sprechen. Klar: Diagnose, Prognose, Therapie, es wird beinhart aufgeklärt, aber wirklich miteinander gesprochen wird nicht. Dabei könnte man allein dadurch helfen, dass man mit den Menschen spricht, zu Gedanken animiert oder nach Ängsten und Wünschen fragt. Denn dann wäre der Kranke wieder am Prozess beteiligt, dann wäre er aus dieser Statik befreit, die einem die Krankheit aufzuzwingen versucht.“33
In je eigener Weise wirken die Menschen in Institutionen zusammen und auf den Sterbenskranken ein. Alle sind auf Grund seiner Erkrankung miteinander verbunden und leben von dieser Verbindung. Das Wohlbefinden aller Beteiligten wird angestrebt und ist letztlich auch das Maß für ihre Zufriedenheit. Die beteiligten Menschen und Gruppen unterstützen, behindern oder verhindern mit ihren Aktivitäten, Möglichkeiten, Grenzen und Interessen die Qualität der Versorgung der Sterbenskranken. Zusammen sind sie verantwortlich für den Status, die Wertschätzung, die Anerkennung und Würde Sterbenskranker in unserer Gesellschaft.
Die Ausbildung der Ärzte und der Pflegenden ist auf eine individuumszentrierte Kommunikation, nach dem Leitsatz „Ich und der Patient“, ausgerichtet. Daher neigen Ärzte und Pflegende dazu, das komplexe Sozialgeflecht, in dem sie und der Patient sich befinden, auf eine reine Zweier-Beziehung „Patient und Arzt/Pflegekraft“ zu reduzieren. Diese Reduktion des komplexen Beziehungsgeflechts und der zahlreichen Einflussfaktoren auf die zwei agierenden Personen wird der gegebenen Sachlage allerdings nicht gerecht. Sie handeln – ob sie es wollen oder nicht – immer eingebunden in ihrem sozialen Kontext und nicht losgelöst von ihm.
Wenn jemand keinen Kontakt zu anderen Menschen hat, kann es sein, dass er bewusst allein sein möchte und sich freiwillig in die Einsamkeit begibt. Es kann aber auch sein, dass er einsam ist und die Einsamkeit nicht freiwillig gesucht hat, sondern sich in ihr notgedrungen vorfindet: Die Angehörigen und Freunde sind mit ihm zerstritten oder bereits verstorben. Mit bewusster und gezielter Kommunikation können vereinsamte Sterbenskranke begleitet und in die Gemeinschaft einbezogen werden. Ein Rest bleibt aber offen:
„Das Gespräch zwischen einem, der weiß, dass seine Zeit bald abläuft, und einem, der noch eine unbestimmte Zeit vor sich hat, ist sehr schwierig. Das Gespräch bricht nicht erst mit dem Tod ab, sondern schon vorher. Es fehlt ein sonst stillschweigend vorausgesetztes Grundelement der Gemeinsamkeit.“34
Theorien, Modelle und Methoden, die Kommunikation mit Sterbenskranken bewusst zu gestalten, gibt es in großer Auswahl.
Gängige Kommunikationstheorien bauen auf dem nachrichtentechnischen Paradigma von Sender-Kanal-Empfänger auf und bieten mindestens acht Ansatzpunkte, die Kommunikation zu variieren:
•Wer (Sender, Kommunikator, Sprecher, Schreiber)
•sagt was (Aussage, Nachricht, Botschaft, Information)
•zu wem (Empfänger, Adressat, Zuhörer, Leser)
•in welchem Kontext (Zeit, Raum, Institution, Gesellschaft)
•womit (Zeichen, Signal, Sprache, Körpersprache)
•durch welches Medium (direktes Gespräch, Brief, E-Mail)
•mit welcher Absicht (Motivation, Handlungsziel)
•mit welchem Effekt (Erkenntnis, Einsicht, Handlung)?35
Während einer Begegnung sind wir immer zugleich Sender und Empfänger. Es ist nicht möglich, nur Sender oder nur Empfänger zu sein. Wenn wir eine Botschaft senden, empfangen wir sogleich die Antwort des Empfängers, zumindest über Körpersprache. Und wenn wir eine Botschaft empfangen, senden wir sogleich eine Antwort auf die Botschaft des Senders.
Einige Autoren legen für die Kommunikation mit schwerkranken und sterbenden Patienten fest, welche Sätze man sagen darf oder nicht sagen sollte. Nach Husebø darf ein Arzt zum Beispiel sagen: „Welche Informationen haben Sie von den Ärzten über Ihre Erkrankung bekommen?“ – „Haben Sie gedacht, es könnte Krebs sein?“ – „Es gibt unendlich viel, was wir für Sie und ihre Familie noch tun können.“ Nicht sagen sollte ein Arzt nach Husebø zum Beispiel: „Jetzt kann ich nichts mehr für Sie tun.“ – „Sie müssen leider mit ihren Schmerzen leben.“ – „Reißen sie sich zusammen.“ – „Ich habe diese und nächste Woche leider keine Zeit.“36 Andere Autoren nennen Interventionen, die die Würde von Sterbenden berücksichtigen und stützen. Für Mehnert/Chochinov sind würdebezogene Fragen beispielsweise: „Fühlen Sie sich behaglich?“ – „Auf was sind Sie in Ihrem Leben besonders stolz?“ – „Können Sie Ihre jetzige Situation annehmen?“37 Wieder andere Autoren benennen nonverbale Signale, die das Gespräch mit Patienten unterstützen. Für den Arzt-Patienten-Kontakt empfehlen Schweickhardt/Fritzsche zum Beispiel: „Direkter Blickkontakt, der nicht als Anstarren erlebt wird. – Sitzt dem Patienten direkt gegenüber. – Offene Körperhaltung. – Leicht nach vorn gebeugte Haltung. – Freundlicher Gesichtsausdruck.“38
Konkret ausformulierte Vorgaben treffen vielleicht für spezielle Einzelfälle zu, aber generell taugen Festlegungen dieser Art nicht für eine angemessene Kommunikation mit Sterbenskranken. Bei solchen Vorgaben werden nämlich weder die Rahmenbedingungen der jeweiligen Situation noch die verschiedenen Charaktereigenschaften der Sterbenskranken und ihrer Begleiter noch die Komplexität von Kommunikation berücksichtigt. Soll die Kommunikation gelingen, dann ist die Lebenswirklichkeit möglichst aller Beteiligten gebührend zu berücksichtigen. Deshalb darf man nach meiner Auffassung nicht vorab festlegen, was man Sterbenskranken nicht sagen oder sagen darf, was würdebezogen oder nicht würdebezogen ist. Derselbe Satz, der für den einen Sterbenskranken würdebezogen ist, kann für einen anderen Sterbenskranken nicht würdebezogen, sondern verletzend sein. Fragen und Antworten in der Kommunikation mit Sterbenskranken sollten nicht abstrakt mit „richtig oder falsch“, mit „gut oder schlecht“ bewertet werden, sondern mit „in der Situation angemessen oder unangemessen“, „passt oder passt nicht in dem Kontext“, „stimmt oder stimmt nicht für die Gesprächspartner“.
Jeder ist in der Kommunikation auch abhängig von seinem jeweiligen persönlichen Befinden. Wenn es mir schlecht geht, bin ich sehr eingeschränkt, mich anderen Menschen zuzuwenden. Wer starke Zahnschmerzen hat, kann einen Patienten vermutlich nicht freundlich fragen: „Fühlen Sie sich behaglich?“ Wenn ein Arzt von einem fordernden Patienten total genervt ist, kann es völlig angemessen sein zu sagen: „Jetzt kann ich wirklich nichts mehr für Sie tun.“ Außerdem ist zu berücksichtigen: Manche Menschen sind hartgesotten und andere sind sensibler. Wie jemand handelt oder ansprechbar ist, das hängt von seiner persönlichen Lage und seinen Persönlichkeitseigenschaften ab. Wir sind kein Nichts, keine leblosen Neutra oder Roboter, sondern empfindsame Menschen.
Wahrhaft hilfreich können gesunde Menschen für Sterbenskranke sein, wenn sie bereit und fähig sind, sich dem Unfassbaren auszusetzen und Sterbenskranken zu begegnen, zu einer Zeit, da sie selbst noch nicht sterben müssen. Dann wird das Handeln nicht durch äußere Vorgaben bestimmt, sondern ist in den Handelnden selbst begründet und stimmt in der Situation. Ein selbstkritischer Mensch erlebt sich, kennt seine Stärken und Schwächen, spürt seine Gefühle und Beweggründe und bemüht sich bewusst zu handeln. Wünschenswert ist es, für das Unerwartete offen zu sein und über Kommunikationsvarianten, die situativ und kontextbezogen flexibel genutzt werden können, zu verfügen.
5Grundlagen und Grenzen dieses Buches
Wenn die Kommunikation zwischen gesunden und sterbenskranken Menschen nicht an ein Spiel, in dem ein Schachspieler und ein Damespieler gegeneinander und nach ihren eigenen Regeln an einem B(r)ett spielen, erinnern soll, dann können Sterbenskranke für gesunde Menschen wegweisende Lehrer sein.
Oft habe ich sterbenskranke und trauernde Menschen begleitet und an ihrem Leben teilgenommen. Sie sind meine Lehrer und haben mich darin unterrichtet, worauf zu achten ist, damit Kommunikation mit ihnen gelingen kann. Die Begegnungen mit ihnen bilden die Grundlage meiner Ausführungen. Prägende Elemente dieser Begegnungen kann ich nur nennen, aber nicht vermitteln: Schweigen, Gerüche, Stöhnen, Lächeln, Seufzen, Weinen, Schwitzen und Frieren.
Selbstverständlich baue ich meine Ausführungen auch auf meine Begegnungen mit Angehörigen, Ärzten, Pflegenden sowie auf eigene empirischen Studien und die einschlägige Fachliteratur zur Kommunikation mit Sterbenskranken auf.39 Ein gewisses Maß an Subjektivität liegt meinen Ausführungen zugrunde. Allerdings habe ich meine Erkenntnisse und Empfehlungen im Austausch mit Ärzten, Pflegenden, Psychologen, Seelsorgern und Sozialarbeiterinnen, die Sterbenskranke begleiten, überprüft und falls nötig korrigiert.
Im Rahmen der Weiterbildungsseminare zur Palliativmedizin stellen Ärzte ihre Behandlung und Kommunikation mit Sterbenskranken vor. Mit mehr als 400 Ärzten habe ich jeweils eine ihrer palliativmedizinischen Behandlungen besprochen und die Kommunikation zwischen ihnen und dem Sterbenskranken analysiert, Alternativen für die Kommunikation entworfen und eingeübt. Über 80 Seminare und Workshops habe ich mit Pflegekräften zur Kommunikation mit Sterbenskranken durchgeführt. Hinzu kommen zahlreiche Supervisionen und Projekttage mit Mitarbeiterinnen von Sozialstationen, Palliativstationen, Hospizen, ambulanten palliativmedizinischen Diensten, Altenheimen und Hospizvereinen.
Im Laufe der Geschichte haben Autoren aus allen Epochen ihre eigenen Erfahrungen als Sterbenskranker oder das Sterben eines ihnen nahen Menschen in Novellen, Tagebüchern oder Romanen aufgezeichnet. Einige dieser Werke beziehe ich in meine Darstellungen mit ein.
Der Prozess des Bewusstwerdens und der Kampf gegen die Erkenntnis „Ich muss bald sterben.“ ist von Schriftstellern erschütternd lebendig in Worte gefasst worden: So zum Beispiel in Romanen wie „Krebsstation“ von Alexander Solschenizyn, „Paula“ von Isabel Allende, „Der Verlust“ von Siegfried Lenz, „Mars“ von Fritz Zorn, „Du stirbst nicht“ von Kathrin Schmidt. In Novellen wie „Der Tod des Iwan Iljitsch“ von Lev N. Tolstoj. In Interviews wie „Dienstags bei Morrie. Die Lehre eines Lebens“ von Mitch Albom und in Gedichtbänden wie die „K-Gedichte“ und „Später Spagat“ von Robert Gernhardt.
Von methodologisch herausragender Bedeutung sind einige Tagebücher Sterbenskranker wie zum Beispiel „Leben wär’ eine prima Alternative“ von Maxie Wander, „Es wird mir fehlen, das Leben“ von Ruth Picardie, „Diktate über Sterben und Tod“ von Peter Noll, „Das Leben ist der Ernstfall“ von Jürgen Leinemann und „So schön wie hier kanns im Himmel gar nicht sein“ von Christoph Schlingensief. Wander, Picardie, Noll und Leinemann haben ihr Erleben in Tagebücher und Briefe aufgeschrieben. Schlingensief hat sein Erleben während seiner Erkrankung täglich spontan auf Band gesprochen und das Diktierte später für die Veröffentlichung transkribiert.
In meinen Ausführungen zitiere ich Sterbenskranke, Angehörige, Ärzte und Pflegende aus verschiedenen Kulturen und Epochen. Diese Zitate sind jeweils kursiv geschrieben und eingerückt. Bei Aussagen von Sterbenskranken aus der Literatur gebe ich jeweils die Quelle an. Ohne Quellenangabe sind die Aussagen von Sterbenskranken, Angehörigen, Ärzten und Pflegenden, denen ich persönlich begegnet bin.
Sterbesituationen wie zum Beispiel der plötzliche Tod bei einem akuten Infarkt oder bei einem Unfall und die Kommunikation mit sterbenskranken Kindern40 behandele ich nicht eigens. Ethische und juristische Aspekte des Sterbens wie zum Beispiel aktive Sterbehilfe, assistierter Suizid oder Euthanasie habe ich ausgegrenzt.
Teil 2
Erleben und Verhalten Sterbenskranker
Was erlebt ein Mensch und wie verhält er sich, wenn sein Leben durch eine Krankheit bedroht wird? Inwieweit gleichen sich die Sterbeprozesse der Menschen? Sind bestimmte, immer wiederkehrende Phasen und Verhaltensmuster zu erkennen? Stirbt jeder Mensch auf seine persönliche Weise seinen individuellen Tod?
Diese Fragen werden sehr verschieden beantwortet: Verbreitet sind Auffassungen, nach denen Sterbende bestimmte Phasen durchleben (müssen). Das bekannteste Modell hierfür ist das Phasenmodell von Elisabeth Kübler-Ross. Danach verläuft das Sterben in fünf Phasen. Der Sterbeprozess beginnt mit der Aufklärung über die tödliche Erkrankung durch den Arzt. Die Reaktionen des Kranken sind dann nacheinander: Nicht-wahrhaben-wollen – Zorn – Verhandeln – Depression – Akzeptanz. Dabei sei es gleichgültig, ob es sich um ein Kind oder einen Greis, Mann oder Frau, Christ oder Muslim, Förderschüler oder Professor, Gläubigen oder Ungläubigen handelt; der bio-psychosoziale Prozess sei bei allen gleich.41
Die Mehrzahl der internationalen Sterbeforscher lehnt dagegen Phasenmodelle mit eindeutig zugeordneten, prozessorientierten Verhaltensweisen ab: Sie sind weder empirisch nachweisbar, noch werden sie der Komplexität und Einmaligkeit menschlichen Sterbens gerecht.
Als Ergebnis empirischer Studien werden Faktoren, die nicht nur das Erleben, sondern auch das Verhalten jedes Menschen beeinflussen, genannt:
•Die Persönlichkeitsstruktur und die Biographie des Sterbenskranken,
•die persönlichen körperlichen, psychischen und spirituellen Ressourcen des Sterbenskranken,
•die Art, der Grad und die Dauer der Erkrankung sowie die Folgen und Nebenwirkungen der Behandlung,
•die Qualität der ärztlichen Behandlung und der pflegerischen Versorgung,
•die Art und Intensität weltanschaulicher beziehungsweise religiöser Bindungen,
•die externen Belastungen (finanzielle Verpflichtungen, Sorgen um kleine Kinder u.a.) der Sterbenskranken,
•die materiellen Rahmenbedingungen (Ausstattung des Zimmers, der Wohnung bzw. der Klinik, des Heimes u.a.) und
•die Erwartungen, die Normen und das Verhalten der Umgebung (Angehörige, Pflegende, Ärzte, Klima auf der Station, Öffentlichkeit usw.).42
Vergleicht man die Ergebnisse internationaler empirischer Studien über den Verlauf von Sterbeprozessen43 miteinander, dann zeigt sich: Den Sterbenden an sich gibt es nicht und ein gesetzmäßiger Verlauf des Sterbens, dem alle Menschen unterliegen, ist auch nicht zu erkennen. So wie das Leben eines jeden Menschen einzigartig ist, ist auch sein Sterben einzigartig. Dennoch finden sich Übereinstimmungen im Sterben eines jeden Menschen: Typisches im Individuellen. Das sind typische Erkenntnisse, die nicht ignoriert werden können, typische Aufgaben, die auf je eigene Weise gelöst werden müssen, und typische Einschränkungen, mit denen der Betroffene leben muss.
„Das Faszinierende am Tode ist folgendes: Der Tod ist das Allgemeinste und zugleich das Individuellste. Ein toter Bundesrat ist gleich tot wie ein toter Jugoslawe, der bei der Müllabfuhr gearbeitet hat, und – vom Leben aus gesehen – sogar gleich tot wie eine tote Fliege. Zugleich aber ist der Tod das individuellste Ereignis der Person. Jeder stirbt allein, kein anderer kann mit ihm sein, selbst wenn er gleichzeitig stürbe.“44
Im Folgenden beschreibe ich typische Erkenntnisse, Aufgaben und Einschränkungen Sterbenskranker und wie sie damit umgehen. Die Zusammenstellung bildet keinen zeitlichen Ablauf ab. Die zuvor schon genannten Faktoren beeinflussen die Art und Weise, wie jeder Mensch die für das Sterben typischen Herausforderungen persönlich bewältigt, sich ihnen stellt, sie ignoriert, sich verschließt, verdrängt, ausweicht, rebelliert, kämpft, in die (Über-)Aktivität flieht, leugnet, resigniert, aufgibt, sich den baldigen Tod wünscht, verbittert, sich mit Alkohol, Drogen, Psychopharmaka betäubt, sich zustimmend einfügt, sich arrangiert.
Die Charaktereigenschaften Sterbenskranker werden wie unter einem Vergrößerungsglas sichtbar: Der Verschlossene wird zum Beispiel noch verschlossener, der Tapfere wird noch tapferer, der Verzagte wird noch verzagter und der Offene noch offener.
1„Ich hab’s befürchtet.“ –Sterbenskranke (er)kennen „die Wahrheit“
Soll man einen unheilbar erkrankten Menschen über seine Erkrankung aufklären oder nicht? Wer so fragt, der geht davon aus, dass jemand, der noch nichts von seiner Erkrankung weiß, plötzlich darüber aufgeklärt werden muss, dass er unheilbar, ja tödlich erkrankt ist. Diese Annahme ist für (fast) alle unheilbar erkrankten Menschen falsch! Dennoch hält sich diese Auffassung hartnäckig: auf Fachsymposien, wenn Mediziner, Juristen, Psychologen und Theologen über „Die Wahrheit am Krankenbett“ diskutieren und auch in Arztpraxen, Kliniken und Altenheimen, wenn Ärzte, Angehörige und Pflegekräfte darüber beraten, ob jemand über seine unheilbare Erkrankung aufgeklärt werden soll. Bei diesen Diskussionen und Beratungen bleibt „die Wahrheit im Krankenbett“, also die Kenntnis und das Bewusstsein der Erkrankten über ihre Erkrankung, unbeachtet.
Empirische Studien haben ergeben: Unheilbar kranke Menschen kennen ihre Lage genau und sind sich bis auf wenige Ausnahmen ihrer Lebensbedrohung bewusst, ohne dass sie eigens von irgendjemandem darüber aufgeklärt worden sind. Offen ist, ob sie ihr Wissen mitteilen, wem sie sich anvertrauen, wann und wie sie es tun.
Das persönliche Erleben, dass das Leben gefährdet ist, geht der professionellen Aufklärung voraus und bestimmt sowohl das Befinden des Betroffenen als auch seine Erwartungshaltung der ärztlichen Untersuchung gegenüber. Die Kenntnis der ärztlichen Diagnose mit den entsprechenden Fachbegriffen und der sich daraus ergebenden Prognose über den Verlauf und die Lebenserwartung bestätigt beziehungsweise konkretisiert das Erlebte.
„Ehrlich gesagt, der Hirntumor war eigentlich keine so große Überraschung. Ich bekam immer wieder fiese Kopfschmerzen, die drei oder vier Tage dauerten, und da waren auch wabernde Lichter an der Peripherie meines Blickfeldes.“45
Es lassen sich also zwei Erkenntniswege unterscheiden: Das persönliche Erleben der Bedrohung und die Mitteilung der Diagnose durch den Arzt.
In dem Märchen der Brüder Grimm „Boten des Todes“ (1806) verspricht der Tod dem Jüngling, dass er ihm Boten sendet, bevor er kommt und ihn abholt. Diese Boten sind Fieber, Schwindel, Gicht, Ohrenbrausen, Zahnschmerz und der Schlaf als leiblicher Bruder des Todes.46 Auf dem Weg vom Gesunden zum Kranken bis schließlich zum Sterbenden gibt es deutliche Signale, dass der Tod näher und näher kommt.
Wenn wir gesund sind, merken wir zum Beispiel unseren Atem nicht. Doch dann fällt uns eines Tages das Atmen schwer und wir husten andauernd. Mit Hustenbonbons gehen wir dagegen an. Doch der Husten geht nicht weg und das Treppensteigen fällt zunehmend schwerer. Es kommt Unruhe auf.
„Alle waren gesund. Iwan Iljitsch klagte zwar mitunter über einen seltsamen Geschmack im Mund und leichte Beschwerden in der linken Magenhälfte, doch als Krankheit konnte man das wohl kaum bezeichnen. Diese Beschwerden wurden indessen immer stärker und gingen nach und nach wenn auch nicht in Schmerz, so doch in ein andauerndes Druckempfinden in der einen Seite über und hatten zur Folge, dass Iwan Iljitsch schlecht gelaunt war.“47
Wir erinnern uns auf einmal an Menschen, bei denen es „auch so angefangen“ hat, vergleichen unser Befinden und überprüfen unsere Symptome mit dem, was wir bei den anderen sehen oder über sie wissen:
„Wurde in der Gegenwart von Iwan Iljitsch von kranken, gestorbenen oder wieder genesenen Menschen gesprochen, besonders wenn es dabei um eine Krankheit ging, die der seinen glich, dann hörte er, bemüht seine Erregung zu verbergen, aufmerksam zu, erkundigte sich nach Einzelheiten und verglich diese mit den Symptomen seiner eigenen Krankheit.“48
Vor 150 Jahren las Tolstojs Iwan Iljitsch medizinische Fachbücher, um seine Erkrankung besser kennen zu lernen.49 Heute nutzen wir das Internet, um uns über Symptome, Diagnosen, Prognosen und Therapien zu informieren. In Fernseh- und Rundfunksendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Magazinen und Blättern aller Art wird außerdem ständig und ausführlich das ganze Spektrum der Krankheiten behandelt.
„Muss mir noch einen Web-Browser beschaffen und die Internet-Seite über Brustkrebs aufrufen.“50
Medizinlexika und Sachbücher zu Fragen der Gesundheit sind Bestseller und stehen in jedem Haushalt. Noch nie zuvor wussten so viele Menschen in den Industrieländern so gut über ihre Erkrankung und deren Verlauf Bescheid wie heute. Wir werden mit Informationen zu unseren Symptomen überschwemmt und ziehen unsere Schlüsse daraus. Nicht selten werden gezielt medizinische Fachzeitschriften in die Recherche einbezogen oder die neuesten Forschungsergebnisse aus dem Internet heruntergeladen. Dieses Wissen – ob es nun stimmt oder nicht – beeinflusst das Leben sterbenskranker Menschen und die Kommunikation mit ihnen.
Der Husten bleibt, wird stärker und hartnäckiger. Wir suchen nach Erklärungen und überlegen, ob wir nicht doch besser zum Arzt gehen sollten. Es kann lange dauern, ehe um fachliche Hilfe gebeten wird. Nachdem alle Hausmittel versagen, sind wir irritiert und beschließen endlich, zum Hausarzt zu gehen.
„Lange, lange Zeit hatte er sich immer eingeredet, dass ihm nichts fehle, überhaupt nichts, und mit viel Ausdauer die Konsultation eines Arztes hinausgeschoben. … Und als er endlich hinging, wollte er nicht begreifen, was mit ihm los war. Er glaubte nicht seinem gesunden Verstand, sondern dem Wunsch: Ich habe keinen Krebs, und es wird vorübergehen.
Aber die Zunge schmerzte, die flinke, geschickte, verborgene, im Leben so nützliche Zunge. Fünfzig Jahre hatte er mit ihr viel erreicht. … Und plötzlich schwoll sie an. Begann an die Zähne zu stoßen. Ihr kraftvolles, weiches Bett wurde ihr zu eng. Aber er wollte das alles nicht wahrhaben.“51