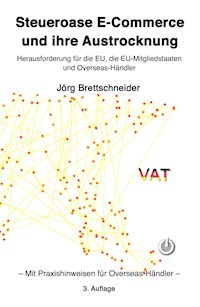19,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Eine Vielzahl von Händlern aus Drittländern (insbesondere aus der V. R. China) bieten Waren auf E-Commerce-Plattformen wie Amazon und eBay zum Verkauf an. Es kommt in diesem Zusammenhang zu Abgabenhinterziehungen großen Ausmaßes mit der Nebenfolge von Wettbewerbsverzerrungen. Es wird die Frage behandelt, welche Schritte die Bundesrepublik Deutschland unter Beachtung des EU-Rahmens dagegen unternehmen kann. Es sind einerseits rechtliche Voraussetzungen zur Verbesserung der Kontrolle zu schaffen und andererseits ist die Compliance zu erleichtern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Jörg Brettschneider
Steuerbetrug im Overseas E-Commerce als gesetzgeberische Aufgabe
Verbesserung der Kontrolle und Vereinfachung der Compliance
Copyright: © 2017: Dr. Jörg Brettschneider
Lindenweg 1
D-25856 Hattstedt
Coverdesign: Qian Zhang – ichbinzq@163com
Verlag und Druck:
tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
„Die Digitalisierung der Wirtschaft hat Herausforderungen für die Steuerpolitik geschaffen, die immer dringender nach einer Lösung verlangen. Es braucht innovative und zukunftsweisende Lösungen, um mit diesen neuen Trends Schritt halten zu können. Die Steuervorschriften müssen weiterentwickelt werden, um sie dem raschen Wandel von Geschäftsmodellen und Verbrauchsmustern anzupassen. Gleichzeitig sollte die Besteuerung fair und wirksam für neu gegründete Unternehmen sein und positiv zur Entwicklung des digitalen Binnenmarkts beitragen“
(Kommission, Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, Follow-up zum Aktionsplan im Bereich der Mehrwertsteuer, Auf dem Weg zu einem einheitlichen europäischen Mehrwertsteuerraum: Zeit zu handeln, COM(2017) 566 final, S. 5).
„In einem wirklichen Binnenmarkt sollte es genauso einfach sein, von Köln nach Paris zu liefern wie von Köln nach München“ (Ursprungslandkommission, Ausarbeitung der endgültigen Regelung für die Umsatzbesteuerung des innergemeinschaftlichen Waren- und Dienstleistungsverkehrs und ein funktionsfähiges Clearing-Verfahren, UR 1994, S. 213, 214)
„As HMRC knows, for some long while Amazon and eBay have been collaborating with hundreds of overseas retailers to defraud the taxman of millions of pounds every day. It seems that HMRC has been very slow in its response. Does HMRC realise the importance of effective and speedy enforcement for the fairness of the tax system and for the protection of honest internet retailers, and why has it been so reluctant to work openly and actively with UK businesses that know this part of the internet backwards and are in a position to help it make its enforcement effective and speedy?“
(Lord Lucas (Con), in Hansard, House of Lords, 21. December 2015, Vol. 767, Column 2306, https://hansard.parliament.uk/Lords/2015-12-21/debates/1512215000594/VATEvasion?highlight=2306#contribution-1512215000017).
Vorwort
Der Begriff „Overseas E-Commerce“ bezeichnet hier den Handel mit Waren (und Leistungen), die über E-Commerce-Plattformen wie Amazon und eBay vermittelt werden und einen händlerseitigen Bezug zu Drittstaaten aufweisen. Dabei haben die Verkäufer ihren Sitz außerhalb der EU und die Käufer sind innerhalb der EU ansässig.
Anlass dieser Ausführungen zum Steuerbetrug1 im Overseas E-Commerce sind meine beruflichen Erfahrungen als Rechtsanwalt. Ich berate vor allem chinesische Mandanten in wirtschaftsrechtlichen Fragen.
Im Interesse der rechtstreuen Händler (auch der rechtstreuen Händler aus der V. R. China) ist einerseits zu hoffen, dass Abgabenhinterziehungen im E-Commerce möglichst bald effektiv sanktioniert werden. Andererseits sind Schritte zur Vereinfachung der Compliance für grenzüberschreitend tätige Händler dringlich. Es steht zu befürchten, dass der deutsche Gesetzgeber und die EU lange Zeit benötigen werden, um ausgewogene legislative Antworten auf diese Fragen zu finden und umzusetzen.
Ich danke Peng Lu, Hamburg, für seine äußerst wertvollen Hinweise und Erläuterungen zur Praxis des Overseas E-Commerce, die diesen Aufsatz geprägt haben. Er hat mich in die Welt des internationalen E-Commerce eingeführt und mit mir stundenlang das hier behandelte Thema diskutiert. Zudem gilt dem Hessischen Finanzministerium Dank für ein ausführliches Gespräch zusammen mit Peng Lu und dem Verfasser am 12.10.2017 in Wiesbaden. Ein wertvolles Gespräch wurde im Rahmen eines Mandats auch mit der Steuerfahndung Hamburg Anfang 2017 geführt. Weitere wertvolle Gespräche führten Peng Lu und der Verfasser mit Roger Gothmann von der taxdoo GmbH und Gordian Brockstedt von der Accountone UG (haftungsbeschränkt). Dank gilt Professor Qian Zhang (Xi’an, V. R. China) für das Cover-Design in Form einer Bezugnahme auf die (alte) Seidenstraße, für den Satz und die Herstellung Erik Kinting (Hamburg) und für das Korrektorat Manfred Weichselbaumer (Köln). Für alle etwaigen Fehler, Ungenauigkeiten etc. ist selbstverständlich der Verfasser allein verantwortlich.
Eine Diskriminierung chinesischer Händler oder gar des chinesischen Volkes ist mit den folgenden Ausführungen keinesfalls beabsichtigt. Ich habe äußerste Hochachtung vor den Leistungen des chinesischen Volkes und schätze u.a. Gastfreundschaft und Freundlichkeit in der V. R. China außerordentlich. Jeder Aufenthalt in der V. R. China hat für mich einen großen Wert.
Die Verwendung der männlichen Form geschieht lediglich zu Zwecken der sprachlichen Vereinfachung. Auch diesbezüglich ist keine Diskriminierung beabsichtigt.
Ich habe mich bewusst für ein Self-Publishing dieses Werkes entschieden, da der Text angesichts der Aktualität des Themas sehr zeitnah als Buch vorliegen sollte und ich das Self-Publishing als ein persönliches Experiment betrachte. Aufgrund dieser Veröffentlichungsform kann das Werk auch relativ günstig angeboten werden und eine Neuauflage unter Berücksichtigung weiterer Entwicklungen ist grundsätzlich zu geringen Kosten möglich. Entscheidend für den Erfolg dieser Publikationsweise wird sein, ob das Buch eine angemessene Verbreitung finden wird.
Finanzmittel für die Publikation dieses Werks sind von keiner Seite geflossen. Meine vertretenen Ansichten sind deswegen „nicht gefärbt“.
Das Werk befindet sich auf dem Stand von Anfang November 2017. Dies gilt auch für die Links auf Internetseiten.
Über Kommentare und Anregungen von Ihnen würde ich mich freuen.
Hamburg, im November 2017
1 Zum Begriff des „Steuerbetrugs“ vgl. Gaede, Der Steuerbetrug, Eine Untersuchung zur Systematisierung der europäisierten Deliktsfamilie des Betruges und zur legitimen Reichweite des notwendig normgeprägten Betrugsunrechts der Steuerhinterziehung, Zugleich ein Beitrag zum Verhältnis von Strafrecht und Verfassungsrecht, S. 27.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
A. Overseas E-Commerce vor dem Hintergrund abgabenrechtlicher Pflichten
I. Direktversand
II. Versand mittels Einschaltung Overseas Warehouses
1) Funktionsweise
2) Rechtliche Pflichten der Händler
III. Quantitative Bedeutung der Abgabenhinterziehungen und Folgen
IV. Kosten der umsatzsteuerrechtlichen Compliance
B. Relevante zukünftige Rechtsetzung auf EU-Ebene
I. Schaffung eines Systems einer einzigen Anlaufstelle
II. Abschaffung der Kleinbetragsregelung in Bezug auf Einfuhrumsatzsteuer
III. EU-MwSt-Forum
IV. Veränderung der Regelungen in Bezug auf grenzüberschreitenden Handel
C. Gesetzgeberische Maßnahmen in Großbritannien und deren Übertragbarkeit auf Deutschland
I. Haftung von Onlineplattform-Betreibern
1) Darstellung
2) Bewertung und Vorbildcharakter der britischen Regelung für Deutschland?
II. Pflicht zur Bestellung eines haftenden Repräsentanten und zur Sicherheitsleistung
III. Due Diligence Scheme für Fulfillment-Dienstleister
1) Darstellung
2) Bewertung und rechtspolitische Bedeutung für Deutschland
D. Diskussion um Split Payment
I. Einziehung der Umsatzsteuer durch Banken und Zahlungsdienstleister
II. Einziehung der Umsatzsteuer durch Online-Plattformen
III. Bewertung
E. Weitere rechtspolitische Vorschläge einer nationalen Regelung in Deutschland
I. Diskussionsverlauf in Deutschland
II. Erweiterung der Wissensbasis des Gesetzgebers
III. Vereinfachung der laufenden Compliance
1) Bereitstellung von Informationen
2) Unterstützung von IT-unterstützer Compliance
IV. Beschleunigung der umsatzsteuerlichen Registrierung
V. Stärkung der Ermittlungen
1) Pflicht von Plattform-Betreibern zur Bestellung eines persönlichen Repräsentanten im Inland zu Steuerzwecken
2) Informationspflichten
3) Datenabruf der Finanzbehörden bei Kontrollbedürfnis
3) Meldebutton in Bezug auf Verdachtsfälle
4) Kontrolle von Sendungen mit geringem Wert und Sanktionierung von Missbrauch
5) Schaffung von Anreizen von Fulfillment über Private Zolllager
VI. Haftbarmachung von Verbrauchern für Umsatzsteuer und Einziehung von Verbrauchern
F. Fazit
I. Mögliche Maßnahmen Deutschlands
1. Themenbereich: Wissensgenerierung und Information
2. Themenbereich: Verbesserung der Kontrolle
3. Themenbereich: Vereinfachung der Compliance
II. Wahrscheinliche Regelung in Deutschland
III. Perspektive auf EU-Ebene
Abstract in English
Literaturverzeichnis
Zum Verfasser
Abkürzungsverzeichnis
ABl. EU
Amtsblatt der Europäischen Union
Abs.
Absatz
AO
Abgabenordnung
Art.
Artikel
Aufl.
Auflage
Az.
Aktenzeichen
BB
Betriebs-Berater
Bd.
Band
BFH
Bundesfinanzhof
BGBl.
Bundesgesetzblatt
BGH
Bundesgerichtshof
BGHZ
Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
BKR
Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht
BStBl.
Bundessteuerblatt
BT-Drs.
Drucksache des Deutschen Bundestages
BVerfG
Bundesverfassungsgericht
BVerfGE
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
c’t
Magazin für Computer Technik
CR
Computer und Recht
DB
Der Betrieb
DIHK
Deutscher Industrie- und Handelskammertag
Diss.
Dissertation
Drs.
Drucksache
DStZ
Deutsche Steuer-Zeitung
endg.
endgültig
EU
Europäische Union
EuGH
Europäischer Gerichtshof
FinBeh
Finanzbehörde(n)
FS
Festschrift
GG
Grundgesetz
HM
Her Majesty
HMRC
HM Revenue & Customs
Hrsg.
Herausgeber
hrsg.
herausgegeben
IStR
Internationales Steuerrecht
jM
juris – Die Monatszeitschrift
jurisPR-BKR
juris PraxisReport Bank- und Kapitalmarktrecht
JuS
Juristische Schulung
Lfg.
Lieferung
LG
Landgericht
MMR
MultiMedia und Recht
MwSt.
Mehrwertsteuer
NJW
Neue Juristische Wochenschrift
NStZ
Neue Zeitschrift für Strafrecht
o. V.
ohne Verfasserangabe
OECD
Organisation for Economic Co-operation and Development
PIStB
Praxis Internationale Steuerberatung
PStR
Praxis Steuerstrafrecht
Rn.
Randnummer
Rs.
Rechtssache
S.
Seite
Sec.
Section
Tz.
Textzeichen
UR
Umsatzsteuer-Rundschau
USt
Umsatzsteuer
UStB
Umsatzsteuerberater
UStG
Umsatzsteuergesetz
UVR
Umsatzsteuer- und Verkehrsteuer-Recht
VAT
Value Added Tax
Vgl.
vergleiche
VVDStRL
Veröffentlichung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer
ZfZ
Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern
ZSTW
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft – ZStW
Es wird ergänzend verwiesen auf das Werk Kirchner/Böttcher, Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache, 8. Aufl., Berlin 2015.
A. Overseas E-Commerce vor dem Hintergrund abgabenrechtlicher Pflichten
Eine Vielzahl von Händlern aus Drittländern (§ 1 Abs. 2a Satz 3 UStG), vor allem Händler aus der V. R. China2, und dort aus der Hauptstadt der E-Commerce-Händler Shenzhen3, bieten auf Online-Marktplätzen (E-Commerce-Plattformen) 4 wie Amazon und eBay Waren in den EU-Mitgliedstaaten, der USA und Australien an. Die Händler aus der V. R. China dominieren den Overseas E-Commerce.5 Erstens ist die V. R. China ein sehr wichtiger exportorientierter Produktionsstandort. Zweitens besitzt der E-Commerce in der V. R. China – als E-Commerce-Nation – mit den Plattformen Alibaba6, Taobao, Jingdong (JD.com)7, Weipinhui, Jumeiyoupin usw. selbst eine sehr hohe Bedeutung. Zu erwähnen ist auch der E-Commerce-Singles Day am 11.11. jeden Jahres – double 11 –, und die Bedeutung von WeChat als Kommunikationsmittel und Verkaufs-Tool8. Die V. R. China hat sich eine führende Position im E-Commerce erarbeitet. 9 Der E-Commerce ist dort mit der erwirtschafteten Umsatzhöhe zu einem sehr erfolgreichen und dynamischen Markt geworden, der regelmäßig neue, mittels Umsatzvolumina definierte E-Commerce-Stars 10 hervorbringt. Drittens baut der chinesische E-Commerce gerade auf eine Vielzahl von Händlern auf, d.h. die Waren werden oft nicht von den Plattformen selbst geliefert, sondern von sparaten Händlern,11 wodurch für eine Vielzahl von Personen und Familien 12 unternehmerische Betätigung möglich wird.13 Ein nach Größe mittlerer chinesischer Händler setzt Waren im Wert von ca. 1 Mio. EUR pro Monat um. Aufgrund der Marktbedeutung der chinesischen Händler stehen sie ganz im Vordergrund der folgenden Betrachtung. Zielgruppe der Händler sind vor allem Verbraucher (B2C), denn E-Commerce ist bislang vor allem Phänomen des B2C-Handels.
Bei den Händlern mit Sitz in der V. R. China handelt es sich zum Teil um Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitern. Jeder Mitarbeiter eines solchen Unternehmens betreut oft jeweils einen Account, d. h. bietet selbständig mittels einer gewählten Bezeichnung Waren an. Dadurch ist das jeweilige Unternehmen mittels einer Vielzahl von Accounts auf den E-Commerce-Plattformen aktiv. E-Commerce Unternehmen mittlerer Größe besitzen mindestens 100 Accounts. Es werden dabei einzelne Waren über die Accounts verkauft als auch Webshops auf den Plattformen betrieben, in denen wiederum die gleichen Händler unter ggfs. anderen Accounts oder andere Händler Waren verkaufen. Zum Teil sind die Accounts auch auf Strohfirmen bzw. Strohleute registriert.
In der EU ist der deutsche Markt (vor dem britischen Markt) für diese Händler am wichtigsten. Demgegenüber steckt z. B. der spanische Markt gerade in den Anfängen der Entwicklung mit positiver Aussicht. Andere mitgliedstaatliche Märkte spielen demgegenüber keine Rolle. Vor diesem Hintergrund kommt aus Perspektive der Händler mit Sitz in der V. R. China und der Plattform-Betreiber der deutschen Reaktion auf die Abgabenhinterziehungen eine ganz wesentliche Bedeutung zu. Der deusche Markt kann von den chinesischen Händlern keinesfalls ignoriert werden, wobei eine andere Frage ist, in welchem Mitgliedstaat das Fulfillment vorgenommen wird. Auch vor diesem Hintergrund kommt der Schaffung der zukünftigen deutschen Regelung zentrale Bedeutung zu.
I. Direktversand
Auf der einen Seite findet ein Direktversand von Waren von einem Drittland (vgl. § 1 Abs. 2, Abs. 2a UStG) und insbesondere der V. R. China aus an Kunden statt.14
Die Lieferzeiten betragen in der Regel mindestens 5 Tage, häufig länger. Ursache für diese Lieferzeiten ist, dass Waren zum Zwecke des Direktversandes typischerweise erst einmal gesammelt und zu einer Luftfrachtsendung zusammengestellt (konsolidiert) werden und als Sammelsendung für den Lufttransport vorbereitet werden. Der Overseas Direktversand von China nach Deutschland entspricht angesichts der Länge der Lieferzeiten damit nicht den Anforderungen des modernen E-Commerce,15 wobei zukünftig die Ansprüche in Bezug auf Schnelligkeit wahrscheinlich noch steigen werden16. Zudem stellt sich im Rahmen des Direktversands das Problem der Abwicklung von Retouren. 17 Auch gerade innerchinesischen Bedürfnissen würde diese Zeitdauer überhaupt nicht entsprechen, wobei in großen Städten z.T. eine kostenfreie Zustellung am selben Tag möglich ist.
Der Zollanmelder (vgl. Art. 4 Nr. 18 ZK18)19 ist verpflichtet, bei der Einfuhr von Waren aus einem Drittland (im Sinne des Überführens der Waren in den freien Verkehr20) Zölle (Art. 201 ZK) und die Einfuhrumsatzsteuer nach nationalem Umsatzsteuersatz (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG) zu zahlen (Art. 201 Abs. 3 Satz 1 ZK, § 13a Abs. 2 UStG iVm, § 21 Abs. 2 UStG; Art. 70 MwStSystRL).21 Dabei stellt die Einfuhrumsatzsteuer22 den größten Betrag dar, sofern Zölle und Einfuhrumsatzsteuer überhaupt anfallen. Es ergibt sich ein großes Steuerhinterziehungspotential durch die Angabe zu niedriger Zollwerte23 und der fälschlichen Deklaration von Waren als Sendungen mit geringem Wert (Kleinsendungen),24 denn für Waren mit einem Wert von unter 150 EUR muss gemäß Art. 23 Zollbefreiungsverordnung25 grundsätzlich kein Zoll, und für Waren von unter 22 EUR keine Einfuhrumsatzsteuer (§ 1a EUStBV) gezahlt werden.26 Die Befreiung gilt auch dann, wenn mehrere Sendungen des Absenders an den Empfänger versendet werden27 oder Waren mittels Sammelsendungen eingeführt werden, sofern jede Ware einzeln verpackt und adressiert ist. 28 Derartige Gestaltungen können ihre Grenze aber im Mißbrauch gemäß § 42 AO29 finden.30
Es gilt aber bei Zollanmeldung seitens des Lieferers, bzw. Versenders, bzw. durch seinen Beauftragten gemäß § 3 Abs. 8 UStG als Ort der Lieferung das Inland und damit fällt auch die Umsatzsteuer (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) an.31 Es ist dabei keine Voraussetzung für das Entstehen der Umsatzsteuerschuld nach § 3 Abs. 8 UStG, dass Einfuhrumsatzsteuer tatsächlich anfällt, so z. B. wenn es sich um geringwertige Waren i.S.d. § 1a EUStBV handelt.32
Im Postverkehr (Beförderung durch die Deutsche Post AG33) gilt der Empfänger als Anmelder (Art. 237 Abs. 2 Satz 1 ZK-DVO)34 und ist damit Schuldner auch der Einfuhrumsatzsteuer (vgl. § 21 Abs. 2 UStG iVm § 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG).35 Die Deutsche Post AG ist berechtigt, in Vertretung des Empfängers (Art. 5 Abs. 2 ZollVG) Zollanmeldungen abzugeben, wenn die Waren nach dem ZK zu gestellen sind (Art. 238 ZK-DVO).36 Andere Paketdienste handeln in Bezug auf die Anmeldung auf Grundlage rechtsgeschäftlicher Vertretung des Einführers.37 Dabei können unverhältnismäßig hohe Kosten38 anfallen (wie z. B. im Fall der Einschaltung der GDSK39 in Höhe von 26,95 EUR pro Sendung). Der Versender kann jedoch die Übernahme der Verzollung und Einfuhrumsatzsteuerzahlung (Lieferung „verzollt und versteuert“40 ) übernehmen und als Anmelder fungieren,41 womit gemäß § 3 Abs. 8 UStG als Ort der Lieferung das Inland gilt.
Es gilt, dass der Anmelder (vgl. Art. 4 Nr. 18 ZK) grundsätzlich eine in der EU ansässige Person sein muss (Art. 64 Abs. 2 b) ZK), die damit auch für die Zollschuld haftet.42 Damit soll die „Prüfbarkeit der zollrechtlichen Vorgänge“ und die Durchsetzbarkeit von abgabenrechtlichen Ansprüchen sichergestellt werden.43 Bei nur gelegentlichen Anmeldungen kann von der Regelung befreit werden,44 wobei das Merkmal einer „nur gelegentlichen“ Anmeldung erfüllt ist, wenn weniger als 10 Anmeldungen im Jahr erfolgen45.
II. Versand mittels Einschaltung Overseas Warehouses
1) Funktionsweise
Auf der anderen Seite werden die Waren auch bereits zum Zeitpunkt des Verkaufes in den Zielländern bzw. in anderen EU-Mitgliedstaaten gelagert und verwaltet, um eine sehr schnelle Zustellung zu gewährleisten. Die ursprüngliche Barriere der räumlichen Entfernung des Händlers zu den Käufern wird damit aufgehoben. Ermöglicht wird dieses Angebot durch Overseas Warehouses (so die gängige Bezeichnung in der V. R. China auf Englisch46) bzw. durch Fulfillment-Dienstleister47, die die Waren nach dem Verkauf über E-Commerce-Plattformen wie Amazon oder eBay48 oder Rakuten vom Mitgliedstaat aus, in dem der Verbraucher wohnt, bzw. von einem Nachbarland aus im Auftrag der Händler versenden.49 Vor dem Hintergrund der sich damit eröffnenden Möglichkeiten wird der Aufbau von Overseas Warehouses im Ausland durch die chinesische Regierung im Rahmen der „One Belt and one Road“-Strategie50 („Neue Seidenstraße“51) ausdrücklich unterstützt.52
Das Leistungsangebot chinesischer Service-Anbieter (wie z. B. das Leistungsangebot der BFE Corp. Ltd., Hong Kong/Guangzhou) bezieht sich dabei auch auf Importabwicklungen für chinesische Händler und Fulfillment über von ihnen selbst initiierte Gesellschaften. Es handelt sich damit um ein Komplettpaket. Chinesische Händler zahlen dafür an chinesische Dienstleister sehr oft Pauschalpreise für den Transport und Import und damit auch zur Abgeltung der Einfuhrabgaben nach kg (!). Gängig sind zurzeit für ein Komplettpaket 4 EUR pro kg. bei Beförderung mittels Luftfracht.53 Fulfillment-Dienstleister wie Amazon54 sind hingegen an der Importabwicklung und der umsatzsteuerrechtlichen Compliance (im Sinne der Erfüllung der umsatzsteuerlichen Rechtsvorschriften als Teil der Tax-Compliance55) ausdrücklich nicht beteiligt.56
Wenn chinesische Dienstleister involviert sind, spalten diese ihre Aktivitäten auf verschiedene Gesellschaften auf. 57 Es existiert eine chinesische Gesellschaft, die die Verträge mit den Händlern schließt und die Einnahmen generiert. Die Lager in den Zielländern werden durch weitere Gesellschaften betrieben.58 Es kann sich um Tochtergesellschaften handeln oder um Gesellschaften, deren Anteile über Strohleute gehalten werden. Als zollrechtliche Anmelderin der Waren59, die persönlich u.a. für die Richtigkeit der Angaben haftet (Art. 199 Abs. 1 ZK-DVO)60 und Schuldnerin der Einfuhrabgaben ist61, kann eine weitere Gesellschaft auftreten62 (als Anmelder/in muss wie angedeutet eine in der EU ansässige Person agieren, vgl. Art. 4 Nr. 2 ZK). Der Nachweis, wer wirklich hinter den Geschäften steckt, ist aufgrund dieser Verschachtelung problematisch und kann staatliches Einschreiten erheblich erschweren.63 Grafisch lässt sich das mögliche Zusammenspiel der verschiedenen Gesellschaften wie folgt visulisieren:
2) Rechtliche Pflichten der Händler
B. Relevante zukünftige Rechtsetzung auf EU-Ebene
Für die EU stellt sich die Aufgabe, den Ordnungsrahmen des Overseas E-Commerce im Hinblick auf die Durchsetzung der Abgabeansprüche der Mitgliedstaaten zu reformieren.1 Bereits in der Frühphase des Internets wurden die Durchsetzung der (Umsatzsteuer-) Ansprüche von Staaten im E-Commerce – auch gerade in den USA, wo sich E-Commerce frühzeitig stark entwickelte – intensiv diskutiert.2 Diese Diskussion steht auch in Zusammenhang mit dem Vorschlag einer „bit tax“3 und dem E-Card-Vorschlag der Clinton-Administration, bei dem es u.a. um die Identifikation des Staates, in dem der Empfänger ansässig ist, mittels einer E-Card als steuerlicher Anknüfungspunkt geht. 4 Heute können die Compliance-Aufwendungen für Händler, die auf dem US-amerikanischen Markt aktiv sind, auch dort erheblich sein, da Bundesstaaten vor dem Hintergrund der Commerce Clause im Fall eines Nexus sales taxes und use taxes (bei letzterem handelt es sich Art Einfuhrumsatzsteuer, deren Zweck die Hebung der zu entrichtenden Steuer auf das örtliche Niveau ist5)6 verlangen können:7
„Perhaps the foremost tax challenge faced by online retailers today relates to sales and use tax compliance. When an online retailer makes a sale in the United States, it may be shipping it’s products to one of roughly 10,000 different sales tax jurisdictions. For retailers lacking substantial tax resources, navigating the different sales and use tax laws of these jurisdictions – determining the applicable sales and use tax rates. Ascertaining the correct tax base, collecting tax from customers, filing the appropriate returns, and remitting proper payment – is a nearly insurmountable task“.8
Die Schaffung eines gemeinsamen Mehrwertsteuersystems9 ist seit langem Ziel auf EU-Ebene, wobei dieses Feld auch vor dem Hintergrund des Einstimmigkeitserfordernisses 10 durch eine Geschichte von Verzögerungen geprägt ist, die bis heute fortdauern. Die Kommission forderte im Jahr 1987 in Bezug auf die Verwirklichung des Binnenmarktes zum Jahresbeginn 1993 (auch vor dem Hinterrund des Umsatzsteuerkarussellbetrugs11), ein umsatzsteuerrechtliches Herkunftslandprinzip12 einzuführen13 und ist bei diesem Ansatz lange geblieben.14 Auch der Bundestag, Bundesrat 15 und Ursprungslandkommission 16 forderten den Übergang zu einem umsatzsteuerrechtlichen Herkunftslandprinzip. Dieser Plan stellte sich im Nachhinein als zu ambitioniert und deswegen nicht zu verwirklichend dar 17. Die Kommission formulierte im Jahr 1997 das Ziel, einen „einheitliche[n] ordnungspolitische[n] Rahmen für den elektronischen Geschäftsverkehr“ zu schaffen.18 Es wurde ausdrücklich das Problem genannt, dass Internetanbieter verschiedenen nationalen Regelungen 19 unterliegen.20 Dies führt zu einer Kumulation rechtlicher Anforderungen,21 die gerade im E-Commerce aufgrund seines grenzüberschreitenden Charakters höchst problematisch sind. Im Bereich der Mehrwertsteuer sind die Erfolge einer Koordinierung jedoch sehr gering. Die Besteuerung ist von der E-Commerce-Richtline22 ausdrücklich ausgenommen (Art. 1 Abs. 5, Erwägungsgründe 12, 13). Die Kommission möchte mit dem von ihr 2016 vorgelegten Aktionsplan eine Diskussion mit den Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament anstoßen, und sie wollte bereits im Jahr 2016 entsprechende Vorschläge in Bezug auf die Anpassung der mehrwertsteuerrechtlichen Regelungen an die Bedürfnisse der Digitalisierung unterbreiten.23