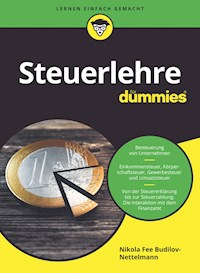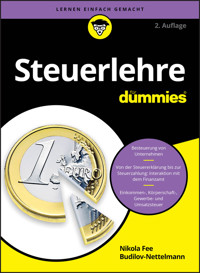
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Für Dummies
- Sprache: Deutsch
Steuern Sie auf eine Prüfung zu?
Bereiten Sie sich mit diesem Buch vor!
Studieren Sie in einem wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang und müssen deshalb die Grundzüge der betrieblichen Steuerlehre beherrschen? Dieses Buch erklärt Ihnen steuerrechtliche Grundprinzipien und stellt Ihnen die Steuerarten vor, die für Wirtschaftswissenschaftler und Unternehmen relevant sind: Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer. Anschauliche Praxisbeispiele und Fallstudien bringen Leben in das Thema, und Sie werden sehen: Steuerlehre kann richtig spannend sein!
Sie erfahren
- Welche Rechte und Pflichten sich im Besteuerungsverfahren ergeben
- Wie Sie die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer berechnen
- Welche Leistungen Umsatzsteuer auslösen und wann Vorsteuer abgezogen werden kann
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 742
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Steuerlehre für Dummies
Schummelseite
EINKOMMENSTEUER
Einordnung in das Steuersystem: Personensteuer und ErtragsteuerSteuersubjekt (wer wird besteuert?): natürliche Person mit Wohnsitz (§ 8 AO) oder gewöhnlichem Aufenthalt (§ 9 AO) im Inland, § 1 Abs. 1 EStG (unbeschränkt einkommensteuerpflichtig)Steuerobjekt (was wird besteuert?): Einkommen, quantifiziert durch das zu versteuernde Einkommen als Bemessungsgrundlage, § 2 Abs. 5 EStGTarif (Zusammenspiel von Steuersatz oder Tarifformel und Bemessungsgrundlage): Normaltarif (Tarifformel) verläuft linear-progressiv, § 32a EStG; Eingangssteuersatz: 14 %, Spitzensteuersatz 42 % bzw. 45 %, Sondertarif für private Kapitalerträge, § 32d Abs. 1 EStG (25 %)Hilfreicher Link zur Berechnung der Steuer: www.bmf-steuerrechner.deSteuererhebung: vierteljährliche Vorauszahlungen als Abschlagzahlungen auf die voraussichtliche Jahressteuerschuld, § 37 EStG; Lohnsteuer (§§ 38 bis 42g EStG) und Kapitalertragsteuer (§§ 43 bis 45e EStG) als im Abzugsverfahren erhobene Steuern; Kapitalertragsteuer als Abgeltungsteuer; Abschlusszahlung ist einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig, § 36 Abs. 4 EStG.KÖRPERSCHAFTSTEUER
Einordnung in das Steuersystem: Personensteuer und ErtragsteuerSteuersubjekt: juristische Person mit Sitz (§ 11 AO) oder Ort der Geschäftsleitung (§ 10 AO) im Inland, § 1 KStG (unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig)Steuerobjekt: Einkommen, quantifiziert durch das zu versteuernde Einkommen als Bemessungsgrundlage, § 7 Abs. 1 KStGTarif: ist proportional in Höhe von 15 % des zu versteuernden Einkommens, § 23 Abs. 1 KStGSteuererhebung: vierteljährliche Vorauszahlungen als Abschlagzahlungen auf die voraussichtliche Jahressteuerschuld, § 31 Abs. 1 KStG i.V.m. 37 EStG; Kapitalertragsteuer als im Abzugsverfahren erhobene Steuern, bei Kapitalgesellschaften nicht als Abgeltungsteuer ausgestaltet; Abschlusszahlung ist einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig, § 31 Abs. 1 KStG i.V.m. § 36 Abs. 4 EStG.GEWERBESTEUER
Einordnung in das Steuersystem: Objektsteuer und ErtragsteuerSteuersubjekt: Steuerschuldner ist der Unternehmer. Als Unternehmer gilt der, für dessen Rechnung das Gewerbe betrieben wird, § 5 Abs. 1 GewStG.Steuerobjekt: Gewerbebetrieb, quantifiziert durch den Gewerbeertrag als Besteuerungsgrundlage, § 6 GewStGTarif: ist zweigeteilt in eine proportionale Steuermesszahl (3,5 %, § 11 Abs. 2 GewStG) und einen Hebesatz, der von den Gemeinden festgesetzt wird (Mindesthebesatz: 200 %, § 16 Abs. 4 GewStG)Hilfreicher Link für Gewerbesteuerhebesätze: https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Hebesaetze.htmlSteuererhebung: vierteljährliche Vorauszahlungen als Abschlagzahlungen auf die voraussichtliche Jahressteuerschuld, § 19 GewStG; Abschlusszahlung ist einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig, § 20 Abs. 2 GewStG.UMSATZSTEUER
Einordnung in das Steuersystem: (allgemeine) Verkehrsteuer und VerbrauchsteuerSteuersubjekt: Unternehmer. Unternehmer ist, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbständig ausübt, § 2 Abs. 1 UStG. Wirtschaftlich belastet ist der Endverbraucher (Konsument).Steuerobjekt: hauptsächlich Lieferungen und sonstige Leistungen, § 1 Abs. 1 UStGTarif: ist proportional ausgestaltet und zweigeteilt als Normaltarif (19 %) und ermäßigter Tarif (7 %), § 12 UStGSteuererhebung: monatliche oder vierteljährliche Vorauszahlungen auf der Basis von Umsatzsteuervoranmeldungen, § 18 Abs. 2 UStG; Abschlusszahlung ist einen Monat nach dem Eingang der Steueranmeldung fällig, § 18 Abs. 4 UStG
Steuerlehre für Dummies
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
2. Auflage 2025
© 2025 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße 12, 69469 Weinheim, Germany
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Bevollmächtigte des Herstellers gemäß EU-Produktsicherheitsverordnung ist die Wiley-VCH GmbH, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Deutschland, E-Mail: [email protected].
Alle Rechte bezüglich Text und Data Mining sowie Training von künstlicher Intelligenz oder ähnlichen Technologien bleiben vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne die schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Coverfoto: © janvier / stock.adobe.comKorrektur: Johanna Rupp, WalldorfProjektmanagement und Lektorat: Katharina Hemschemeier, Berlin
Print ISBN: 978-3-527-72177-1ePub ISBN: 978-3-527-85587-2
Über die Autorin
Nikola Fee Budilov-Nettelmann ist Steuerberaterin und Professorin für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere betriebliche Steuerlehre an der Technischen Hochschule Wildau. Ihre Leidenschaft hat sie zu ihrem Beruf gemacht: die Wissensvermittlung. Das Steuerrecht mit seinen vielen Facetten bietet ihr die perfekte Challenge, um komplizierte Sachverhalte verständlich darzustellen. Der praktische Bezug ist ihr dabei immer sehr wichtig. Inspiration und Erholung findet sie bei der Gartenarbeit und beim Musizieren. Mit ihrem Mann lebt sie in Berlin, die beiden Töchter sind schon erwachsen.
Ich widme das Buch meinem Vater, Steuerberater Prof. Achim Nettelmann (†), der mir schon früh gezeigt hat, dass das Steuerrecht gar nicht trocken und langweilig sein muss. Der Austausch mit ihm hat mich bei vielen Fallbeispielen inspiriert. Danke, Papa!
Über die Fachkorrektorinnen
Christine Immenkötter ist Steuerberater und Professorin für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Rechnungswesen, Finanzwirtschaft und am allerliebsten Steuern an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Zuvor war sie bei einer der Big Four Steuerberatungsgesellschaften im Bereich Internationales Steuerrecht tätig und gibt heute nun ihre Begeisterung für das Fach Steuern an ihre Studierenden weiter. Als Ausgleich zum Beruf findet man sie bei schönem Wetter im eigenen Garten oder wetteifert mit ihrem Mann und vor allem den beiden Söhnen, wer den höchsten Lego-Turm bauen kann.
Sabrina Ruge lebt mit ihrer Familie in Hannover. Dort arbeitet sie als Syndikus-Steuerberaterin für einen weltweit agierenden Rückversicherungskonzern, bei dem sie ihre Begeisterung für das Internationale Steuerrecht mit Schwerpunkt Betriebsstättenbesteuerung voll ausleben kann. Zuvor war sie fünf Jahre in der Steuerberatung für eine Big Four Gesellschaft mit dem Industrieschwerpunkt Financial Services tätig.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Über die Autorin
Über die Fachkorrektorinnen
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Über dieses Buch
Konventionen in diesem Buch
Was Sie nicht lesen müssen
Törichte Annahmen über den Leser
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Wie es weitergeht
Teil I: Ohne Grundlagen geht es nicht
Kapitel 1: Worum es geht: Steuern und Steuersystem
Steuern und ihre Notwendigkeit
Die Definition von Steuern
Die Systematisierung von Steuerarten
Es wird konkreter: Steuersubjekt, Steuerobjekt, Bemessungsgrundlage und Steuertarif
Steuern in Forschung und Lehre
Kapitel 2: Unternehmensbesteuerung im Überblick
Unternehmensbesteuerung ist rechtsformabhängig
Besteuerung von Personen- und Kapitalgesellschaften
Wenn die Gesellschaft mit dem Gesellschafter einen Vertrag abschließt
Was ist mit den Verlusten?
Ertragsteuerliche Gesamtbelastung
Umsatzsteuer: Auch eine Unternehmensteuer?
Kapitel 3: Rechtsquellen der Besteuerung
Steuergesetze: Der normative Rahmen
Durchführungsverordnungen
Verwaltungsvorschriften: Die Meinung der Finanzbehörden
Rechtsprechung: Nicht nur für Kläger und Beklagten
Doppelbesteuerungsabkommen
Europäisches (Steuer-)Recht als überstaatliches Recht
Steuerberater: Hilfe im Steuerdschungel
Kapitel 4: Das Besteuerungsverfahren
Das Ermittlungsverfahren
Das Festsetzungs- und Feststellungsverfahren
Wie kommt der Staat an sein Geld? Das Erhebungsverfahren
Das Rechtsbehelfsverfahren
Teil II: Die Besteuerung natürlicher Personen: Die Einkommensteuer
Kapitel 5: Überblick und Wegweiser
Einkommensteuer kurz gefasst
Schema zur Ermittlung der Einkommensteuer
Vom Lebenssachverhalt zur Einkommensteuer
Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag
Kapitel 6: Am Anfang war … die persönliche Steuerpflicht
Steuerinländer und Steuerausländer
Welteinkommen im Fokus: Die unbeschränkte Steuerpflicht
Inlandseinkommen im Visier: Die beschränkte Steuerpflicht
Die Doppelbesteuerung und deren Vermeidung
Sonderformen der persönlichen Steuerpflicht
Kapitel 7: Die sachliche Steuerpflicht (Steuerobjekt)
Darf ich vorstellen? Die sieben Einkunftsarten
Steuerfreies Einkommen
Gewinn- und Überschusseinkünfte und steuerliche Vermögenskategorien
Was »Einkünfte« sind: Das objektive Nettoprinzip
Private Ausgaben und das subjektive Nettoprinzip
Gemischte Aufwendungen
Negative Einkünfte und Verlustausgleich
Weitere Vorgehensweise
Kapitel 8: Was gehört wozu? Die Einkunftsarten
Die Rangfolge der Einkunftsarten
Die Gewinneinkünfte
Die Überschusseinkünfte
Kapitel 9: Wie was berechnen? Ermittlung der Überschusseinkünfte
Ermittlungsgrundsätze für Überschusseinkünfte
Einnahmen
Werbungskosten
Kapitel 10: Bilanzieren oder nicht? Ermittlung der Gewinneinkünfte
Überblick und Grundlagen
Der Betriebsvermögensvergleich
Die Einnahmen-Überschussrechnung
Kapitel 11: Kapitalerträge im System der Einkommensbesteuerung
Welche Kapitalerträge es betrifft oder nicht
Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen
Sondertarif für Einkünfte aus Kapitalvermögen
Kapitalertragsteuer als Abgeltungsteuer
Kapitalerträge in der Steuererklärung
Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer
(Bestimmte) betriebliche Kapitalerträge und Teileinkünfteverfahren
Kapitel 12: Private Abzugsbeträge: Die Ermittlung der Bemessungsgrundlage
Private Ausgaben
Vorsorgeaufwendungen und weitere Sonderausgaben
Außergewöhnliche Belastungen
Kinder und Steuern: Der Familienleistungsausgleich
Kapitel 13: Steuertarif
Der Normaltarif nach § 32a EStG
Veranlagung von Eheleuten und Splittingtarif
Steuerfreiheit mit Einschränkungen: Progressionsvorbehalt
Proportional: Sondertarif bei Kapitaleinkünften
Kapitel 14: Steuerermäßigungen, Steuerfestsetzung und Steuerzahlung
Steuerermäßigung für gewerbliche Einkünfte
Steuerermäßigung für Handwerker und Haushaltshilfen
Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer
Steuerzahlung: Welchen Betrag bekommt das Finanzamt?
Kapitel 15: Besteuerung von Personengesellschaften
Personengesellschaft als (k)ein Steuersubjekt
Einkünfte der Gesellschafter
Steuerliches Betriebsvermögen der Personengesellschaft
Gewinnermittlung auf zwei Stufen
Gewinnverwendung und Thesaurierungsbegünstigung
Besteuerungsverfahren bei Personengesellschaften
Teil III: Die Besteuerung juristischer Personen: Die Körperschaftsteuer
Kapitel 16: Überblick und Wegweisung
Körperschaftsteuer kurz und knapp
Trennungsprinzip und Doppelbelastung
Vom Lebenssachverhalt zur Körperschaftsteuer
Schema zur Ermittlung der Körperschaftsteuer
Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag
Kapitel 17: Persönliche Körperschaftsteuerpflicht
Steuerinländer und Steuerausländer
Problem der Doppelbesteuerung
Beginn der Steuerpflicht
Kapitel 18: Sachliche Körperschaftsteuerpflicht und Bemessungsgrundlage
Überblick über die Einkommensermittlung
Von der Handelsbilanz zur Steuerbilanz
Korrekturen außerhalb der Bilanz
Nicht immer positiv: Behandlung von Verlusten
Kapitel 19: Tarif, Steuerzahlungen und Steuerrückstellungen
Sehr gleichmäßig: Der proportionale Steuersatz
Steuerzahlung und Fälligkeiten
Steuerrückstellung und Steuerforderung in der Bilanz
Kapitel 20: Gewinnausschüttungen und Beteiligungserträge
Unternehmensbeteiligungen und Kaskadeneffekt
Gewinnausschüttungen als steuerfreie Beteiligungserträge
Veräußerungsgewinne
Gewinnausschüttung an eine natürliche Person
Kapitel 21: Verdeckte Gewinnausschüttungen und verdeckte Einlagen
Leistungsbeziehungen zwischen Kapitalgesellschaft und Anteilseigner
Wann liegt eine verdeckte Gewinnausschüttung vor?
Steuerliche Behandlung der verdeckten Gewinnausschüttung
Verdeckte Einlage
Steuerliches Einlagekonto
Kapitel 22: Die Organschaft
Voraussetzungen für eine Organschaft
Vorteile der Organschaft
Rechtsfolgen der Organschaft
Ein bisschen Verfahrensrecht gefällig?
Wie ist das mit der Gewerbesteuer?
Teil IV: Besteuerung des Gewerbebetriebs: Die Gewerbesteuer
Kapitel 23: Überblick und Wegweisung
Gewerbesteuer kurz gefasst
Schema zur Ermittlung der Gewerbesteuer
Steuergegenstand: Der Gewerbebetrieb
Mehrere Gewerbebetriebe
Beginn und Ende der Gewerbesteuerpflicht
Steuerschuldner
Kapitel 24: Bemessungsgrundlage bei der Gewerbesteuer
Ausgangsgröße: Einkünfte aus Gewerbebetrieb
Hinzurechnungen
Kürzungen
Spenden
Nicht immer positiv: Behandlung von Verlusten
Kapitel 25: Tarif, Steuerzahlung, Rückstellung
Zweigeteilt und standortabhängig: Der Gewerbesteuertarif
Besonderheiten des Besteuerungsverfahrens
Steuerrückstellung und Steuerforderung in der Bilanz
Zerlegung: Ein Gewerbebetrieb in mehreren Gemeinden
Zusammenspiel von Einkommensteuer und Gewerbesteuer
Kapitel 26: Beteiligungserträge bei der Gewerbesteuer
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften
Beteiligung an Personengesellschaften
Teil V: Besteuerung des Umsatzes: Die Umsatzsteuer
Kapitel 27: Grundlagen Umsatzsteuer
Umsatzsteuer kurz gefasst
Das Umsatzsteuersystem
Umsatzsteuer im internationalen Geschäftsverkehr
Harmonisierung der Umsatzsteuer in der EU
Steuergegenstand im Überblick
Schema zur Ermittlung der Umsatzsteuer
Besteuerungsverfahren
Kapitel 28: Der (oder die) Unternehmer
Die Unternehmerfähigkeit
Merkmale der unternehmerischen Tätigkeit
Rahmen des Unternehmens
Kleinunternehmer
Kapitel 29: Entgeltliche Leistungen
Lieferungen
Sonstige Leistungen
Einheitlichkeit der Leistungen
Werklieferung und Werkleistung
Kapitel 30: Der Ort der Lieferungen
Gebietsbegriffe und Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
Ort der Lieferung
Lieferung ist steuerbar – aber auch steuerpflichtig?
Kapitel 31: Ort der sonstigen Leistungen
Grundregeln nach Status des Leistungsempfängers
Sonderregelungen nach Art der sonstigen Leistungen
Ort der sonstigen Leistung und Umkehr der Steuerschuldnerschaft
Kapitel 32: Weitere Steuertatbestände (Umsatzarten)
Innergemeinschaftlicher Erwerb
Einfuhr
Kapitel 33: Steuerbefreiungen
Überblick über wichtige Steuerbefreiungen
Belastungswirkungen: Steuerbefreiungen und Vorsteuer
Verzicht auf Steuerbefreiungen
Kapitel 34: Steuerbefreiungen bei Warenexporten
Innergemeinschaftliche Lieferungen
Ausfuhrlieferungen
Kapitel 35: Unentgeltliche Wertabgaben
Unentgeltliche Lieferungen
Unentgeltliche sonstige Leistungen
Kapitel 36: Bemessungsgrundlage und Steuersatz
Die Bemessungsgrundlage
Steuersätze
Kapitel 37: Vorsteuer
Voraussetzungen für den Steuerabzug
Ausschluss des Vorsteuerabzugs
Aufteilung der Vorsteuer
Vorsteuerberichtigung
Kapitel 38: Steuerschuldner und Umkehr der Steuerschuldnerschaft
In welchen Fällen wird die Steuerschuldnerschaft umgekehrt?
Steuerentstehung und Umsatzsteuervoranmeldung
Auch Kleinunternehmer sind betroffen!
Teil VI: Der Top-Ten-Teil
Kapitel 39: Der erste Steuerfall: Zehn Fragen zu Bettina und Paul
Ihr Einkommensteuerfall
Die zehn Fallfragen
1. Sind Bettina und Paul persönlich steuerpflichtig?
2. Welche Einkunftsarten liegen vor?
3. Wie hoch sind die Einkünfte?
4. Wie läuft das mit den Kapitalerträgen von Bettina?
5. Wie ist das mit der Gewerbesteuer bei Paul?
6. Wie hoch ist die Bemessungsgrundlage? Private Abzugsbeträge
7. Wie hoch ist die tarifliche Einkommensteuer?
8. Gibt es Steuerermäßigungen? Wie hoch ist die festzusetzende Einkommensteuer?
9. Wie hoch ist die Abschlusszahlung?
10. Ein Blick in die Zukunft …
Kapitel 40: Der zweite Steuerfall: Zehn Fragen zur DUMBO GmbH
Ihr Fall zur Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer
Die zehn Fallfragen
1. Persönliche Steuerpflicht GmbH
2. Rückstellungs- /Forderungsberechnung
3. Bemessungsgrundlage für die Körperschaftsteuer
4. KSt-Rückstellung und SolZ-Rückstellung
5. Berechnung Gewerbeertrag
6. GewSt-Rückstellung/-Forderung
7. Endgültiger handelsrechtlicher Jahresüberschuss
8. Ablauf des Besteuerungsverfahrens
9. Gewinnausschüttung an den Gesellschafter
10. Tätigkeitsvergütung des Gesellschafters
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Tabellenverzeichnis
Kapitel 1
Tabelle 1.1: Aufteilung des Aufkommens wichtiger Steuerarten auf Bund, Länder un...
Tabelle 1.2: Zusammenfassende Übersicht zu den Steuern und deren Kategorisierung...
Kapitel 3
Tabelle 3.1: Überblick Anwendungsbereiche einiger Steuergesetze
Kapitel 9
Tabelle 9.1: Degressive AfA für bewegliche Wirtschaftsgüter nach Zeiträumen der...
Kapitel 23
Tabelle 23.1: Beginn und Ende der sachlichen Steuerpflicht
Kapitel 25
Tabelle 25.1: Beispiel zur Zerlegung bei der Gewerbesteuer
Kapitel 26
Tabelle 26.1: Beteiligungserträge einer Kapitalgesellschaft bei der Körperschaft...
Tabelle 26.2: Beteiligungserträge eines Gewerbetreibenden bei der Einkommensteue...
Tabelle 26.3: Ertragsteuersatz bei unterschiedlichen Hebesätzen
Kapitel 27
Tabelle 27.1: Voranmeldungszeiträume bei der Umsatzsteuer
Tabelle 27.2: Voranmeldungszeiträume bei Vorsteuerguthaben
Kapitel 31
Tabelle 31.1: Orte der sonstigen Leistung
Kapitel 33
Tabelle 33.1: Überblick über wichtigen Steuerbefreiungen nach § 4 UStG
Kapitel 40
Tabelle 40.1: Berechnung des endgültigen Jahresüberschusses (nach Ertragsteuern)
Illustrationsverzeichnis
Kapitel 1
Abbildung 1.1: Übersicht über die Stellung der Steuern im System der Abgaben
Abbildung 1.2: Systematisierung der Steuerarten aus rechtlicher und wirtschaftli...
Kapitel 2
Abbildung 2.1: Steuerarten und Unternehmensbesteuerung (Ertragsteuern)
Kapitel 3
Abbildung 3.1: Rechtsquellen der Besteuerung
Kapitel 4
Abbildung 4.1: Ablauf des Besteuerungsverfahrens nach der Abgabenordnung (AO)
Abbildung 4.2: Einheitliche und gesonderte Feststellung bei einer Personengesell...
Abbildung 4.3: Bestandskraft und Änderbarkeit von Steuerbescheiden
Abbildung 4.4: Ablauf des Rechtsbehelfsverfahrens
Kapitel 5
Abbildung 5.1: (Vereinfachtes) Schema zur Ermittlung der Einkommensteuer
Kapitel 6
Abbildung 6.1: Grundtatbestände für die persönliche Steuerpflicht
Kapitel 7
Abbildung 7.1: Gewinn- und Überschusseinkünfte bei der Einkommensteuer
Abbildung 7.2: Ausgaben der natürlichen Personen und deren steuerliche Berücksic...
Abbildung 7.3: Die Verlustrechnung bei der Einkommensteuer
Abbildung 7.4: Verlustabzug nach § 10d EStG
Kapitel 8
Abbildung 8.1: Haupt- und Nebeneinkunftsarten
Abbildung 8.2: Prüfungsreihenfolge für das Vorliegen von Einkünften aus Gewerbeb...
Abbildung 8.3: Einkünfte aus Gewerbebetrieb
Abbildung 8.4: Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit, § 18 EStG
Abbildung 8.5: Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit
Abbildung 8.6: Einkünfte aus Kapitalvermögen, § 20 EStG
Abbildung 8.7: Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung nach § 21 EStG
Abbildung 8.8: Sonstige Einkünfte nach § 22 EStG (Überblick)
Kapitel 9
Abbildung 9.1: Grundschema zur Ermittlung der Überschusseinkünfte
Kapitel 10
Abbildung 10.1: Überblick über die Gewinnermittlungsmethoden
Abbildung 10.2: Vermögenssphären und Vermögensarten der natürlichen Person
Abbildung 10.3: Zuordnungsregeln von Wirtschaftsgütern bei gemischter Nutzung
Abbildung 10.4: Gebäudeteile und Betriebs- oder Privatvermögen
Abbildung 10.5: Betriebsvermögensvergleich nach § 4 Abs. 1 EStG
Abbildung 10.6: Zusammenhang zwischen Handels- und Steuerbilanz
Abbildung 10.7: Erscheinungsformen der Steuerbilanz
Abbildung 10.8: Vom Gewinn laut Steuerbilanz zu den Einkünften
Abbildung 10.9: Einnahmen-Überschussrechnung nach § 4 Abs. 3 ESt...
Abbildung 10.10: Umsatzsteuerzahlungen in der EÜR
Kapitel 11
Abbildung 11.1: Veranlagung von Kapitaleinkünften
Kapitel 12
Abbildung 12.1: Einteilung der Sonderausgaben in Vorsorgeaufwendungen und weiter...
Abbildung 12.2: Bedeutung der Berücksichtigung von Ausbildungskosten als Werbung...
Abbildung 12.3: Prüfungsreihenfolge für die steuerliche Einordnung von Ausgaben ...
Kapitel 13
Abbildung 13.1: Der Grundtarif nach § 32a Abs. 1 EStG (VAZ 2025)
Abbildung 13.2: Verlauf von Grenzsteuersatz und Tarifzonen (VAZ 2025)
Abbildung 13.3: Veranlagungsformen und Einkommensteuertarif
Kapitel 14
Abbildung 14.1: Steuerermäßigung nach § 35 EStG
Abbildung 14.2: Berechnung Ermäßigungshöchstbetrag § 35 EStG
Kapitel 16
Abbildung 16.1: Vereinfachtes Schema zur Ermittlung der Körperschaftsteuer bei K...
Kapitel 17
Abbildung 17.1: Persönliche Körperschaftsteuerpflicht
Abbildung 17.2: Beginn der persönlichen Körperschaftsteuerpflicht
Kapitel 18
Abbildung 18.1: Ermittlung des Einkommens bei Kapitalgesellschaften
Kapitel 20
Abbildung 20.1: Kaskadeneffekt bei der Körperschaftsteuer (ohne § 8b KStG)
Abbildung 20.2: Körperschaftsteuerliches Schachtelprivileg
Abbildung 20.3: Beteiligungsertrag und Kapitalertragsteuer
Abbildung 20.4: Veräußerungsgewinn nach § 8b Abs. 2 KStG
Kapitel 22
Abbildung 22.1: Die körperschaftsteuerliche Organschaft
Kapitel 23
Abbildung 23.1: Vereinfachtes Schema zur Ermittlung der Gewerbesteuer
Kapitel 24
Abbildung 24.1: Bemessungsgrundlage bei der Gewerbesteuer
Abbildung 24.2: Hinzurechnungen für Finanzierungsaufwendungen nach § 8 Nr. 1 Gew...
Kapitel 25
Abbildung 25.1: Erhebungsverfahren bei der Gewerbesteuer
Kapitel 26
Abbildung 26.1: Gewerbesteuerliches Schachtelprivileg
Abbildung 26.2: Fallbeispiel Beteiligung an Kapitalgesellschaft
Abbildung 26.3: Fallbeispiel Beteiligung an Personengesellschaft
Kapitel 27
Abbildung 27.1: Das Allphasen-Nettoumsatzsteuersystem mit Vorsteuerabzug
Abbildung 27.2: Steuergegenstand nach § 1 Abs. 1 UStG (Umsatzarten)
Abbildung 27.3: (Vereinfachtes) Schema zur Ermittlung der Umsatzsteuer
Abbildung 27.4: Berechnung der Umsatzsteuervorauszahlung
Abbildung 27.5: Umsatzsteuerjahreserklärung
Kapitel 28
Abbildung 28.1: Umsatzsteuerliches Unternehmensvermögen
Abbildung 28.2: Berechnung des Umsatzes eines Kleinunternehmers
Kapitel 29
Abbildung 29.1: Umsatzsteuerlicher Leistungsaustausch nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG
Abbildung 29.2: Leistungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG
Kapitel 30
Abbildung 30.1: Umsatzsteuerliche Gebietsbegriffe nach § 1 Abs. 2, 2a UStG
Abbildung 30.2: Regelungen zum Ort der (entgeltlichen) Lieferungen
Abbildung 30.3: Das Reihengeschäft nach § 3 Abs. 6a Satz 1 UStG
Abbildung 30.4: Ort der Lieferung bei nachfolgender ruhender Lieferung
Abbildung 30.5: Ort der Lieferung bei vorangegangener ruhender Lieferung
Kapitel 31
Abbildung 31.1: Regelungen zur Bestimmung des Orts der sonstigen Leistungen
Abbildung 31.2: Ort der sonstigen Leistung im Ausland und Besteuerungsverfahren
Kapitel 32
Abbildung 32.1: Besteuerung von Warenimporten
Abbildung 32.2: Handel zwischen Unternehmern in der EU
Kapitel 33
Abbildung 33.1: Wirkung von Steuerbefreiungen
Abbildung 33.2: Steuerbefreiungen und Vorsteuerabzug
Kapitel 34
Abbildung 34.1: Steuerbefreiungen bei Warenexporten
Abbildung 34.2: Warenlieferungen in einen anderen EU-Staat
Abbildung 34.3: Fallgruppen von Ausfuhrlieferungen nach § 6 UStG
Kapitel 35
Abbildung 35.1: Innenumsatz versus Gegenstandsentnahme
Abbildung 35.2: Unentgeltliche Leistungen nach § 3 Abs. 1b, 9a UStG
Kapitel 36
Abbildung 36.1: Einordnung von Bemessungsgrundlage und Steuersatz zur Berechnung...
Abbildung 36.2: Bemessungsgrundlage für Umsätze nach § 1 Abs. 1 ...
Kapitel 37
Abbildung 37.1: Systematik des § 15 UStG (Vorsteuerabzug)
Abbildung 37.2: Vorsteuerabzug nach § 15 UStG
Abbildung 37.3: Vorsteuerberichtigung nach § 15a UStG anhand Fallbeispiel (fünfj...
Kapitel 38
Abbildung 38.1: Umkehr der Steuerschuldnerschaft nach § 13b UStG (Reverse-Charge...
Kapitel 40
Abbildung 40.1: Ablauf der Rückstellungsberechnung bei einer Kap...
Orientierungspunkte
Cover
Titelblatt
Impressum
Über die Autorin
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Fangen Sie an zu lesen
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
1
2
5
6
7
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
257
258
259
260
261
262
263
265
266
267
268
269
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
417
418
419
420
421
422
423
425
426
427
428
429
430
431
432
433
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
511
512
513
514
515
516
517
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
Einführung
Schon Benjamin Franklin (1706–1790) stellte fest, dass uns nur zwei Dinge auf dieser Welt sicher sind: der Tod und die Steuer. Franklin schätzte vermutlich das eine so wenig wie das andere … Um den Tod soll es in diesem Buch nicht gehen (auch wenn die Kosten für die Beerdigung steuerlich absetzbar sind, davon werden Sie noch erfahren). Was hingegen Ihre Einstellung zur Steuer betrifft, hoffe ich, dass dieses Buch einen positiven Betrag dazu leistet und Licht in die auf den ersten Blick fast unübersehbar komplexe Materie bringt. Hier setzen wir uns mit vier von insgesamt rund 30 verschiedenen Steuerarten näher auseinander, die für Unternehmen, aber auch für Privatpersonen von besonderer Bedeutung sind und rund 80 % des gesamten Steueraufkommens ausmachen:
Einkommensteuer (dazu gehören auch die Lohnsteuer und die Kapitalertragsteuer)
Körperschaftsteuer
Gewerbesteuer
Umsatzsteuer
Über dieses Buch
Wenn Sie dieses Buch in die Hand genommen haben, wollen Sie sich vermutlich als Studierende(r) oder Auszubildende(r) umfassend über das Steuerrecht informieren. Sie wollen verstehen, wie das Steuerrecht aufgebaut ist und angewendet werden kann.
Vielleicht interessieren Sie sich aber auch privat oder beruflich für einige dieser Steuerarten besonders – zum Beispiel, weil Sie wissen wollen, mit welchen Steuern Sie persönlich rechnen müssen, welche Termine für Sie als Selbstständiger besonders relevant sind oder was Sie tun können, wenn Sie mit dem Steuerbescheid des Finanzamts nicht einverstanden sind.
Sollten Sie allerdings gerade über Ihrer alljährlichen Steuererklärung s(chw)itzen und sich noch ein paar Steuertipps oder -tricks holen wollen, ist dieses Buch nicht der beste Ratgeber. Hier geht es um die Grundsätze, die für das Verstehen und Anwenden der steuerlichen Regelungen wichtig sind. Den einen oder anderen Tipp zum Steuersparen gibt es aber doch dann und wann.
Wenn Sie …
steuerliche Grundlagen der Besteuerung und die Zusammenhänge verstehen wollen,
und dies unabhängig von den regelmäßigen Änderungen, für die das Steuerrecht berühmt (und vor allem berüchtigt!) ist,
und dabei durch Beispiele und Praxisfälle »unterhalten« werden möchten, dann ist dieses Buch genau das Richtige für Sie!
Konventionen in diesem Buch
Dieses Buch hat das Ziel, komplizierte Sachverhalte verständlich darzustellen. Allerdings kann ich es Ihnen nicht ganz ersparen, Sie in die Welt der steuerlichen Fachbegriffe einzuführen. Zum Teil werden diese Fachbegriffe in den Rechtsnormen verwendet, und dann ist die konkrete Definition gefragt. Wussten Sie beispielsweise, dass Einnahmen, Einkünfte, Einkommen und zu versteuerndes Einkommen unterschiedliche Dinge sind? Oder dass ein Vermieter privater Wohnungen ein Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes ist? (Sehen Sie, und schon geht es los mit dem »Steuer-Deutsch«.)
Nachdem Sie nun die Zielsetzung dieses Buchs kennen, ist Ihnen auch klar, dass es sich nicht um eine wissenschaftliche Abhandlung zum Thema handelt. Ich konzentriere mich auf das Wesentliche und erläutere Zusammenhänge und Hintergründe. Es gibt jede Menge Praxisbeispiele! Diese Beispiele basieren auf dem für das Jahr (den Veranlagungszeitraum) 2025 geltenden Rechtsstand (per 23.5.2025).
Was Sie nicht lesen müssen
Neben den steuerlichen Grundlagen enthält dieses Buch ergänzende Informationen, die für das weitere Verständnis nicht zwingend erforderlich sind. Sie müssen diese Passagen daher nicht unbedingt beim ersten Durcharbeiten lesen. Diese Passagen sind optisch durch die grau hinterlegten Kästchen zu erkennen. Allerdings sind die Informationen durchaus interessant, weshalb ich die Lektüre empfehle. Es kann sich um Praxisbezüge, Hintergründe einer Vorschrift, ein erläuterndes Gerichtsurteil oder auch Hinweise auf vertiefende Lektüre handeln.
Törichte Annahmen über den Leser
Da Sie dieses Buch in der Hand halten, interessieren Sie sich für die Steuerlehre. Dies kann mehrere Gründe haben:
Sie absolvieren ein Studium der Betriebswirtschaftslehre, des Wirtschaftsrechts oder ein artverwandtes Studium, in welchem steuerliche Grundlagenkenntnisse gefragt sind.
Sie haben im Rahmen einer anderen Ausbildung mit Steuern zu tun.
Sie sind bereits selbstständig/gewerblich tätig und wollen sich endlich einmal kompetent mit Ihrem Steuerberater unterhalten können.
Egal, zu welcher dieser Zielgruppen für dieses Buch Sie gehören und welche Motivation Sie haben, gilt für Sie: Sie wollen die Grundlagen des deutschen Steuerrechts verstehen, sich mit der dahinterstehenden Systematik auseinandersetzen und auch praktische Anwendungsfälle lösen können. Außerdem sind Sie bereit, Zeit zu investieren, um etwas tiefer in diese komplexe und überaus nützliche Materie einzutauchen. Sie sind nicht in erster Linie an schnellen Lösungen für die eigene Steuererklärung interessiert oder wollen noch schnell ein paar aktuelle steuerliche Tricks und Steuersparmodelle für Ihr Unternehmen geliefert bekommen, sondern möchten verstehen, wie das Steuerrecht aufgebaut ist und angewendet werden kann.
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Steuerlehre … für Dummies besteht aus insgesamt sechs Teilen, die Sie unabhängig voneinander lesen können und die in sich verständlich sind. Sollten Sie noch über keinerlei Grundlagenkenntnisse verfügen, ist es jedoch sinnvoll, wenn Sie mit Teil I einsteigen. Verbindungen zwischen den einzelnen Teilen habe ich durch entsprechende Querverweise gekennzeichnet.
Teil I – Ohne Grundlagen geht es nicht
In den ersten Kapiteln geht es darum, Sie in die Welt der Steuern, der agierenden Personen und Institutionen sowie der Rechtsquellen einzuführen. Es ist fast so wie bei einem PC-Spiel, bei dem Sie zunächst eine Vorstellung vom Thema bekommen und verstehen sollen, wer die Akteure in der komplexen Welt des Steuerrechts sind.
Die Rechtsquellen könnte man im weitesten Sinne mit den Spielregeln vergleichen, da sie die Grundlage für das Handeln und Wirken der Akteure bilden. Lesen Sie hier über Steuergesetze und Durchführungsverordnungen; lernen Sie, was Steuerrichtlinien sind und welche Bedeutung diese und andere Verwaltungsanweisungen im Besteuerungsverfahren haben, welche Instanzen im Klageverfahren durchlaufen werden müssen und welche Rolle dem Bundesverfassungsgericht zukommt. In diesem Teil erfahren Sie weiterhin, was Doppelbesteuerungsabkommen sind und welche Rolle die Europäische Union und ihre Rechtsakte im Rahmen der Besteuerung spielen.
Das Besteuerungsverfahren könnte man vielleicht mit einer Spielanleitung vergleichen. Okay, vielleicht hinkt der Vergleich doch ein wenig? Beim Besteuerungsverfahren geht es in erster Linie darum, wie die Besteuerung zeitlich und inhaltlich abläuft, wer wann was tun muss und was passiert, wenn man das nicht tut. Also zum Beispiel geht es darum, wer eine Steuererklärung abgeben muss, welche steuerlichen Verwaltungsakte es gibt, wann Steuerzahlungen zu leisten sind und wie man seine Rechte im Besteuerungsverfahren durchsetzen kann.
Am Ende müssen Sie entscheiden, um welches Genre es sich bei dem PC-Spiel handelt: ob Fun-Game, Action-Adventure oder gar Survival-Horror … (Nein, »Love Story« ist leider nicht im Angebot! Allerdings erfahren Sie in Teil II auch, was eine Heirat steuerlich »bringt«.)
Teil II – Die Besteuerung natürlicher Personen: Die Einkommensteuer
Die Einkommensteuer betrifft die Besteuerung der natürlichen Personen, also der Menschen »wie du und ich«. Auch im Rahmen der Unternehmensbesteuerung nimmt die Einkommensteuer eine zentrale Rolle ein: Aus Sicht eines Unternehmens betrachtet, betrifft die Einkommensteuer alle Rechtsformen: Der Gewinn eines Einzelunternehmers unterliegt der Einkommensteuer. Die Gesellschafter einer Personengesellschaft und einer Kapitalgesellschaft haben ebenfalls mit der Einkommensteuer zu tun (sie werden übrigens ganz unterschiedlich besteuert!).
Wenn Sie diesen Teil von vorn bis hinten lesen, können Sie am Ende die Einkommensteuer berechnen. Auf dem Weg dorthin erfahren Sie, welche Lebenssachverhalte einkommensteuerliche Folgen nach sich ziehen (also für welche Arten von Einkünften Sie Steuern zahlen müssen), welche Ausgaben Sie »absetzen« können und wie Kinder in der Einkommensteuererklärung berücksichtigt werden. Kinder können unter Umständen eine außergewöhnliche Belastung darstellen, ebenso wie der Ehepartner (nein, das wollen wir an dieser Stelle nicht vertiefen …). Sie werden erfahren, warum eine Gewerbesteuerzahlung die Einkommensteuer mindert. Ich zeige Ihnen hier auch, welche Stellung die Personengesellschaften und ihre Gesellschafter bei der Einkommensteuer einnehmen.
Teil III – Die Besteuerung juristischer Personen: Die Körperschaftsteuer
Dieser Teil behandelt die Besteuerung der juristischen Personen, also der Kapitalgesellschaften und deren Gesellschafter. Konkret: Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) gegründet. Die GmbH ist eine juristische Person, da sie eine eigene Rechtspersönlichkeit hat. Die GmbH zahlt auf ihren Gewinn Körperschaftsteuer, der Gesellschafter unterliegt dann für sich genommen auch der Besteuerung. Genau darum geht es in Teil III.
Teil IV – Besteuerung des Gewerbebetriebs: Die Gewerbesteuer
Die Gewerbesteuer erfasst auf der einen Seite natürliche Personen, die gewerblich tätig sind; zum Beispiel, weil sie einen Handwerksbetrieb, ein Einzelhandelsgeschäft, eine Event-Agentur oder Ähnliches betreiben. Aber auch Personen- und Kapitalgesellschaften haben mit der Gewerbesteuer zu tun. In diesem Teil erfahren Sie, wer konkret gewerbesteuerpflichtig ist und wie sich die Gewerbesteuer berechnet.
Teil V – Steuer auf den Mehrwert: Die Umsatzsteuer
Teil V widmet sich der Umsatzsteuer, die von Unternehmern entrichtet werden muss, aber von den privaten Endverbrauchern (also von Ihnen und von mir) wirtschaftlich getragen wird. Als Endverbraucher zahlen wir zwar Umsatzsteuer, wenn wir beispielsweise ein Buch der … für Dummies-Reihe kaufen (übrigens nur 7 Prozent), wir haben aber nichts damit zu tun, wie diese Steuer zum Finanzamt kommt. Daher ist dieser Teil insbesondere für alle selbstständig Tätigen (Unternehmer) von Interesse, aber natürlich auch für alle diejenigen Leser, die einfach nur das Mehrwertsteuersystem, das übrigens europaweit einheitlich geregelt ist, verstehen wollen.
Teil VI – Der Top-10-Teil
… denn der darf in keinem … für Dummies-Buch fehlen! Hier finden Sie zwei zusammenfassende und wiederholende Fallstudien, die auch das Zusammenwirken der verschiedenen Steuerarten verdeutlichen. Für Bettina und Paul berechnen Sie die Einkommensteuer. Für die DUMBO-GmbH ermitteln Sie die Steuerrückstellungen und wie viel vom Gewinn nach Steuern übrig bleibt.
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Vielleicht kennen Sie bereits die typischen Symbole der … für Dummies-Reihe! Die Symbole helfen Ihnen bei der Orientierung im Buch und verweisen auf Tipps, Fallbeispiele, Orientierungsfälle und »Merk-«Würdiges. Hier ist eine Übersicht über die Symbole, die in diesem Buch verwendet werden:
Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass es sich um einen Tipp oder einen Hinweis für Sie handelt, der für die Praxis wichtig ist (oder einfach unter »nice to know« fällt).
Dieses Symbol macht Sie auf etwas aufmerksam, das für das weitere Verständnis von besonderer Bedeutung ist. Diese Inhalte und Informationen sollten Sie unbedingt lesen und erinnern!
Dieses Symbol gibt Ihnen Erläuterungen zu steuerlichen Begriffen und Definitionen.
Bei diesem Symbol werden Sie auf Fallstricke und typische Fehler hingewiesen und darauf, was Sie beachten sollten.
Jetzt dürfen Sie dreimal raten, was sich hinter diesem Symbol verbirgt …! Hier erwartet Sie ein anschauliches Beispiel zum jeweiligen Thema.
Wie es weitergeht
Der Vorrede und Einführung sei nun genug. Ich hoffe, dass Sie auch ein bisschen gespannt auf die vorliegenden Kapitel sind. Wie auch bei einem PC-Spiel sollen Sie durchaus aktiv werden und sich nicht nur passiv zurücklehnen. Auch wenn Steuergesetze sicherlich nicht die spannendste Lektüre darstellen, ist es wichtig, dass Sie sich mit den diversen Rechtsquellen von Anfang an vertraut machen. Dies gilt insbesondere, wenn Sie sich im Studium oder in der Ausbildung befinden. Bedenken Sie: Die Steuergesetze sind (in der Regel) der erlaubte »Spickzettel« in den Prüfungen, natürlich ohne Ihre handschriftlichen Anmerkungen und Ergänzungen!
Seien Sie ermutigt, dass häufig nur aller Anfang schwer ist. Mit zunehmendem Wissen und Verständnis steigt auch die Freude am Thema und die Motivation, mehr zu erfahren. Das gilt sogar für die Steuerlehre. Aber nun: Loggen Sie sich ein, das Spiel beginnt!
… und übrigens: Das Buch spiegelt den Rechtsstand per 23.5.2025 wider.
Teil I
Ohne Grundlagen geht es nicht
IN DIESEM TEIL …
bekommen Sie einen Überblick über das deutsche (Viel-)Steuersystem und lernen systemtragende Begriffe kennen.werden Sie verstehen, dass Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften unterschiedlich besteuert werden.lernen Sie die steuerlichen Rechtsquellen kennen …… und erhalten einen Überblick über den Ablauf des Besteuerungsverfahrens.Kapitel 1
Worum es geht: Steuern und Steuersystem
IN DIESEM KAPITEL
Wie Steuern systematisch eingeteilt werdenWichtige BegriffeTatbestandsmerkmale von SteuernAller Anfang ist schwer und vielleicht auch ein wenig unspektakulär; ein Kapitel über die Grundlagen bietet nun einmal relativ wenig Raum für aufsehenerregende Fälle aus der Praxis. Allerdings ist es in einem Buch über Steuern schon sinnvoll, sich Gedanken darüber zu machen, wofür man überhaupt Steuern braucht, wie Steuern definiert werden, welche Arten von Steuern es gibt und wann der Staat überhaupt Steuern erheben kann. Also nichts wie hinein in medias res und die wichtigste Frage gleich vorneweg: Was sind Steuern überhaupt?
Lassen Sie sich bitte durch die vielen Definitionen und Begriffsklärungen zu Beginn unseres gemeinsamen Weges nicht abschrecken! Verschaffen Sie sich in diesem Kapitel erst einmal einen Überblick, sodass Sie dann sagen können: Ja, das habe ich so einigermaßen verstanden, selbst wenn das Juristen-(Steuer)-Deutsch wirklich sehr gewöhnungsbedürftig ist. Ich wage auch nicht zu behaupten, dass Sie diese Ausdrucksweise irgendwann noch lieben lernen werden … Wenn Sie dann später in die weiteren Teile des Buchs eintauchen, können Sie den Grundlagenteil immer wieder als Orientierung zur Hand nehmen.
Steuern und ihre Notwendigkeit
Wenn Sie den Begriff »Steuern« hören, wissen Sie ziemlich sicher, was gemeint ist. Im Regelfall verbindet man damit eine finanzielle Belastung, die Sie als Steuerbürger – eher unfreiwillig – tragen; zumindest auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick ist es dann doch einleuchtend, dass ein marktwirtschaftlich organisiertes Gemeinwesen für seine diversen Aufgaben Geld benötigt. Öffentliche Infrastruktur, die innere und äußere Sicherheit, soziale Absicherung und Bildung sind nur einige der Bereiche, die durch den Staat organisiert und garantiert werden, aber eben auch finanziert werden müssen, und zwar von allen Bürgern dieses Staates.
Die Definition von Steuern
Da es in diesem Buch um Steuern geht, sollten Sie sich nun diesen Begriff etwas näher anschauen. Was Steuern sind, ist in § 3 Abs. 1 der Abgabenordnung (AO) definiert: »Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung, für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.«
Die Merkmale von Steuern
Es klingt zunächst reichlich abstrakt, was mit dieser Definition gemeint sein könnte. Wenn Sie sich die einzelnen Tatbestandsmerkmale genauer anschauen, wird klarer, worum es hier geht:
Steuern sind Geldleistungen:
Dieser Punkt leuchtet unmittelbar ein, die Begleichung der Steuerschuld mit Naturalien (Äpfel, Kuchen, Wein …) ist nicht möglich. Mittlerweile üblich ist der bargeldlose Zahlungsverkehr mit dem Finanzamt.
Steuern sind ohne unmittelbaren Anspruch auf Gegenleistung:
Der Steuerbürger, der Steuern entrichtet, erwirbt keinen unmittelbaren Anspruch auf eine Gegenleistung des Staates. Vor allem in diesem Punkt unterscheiden sich die Steuern von anderen Abgaben wie beispielsweise den
Gebühren
(Nutzungs- oder Verwaltungsgebühren) oder
Beiträgen
(wie etwa Kammerbeiträge und Sozialversicherungsbeiträge). Kurzum: Selbst wenn Sie Steuern zahlen, haben Sie keinen Anspruch darauf, dass die Gemeinde die Straße vor Ihrem Grundstück endlich repariert oder ein Kindergarten im Dorf gebaut wird.
Steuern sind hoheitlich auferlegt:
Steuern darf nicht jeder erheben. Berechtigt dazu sind der Bund, die Bundesländer, die Gemeinden/Gemeindeverbände und bestimmte Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften mit öffentlich-rechtlichem Status.
Steuern dienen der Erzielung von Staatseinnahmen: Steuern erfüllen zuallererst einen Fiskalzweck. Die Gesamtsteuerlast wird auf die einzelnen Steuerpflichtigen verteilt, um den Finanzbedarf des Gemeinwesens zu decken.
Teilweise haben Steuern jedoch auch einen Sozialzweck: In diesem Fall kann die Erzielung von Einnahmen ein Nebenzweck sein. Sozialzwecknormen sind Regelungen, die Lenkungs- oder Umverteilungscharakter haben (Steuervergünstigungen und Steuersubventionen, aber auch Sonderbelastungen). Der Gedanke der Sozialzwecknormen ist: Wer sich wie vom Staat gewünscht verhält, wird (zusätzlich) steuerlich entlastet. Teilweise haben selbständige Sondersteuern auch wirtschaftspolitische Hintergründe und somit Sozialzweckcharakter. So kann man beispielsweise die Tabaksteuer als Lenkungsteuer betrachten, die den Tabakkonsum bremsen soll. Auch die Erhebung von Steuern auf Bier, Branntwein, Schaumwein und Alkopops (Alkoholsteuern) wird gesundheitspolitisch gerechtfertigt. Dass Wein nicht gesondert besteuert wird, legt allerdings fälschlicherweise die Annahme nahe, dass es sich hierbei staatlicherseits um ein »wünschenswertes« Getränk handelt …
Gesetzmäßigkeit/Tatbestandsmäßigkeit der Besteuerung:
Die Auferlegung von Steuerlasten ist dem Gesetz vorbehalten und muss durch dieses angeordnet sein. Voraussetzung für die Festsetzung einer Steuer ist weiterhin, dass ein Tatbestand erfüllt sein muss, an den als Rechtsfolge eine Steuer geknüpft ist. Dazu führt § 38 AO näher aus (Vorsicht: wieder einmal Steuerjuristendeutsch!):
»Die Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis entstehen, sobald der Tatbestand verwirklicht ist, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft.«
Daraus folgt, ganz pragmatisch ausgedrückt, dass Steuern beispielsweise nicht zwischen Steuerbürger und Finanzverwaltung »verhandelbar« sind.
Zu den Steuern zählen auch die Zölle als Ein- und Ausfuhrabgaben, § 3 Abs. 3 AO. Aufgrund des europäischen Binnenmarktes werden Zölle nur an den Außengrenzen der Europäischen Union (EU) erhoben. Die Regelungen hierzu finden Sie im Zollkodex, der in diesem Buch jedoch nicht näher behandelt wird.
Andere Abgaben
Neben den Steuern gibt es noch weitere Abgaben (siehe Abbildung 1.1). Die Abgaben werden durch folgende Definitionen von dem Begriff der Steuern abgegrenzt:
Abbildung 1.1: Übersicht über die Stellung der Steuern im System der Abgaben
Gebühren
:
Diese dienen wie die Steuern der Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs des Staates. Allerdings sind Gebühren dadurch gekennzeichnet, dass sie mit einer individuell zurechenbaren Gegenleistung einer öffentlichen Einrichtung verbunden sind. Darunter fällt zum Beispiel die Gebühr für die Ausstellung eines Personalausweises oder Gebühren für die Nutzung öffentlicher Parkplätze.
Beiträge
:
Hierbei handelt es sich um einen Aufwendungsersatz für die
mögliche Inanspruchnahme
einer öffentlichen Einrichtung. Beispiele hierfür sind Beiträge der Industrie- und Handelskammern, Sozialversicherungsbeiträge oder auch der Rundfunkbeitrag.
Steuerliche Nebenleistungen
:
Dazu zählen unter anderem Zwangsgelder, Säumniszuschläge (etwa für die verspätete Steuerzahlung, § 240 AO), Verspätungszuschläge (für die verspätete Abgabe einer Steuererklärung oder -anmeldung, § 152 AO) und Zinsen (§ 233 ff. AO, § 3 Abs. 4 AO. Die steuerlichen Nebenleistungen werden im Besteuerungsverfahren wie Steuern behandelt, § 37 Abs. 1 AO.
Die Systematisierung von Steuerarten
Wenn wir uns über Steuern unterhalten, kann man eigentlich nicht von »der Steuer« sprechen, denn die gibt es gar nicht. »Die« Steuer setzt sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Steuerarten zusammen, die an unterschiedliche Lebenssachverhalte anknüpfen (die Tatbestandsmerkmale). Nach einem kurzen Überblick über die wichtigsten dieser unterschiedlichen Steuerarten erkläre ich Ihnen noch ein paar weitere Begriffe, die Ihnen in diesem Buch begegnen werden.
Das deutsche Steuersystem – ein »Vielsteuersystem«
Es gibt derzeit über 30 Steuerarten, die auf unterschiedlichste Art und Weise systematisiert und typologisiert werden können. Wie komplex das aussehen kann, wird Ihnen am folgenden Beispiel deutlich.
Paul studiert Betriebswirtschaftslehre und wohnt mit seiner Freundin Bettina in einer kleinen Zweizimmerwohnung in Berlin. Zur Finanzierung seines Studiums erstellt Paul Webseiten für Kunden, entwirft Layouts für Flyer, Visitenkarten und Ähnliches. Er erzielt so einen (Jahres-)Gewinn in Höhe von 12.300 €. Bettina ist Angestellte einer Versicherungsgesellschaft und hat ein Gehalt von 30.000 € /Jahr. Zur Mini-WG zählen übrigens auch noch zwei Dackel.
Paul fährt fast ausschließlich mit dem Fahrrad, Bettina hat einen eigenen Pkw. Beide trinken gern Kaffee und nach dem Abendessen gern ein Glas Grappa. Bettina ist Raucherin. Im vergangenen Monat brauchte Paul einen neuen Reisepass für 60 €. Im Vorjahr beerbte Bettina ihre Großtante, die ihr ein Mietwohngrundstück in Berlin-Zehlendorf hinterließ, aus dem sie nun regelmäßig Mieteinnahmen erzielt. Außerdem erbte sie von ihrer Großtante Bargeld. Für Zinserträge schrieb ihr die Bank 600 € auf dem Konto gut. Bettina ist Mitglied der evangelischen Landeskirche Berlin.
Welche Steuern (Steuerarten) zahlen Paul und Bettina? Wie können diese (und andere) Steuern systematisiert werden?
Pauls Gewinn aus der gewerblichen Tätigkeit unterliegt der
Einkommensteuer
und grundsätzlich auch der
Gewerbesteuer
(allerdings ist hier der Freibetrag nicht überschritten, aber dazu später in
Kapitel 24
). Darüber hinaus unterliegen die von ihm erbrachten Leistungen der
Umsatzsteuer
(allerdings wird die Umsatzsteuer bei Unterschreiten bestimmter Umsatzgrenzen nicht erhoben, auch hierzu später mehr in
Kapitel 28
).
Bettinas Gehalt unterliegt der
Lohnsteuer
(sowie der
Kirchensteuer
zur Lohnsteuer). Die Lohnsteuer ist allerdings keine eigenständige Steuerart, sondern eine Erhebungsform der Einkommensteuer. Bettinas Gehalt ist darüber hinaus auch mit Sozialabgaben belastet (
Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen-, Unfall- und Rentenversicherung
). Hierbei handelt es sich nicht um Steuern, sondern um Beiträge. Die Sozialversicherungsträger sind zwar Körperschaften des öffentlichen Rechts, finanzieren sich aber überwiegend aus den Beiträgen der Mitglieder.
Das Erbe der Großtante unterlag bei Bettina der
Erbschaftsteuer
.
Das Grundstück unterliegt der
Grundsteuer
. Die Vermietungseinkünfte werden bei Bettina der
Einkommensteuer
unterworfen.
Die Zinserträge unterliegen der
Kapitalertragsteuer
. Die Kapitalertragsteuer ist – wie auch die Lohnsteuer – eine Erhebungsform der Einkommensteuer. Sie hat jedoch – anders als die Lohnsteuer – abgeltende Wirkung, weswegen sie auch als Abgeltungsteuer bezeichnet wird.
Für das Halten des Pkw fällt
Kfz-Steuer
an. Die Tankfüllung ist mit
Energiesteuer
belastet.
Für das Halten von Hunden fällt
Hundesteuer
an.
Kaffeepulver unterliegt der
Kaffeesteuer
, Grappa der
Branntweinsteuer
.
Wenn Bettina Zigaretten kauft, zahlt sie (indirekt)
Tabaksteuer
.
Die für den Reisepass fällige Gebühr ist keine Steuer (es handelt sich zwar um eine Abgabe, diese ist jedoch nicht »gegenstandslos«).
Wie Sie aus dem Beispiel sehen können (und was Ihnen wohl auch hinlänglich aus »praktischer Erfahrung« bekannt sein dürfte), ist das deutsche Steuersystem ein Vielsteuersystem, das aus unterschiedlichen Steuerarten besteht. Es gibt unterschiedliche Dinge und Sachverhalte, die der Besteuerung unterliegen. Im Steuerdeutsch spricht man hier von Steuergegenständen oder Steuerobjekten.
Fehlten Ihnen bei der Aufzählung vielleicht der Solidaritätszuschlag (SolZ)? Der SolZ wurde 1991 im Rahmen der Wiedervereinigung Deutschlands eingeführt. Hintergedanke war die Finanzierung des Aufbaus der ostdeutschen Bundesländer. Den SolZ habe ich jetzt bei Bettina und Paul nicht genannt. In Kapitel 5 erfahren Sie, warum.
Um eine Art Ordnung in die verschiedenen Steuerarten zu bringen, liegt es nahe, diese zu systematisieren. Keine Sorge: Diese Systematisierung müssen Sie ganz sicher nicht auswendig lernen, aber sie dient dennoch dem Verständnis des »großen Ganzen«. Außerdem sollten Sie mit den Begrifflichkeiten vertraut werden. Im nächsten Unterabschnitt geht es daher darum, wie die verschiedenen Steuerarten eingeteilt werden können (und damit auch um die Beantwortung der weiter oben gestellten zweiten Frage nach der Systematisierung).
Systematisierung der verschiedenen Steuern (Steuerarten)
Wie Sie schon am Beispiel von Bettina und Paul weiter oben gesehen haben, knüpfen die diversen Steuern an unterschiedliche Lebenssachverhalte an, und diesen liegen natürlich immer unterschiedliche Bezugsgrößen (Besteuerungsbasen) zugrunde. Danach kann differenziert werden, wem das Aufkommen an Steuern zusteht; wer also über die Ertragshoheit verfügt.
Man kann die Steuern einteilen beziehungsweise systematisieren nach:
rechtlichen Kriterien
(gesetzliches Anknüpfungsmerkmal für die Besteuerung)
wirtschaftlichen Kriterien
(Besteuerungsbasis)
der Ertragshoheit
(finanzwissenschaftliche Perspektive)
Systematisierung nach rechtlichen Kriterien (juristische Betrachtungsweise)
Im Rahmen einer juristisch orientierten Betrachtungsweise wird danach systematisiert, woran das Gesetz die Steuerpflicht knüpft.
Personensteuern
Bei den Personensteuern bezieht sich die Steuerpflicht auf eine natürliche oder eine juristische Person; es sind daher Subjektsteuern. Zu dieser Gruppe zählen die Einkommensteuer, die Körperschaftsteuer und die Erbschaft- und Schenkungsteuer und im weiteren Sinne auch der Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer. Diese Steuern werden als Zuschlagsteuern bezeichnet, da ihre Bemessungsgrundlage jeweils die Einkommensteuer (Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) und die Körperschaftsteuer (Solidaritätszuschlag) sind. Personensteuern wirken sich auf die Steuerpflicht, die Bemessungsgrundlage und den Tarif aus.
Gesetzestechnisch erkennt man die Personensteuern an den Regelungen zur »persönlichen Steuerpflicht« jeweils zu Beginn des jeweiligen Gesetzes. Bei den Personensteuern werden die persönlichen Verhältnisse des Steuerpflichtigen berücksichtigt. Dies gilt insbesondere für die Einkommensteuer und die Erbschaft- und Schenkungsteuer. Persönliche Verhältnisse sind beispielsweise der Familienstand, Kinder, Unterhaltsverpflichtungen, Behinderungen oder krankheitsbedingte Einschränkungen. Es ist eine »Besteuerung nach der (individuellen) Leistungsfähigkeit« und dem daraus abgeleiteten Leistungsfähigkeitsprinzip. Das Leistungsfähigkeitsprinzip ist ein Fundamentalprinzip der Besteuerung und basiert auf Art. 3 Grundgesetz (GG). Einfach ausgedrückt: Jeder Bürger soll im Rahmen seiner individuellen ökonomischen Leistungs- und Zahlungsfähigkeit zur Finanzierung der staatlichen Leistungen beitragen.
Diese Definition ist zugegebenermaßen ein wenig abstrakt, wie so oft bei juristischen Definitionen. Bitte nehmen Sie an dieser Stelle zunächst mit, dass es sich bei dem Leistungsfähigkeitsprinzip um ein systemtragendes Prinzip handelt.
Objektsteuern (auch: Realsteuern)
Die Objektsteuern knüpfen, wie der Name schon vermuten lässt, an ein bestimmtes Objekt an. Zu den Objektsteuern zählen beispielsweise die Gewerbesteuer, deren Gegenstand der Gewerbebetrieb ist, und die Grundsteuer, deren Gegenstand der Grundbesitz ist, vergleiche auch § 3 Abs. 2 AO.
Verkehrsteuern
Verkehrsteuern stellen auf Vorgänge des wirtschaftlichen Verkehrs von Gütern und Leistungen ab. Hierzu zählen zum Beispiel die Umsatzsteuer als allgemeine Verkehrsteuer, Grunderwerbsteuer (Übertragung von Grundbesitz), Versicherungsteuer (Prämien- und Beitragszahlungen aus Versicherungsverträgen), Kfz-Steuer (Halten eines Fahrzeugs zum Verkehr auf öffentlichen Straßen) Rennwett- und Lotteriesteuer (Wetten bei öffentlichen Pferderennen oder Lotterien und Ausspielungen).
Verbrauchsteuern
Verbrauchsteuern stellen auf den Verbrauch bestimmter Güter ab. Insbesondere die Verbrauchsteuern haben neben dem Fiskalzweck auch Lenkungscharakter. Zu den Verbrauchsteuern zählen beispielsweise die Energiesteuer, die Tabaksteuer und die Branntweinsteuer.
Systematisierung nach der Besteuerungsbasis (wirtschaftliche Betrachtungsweise)
Im Rahmen dieser Betrachtungsweise steht die Grundlage der Besteuerung (die Besteuerungsbasis) im Vordergrund. Die Frage lautet hier also: Was wird besteuert?
Besteuerung von Erwerbseinkommen (Ertragsteuern)
Besteuert werden »am Markt« erzielte Vermögensmehrungen beziehungsweise der wirtschaftliche Erfolg (Gewinn) einer Person oder eines Objekts (zum Beispiel eines Gewerbebetriebs). Abgestellt wird auf das Erwerbseinkommen als das Einkommen aus einer mit Gewinnabsicht ausgeübten Erwerbstätigkeit. Hierunter fallen die Einkommensteuer, die Körperschaftsteuer, die Gewerbesteuer sowie der Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer. Bitte beachten Sie, dass die Lohnsteuer und die Kapitalertragsteuer als Erhebungsformen der Einkommensteuer auch in diese Kategorie fallen.
Diese Steuern werden auch als Ertragsteuern bezeichnet. In einer anderen Systematisierung fallen die genannten Steuern auch unter die Besitzsteuern.
Besteuerung des (unentgeltlichen) Vermögenstransfers
Besteuert werden Vermögensmehrungen, die unentgeltlich erzielt wurden. Hierunter fällt die Erbschaft- und Schenkungsteuer.
Besteuerung des Vermögensbestands (Substanzsteuern)
Besteuert wird das Eigentum an Wirtschaftsgütern. Substanzsteuern sind unabhängig von der Erzielung von Einkommen (mit diesen Wirtschaftsgütern). Hierunter fallen zum Beispiel die Grundsteuer und die Vermögensteuer, die allerdings seit dem Jahr 1997 nicht mehr erhoben wird. Diese Steuern sind Substanzsteuern. Die Ertragsteuern und Substanzsteuern werden zusammen genommen auch als Besitzsteuern bezeichnet.
Besteuerung der Verwendung von Einkommen und Vermögen und des Konsums (Verkehr- und Verbrauchsteuern)
Unter diese Kategorie fallen die Verkehrsteuern und die Verbrauchsteuern, die die Verwendung von Einkommen und Vermögen, also die Konsumausgaben, besteuern.
Abbildung 1.2 veranschaulicht die Zusammenhänge.
Halten Sie an dieser Stelle einmal ganz kurz inne, da Sie möglicherweise durch die vielen Begriffe etwas erschlagen sind (aber ich hatte Sie ja gewarnt!). Was ist wichtig zu behalten?
Es gibt viele Steuerarten, die unterschiedliche Lebenssachverhalte erfassen (Vielsteuersystem).Diese Steuerarten können nach unterschiedlichen Kriterien eingeteilt werden. Eine mögliche Einteilung ist die nach rechtlichen Kriterien und nach der Besteuerungsbasis. Hier ist es nicht so wichtig, dass Sie die Einteilungskriterien kennen, sondern wissen, was sich hinter den hierunter gefassten »Steuergruppen« verbirgt!Bei der rechtlichen Betrachtungsweise wird danach systematisiert, woran das Gesetz die Steuerpflicht knüpft. Hier können Sie Personen-, Objekt-, Verkehr- und Verbrauchsteuern unterscheiden.Bei der wirtschaftlichen Betrachtungsweise (Besteuerungsbasis) erfolgt die Systematisierung nach dem Gegenstand der Besteuerung, also Ertragsteuern, Substanzsteuern, Verkehr- und Verbrauchsteuern sowie Steuern auf den unentgeltlichen Vermögenstransfer.Für die Steuerarten, die in diesem Buch behandelt werden, gibt es unterschiedliche Bezeichnungen je nach Kriterium. So ist die Einkommensteuer beispielsweise sowohl eine Personen- als auch eine Ertragsteuer.Abbildung 1.2: Systematisierung der Steuerarten aus rechtlicher und wirtschaftlicher Sicht
Systematisierung nach der Ertragshoheit
Steuern können Sie auch danach unterscheiden, wem das Aufkommen an Steuern zusteht. In der finanzwissenschaftlichen Terminologie geht es hier um die Ertragshoheit (kurz gefasst: Wer bekommt das Geld?). Wem das Aufkommen an Steuern zusteht, ist im Grundgesetz nach Art. 106 GG geregelt, das Bundessteuern, Ländersteuern, Gemeindesteuern und Gemeinschaftsteuern unterscheidet.
Gemeinschaftsteuern:
Bei den in diesem Buch behandelten Steuern handelt es sich (mit Ausnahme der Gewerbesteuer) um
Gemeinschaftsteuern
. Das Steueraufkommen wird auf Bund, Länder und Gemeinde nach einem in Art. 106 GG festgelegten Schlüssel aufgeteilt. Der Schlüssel ist für die Einkommensteuer und die Körperschaftsteuer fest (Art. 106 Abs. 3 GG), während bei der Umsatzsteuer die Anteile von Bund, Ländern und Gemeinden schwanken können (Art. 106 Abs. 4 GG).
Tabelle 1.1
zeigt den Anteil von Bund, Ländern und Gemeinden am Steueraufkommen im Jahr 2022.
Steuerart
Bund
Länder
Gemeinden
(Veranlagte) Einkommensteuer
42,5 %
42,5 %
15,0 %
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag
50,0 %
50,0 %
-
Körperschaftsteuer
50,0 %
50,0 %
-
Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge
44,0 %
44,0%
12,0 %
Umsatzsteuer
52,81 %
45,19 %
2,00 %
Tabelle 1.1: Aufteilung des Aufkommens wichtiger Steuerarten auf Bund, Länder und Gemeinden (2023) (Bundesminister der Finanzen, Datensammlung zur Steuerpolitik, Ausgabe 2024, Seite 10)
Gemeindesteuer:
Die Gewerbesteuer und die Grundsteuer sind
Gemeindesteuern
, da das Gewerbesteueraufkommen nach 106 Abs. 6 GG den Gemeinden zusteht. Bund und Länder können durch eine Umlage an der Gewerbesteuer beteiligt werden; alles Weitere regelt das Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz).
Bundessteuern
sind beispielsweise die Energie-, Tabak-, Branntwein-, Kfz-Steuer und der Solidaritätszuschlag (Art. 106 Abs. 1 GG).
Ländersteuern
sind unter anderem die Erbschaftsteuer, die Grunderwerbsteuer und die Rennwett- und Lotteriesteuer (Art. 106 Abs. 2 GG). Daneben steht den Ländern ein Anteil am Aufkommen der Einkommen-, Körper- und Umsatzteuer zu.
Und noch ein paar Begriffe mehr …
Ihnen schwirrt schon der Kopf wegen so vieler (neuer) Begriffe? Leider sind wir hier noch nicht am Ende. Aber keine Angst: Viele der Begriffe tauchen in diesem Buch noch häufiger auf, sodass es im Zusammenhang dann vielleicht leichter erinnert werden kann. Außerdem wissen Sie ja: Sie können auf diesen Grundlagenteil später immer wieder zurückgreifen!
Direkte und indirekte Steuern: Bei dieser Unterscheidung geht es um die Frage, wer die Steuern schuldet (sie also ans Finanzamt übermittelt) und wer sie (wirtschaftlich) trägt oder tragen soll (also mit ihr »belastet« ist). Bei den direkten Steuern sind Steuerschuldner und Steuerträger identisch. Das bedeutet also, dass der Steuerschuldner die Steuerlast selbst zu tragen hat. Hierunter fallen zum Beispiel die Einkommensteuer und die Körperschaftsteuer, aber auch die Gewerbesteuer und die Erbschaft- und Schenkungsteuer.
Bei den indirekten Steuern fallen Steuerschuldner und Steuerträger auseinander. Hierzu zählen zum Beispiel die Umsatzsteuer und die Verbrauchsteuern; die Steuerlast wird also auf den Konsumenten abgewälzt.
Auf das weiter vorn geschilderte Beispiel angewandt: Paul schuldet als gewerblicher Unternehmer die Einkommensteuer auf seine Einkünfte aus dem Gewerbebetrieb (er ist Steuerschuldner); ebenso die Gewerbesteuer. Mit beiden Steuern ist Paul wirtschaftlich belastet. Einkommen- und Gewerbesteuer sind direkte Steuern. Die Umsatzsteuer auf seine gewerblichen Einnahmen schuldet er zwar dem Finanzamt (er ist Steuerschuldner). Er ist aber nicht wirtschaftlich mit ihr belastet, sondern bekommt diese Steuer vom Verbraucher (Endkonsument). Dieser ist hier der Steuerträger. Die Umsatzsteuer ist daher eine indirekte Steuer.
Das Verhältnis von direkten und indirekten Steuern am gesamten Steueraufkommen der Bundesrepublik Deutschland beträgt im Übrigen rund 55 % (direkte Steuern) zu 45 % (indirekte Steuern).
Veranlagungsteuernund Abzugsteuern: Bei Veranlagungsteuern muss der Steuerpflichtige (§ 33 Abs. 1 AO) eine Steuererklärung abgeben. Die Steuer wird dann in einem förmlichen Verfahren vom Finanzamt ermittelt und festgesetzt (Steuerbescheid). Hierzu zählen beispielsweise die Einkommen-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer sowie die Erbschaft- und Schenkungsteuer. Die Abzugsteuern werden hingegen bei Auszahlung von der auszahlenden Stelle einbehalten und für fremde Rechnung an das Finanzamt abgeführt (zum Beispiel Lohnsteuer und Kapitalertragsteuer).
Auf das Beispiel weiter vorn angewandt bedeutet das: Paul muss als Folge seiner gewerblichen Tätigkeit unter anderem eine Einkommensteuererklärung abgeben. Das Finanzamt berechnet dann die Einkommensteuer und schickt Paul einen entsprechenden Einkommensteuerbescheid. Die Einkommensteuer ist eine Veranlagungsteuer. Bettinas Arbeitgeber ist verpflichtet, Lohnsteuer von ihrem Gehalt einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen, Bettina erhält also nur den Nettobetrag. Die Lohnsteuer ist einer Abzugsteuer. Bettina muss übrigens trotzdem (auch) eine Steuererklärung abgeben, weil sie noch Vermietungseinkünfte hat (§ 46 Abs. 2 Nr. 1 EStG).
Jahressteuern: Bei den Jahressteuern werden die Grundlagen der Besteuerung jeweils für ein Kalenderjahr ermittelt. Man kann sie auch als periodische Steuern bezeichnen, die unter normalen Verhältnissen regelmäßig anfallen (eben einmal im Jahr). Hierzu zählen die Einkommen-, Körper-, Gewerbe- und Umsatzsteuer. Im Gegensatz dazu stehen aperiodische Steuern, die unter normalen Umständen nicht regelmäßig entstehen. Hierunter fallen beispielsweise die Erbschaft- und Schenkungsteuer.
Für unser Beispiel bedeutet das: Paul gibt die Einkommensteuer- wie auch die Gewerbesteuererklärung für ein Kalenderjahr ab, zum Beispiel für das Jahr 2020 (dem Veranlagungszeitraum). Einkommensteuer und Gewerbesteuer sind periodische Steuern, da sie regelmäßig anfallen. Die Erbschaftsteuererklärung von Bettina betraf jedoch nur das (einmalige) Erbe der Tante. Die Erbschaft- und Schenkungsteuer ist somit an ein Erbe oder eine Schenkung gebunden und daher eine aperiodische Steuer.
Zusammenfassende Übersicht
Tabelle 1.2 fasst die wichtigsten Steuerarten (rund 97 % des gesamten Steueraufkommens) noch einmal zusammen und ordnet sie in die oben genannten Kategorien ein. Ergänzt wird die Darstellung um Angaben zum prozentualen Anteil der Steuern am gesamten Steueraufkommen der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2021.
Steuerart
Anteil am Steueraufkommen (2021)
Exemplarische Einordnung in die oben genannten Kategorien
Einkommensteuer
38,5 %
Ertragsteuer, Personensteuer, direkte Steuer,
gemeinschaftliche Steuer, Veranlagungsteuer (in dem Wert sind aber auch die Abzugsteuern enthalten)
Umsatzsteuer
30,8 %
(allgemeine) Verbrauchsteuer, Verkehrsteuer, indirekte Steuer, gemeinschaftliche Steuer, Veranlagungsteuer
Gewerbesteuer
7,2 %
Ertragsteuer, Objektsteuer, direkte Steuer,
Gemeindesteuer, Veranlagungsteuer
Energiesteuer
5,3 %
Verbrauchsteuer, indirekte Steuer, Bundessteuer
Körperschaftsteuer
4,3 %
Ertragsteuer, Personensteuer, direkte Steuer,
gemeinschaftliche Steuer, Veranlagungsteuer
Solidaritätszuschlag
2,4 %
Ertragsteuer, Personensteuer, direkte Steuer,
Bundessteuer, Zuschlagsteuer zur Einkommensteuer und Körperschaftsteuer
Tabaksteuer
1,8 %
Verbrauchsteuer, indirekte Steuer, Bundessteuer
Grundsteuer
1,9 %
Objektsteuer, direkte Steuer, Gemeindesteuer
Grunderwerbsteuer
1,8 %
Verkehrsteuer, direkte Steuer, Ländersteuer
Kfz-Steuer
1,2 %
Verkehrsteuer, direkte Steuer, Bundessteuer
Stromsteuer
0,9 %
Verbrauchsteuer, indirekte Steuer, Bundessteuer
Erbschaft- und Schenkungsteuer
0,9 %
Personensteuer, direkte Steuer, Ländersteuer
Tabelle 1.2: Zusammenfassende Übersicht zu den Steuern und deren Kategorisierung sowie prozentualer Anteil am Steueraufkommen (2021) (alle Gebietskörperschaften; Bundesminister der Finanzen, Datensammlung zur Steuerpolitik, Ausgabe 2023, S. 14 und 15)
Es wird konkreter: Steuersubjekt, Steuerobjekt, Bemessungsgrundlage und Steuertarif
Nachdem Sie nun erfahren haben, was Steuern sind und wie sie systematisiert werden können, soll es nun darum gehen, mit welchen Fragen Sie sich im Rahmen der einzelnen Steuerarten beschäftigen müssen. Anders ausgedrückt: Sie sympathisieren mit Bettina und Paul aus dem Beispiel weiter vorne und fragen sich nun, wie hoch denn nun eigentlich die Steuern sind, die die beiden an den Fiskus zu zahlen haben. Ich mute Ihnen auch hier wieder ein bisschen Theorie zu. Selbst wenn es trocken erscheint – so ganz »ohne« geht es im Steuerrecht leider nicht!
Voraussetzung für die Festsetzung einer Steuer ist, dass ein Tatbestand erfüllt sein muss, an den als Rechtsfolge eine Steuer geknüpft ist. Den § 38 AO habe ich zu Beginn des Kapitels bereits erwähnt und pragmatisch erklärt, dass Sie Ihre Steuern beispielsweise nicht mit der Finanzverwaltung verhandeln können: »Die Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis entstehen, sobald der Tatbestand verwirklicht ist, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft.«
Die Steuerarten, die Paul und Bettina zahlen müssen, hatte ich ja bereits erläutert. Doch welche Tatbestandsmerkmale liegen der Besteuerung zugrunde? Konkret sind das:
Steuersubjekt
bzw.
Steuerschuldner
Steuerobjekt
Steuertarif
bzw.
Steuersatz
Im Rahmen der Betrachtung des Steuerobjekts wird es auch noch um die steuerliche Bemessungsgrundlage gehen.
Das Steuersubjekt oder der Steuerschuldner
Dem Steuersubjekt (also in unserem Beispiel Bettina beziehungsweise Paul) wird der jeweilige Steuergegenstand (Steuerobjekt) und damit auch die Steuerschuld zugerechnet. Steuerschuld und Steuersubjekt gehören also zusammen. Beim Steuersubjekt handelt sich um die zur Besteuerung herangezogene Person. Das Steuersubjekt wird auch als Steuerschuldner bezeichnet. An diese steuerliche Zurechnung sind steuerliche Verpflichtungen geknüpft, wie zum Beispiel die Abgabe einer Steuererklärung. Der Steuerschuldner ist Steuerpflichtiger im Sinne des § 33 AO. Das klingt an dieser Stelle vielleicht relativ kompliziert, ist aber ganz einfach: Bettina ist Steuersubjekt, Steuerschuldnerin und Steuerpflichtige.
Bei den Personensteuern ist die persönliche Steuerpflicht zu Beginn der jeweiligen Gesetze geregelt (§ 1 EStG, § 1 KStG, § 2 ErbStG). Die Einkommensteuer knüpft die persönliche Steuerpflicht beispielsweise an den Wohnsitz oder den gewöhnlichen Aufenthalt einer natürlichen Person an. Bettina ist beispielsweise Steuerschuldnerin der Einkommensteuer (sie ist dort Steuersubjekt). Darüber hinaus ist sie bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer als Erbin ihrer Tante persönlich steuerpflichtig. Paul schuldet die Umsatzsteuer aus seiner gewerblichen Tätigkeit und ist auch Steuerschuldner bei der Gewerbesteuer.
Das Steuersubjekt oder der Steuerschuldner ist die zur Besteuerung herangezogene Person; dieser Person (hier Bettina oder Paul) wird der jeweilige Steuergegenstand zugerechnet. Das Steuersubjekt gibt Antwort auf die Frage: Wer wird besteuert?
Das Steuerobjekt
Das Steuerobjekt ist der Steuergegenstand. Es erfasst das Steuergut beziehungsweise Besteuerungsgut