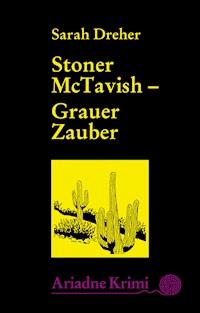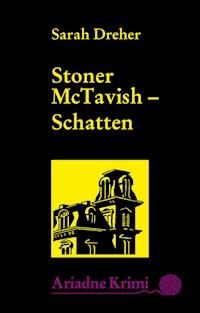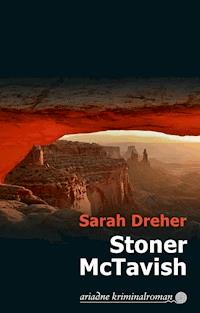Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Argument Verlag mit Ariadne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Irgendwas stimmt mit Tante Hermione nicht. Sie wird immer dünner und blasser, neigt zur Vergesslichkeit und ist erschreckend geistesabwesend – ganz untypisch für die rüstige Spiritualistin! Stoner tut, was sie am besten kann: Sie macht sich Sorgen. Als der Arzt nichts finden kann, obwohl sich Hermiones Zustand weiter verschlimmert, holt Stoner den Rat einer professionellen Schamanin ein. Die empfiehlt eine schamanische Reise, um den Verbleib von Hermiones starker Seele zu klären. Nur: Mit solchen Dingen wollte Stoner nie etwas zu tun haben, denn die machen ihr eine Höllenangst!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 421
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sarah Dreher
Der Rat der Schamanin
Stoner McTavish 7
Deutsch von Hilke Bleeken
Ariadne
Titel der US-Originalausgabe: Shaman’s Moon
© 1998 by Sarah Dreher
Lektorat: Hiltrud Bontrup
Alle Rechte vorbehalten
© Argument Verlag 1999/2022
www.argument.de
Glashüttenstraße 28
20357 Hamburg
Telefon 040 / 40 18 00 0 – Fax 040 / 40 18 00 20
Umschlaggrafik: Martin Grundmann
ISBN 978-3-86754-795-6 (E-Book)
Inhalt
Kapitel 1
Tante Hermione bestand darauf, dass es ihr gut ging, aber Stoner wusste, dass etwas nicht in Ordnung war. Sie merkte es an diesem Sekundenbruchteil des Zögerns, ehe Tante Hermione sprach, so als müsste sie nach Worten suchen. Sie merkte es an der wachspapierartigen, beinahe durchsichtigen Konsistenz der Haut auf den Wangen ihrer Tante. Merkte es an dem winzigen, untypischen Seufzer, der ihr entwich, wenn sie sich aus ihrem Sessel erhob. Und sie merkte es an dem Schauder in ihren eigenen Knochen, an dem Prickeln unter ihrer Haut, wenn sie einen unerwarteten Blick von ihr erhaschte.
Sogar Gwen, Stoners Geliebte und Lebensgefährtin, die dreimal olympisches Gold für Sorglosigkeit geholt hatte, war beunruhigt. Sie sagte nicht viel, aber Stoner ertappte sie dabei, wie sie in Tante Hermiones Richtung blickte, wenn sie sich unbeobachtet fühlte.
Marylou Kesselbaum, ihre vierte Mitbewohnerin und Stoners Partnerin im Reisebüro Kesselbaum & McTavish, war am wenigsten besorgt. »Wenn irgendetwas nicht stimmt, wird sie es uns sagen«, hatte Marylou geantwortet, als Stoner das Thema aufbrachte, und ihr ein Waldmeister-Wassereis angeboten.
Stoner saß beunruhigt auf der vorderen Verandatreppe und betrachtete den Deerfield River, der eine Meile von ihrem Haus entfernt am Hang entlangfloss, aber dennoch zu sehen war. Seit sieben Monaten lebten sie jetzt in Shelburne Falls. Wegen des Hauskaufes bis zum Hals verschuldet, hatten sie sich bemüht, das Reisebüro auch während der Wintersaison am Laufen zu halten. Sie liebte die Kleinstadtatmosphäre in West-Massachusetts, aber sie hatte sich immer noch nicht an die Ruhe gewöhnt. Die Jahre in der Bostoner Innenstadt hatten, so dachte sie, das Verkehrsrauschen zu einer Selbstverständlichkeit werden lassen, die nun Stille laut und Lärm wie Ruhe erscheinen ließ.
Es war ein nahezu vollkommener Spätfrühlingstag. Ein hoher, strahlend blauer Himmel mit ein paar Wolkenfetzen spiegelte sich im glitzernden Wasser. Ahornbäume und Eichen standen in vollem Laub. Der Duft von Apfelblüten lag in der Luft. Bienen summten über den Irisblüten, und eine leichte Brise ließ silberne Schatten im Gras tanzen.
Eine neue Jahreszeit. Sie hatten sich wirklich gut eingelebt. Tante Hermione hatte verwandte Seelen und Kundschaft durch die Gesellschaft für mentales Bewusstsein und in der Spiritistischen Kirche von Springfield gefunden. Nachdem sie ihr Leben lang nur öffentliche Verkehrsmittel benutzt hatte, war sie nun tatsächlich entschlossen, den Führerschein zu machen, um ihre neuen Freundinnen öfter besuchen zu können. Zu Lichtmess war sie in einen Hexenzirkel in der Gegend aufgenommen worden, nachdem eines der Mitglieder verstorben und ein anderes nach Oregon gezogen war. Sie fand es anregend, einer Gruppe gemischten Alters anzugehören. Aber manchmal strengte es sie an. »Junge Leute«, sagte sie zu Stoner, »sind so übersprudelnd.«
Marylou, die immer am falschen Ort nach Liebe suchte, hatte sie wieder einmal gefunden. Ihre derzeitige Flamme war ein Vietnamveteran namens Cutter. Er lebte irgendwo tief im Wald und verbrachte seine Tage in einem buddhistischen Camp draußen bei Ashfield, wo er Bauarbeiten erledigte und was sonst noch so anfiel, um für seine Sünden zu büßen. Sie hatte ihn eines Morgens in McCuskers Supermarkt getroffen, als sie das Angebot an Vollkornmuffins inspizierte. Cutter sprach sehr wenig, rasierte sich den Kopf und trug meistens eine buddhistische Mönchskutte. Marylou fand das attraktiv. Einmal kam er zum Abendessen, fühlte sich aber in ihrem Wohnzimmer so unwohl, dass er schließlich mit Marylou auf der hinteren Veranda aß.
Stoner hatte das Gefühl, dass Marylou ein hoffnungsloser Fall war.
Gwen hatte Arbeit in der Mohawk-Schule gefunden. Zuerst als Aushilfslehrerin, dann Teilzeit, und im April hatte sie eine befristete Vollzeitstelle für die Fächer Geschichte und Sozialkunde übernommen. Sie fand es ein wenig nervtötend, nach zwölf Jahren Unterrichtserfahrung am Ende des Schuljahrs wie eine Anfängerin mit einer Kündigung dazustehen. Aber obwohl sie während der ersten drei Jahre jeweils im Mai gefeuert werden würde, hatte der Direktor ihr versichert, sie wieder einzustellen, wenn sie ihre Bewerbung erneut einreichen würde. Der Sohn der Elternratsvorsitzenden war ihr Schüler gewesen. Er hatte sich auf der Stelle in Gwen verknallt und daraufhin seine Fünf in Geschichte innerhalb eines Halbjahrs in eine Zwei verwandelt. Die Tochter eines anderen Elternratsmitglieds würde dieses Jahr in ihrer Klasse sein. Neuigkeiten verbreiteten sich hier schnell über den Gartenzaun oder bei einer Tasse Kaffee. Und der Elternrat der Mohawk-Schule hatte bereits entschieden, dass Gwen Owens zu den guten Neuigkeiten zählte.
Und was ist mit dir, fragte sich Stoner. Der Umzug war einfacher, als sie gedacht hatte. Natürlich, die Dinge liefen immer einfacher, als sie erwartete. Das war so, weil sie in ihrer Vorstellung immer einen Platz für unerwartete Katastrophen frei hielt. Tante Hermione war überzeugt, dass Stoners Problem latente und angstbesetzte übersinnliche Fähigkeiten waren, die dazu führten, dass sie negative Vorahnungen hatte. »Unentwickelte übersinnliche Fähigkeiten sind eine Beleidigung der Natur«, pflegte ihre Tante zu sagen. »Mit dem übersinnlichen Trieb ist es wie mit dem Sex. Für sich genommen ist er wunderbar, aber man muss ihn im Griff haben.«
Das war alles schön und gut für Tante Hermione. Sie hatte ihr Leben lang übersinnliche Fähigkeiten gehabt – mehrere Leben lang, wenn es nach ihr ging – und lebte sogar ganz gut von der Hellseherei. Sie war gleich gut in Tarot und Hellsehen und Stimmenhören, als Medium – sowohl in Trance als auch im Wachzustand – und Psychometrie. Astrologie jedoch, so erklärte sie, sei zu wissenschaftlich, wenn man erst mal zu den Transiten kam, und liege außerhalb ihrer Kenntnisse.
Stoner glaubte an das, was ihre Tante tat, denn sie hatte genug davon gesehen. Sie wäre eine Närrin, wenn sie nicht daran glauben würde. Aber was sie selbst betraf, so wollte sie nichts, absolut gar nichts damit zu tun haben.
Ihre Tante war über ihre Abneigung nicht überrascht. Steinböcke, so erklärte sie, hatten häufig Schwierigkeiten mit übersinnlichen Angelegenheiten, weil sie naturgemäß die Dinge bodenständig und handfest liebten.
Um möglichst bodenständig zu sein, versuchte Stoner sich von Zeit zu Zeit vor Augen zu führen, dass Tante Hermione nicht jünger wurde – immerhin ging sie auf die achtzig zu. Eines Tages würde ihre Gesundheit versagen. Daran führte kein Weg vorbei, und es war sinnlos, das zu leugnen. Die gesündesten Leute der Welt wurden irgendwann alt. Und dann …
Wann immer sie an den unvermeidlichen Tod ihrer Tante dachte, verwandelte sich alles in ihrem Kopf in weißes Rauschen. Sie konnte nicht mehr denken, konnte sich nicht mehr bewegen. Die Zukunft existierte nicht. Da war eine hohe Mauer am Ende des Jetzt und am Anfang des Danach, und hinter dieser Mauer war nichts.
Sie wusste wirklich nicht, was sie tun würde, wenn es so weit war. Sie hatte die meiste Zeit ihres Lebens mit ihrer Tante verbracht. Seit sie mit sechzehn von zu Hause fortgelaufen war, fort von ihren Eltern, die sie hassten, weil sie eine Lesbe war. Tante Hermione hatte sie in ihren Armen und in ihrem Leben willkommen geheißen. Tante Hermione war mehr gewesen als eine Tante, sie war eine Freundin, ein Elternteil, ihre Familie. Tante Hermione hatte ihr während der Höhen und Tiefen des Erwachsenwerdens die Hand gehalten, und während der Launen der Liebe. Sie kümmerte sich um sie, wenn sie krank war. Versorgte sie und liebte sie und brachte sie manchmal um den Verstand.
Das galt übrigens auch umgekehrt.
Aber eines Tages würde Tante Hermione nicht mehr da sein. Egal, wie vehement sie darauf bestand, dass ihr Geist immer da sein würde und dass sie Stoner das Leben zur Hölle machen würde, wenn sie sich nicht benahm … Eines Tages würde sie einfach nicht mehr da sein. Eines Morgens würde Stoner in die Küche hinunterkommen, und es würde nicht nach Schinken und Kuchen und aufgewärmten Resten vom letzten Abendessen riechen.
Tante Hermiones Vorstellung von einem Frühstück bestand nämlich aus einer Kombination von Speisen, die sie im Kühlschrank aufstöberte oder zufällig sah, ganz gleich, ob diese irgendetwas mit einem normalen Frühstück zu tun hatten oder nicht. »Stell dir einfach vor, es wäre ein Brunch«, sagte sie, wenn Stoner erklärte, dass es viel zu früh sei für Hackbraten und Spinatsoufflé.
Stoner hatte sich nie an Desserts und Reste gewöhnt, die am frühen Morgen auf ihren Magen trafen. Es war einfach nicht richtig. So etwas machte man nicht. Es war unmoralisch.
Tante Hermione sagte, dass Stoner den Humor einer Protestantin habe.
Da hatte Stoner eingesehen, dass sie wirklich stur war. Und ihrer Tante den Spaß verdarb.
Tante Hermione war sogar einmal verheiratet gewesen – für etwa zehn Minuten, so schien es – mit einem ›Herrn mit protestantischer Überzeugung‹. Sie bestand darauf, dass dies eins der unangenehmsten und übelsten Erlebnisse ihres Lebens gewesen sei. Danach hatte sie nicht nur den Protestanten abgeschworen, sondern auch der Religion, der Ehe und den Männern im Allgemeinen. Dennoch hatte sie eine kurze Affäre mit einem niederen Mitglied der Kennedy-Familie gehabt. »Es war«, so Tante Hermione, »nichts Besonderes dabei. Das machen doch alle.«
Tatsächlich hielt ihre Tante die ganze romantische Vorstellung von Liebe für ziemlich überbewertet. Jedenfalls bis zu dem Zeitpunkt, als sie Grace D’Addario traf.
Grace war eine ältere Frau, wie Tante Hermione, aber ein paar goldene Jahre länger auf dieser Welt. Sie war groß, freundlich und furchteinflößend. Und sie war eine Wicca, eine einsame Praktizierende der Hexenkunst. Seit Grace in ihr Leben getreten war, fand sich Stoner von beschämenden Gefühlen überwältigt.
Es war klar, dass Tante Hermione sich Hals über Kopf in diese Frau verliebt hatte.
Und Grace erwiderte dieses Gefühl.
Sie benehmen sich wie Kinder, dachte Stoner damals herablassend. Hielten in der Öffentlichkeit Händchen. Sogar in Restaurants. Brachten einander Blumen mit. Hingen endlos am Telefon.
»Du machst dich lächerlich.« Stoner war geschockt, sich eines Abends plötzlich so reden zu hören. »Du bist zu alt für so etwas.«
Ihre Tante sah sie vollkommen erstaunt an.
»Etwas sehr Schlimmes wird passieren, wenn du dich weiterhin so benimmst.« Sie hörte, wie ihre Stimme in unangenehme Höhen stieg, und konnte es nicht verhindern. »Du bist schon einmal verhaftet worden, um Himmels willen!«
»Tatsächlich«, sagte Tante Hermione gelassen, »wurde ich schon mehrmals verhaftet. Du weißt nur nichts davon.«
»NACKT über einen Friedhof zu laufen!«
»Bitte, Stoner, du weißt, worum es dabei ging.«
Das wusste sie sogar ganz genau. Wann immer eine finstere Gestalt gestorben war, tanzten Grace und Tante Hermione bei Neumond nackt auf dem frischen Grab, »um sicherzugehen, dass er dort unten bleibt.« Das taten sie bei Leuten, die sie persönlich kannten, wie Gwens Ehemann, der versucht hatte, sie umzubringen, den Stoner aber zuerst erwischt hatte. Sie taten es bei Leuten, über die sie in der Zeitung gelesen hatten – Vergewaltiger, Kindesmisshandler, prügelnde Ehemänner und rundherum unangenehme Typen. Manchmal taten sie es, wenn sie an einem frischen Grab vorbeikamen und dabei ›ein ungutes Gefühl‹ hatten.
Sie waren niemals wirklich für nacktes Grabtanzen verhaftet worden. Einmal wäre es fast dazu gekommen, aber der Polizist, der sie gestellt hatte, war jung und konnte sich nicht dazu überwinden, jemandes Großmutter einzukassieren.
Offensichtlich hatte Grace einen schrecklichen Einfluss auf Tante Hermione. Sie waren wie Hunde im Rudel, es war viel wahrscheinlicher, dass sie zusammen Unheil anrichteten als alleine.
Und es gab nichts, was Stoner dagegen tun konnte. Sie fühlte sich so hilflos wie die Eltern eines Teenagers.
Also sorgte sie sich und schmollte, bis irgendwann sogar Gwen ihre schlechte Laune leid war. Sie knöpfte sich Stoner eines Nachts vor und sagte ihr, sie sei stur wie ein Maultier. Gwen meinte es wirklich ernst, und wenn sie verärgert war, wechselte sie in ihren Südstaatenakzent über. Dann brachte sie es fertig, aus ›Maultiah‹ ein sechssilbiges Wort zu machen.
Stoner brach in Tränen aus, und während sie weinte, wurde ihr klar, dass sie eifersüchtig war und Angst hatte. Angst, dass ihre Tante sie wegen dieser neuen, glühenden Liebe in ihrem Leben nicht mehr brauchen würde.
Sie hatte erwartet, dass Grace ihr böse sein oder sie zumindest auslachen würde, als sie ihr dies gestand und sich entschuldigte. Aber Grace hörte ruhig zu, nickte und sagte, sie verstehe.
»Außerdem«, sagte sie dann, »verlierst du nicht deine Tante, sondern du bekommst einen ganzen Haufen neuer Probleme.«
Ein verbeulter Pick-up rumpelte am Haus vorbei. Der Fahrer blinzelte kurzsichtig zu den Straßenschildern hinüber und fluchte offensichtlich vor sich hin. Er sah sie und kurbelte sein Fenster herunter. »Hey!«, rief er.
Es war kein ›Hey, hallo, wie geht’s dir, schön, dich zu sehen‹-Hey. Es war ein ›Hey, du Dussel, krieg deinen lahmen Hintern hoch und sag mir, wie zum Teufel ich aus dieser verfluchten Stadt rauskomme, in der niemand, der noch bei Trost ist, leben würde!‹-Hey.
Stoner tat, als würde sie nicht verstehen, grinste und winkte idiotisch.
Mr. Pick-up rammte seinen Fuß aufs Gas und verheizte einen der noch verbleibenden zwei Zentimeter seines Reifenprofils.
Vielleicht sollte sie Grace anrufen, vielleicht hatte sie auch irgendetwas … Merkwürdiges … an Tante Hermione bemerkt.
Aber wie sollte sie ihr erklären, was sie meinte? Es gab nichts, worauf sie den Finger legen konnte, nichts war klar benennbar. Da war nur dieses komische Gefühl. Tante Hermione würde es eine Disharmonie zwischen den Chakren nennen.
Stoner fand, dass sie ihre Tante zu genau beobachtete, zu ängstlich. Ihre Tante würde sagen, dass Stoner die dunklen Mächte mit negativer Energie fütterte, oder irgendetwas in dieser Art. Stoner war zwar nicht bereit, so weit zu gehen, aber sie wusste, dass sie verrückt werden würde, wenn sie nicht bald damit aufhörte.
In einem Baum hinter dem Haus sang ein Pirol. Sie hatte eine Frau im Buchladen getroffen, die Pirole ›die Rachevögel des Satans‹ nannte, weil sie ihre Nester in der Nähe von Häusern bauten, mit ihren Stimmen Blei durchdringen konnten und weil sie im Morgengrauen zu singen begannen und den ganzen Tag weitermachten. »Und nicht nur das«, hatte die Frau gesagt. »Sie suchen Leute mit posttraumatischem Stresssyndrom und quälen sie vorsätzlich.« Sie verzog das Gesicht, als ob sie aus persönlicher Erfahrung sprach.
Stoner hoffte, dass sich auf Cutters Camp keine Pirole herumtrieben.
Dennoch, sie mochte diese Vögel. In Boston gab es keine Pirole. Abgesehen von dem Baseballteam mit dem großen ›P‹ natürlich, das normalerweise die Red Sox im Heimspiel fertigmachte und im Fenway Park nicht gerade freundlich empfangen wurde. Aber dieser Pirol hier, dieses Leuchten in Orange und Schwarz, das sie aus dem Augenwinkel sah, war faszinierend. Zuerst einmal die Farben. Stadtvögel hatten keine Signalfarben. Stadtvögel waren trist und grau, und wenn sie jemals bunt gewesen waren, so war diese Farbe über Generationen von der Stadtluft ausgeblichen worden, bis das Zementgrau ein Teil ihres genetischen Make-ups wurde. Sogar die Vögel im Zoo des Franklinparks sahen matt und farblos aus.
Und dann dieser Gesang. Schrill, ja, aber mit einem flötenähnlichen Ton, der weder von Menschen noch von einem von Menschenhand geschaffenen Instrument nachgeahmt werden konnte. Wenn man dieses Lied einmal kannte, würde man einen Pirol niemals mit einem anderen Vogel verwechseln.
Pirole hatten eine besondere Präsenz. Sie waren, was sie waren, nichts anderes. Stoner bewunderte diese Qualität.
Aber sie sollte sie lieber vom Büro aus bewundern. Während der Nebensaison wechselten sie und Marylou sich mit der Vormittags- und Nachmittagsschicht ab. Stoner bevorzugte die Nachmittagsschicht, weil sie außerstande war, sich selbst und andere vor zehn Uhr morgens anständig zu behandeln. Marylou war auf den Beinen, wenn der Morgen anbrach, und bereit, das Leben zu umarmen. Ihre einzige Angst war, dass sie etwas Aufregendes verpassen könnte.
Stoner hingegen war glücklich, wenn sie etwas verpasste. Hinterlasst mir einfach eine Nachricht, wenn es irgendetwas gibt, was ich wissen muss. Das war ungefähr so viel Aufregung, wie sie im Moment ertragen konnte.
Sie ging ins Haus, um abzuwaschen. Tante Hermione werkelte geschäftig in ihrem Arbeitszimmer herum und bereitete sich auf eine Sitzung vor. Sie hatte das Zimmer aufgeräumt, ihre Kristalle aus der Vitrine genommen und sie auf dem Tisch arrangiert, einen Krug mit Wasser gefüllt und eine neue Kerze in den Halter gesteckt. Jetzt widmete sie sich den Essenzen.
»Was denkst du, Stoner? Athene oder Mars? Die Klientin ist Skorpion.«
Stoner blickte ihrer Tante über die Schulter. Die gemischten Düfte der Essenzen kitzelten in ihrer Nase. »Ich glaube nicht, dass Mars und Skorpion sich gut vertragen«, sagte sie. »Hast du noch etwas Kali?«
»Natürlich«, sagte Tante Hermione. »Die vielarmige Göttin für die vielarmige Skorpionfrau.« Sie sah Stoner direkt an. »Du hast wirklich mehr Sinn für diese Dinge als andere Menschen.«
»Es war logisch.«
»Oh ja, die Durchschnittsfrau verbringt den größten Teil des Tages damit, über Sternzeichen und Essenzen nachzudenken«, sagte Tante Hermione ironisch.
Sie hatte leicht graue Schatten unter den Augen.
»Du siehst müde aus«, sagte Stoner.
»Oh, fang nicht schon wieder davon an!« Die ältere Frau warf ihr einen liebevoll-verzweifelten Blick zu. »Es geht mir gut. Es ging mir gut, als wir hierherkamen, und es geht mir immer noch gut.«
»Das hoffe ich.«
»Versuchst du, mich mit diesen Fragen in ein frühes Grab zu bringen? Wirklich, Liebes, das ist sehr ermüdend.«
»Tut mir leid. Ich mach mir einfach Sorgen.«
Ihre Tante tätschelte ihr beruhigend die Wange. »Ich weiß, dass du das tust, Stoner«, sagte sie. »Alle, die du jemals getroffen hast, und alle, die jemals von dir gehört haben, wissen, dass du dir Sorgen machst.«
Sie merkte, wie sie rot wurde. »Ich gehe jetzt.«
»Einen schönen Tag«, rief Tante Hermione fröhlich. »Erinnere Marylou bitte daran, nicht zu jauchzen, wenn sie heimkommt. Das erschreckt die Kundschaft.«
In Boston zur Arbeit zu gehen, war ein riskantes und ziemlich unangenehmes Unterfangen. Wenn man nicht ausgeraubt oder von einem der berüchtigten Bostoner Busfahrer überrollt wurde, wurden Hirn und Lunge von schädlichen Abgasen angegriffen. Die Augen wurden von hässlichen, feucht glänzenden Flecken ungeklärter Herkunft auf dem Asphalt beleidigt und von zerknittertem Papier, das wie Blutegel an den Füßen klebte. Das Wetter war ein Wechselbad zwischen kalt, feucht und ungemütlich und stickig, heiß und schwül.
Hier draußen aber führte sie der Weg zum Reisebüro durch Alleen und an Vorgärten entlang. Die Flecken auf der Straße waren leicht als Ölflecken, Bremsspuren, heruntergefallene Eiskugeln und Überreste von lebensmüden Tieren zu identifizieren. Und die schlimmsten Gerüche waren die von verfaulendem Obst und leeren Bananenkisten hinter dem Supermarkt.
Das Gras war in den letzten beiden kühlen und regnerischen Wochen schön grün geworden. Der Wasserspiegel des Flusses war gestiegen, und nun strömte und sprudelte er durch die Potholes. Diese eiszeitlichen Wasserbecken waren die natürliche Touristenattraktion von Shelburne Falls. Die nicht-natürliche war die sogenannte Blumenbrücke. Das war ein Fußweg zwischen den Wasserfällen und Buckland, dem Ort auf der anderen Seite des Flusses. Die ehrbaren Damen der Stadt hatten eine alte, verlassene Eisenbahnbrücke in einen langen Blumengarten verwandelt, der sich an beiden Seiten des Pfades entlangzog. Die Blumen wurden liebevoll gepflegt. Sie waren gesund und kräftig und mit kleinen Schildern versehen, um die Jugend und die Unwissenden zu belehren. Je nach Saison wurden neue Blumen gepflanzt. Am Eingang des Fußwegs bot ein kleiner Kiosk Postkarten von der Blumenbrücke an, die aussahen, als wären sie damals in den Fünfzigern aufgenommen worden. Letztes Jahr zu Weihnachten waren die beiden Städte und die Brücke dazwischen mit tausenden winzigen, hellen Lichtern dekoriert worden, die sich in dem schwarzen, schlammigen Fluss spiegelten.
Wer das nicht selbst gesehen hat, dachte Stoner, kann sich so etwas nicht vorstellen.
Sie atmete die frische Luft tief ein. Sie fühlte sich hier wohl. Sie fühlte sich tatsächlich so wohl, dass sie dauernd Angst hatte, Gwen, Marylou und Tante Hermione würden das Kleinstadtleben hassen und nur nichts sagen, weil sie hier offensichtlich so glücklich war.
»Stoner …« Sie konnte die Stimme von Dr. Edith Kesselbaum, ihrer früheren Therapeutin und Marylous Mutter, beinahe hören. »Bitte erspare uns deinen Größenwahn. Drei Leute würden nicht leiden, nur um dich glücklich zu machen.«
Kleinstädte können gute Orte sein. Manchmal. Sie hatten auch ihre Schattenseiten. Gwen hatte begonnen, ihre alten Shirley-Jackson-Geschichten über das Kleinstadtleben noch einmal zu lesen. Sie kannte Die Lotterie fast auswendig und war bei ihrem zweiten Durchgang von Wir haben immer in einem Schloss gelebt.
Stoner hoffte, dass dies kein schlechtes Zeichen war.
Stoners Heimatstadt King’s Grant, Rhode Island, war zweifellos ein unangenehmer Ort. Eines dieser gewollt malerischen Neuengland-Städtchen, wo Grünanlagen die Häuser im Kolonialstil säumen. King’s Grant zeichnete sich durch eine Atmosphäre von Reichtum und Verlogenheit aus. Man war stolz auf die Unverfälschtheit der Stadt aus dem achtzehnten Jahrhundert, aber Stoner dachte, wenn es ihnen mit der Unverfälschtheit wirklich ernst war, sollten sie aufhören, zu baden und elektrischen Strom zu benutzen.
Es gab kein Einkaufszentrum in King’s Grant. Allein dieses Wort auszusprechen war tabu. Wenn die Ansässigen in den Läden im Ort nicht fanden, was sie suchten, verließen sie die Stadt, meist im Schutze der Dunkelheit, und fuhren zu den Einkaufszentren am Stadtrand von Westerly. Westerly war ebenfalls verlogen, aber man lebte dort immerhin so weit im zwanzigsten Jahrhundert, dass man Einkaufszentren hatte.
Gwen war ebenfalls in einer Kleinstadt aufgewachsen. In Georgia. Sie sprach wenig darüber. Überhaupt sprach sie wenig über ihre Kindheit. Stoner wusste nur, dass ihr Vater sie misshandelt hatte und ihre Mutter eine eingebildete Frau war. Ihr Bruder war von zu Hause abgehauen. Ihre Eltern waren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, als Gwen vierzehn war, und sie war daraufhin nach Boston gezogen, um bei ihrer Großmutter zu leben. Die beiden hatten sich entzweit, als Gwen sich in Stoner verliebte und erklärte, sie würde Frauen lieben. Das war vor mehr als fünf Jahren gewesen, und seitdem hatte Gwen nichts mehr von ihr gehört. Sie behauptete, dass Jefferson, Georgia, der langweiligste Ort auf Erden sei. Die einzige Aufregung dort boten der jährliche Umzug des Ku-Klux-Klan durch die Stadt und ein großes Sommerfest, das von der Motorradfabrik der Nachbargemeinde veranstaltet wurde, denn dort arbeiteten die meisten Leute aus Jefferson. Sie vermisste Jefferson ›nicht die Spuah‹.
Shelburne Falls war weder Jefferson noch King’s Grant. Irgendwie war es schwer einzuordnen. Im Sommer, so erzählten die Einheimischen, wurde der Ort von Touristen überfallen, sobald die Ferien begannen (und alle kamen natürlich wegen der Potholes und der Blumenbrücke). Wanderer erkundeten den Nationalpark rund um den Mohawk-Pfad. Im Herbst wurde der Ort von Jägern heimgesucht, und die Waffen- und Spirituosenläden machten genug Umsatz, um über den Winter zu kommen. Bei den meisten Leuten waren die Jäger jedoch nicht gern gesehen.
Hinter der durchschnittlichen Fassade verbarg sich in Shelburne Falls ein ganz und gar anderes Leben. Die Kleinstadt war ein Refugium für Künstlervolk und Handwerksleute. In dem beschaulichen Ort konnte man ein museumstaugliches Bild direkt in einem echten Maleratelier erstehen. Die meisten Kunstschaffenden stellten ihre Arbeiten in der Salmon-Falls-Markthalle aus. Das alte Holzgebäude war wahrscheinlich eine ehemalige Haltestelle der Eisenbahn, denn Schienen und Bahnsteige verliefen direkt hinter den Läden. Es hatte Pläne gegeben, den alten Bahnhofsvorplatz zu einer Skateboard-Anlage umzugestalten. Andere wiederum hofften, dass es mit der Eisenbahn wieder bergauf gehen könnte und der Platz wieder in seinem ursprünglichen Glanz erstrahlen würde. Ein Traum, den Shelburne Falls schon seit dem vergangenen Jahrhundert träumte, wie Ethel, die Betreiberin des Trolley Stop, ihr erzählt hatte.
Im Erdgeschoss der Markthalle lag das Turquoise, ein Laden, in dem Schmuck, Bücher, Essenzen, Kristalle und viele andere New Age-Utensilien verkauft wurden. Die Besitzerin, Diana, hatte sich als Medium ›auf die Geister eingestimmt‹. Sie half bei allen Problemen, von Entscheidungen auf Leben und Tod bis hin zur Wahl des passenden Geschenks. Diana war Steuerberaterin gewesen, bevor sie ihre Kräfte annahm – oder was man auch immer mit diesen Kräften tat. Stoner mochte sie, aber sie fühlte sich in ihrer Gegenwart etwas unwohl, denn Diana teilte Tante Hermiones Meinung über Stoners hellseherische Fähigkeiten und meinte ebenfalls, dass sie Schwierigkeiten bekommen würde, wenn sie sie nicht akzeptierte.
Diana wusste, wovon sie sprach. Sie war, so sagte sie, an Körper und Geist gemartert und stand an der Schwelle des Todes, bevor sie ihre hellseherische Berufung annahm.
Hellsehende, Hexen, AnhängerInnen der Alten Religion und verschiedene HeilerInnen bildeten die andere große Gruppe der Bewohnerschaft. Man konnte zwischen Astrologie, Stimmenhören, Kräuterkunde, Massage, Reiki, Homöopathie und Tierheilkunde wählen, es gab TherapeutInnen, die mit Bach-Blüten, Aromaölen oder Ayurveda arbeiteten – die Liste war endlos. Wenn man nach einer neuen Heilmethode suchte, die noch nicht im örtlichen Branchenbuch zu finden war, so musste man es nur herumerzählen, und innerhalb von achtundvierzig Stunden würden die entsprechenden Fachleute auftauchen.
Stoner stand allerdings nicht allein mit dem Verdacht, dass die meisten zwar ernsthaft und hingebungsvoll arbeiteten, dass einige dieser wohlmeinenden Seelen jedoch mit kaum mehr als einem eintägigen Workshop oder der Lektüre eines Buches qualifiziert waren. Dies war schließlich Amerika. Alles ist möglich, solange du damit ein paar Dollar machen kannst und nicht gegen das Gesetz verstößt. Wer etwas Bestimmtes suchte und keine Anlaufadresse hatte, musste nur im Turquoise vorbeischauen und sich bei Diana erkundigen. In Shelburne Falls lag ein guter Ruf fest in Dianas Hand.
Sie wusste zwar bislang nicht von einer stimmenhörenden Anwältin, aber es gab bestimmt eine in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. Wahrscheinlich ein Medium von Justice Learned Hand, dem Mahner der Demokratie. Oder von Clarence Darrow, dem Anwalt aller Mühseligen und Beladenen.
Interessant, dachte Stoner, als sie in die Hauptstraße einbog. Es gab nicht viele tote Anwälte, zu denen sie Kontakt aufnehmen wollte. Unter den Lebenden ließen sich Juristen in zwei Kategorien einteilen: diejenigen mit Moral und die anderen, die auf der Gewinnerseite standen. Die Gewinner gingen zum Fernsehen und die Moralischen in die Regierung, wo sie ganz schnell korrupt wurden und dann auch als Gewinner dastanden.
Also, dachte sie, wir sind wirklich in einer großartigen Stimmung, um diesen Tag zu beginnen.
Als sie an der Trolley Stop Bar vorbeikam, winkte Ethel ihr durch das staubige Fenster zu. Ethel war weit über das Rentenalter hinaus, aber sie betrieb das ehemalige Café nach dem Tod ihres Mannes weiter. Im Ort nannte man es immer noch ›Das Café‹, das einzige Café in der Gegend, obwohl Ethel sich eine Lizenz für Alkoholausschank besorgt hatte. Wie sie an die Lizenz gekommen war, war Stoff für viele Spekulationen und Gerüchte, denn es war sehr wohl bekannt, dass in Shelburne Falls keine Lizenz mehr vergeben wurde. Aber, wie Ethel geheimnisvoll zu sagen pflegte: »Es gibt mehr als zwei Arten, einer Katze das Fell über die Ohren zu ziehen.«
Kein Geheimnis war dagegen, warum sie so viel auf sich genommen hatte, um an diese Lizenz heranzukommen. Massachusetts hatte das Gesetz ›Rauchverbot in Cafés und Restaurants‹ verabschiedet. In Bars jedoch war Rauchen erlaubt. Also erhöhte Ethel den Biervorrat, schloss den Laden für eine Woche und eröffnete dann die Trolley Stop Bar. Das besagten jedenfalls die Akten im Rathaus. Ethel kam nie dazu, ein neues Schild anzubringen. Und die alkoholischen Getränke, die es Ethels Kunden ermöglichten, in Rauchschwaden gehüllt über einer Tasse Kaffee zu sitzen und ihr Leben zu zerstören, blieben unangerührt.
Ethels Stammkundschaft war ein unglücklicher Haufen. Die Sorte, die man in einem vollgestopften kleinen Laden mit angelaufenen Fenstern und mumifizierten Insekten an den Wänden erwartete. Mürrische alte Kerle mit geflickten Hemden und Dreitagebärten. Sie waren alle über siebzig und im Ruhestand, obwohl man sich fragte, von wo aus sie in den Ruhestand getreten waren. »Im Ruhestand vom Ausruhen«, pflegte Ethel zu sagen. Sie waren alle im Krieg gewesen, mehr oder weniger jedenfalls. Einige der alten Geschichten schienen sich beim wiederholten Erzählen zu verändern, und manchmal erzählte Ed die Geschichten von Malvin, als wären es seine eigenen. Sie hatten alle Schmerzen und Zipperlein, verabscheuten junge Leute, und Frauen gab es keine in ihrem Leben.
»Was uns nicht überrascht«, sagte Ethel. »Welche halbwegs vernünftige Frau würde es mit denen schon aushalten?«
Stoner hatte sie einmal gefragt, warum sie das Trolley Stop weiterhin geöffnet hielt. Sie brauchte weder das Geld noch die Arbeit. Ihre Kinder waren erwachsen, ihr Mann gestorben. Ihre Tochter wollte, dass sie zu ihr nach South Carolina zog. Sie meinte, es würde ihr guttun, diesen unnützen alten Sündern die Tür vor der Nase zuzumachen und stattdessen unter Leuten zu leben, die nicht mit Gott haderten.
»Ich weiß nicht«, sagte Ethel nachdenklich. »Es erscheint mir nicht richtig. Und wo sollten sie dann im Winter hin?«
Tante Hermione glaubte, dass Ethels Stammkunden in Wirklichkeit Engel waren, und dass Ethel ihr Schicksal kannte, vielleicht ohne dass es ihr selbst bewusst war.
Die Tür des Reisebüros schloss sich mit einem leisen Klingeln hinter ihr. Sie sah sich um. Eine kleine Glocke aus angelaufenem Metall hing über dem Türrahmen, so dass die Tür sie bei jedem Öffnen und Schließen zum Klingen bringen würde.
»Niedlich«, sagte sie.
»Gefällt’s dir?«, fragte Marylou geschäftig. »Ich habe sie heute Morgen erstanden. Beim Trödler in der Colrain Road.«
»Na ja, zumindest kann sich jetzt niemand mehr reinschleichen.« Sie hängte ihre Tasche über den Garderobenständer und bedeutete Marylou, den Schreibtisch zu räumen.
Ihre Partnerin lachte. »Stoner, niemand könnte sich jemals hier reinschleichen. Wir haben eine acht mal zwölf Meter breite Ladenfront in einem ehemaligen Waschsalon, und eine Tür und Fenster, durch die wir alle Menschen auf der Straße sehen und durch die uns alle sehen.«
»Warum dann die Glocke?« Sie legte das Buch, das sie mitgebracht hatte, in die Schublade und tauschte die Laufschuhe gegen ein paar Latschen.
»Für die Touristen. Um unserem Laden ein gewisses historisches Flair zu verleihen. Du weißt schon, alter Kolonialwarenladen und so.«
»Marylou.« Sie schüttelte lächelnd den Kopf. »Zum einen bezweifle ich, dass es während der Kolonialzeit Reisebüros gab. Und zum anderen sind die Touristen schon dort, wo sie hinwollen, wenn sie zu uns kommen.«
Marylou grummelte. »Wir könnten irgend so ein ›Der besondere Ausflug‹-Ding anbieten. So was wie Bustouren zu den Spukhäusern in der Gegend.«
»Gibt es in dieser Gegend Spukhäuser?«
»Wir sind in Massachusetts! Natürlich gibt es hier Spukhäuser.«
Plötzlich ernst geworden, sah Stoner sie an. »Stecken wir in Schwierigkeiten? Finanziell?«
»Noch nicht, aber es wird Zeit, dass wir uns einen Werbegag einfallen lassen.«
Es war anfangs ein bisschen beängstigend gewesen, Marylou die Buchführung zu überlassen. Marylou raste durch das Leben wie ein Karussell bei Höchstgeschwindigkeit. Die Höhen waren schwindelerregend, und bei den Abfahrten blieb einer das Herz stehen. Im Durchschnitt kamen Sorgen dabei heraus.
Tatsache war jedoch, dass Marylou genau wusste, was sie tat, und dass sie niemals zu weit ging.
Außerdem hatte Stoner eine beinah irrationale Angst vor offiziellen Behördenangelegenheiten. Zum Beispiel vor Steuererklärungen. Sie glaubte fest daran, dass sie einen fürchterlichen Fehler machen würde und den Rest ihrer Tage im Frauengefängnis von Framingham verbringen müsste. Das reichte, um ihr Denkvermögen auszuschalten, wann immer wichtig aussehende Post im Reisebüro ankam.
Marylou sah die Dinge anders. Sollten sie einen Fehler machen, so versicherte sie Stoner, würde das Finanzamt ihnen lieber eine Geldstrafe aufbrummen, als ein paar Reisekauffrauen mit Steuergeldern durchzufüttern. Marylou dachte über Steuerinspektoren so, wie Stoner über Katzen – sie waren sonderbar, irgendwie niedlich und absolut harmlos, solange man es nicht zu wild trieb.
Um ehrlich zu sein, Marylou wusste, wie mit Männern im Allgemeinen umzugehen war. Was sie betraf, waren sie letztlich alle gleich, egal ob alternder Hippie oder Finanzbeamter.
»Was meinst du?«, fragte Marylou. Sie öffnete ihr Portemonnaie mit dem Kleingeld und zählte nach, ob es für eine Kleinigkeit bei McCuskers reichte. »Sollen wir, oder sollen wir nicht?«
»Sollen wir was?«
»Das Frauen-Softballteam sponsern?«
»Welches Frauen-Softballteam?«
Marylou leerte ihre Brieftasche auf dem Schreibtisch vor Stoner und stocherte mit dem Finger in den Ecken. »Es gibt kein Frauen-Softballteam. Jedenfalls nicht, wenn wir sie nicht unterstützen. Es sei denn, sie finden jemand anders. Das einzige Angebot, das sie haben, kommt vom hiesigen Tierpräparator, und damit fühlen sie sich nicht wohl.«
Stoner fuhr sich mit den Händen durchs Haar. »Ich habe noch nicht einmal etwas von einem Frauen-Softballteam in dieser Gegend gehört.«
»Na ja, gesehen hast du sie auf jeden Fall. Die kleinen Lesben, die auf der anderen Straßenseite rumhängen und nur darauf warten, einen Blick auf dich werfen zu können.«
Ja, die hatte sie bemerkt. Eine balgende Horde, die meisten Anfang zwanzig, in Shorts und ärmellosen T-Shirts. Sie liefen aufgedreht und neugierig auf dem Rasenstück vorm Postamt herum und stießen sich gegenseitig mit den Ellenbogen an.
»Das hat nichts mit mir zu tun«, sagte sie. »Das ist einfach nur ihr Treffpunkt.«
Marylou schüttelte den Kopf, als wäre Stoner ein wandelndes Rätsel für sie. »Wenn du morgens hier wärst, könntest du sie herbeiflattern und einfliegen sehen, eine nach der anderen, sobald es auf Mittag zugeht. Es ist wie eine Szene aus Die Vögel.«
»Sie haben Mittagspause. Und die verbringen sie nun mal hier. Auf der anderen Straßenseite –«
»Gegenüber von unserem Reisebüro«, fiel Marylou ihr ins Wort und beendete den Satz. Sie nahm ihre Handtasche, kippte den Inhalt auf den Schreibtisch und kramte darin herum. Pfefferminz, Lippenstift, Mascara, ein kleines Notizbuch. Sonnenbrillenetui, leer. Terminkalender, abgelaufen. Drei Kugelschreiber, aus Motelzimmern gestohlen, einer ohne Kappe. Eine Packung Kondome. Ein paar zerfetzte Papiertaschentücher. Ein Überweisungsbeleg.
»Um Himmels willen, hier.« Stoner holte ihre Brieftasche raus und bot ihr Geld an. »Nimm, so viel du brauchst.«
Marylou sah die Auswahl an Scheinen durch und wählte fünf Dollar. »Das sollte reichen. Außer du willst auch noch etwas aus dem Laden.«
»nein danke. Erzählst du mir von dem Softballteam?«
»Ja, richtig.« Marylou stopfte ihren Kram zurück in die Handtasche und machte es sich auf dem Schreibtisch bequem. »Sie möchten ein Softballteam gründen. Feministisch, wie man früher sagte, ohne Angst, das könnte beleidigend sein. Keine Konkurrenz, alle dürfen spielen, es geht nur um Spaß. Sie werden in die Northampton-Liga aufgenommen, wenn sie eine Sponsorin haben.«
»Und was hat es damit auf sich, Sponsorin zu sein?«
»Wir müssten die Trikots bezahlen und zu ein paar Spielen gehen.« Sie zuckte die Schultern. »Und sie bemuttern, nehme ich an.«
Stoner lachte und verdrehte die Augen. »Ich sehe schon deutlich vor mir, wie du ein Softballteam bemutterst.«
Marylou schob ihr Kinn vor, als wäre sie beleidigt. »Ich kann das. Du fragst sie, wie’s läuft, bringst Kekse zu den Spielen mit und pustest, wenn sich eine wehgetan hat.«
»Mhm«, sagte Stoner. »Sie werden das einzige Team in der Liga sein, das Kekse mit Godiva-Schokolade bekommt.«
»Und was ist dabei?«
»Die Hälfte von ihnen wird noch nicht einmal Zucker anrühren, und erst recht keine exotische Schokolade. Es sei denn, die Zeiten haben sich geändert.«
Marylou klimperte mit ihren silbernen Armreifen, ein sicheres Zeichen, dass sie der Diskussion ein Ende setzen würde. »Es wäre Werbung, Stoner. Und wir brauchen etwas, was uns in der Gegend bekannt macht. Das Softballteam wäre ideal.« Sie holte zum entscheidenden Schlag aus. »Denk an all die Frauen, die zu diesen Spielen gehen. Und jede von ihnen würde zuerst an Kesselbaum & McTavish denken, wenn sie ein Reisebüro braucht.«
Darüber ließ sich nicht mehr streiten.
»Du weißt, dass wir für ein lesbisches Reisebüro gehalten werden könnten«, warf Stoner ein. »Wie kommst du damit klar?«
»Kein Problem für mich. Und für dich?«
»Warum sollte es?«
»Ich könnte ein Problem sein, weil ich keine von euch bin. Außer du nimmst mich ehrenhalber auf.«
Stoner grinste. »Wir könnten dich als meine Assistentin in ›Hetero als Zweitsprache‹ vorstellen.«
»Du könntest von Zeit zu Zeit eine Hetera-Beraterin gebrauchen«, sagte Marylou ernst und nachdenklich. »Wir könnten mich zur Vizepräsidentin für die Veränderung von nicht-alternativen Lebensformen machen. Natürlich«, fuhr sie gewitzt fort, »können wir die ganze Idee auch fallenlassen und mit der Handelskammer weitermachen und mit Spendensammeln beim Rotary Club. Ich habe übrigens keine Dias mehr, die wir zeigen könnten. Du musst dir für das Treffen im Juni etwas einfallen lassen.«
Stoner vergrub das Gesicht in ihren Händen »Okay, okay, wir sponsern das Softballteam.«
»Super!« Marylou nahm ihre Sachen und ging zur Tür. »Du wirst es nicht bereuen.«
»Berühmte letzte Worte.«
Stoner sah ihr hinterher, wie sie die Straße überquerte und kurz mit den Junglesben sprach. Es war offensichtlich, dass sie gespannt auf sie gewartet hatten. Sie fragte sich, wie viele Treffen zwischen ihnen und Marylou stattgefunden hatten, bevor Marylou ihr Anliegen ›zufällig‹ erwähnte.
Oh Gott, dachte sie, während ihr ganz persönliches Softballteam über die Straße auf sie zustürmte, wo sind wir da hineingeraten?
Wenn das Kind sich nicht ständig solche Sorgen machen würde …
Tante Hermione gab sich im Geiste einen Klaps auf die Hand. Stoner war kein Kind. War es schon seit Jahren nicht mehr, falls sie je eins gewesen war. Manchmal schien es, als wäre ihre Nichte bereits erwachsen auf die Welt gekommen. Im Grunde nichts Ungewöhnliches für ein Einzelkind. Aber in Stoners Fall wurde es noch durch Eltern erschwert, die … nun, um ehrlich zu sein … die so liebevoll und herzlich waren wie Eisblöcke. Zusätzlich zu ihren vielen Talenten war Helen, Hermiones ungeliebte Schwester, ein Snob, eine Aufsteigerin und eine Markenprodukt-Fetischistin. Geschirr, Schuhe, Mäntel, Blusen, was auch immer – Helen schaffte es, einen Blick aufs Etikett zu werfen.
Es gehörte zu Hermiones kleinen Vergnügen, sie dabei zu erwischen. »Meine Liebe«, pflegte sie zu sagen, »die Frau von Welt erkennt eine Marke, ohne auf das Etikett zu schauen.«
Helen beharrte darauf, dass sie das albern fand, und entgegnete etwas Lahmes wie: »Was weißt du schon, du Zigeunerin?«
Aus Helens Mund waren diese Worte zwar kein Kompliment, aber es war etwas Wahres dran. Hermione hatte einige Leben lang zum fahrenden Volk gehört. Nicht verwunderlich, denn solange sie sich erinnern konnte, war sie Hellseherin gewesen. Italien, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, sogar die Britischen Inseln. Manchmal als Mann, manchmal als Frau. Viele Leben lang, in schneller Folge. Sie hatte diese Leben genossen, soweit sie sich erinnern konnte. Es waren harte, kurze Leben, aber voller Leidenschaft. Begehren, Zorn, Liebe, Rache, Wut … alle mit ganz eigener Farbe und mit eigenem Geschmack. Zorn war rot und scharf wie Chilischoten. Wut war schwarz und ölig. Liebe war so blau wie Vogeleier und hatte den Geschmack von Mandeln. Begehren flackerte in orangefarbenen Flammen und roch wie Hunger. Aber Rache, Rache war am eigenwilligsten. Rache war Quecksilber, war silbergrau und nahm die Form an, die zum Behältnis passte. Sie war unmöglich zu erfassen. Immer in Bewegung, veränderte sie sich ständig und blieb doch immer Quecksilber.
Sie hatte niemals so intensiv gelebt wie als Romni. Aber es war anstrengend, und wahrscheinlich waren diese Leben deswegen so kurz.
Hermione war noch immer eine Reisende, wenn das bedeutete, einen unabhängigen Geist zu besitzen und sich nicht von dem beeindrucken zu lassen, was die meisten Menschen aus der Fassung brachte. Und auf die Meinung anderer zu pfeifen. Es lag an diesen vielen Leben, dachte sie häufig. Nach ein paar Runden im kosmischen Karussell hatte das Getue um bestimmte Dinge und gesellschaftlichen Status einen faden Beigeschmack bekommen. Sie konnte sich nicht erinnern, in welchem Leben es passiert war. In einem vorchristlichen rumänischen vielleicht. Oder als sie am Hofe der Kaiserin von China diente, die – davon war sie überzeugt – jetzt als ihre Schwester Helen inkarniert war.
Die Kaiserin war eine durch und durch unangenehme, blutrünstige Person mit berühmt-berüchtigten sadistischen Gelüsten. Verglichen damit hatte Helen es schon weit gebracht. Aber sie war keine Mutter Theresa.
Immerhin hatte die Kaiserin damals ihre Kinder weggegeben. Helen hatte es vorgezogen, ihr Kind wegzuekeln.
Das einzige Mal, dass Hermione das Kind in Stoner sehen konnte, war an jenem Morgen gewesen, als sie die Tür öffnete und ihre sechzehnjährige Nichte zusammengekauert auf den Stufen ihres Bostoner Stadthauses fand – müde, hungrig und die Augen voller Furcht.
»Bitte schick mich nicht zurück«, war alles, was sie sagte, und Tante Hermione versank in Mutterliebe, um nie wieder daraus aufzutauchen.
Stoners kindliche Phase hatte nur einen Tag angehalten. Bis zum Abend des nächsten Tages hatte sie alles geregelt, um die Schule zu beenden, und sich um einen frühen Starttermin an der Bostoner Universität bemüht. Sie bestand darauf, ihrer Tante nicht auf der Tasche zu liegen, sondern ihren Anteil zum Haushaltsgeld beizusteuern.
Es ging natürlich um die Sache mit dem Lesbischsein. Helen hatte – nicht ganz zufällig – Stoners Tagebuch gefunden und gelesen. Darin beschrieb sie ganz bezaubernde Gefühle für eine Lehrkraft – Sozialkunde, wenn sie sich richtig erinnerte –, die eindeutig weiblich war. Das brachte Helen zur Raserei, und was sie Stoner an hässlichen und verletzenden Dingen noch nicht gesagt hatte, das sagte sie ihr jetzt. Stoner hatte es ein paar Wochen über sich ergehen lassen, konnte es schließlich nicht mehr ertragen und floh zu der einzigen Frau in der Familie, der sie vertrauen konnte – ihrer Tante Hermione.
Das war der beste Tag in meinem Leben, dachte Tante Hermione.
Sie blies die Kerzen aus und faltete das Tischtuch zusammen, das sie für ihre Sitzungen benutzte. Ihre Gedanken wanderten wieder einmal umher. Marylous Mutter, ›die berühmte Dr. Edith Kesselbaum‹, wie sie sie liebevoll nannte, würde sie als ›losgelöst und peripher‹ bezeichnen. Aber es war ein berufsbedingtes Laster. Sie musste ihren Gedanken folgen, wo immer sie hinführten. Darin lag das Geheimnis ihrer Intuition.
Das Problem war jedoch, dass sie in letzter Zeit Schwierigkeiten hatte, geradlinig zu denken, wenn es nötig war. Und sie war vergesslich und unkonzentriert. Ein chronischer Fall von prämenstruellem Syndrom, nur dass sie schon lange aus dem Alter heraus war, in dem PMS auftreten konnte, und dass es sie nicht weiter beeinträchtigt hatte, als sie noch in dem Alter war. Sie fühlte sich wie in einem dichten Nebel, in dem sie die Dinge nicht bemerkte, bis sie direkt vor ihr auftauchten und sie dann fast zu Tode erschreckten.
Sie nahm an, es würde vorübergehen, und ehe sie nicht sicher wusste, dass dem nicht so war, wollte sie Stoner nicht beunruhigen. Es würde sich als ein jahreszeitliches Übel herausstellen, eine Allergie vielleicht. Sie wünschte, sie würde sich an ihr Kräuterwissen aus ihrem Leben als Heilerin Blue Mary erinnern, aber manches blieb nicht so gut hängen wie anderes, und Kräuter bildeten die größte Gedächtnislücke in ihrem derzeitigen Leben.
Wenn die anderen wüssten, wie sie sich fühlte, würden sie sie wahrscheinlich wie eine alte Person behandeln. Sie würden die Stimme erheben und in einfachen Sätzen sprechen und sie beim Gehen stützen.
Hermione Moore hatte nicht die Absicht, sich stützen zu lassen, solange sie sich selbst in einer aufrechten Position halten konnte.
Das Schlimmste daran, wie ein alter Mensch behandelt zu werden, war die Einsamkeit, dachte sie. Sie hatte Freundinnen und Klientinnen, die älter wurden. Sie alle litten unter der Einsamkeit. »Es ist nicht so, dass ich vernachlässigt werde«, hatte Laura, eine Jungfrau, ihr einmal erzählt (und wenn es eine gab, die wusste, wann sie vernachlässigt wurde, dann war es eine Jungfrau), »aber sie behandeln mich, als wäre ich ein Kapitel in einem Buch über den Umgang mit Eltern im Alter. Immer heißt es, ›alte Menschen brauchen dies‹ und ›alte Menschen mögen das‹. Sie fragen nie, was ich brauche. Wenn es nicht im Buch steht, brauche ich es nicht.«
Laura hatte damals bei ihrer Tochter in Boston gelebt, und Hermione hatte ihr geraten, wegzulaufen und ihren Namen zu ändern. Das letzte Mal, als Laura sich meldete, schickte sie eine Postkarte aus Las Vegas. Es hatte sich herausgestellt, dass sie die bislang unentdeckte Gabe besaß, sich Zahlen zu merken. Und an den Black-Jack-Tischen schnitt sie gut ab. Schließlich hatte ein Casino ihr eine Stelle angeboten, nur um sie auf seine Seite zu ziehen. Das entsprach zwar nicht ganz Tante Hermiones Vorstellungen, aber es war ein Fortschritt.
Sie hörte die Verandatür und lächelte. Das musste Marylou sein, die den Hintereingang nahm, um sie nicht zu stören, und dann die Tür zuknallte.
»Marylou«, rief sie, froh, aus ihren Grübeleien herausgerissen zu werden, »möchtest du einen Tee?«
Kapitel 2
»Sie wissen wahrscheinlich noch nicht mal, wer Lucy B. Stone war«, sagte Stoner.
»Aber sie wissen, wer du bist«, beharrte Marylou.
Stoner lachte. »Alle vierzehn kennen mich. Und ein paar gute Freundinnen, das macht mich nicht gerade zu einer Berühmtheit.«
Wovon um alles in der Welt redeten sie eigentlich?
Hermione tupfte sich den Mund mit ihrer Serviette ab und platzierte das Messer, das sie nicht benutzt hatte, so, dass der Griff genau im rechten Winkel zur Tischkante lag. Sie musste wieder abgeschweift sein. Vor einer Minute hatten sie über … über … Verflixt, worüber hatten sie gesprochen? Sie hatten über das Wetter gesprochen, über die Touristen, die allmählich in die Stadt einfielen, über Gwens Arbeit und … über was noch?
Sie konnte sich nicht erinnern, gegessen zu haben, aber ihr Teller war leer. Sie erinnerte sich ans Kochen, aber sie wusste nicht mehr, was sie gekocht hatte.
»Was meinst du, Tante Hermione?«, fragte Stoner.
Ach du liebe Güte. »Ich finde …«, sie versuchte sich bedeckt zu halten, »es ist eine gewagte Idee, aber wenn ihr meint …«
Alle starrten sie an.
Sie spürte, wie sie blass wurde.
»Es war doch deine Idee«, sagte Marylou.
»Ja, das stimmt. Aber es war immerhin nur eine Idee. Kein ausgearbeiteter Vorschlag.«
Gwen sah sie in ihrer ruhigen, besorgten Art an. Sie durchschaute sie. Gwyneth war einfach zu gut darin, Menschen zu durchschauen.
»Ich muss Stoner zustimmen«, sagte Gwen. »Die meisten dieser Teenies werden nicht wissen, wer Lucy B. Stone war, und ihr Team werden sie erst recht nicht nach ihr benennen wollen.«
Aha! »Der Name war gut genug für meine Nichte«, sagte sie. »Dann sollte er auch gut genug für ein Softballteam sein.« Sie legte eine Spur schlechte Laune in ihre Stimme und rümpfte ein wenig die Nase. Vielleicht würden sie glauben, dass sie in sorgenvolle Gedanken über die vollkommen unpolitische jüngere Generation versunken gewesen war. »Zumindest schien es zu dem Zeitpunkt eine gute Idee zu sein«, fügte sie mit einem einlenkenden Lächeln hinzu. »Zu schade, dass diese Zeit beinahe vierzig Jahre her ist. Obwohl ich mich erinnere, dass damals zunächst auch niemand wusste, wer Lucy B. Stone war.« Sie berührte Stoners Hand. »Stell dir vor, Liebes, ich habe dich nach einer nebulösen historischen Figur benannt.«
»Lieber nach einer nebulösen als nach einer zwielichtigen.« Stoner erwiderte die Berührung. »Und als ich alt genug war, um mich dafür zu interessieren, nach wem ich benannt worden war, befanden wir uns mitten in der Frauenbewegung. Da wusste jede, wer Lucy B. Stone war.«
Hermione ließ ihre Gedanken zurückwandern zu jenen schönen Tagen, als sie beide kämpferische Feministinnen waren. Stoner als Teenager und ihre Tante im mittleren Alter. Sie gingen überallhin, zu Demonstrationen, zu Versammlungen, zu Besetzungen und Mahnwachen, zu ›Wir erobern uns die Nacht zurück‹-Demos und zu den Märschen gegen Atomenergie. Washington, Miami, die Wall Street und Atlantic City – und Boston natürlich. Sie belagerten die Eingänge von Pornokinos und anderen Abgründen des Sexismus. Sie waren ›Emanzen‹ aus zwei Generationen, die den nie gekannten Genuss feierten, Frauen zu sein.
Damals war es keine Beleidigung, ›Emanze‹ oder ›Frauenrechtlerin‹ genannt zu werden. Jede konnte ›Feministin‹ sagen, ohne sich dafür zu entschuldigen oder erklären zu müssen, was sie meinte. Sogar die Leute, die nicht der gleichen Meinung waren, wussten, dass sie für Veränderungen eintraten.
In den Siebzigern waren Veränderungen nötig, und sie lagen in der Luft.
Gwens Ehe war ein sehr gutes Beispiel dafür, warum die Frauenbewegung gebraucht wurde. Autoritärer, konservativer Vater, egozentrische, konservative Mutter und ein nicht-konservativer, aber psychopathischer Schuft als Ehemann. Sie wurde Lehrerin, denn das war ein sicheres Terrain für eine Frau. Und ihre Großmutter trank sich um den Verstand, weil ihre Enkelin lesbisch war. Wenn das keine Gründe für die Befreiung der Frauen waren!
Sie mochte Gwen. Hatte sie schon immer gemocht. Und war insgeheim stolz darauf, dass Gwen und Stoner dank ihrer Hilfe zusammengekommen waren. Es war ein bisschen Manipulation nötig gewesen, aber Hermione glaubte nicht, dass sie ernsthafte karmische Irritationen verursacht hatte, als sie für ein paar gute Gelegenheiten auf Stoners Weg sorgte.
Gwen war die Ruhigste von ihnen. Nicht aus Schüchternheit oder Introvertiertheit, es war einfach ihre Art. Ihr Körper war ruhig, ihr Geist war ruhig und ihr Herz war offen. Sie mochte es, wenn Dinge und Menschen – besonders Menschen – sich vor ihren Augen entfalteten. Jeder neue Tag war für sie ein neues Leben, und sie ließ sich von ihrem Gefühl sagen, wem sie vertrauen konnte und wer zu meiden war.
Manchmal lag sie falsch, aber meistens hatte sie recht.
Sie ist wie ein Radioteleskop, dachte Hermione, das auf Signale aus dem All wartet, die vielleicht kommen würden, vielleicht auch nicht. Stoner dagegen war ein Echolot. Sie sendete beständig ein ›Piep‹ aus und lauschte auf die Antwort. Gwen tappte gemächlich in Schwierigkeiten. Stoner ließ sich mitten hineinfallen, mit weit geöffneten Augen, die nach den Ausgängen suchten. Weil es sich so gehörte.
Nicht viele Leute taten heutzutage etwas, nur weil es sich gehörte. Hermione war dankbar, mit einer Frau verwandt zu sein, die so war.
»Also«, sagte Marylou und leckte etwas Pudding von ihrem Löffel, »ich finde meine Idee immer noch gut.«
Gwen lächelte. »Natürlich. Du findest deine eigenen Ideen immer gut.«
»Was für ein Waschlappen wäre ich, wenn das nicht so wäre?«
»Ich finde deine Ideen normalerweise auch gut«, sagte Stoner. »Ich frage mich nur, ob ›Ruhm und Rache‹ ein Motto ist, das wir durch ein Softballteam verbreiten sollten.«
»Mir gefällt die Idee nicht«, sagte Gwen. »Erinnert mich irgendwie an einen Feldzug.«
»Ich persönlich«, wagte sich Hermione weiter vor, »wäre dafür, dass ihr euch für ein Reisemotiv entscheidet, wenn ihr ein feministisches Motto nicht für angemessen haltet. Und es sollte vorzugsweise ein positives sein.«
»Ja«, sagte Stoner und rutschte tiefer in ihren Sessel. »Aber welches?«
Hermione strich mit einem Finger über den Stiel ihres Weinglases. Es strengte sie an, so zu tun, als könne sie der Unterhaltung folgen. Und Dinge für die zukünftigen Gedächtnislücken zu erfinden, die plausibel klangen und die niemand nachprüfen konnte.
»Fabulieren«, würde Edith Kesselbaum sagen.
Es war ein Symptom eines großen Spektrums mentaler Probleme, von denen keines erstrebenswert war.
Alzheimer, dachte sie mit Schaudern. Auf keinen Fall würde sie eine Diagnose mit Ronald Reagan teilen.
»Tante Hermione?«
Stoner sah sie mit diesem besorgten Ausdruck an.
»Entschuldigt, ich war in Gedanken.«
»Wo warst du?«
»Ich habe an Ronald Reagan gedacht.«
»Jetzt reicht’s«, sagte Marylou und warf ihre Serviette auf den Tisch. »Ich weiß nicht, welches Räucherzeug du verbrannt hast, als ich reinkam, aber es hat deinen IQ auf einen zweistelligen Wert herabgesetzt.«
»Es war Kali«, sagte Stoner, die ihre Tante immer noch ansah.
»Wirklich?«, fragte Gwen. »Ich fand, hier roch es wie auf der Schultoilette. Bist du sicher, dass es kein Marihuana war?«
»War es nicht, es sei denn, Cutters Lieferung ist eingetroffen.«
»Ist er …?«, setzte Stoner an.
»Nein, er ist nicht ›auf Drogen‹. Er raucht manchmal was, wenn er was kriegen kann. Er kann dann besser schlafen. Seine Nerven liegen blank.«
Hermione nickte, froh, wieder auf sicherem Terrain zu sein. »Damals im Zweiten Weltkrieg sprach man von einer Kriegsneurose. Irgendwie war das eine treffendere Beschreibung als diese posttraumatische Geschichte. Damit wurden die Schuldigen beim Namen genannt.«
Was sie wohl dachten. Klang sie halbwegs vernünftig oder so durcheinander, wie sie sich fühlte? Es gab in diesem Haus keine, die eine Lektion über die Übel des Krieges nötig hatte.