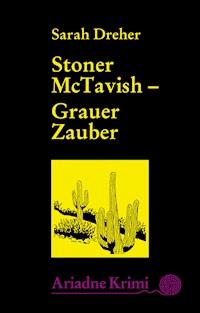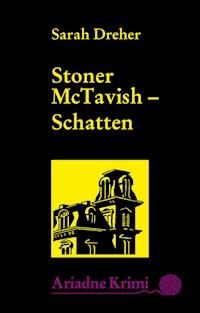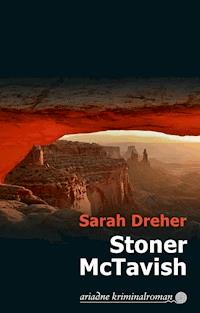Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Argument Verlag mit Ariadne
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Der fünfte Stoner McTavish-Roman ist eine spritzige Satire auf Amerikas Plastikträume und ein Thriller mit einem Schuss Magie. Stoner McTavish und Urlaub in Disney World? Klingt schräg, aber der Superrabatt für Reisebüro-Inhaberinnen war unwiderstehlich, und so hat sich der ganze Clan aufgemacht: Stoner, Gwen, Marylou Kesselbaum (die nie zuvor verreist ist), Dr. Edith Kesselbaum (die nebenbei den Psychiatriekongress heimsucht) und Tante Hermione tummelns ich zwischen überreizten Normalofamilien. Hermoine bemerkt als Erste, dass in der Hochburg der phänomenalen Tricktechnik irgendwas faul ist. Auch Stoners Alarmsensoren schrillen, also sie merkwürdige anonyme Anrufe erhält. Doch dann kommt es dramatischer, als Sorgenspezialistin Stoner befürchtet hat … Ein moderner Fantasy-Krimi – charmant, locker und komödiantisch inszeniert von Kult-Autorin Sarah Dreher.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 446
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sarah Dreher
Die andere Welt
Stoner McTavish 5
Deutsch von Katrin Kremmler
Ariadne
Titel der amerikanischen Originalausgabe: Otherworld
© 1993 by Sarah Dreher
Erstveröffentlicht bei New Victoria Publishers, Norwich, VT
Neuausgabe in neuer Übersetzung
Alle Rechte vorbehalten
© Argument Verlag 2002/2022
Glashüttenstraße 28, 20357 Hamburg
Telefon 040 / 40 18 00 0 – Fax 040 / 40 18 00 20
Umschlaggrafik: Martin Grundmann
ISBN 978-3-86754-796-3 (E-Book)
Inhalt
Für Joanna und Linda
Kapitel 1
»Hilfe!«
Stoner drückte den Hörer fest ans Ohr. »Ich hör Sie so schlecht.«
»Hilfe!«
Sie winkte Gwen, den Fernseher auszuschalten. Die Sonderveranstaltungen des Tages in Disney Worlds Magischem Königreich schrumpften zu einem hellen Punkt und erloschen.
»Könnten Sie bitte etwas lauter sprechen?«, sagte sie.
Die Leitung war tot.
Sie drückte auf die Gabel. Ein Vorgehen, das sie selbst immer für total sinnlos hielt, denn wenn die Leitung tot war, war sie tot, daran gab’s nichts zu rütteln, Misshandlung half nicht. Aber im Kino und im Fernsehen machten die Leute das ständig. Im Kino oder im Fernsehen sagten sie natürlich auch nie »auf Wiedersehen« und waren unhöflich. So tief war sie noch nicht gesunken, noch nicht. Aber wie’s aussah, konnte sie nichts Besseres tun, also haute sie wie eine Idiotin auf die Gabel.
»Was ist denn«, fragte Gwen.
Sie legte auf, hob den Hörer wieder an und bekam das Freizeichen. »Da hat jemand um Hilfe gerufen.«
»Wir haben noch nicht mal ausgepackt«, sagte Gwen. Sie seufzte. »Dein Ruf eilt dir mal wieder voraus.«
»Das ist ernst«, beharrte Stoner. »Da war jemand am Telefon, und sie sagte zweimal ›Hilfe!‹, und dann war die Leitung tot.«
Ihre Liebste lächelte nachsichtig. »Schatz. Wir sind in Disney World. Hier gibt’s jede Menge Kinder. Kinder treiben gern Unfug. Am liebsten mit dem Telefon. Das hat diese Spezies am allerbesten drauf.«
»Stimmt wohl«, sagte Stoner kein bisschen überzeugt.
Gwen legte den Kopf schief und sah sie an. »Reicht dir nicht, was?«
»Nicht direkt.«
»Gut, dann ruf die Rezeption an und frag nach, ob jemand in den letzten fünf Minuten einen Anruf in dieses Zimmer durchgestellt hat.«
Mit einem Knopfdruck hatte sie die Vermittlung dran, die diese Auskunft nicht geben konnte oder wollte, Vielen-Dank-für-Ihren-Anruf.
»Da können wir wohl nichts machen«, sagte Stoner zögernd.
»Dir fällt schon was ein.« Gwen hievte den größten Koffer aufs Bett. »Willst du den auspacken, oder soll ich?«
»Ich mach schon. Das ist meiner.« Sie ließ die Schlösser aufschnappen und fing an, ihre Sachen in eine Kommodenschublade zu werfen.
»Stoner.«
»Was?«
»Vielleicht hängst du ein paar davon lieber auf.«
»Sind doch nur T-Shirts und so Kram.«
»Dieser Kram«, sagte Gwen geduldig, »sind Baumwollblusen. Und Baumwollhosen. Und ein Seidenhemd. Weißt du, wie die nachher aussehen, wenn du sie so in die Schublade stopfst?«
Stoner sah sie hilflos an, aus der einer Hand ergossen sich ihre Unterhosen, aus der anderen quollen Socken hervor …
Gwen nahm sie ihr ab. »Lass mich mal. Deine Vorstellung von Ordnung ist eine Schublade für die saubere Wäsche und eine für die schmutzige.«
»Funktioniert doch«, meinte Stoner.
»Tut es nicht.« Gwen hielt ein zerknittertes, verknülltes Hemd hoch und steckte einen Bügel durch die Ärmel.
»Das solltest du wirklich nicht machen«, sagte Stoner unbehaglich. »Das ist wie – na ja, wie Rollenverteilung, weißt du?«
»Rollen, Schmollen.« Ihre braunen Augen sahen Stoner mit diesem weichen, gespielt-strengen Blick an, in den sie sich jedes Mal wieder neu verliebte. »Ich bete dich an. Und jetzt geh und guck mal nach Marylou, ob sie sich schon erholt hat.«
Marylous Zimmer lag nebenan. Sie klopfte.
»Herein!«, rief Marylou.
Stoner spähte um die Ecke.
Eines der Betten war vollständig mit Vibratoren bedeckt.
»Marylou, was ist das denn?«
»Was ist was?«
»Die Vibratoren. Was machst du denn mit den ganzen Vibratoren?«
»Safe Sex«, erklärte Marylou. Sie aß gerade die letzte Portion Käse und Cracker auf, die ihnen im Flugzeug als ›Snack‹ serviert worden waren. Oder vielleicht war es auch das Mittagessen gewesen. Heutzutage wusste man das ja nie.
»Ich weiß, die Touristikbranche ist langweilig«, sagte Stoner, »aber du hättest mir schon sagen können, dass du aussteigst.«
»Ich aussteigen?« Marylou sah sie stirnrunzelnd an. »Kesselbaum und McTavish ist endlich eine Institution. Wir haben Stammkundschaft. Nächstes Jahr machen wir womöglich Gewinn, wenn das Haus nicht luxussaniert wird. Wieso soll ich da aussteigen?«
Stoner nahm einen Eve’s Garden Spezial und drehte ihn in ihren Händen. »Was hast du dann vor? Willst du die auf dem Schwarzmarkt verkaufen, oder was?«
»Ich will sie nicht verkaufen. Ich will sie benutzen.«
»An was?«
»An mir.«
»Alle?«
»Nicht alle auf einmal«, sagte Marylou. »Vielleicht nacheinander.«
Stoner stellte Eve’s Garden zurück an seinen Platz und setzte sich auf das andere, nicht vollgeräumte Bett. »Wo ist deine Mutter?«
»Die ist bei einem Workshop. Hat mir ’nen Zettel dagelassen.« Marylou wischte sich die Crackerkrümel von den Fingern und wühlte in ihrer voluminösen Tasche. »Meinst du nicht auch, dass es irgendwie krank ist, ein Psychiatriekongress an Halloween in Disney World?«
»Ehrlich gesagt fällt mir da zum ersten Mal auf, dass Psychiater Sinn für Humor haben könnten.«
Marylou kippte den Inhalt ihrer Tasche auf die Frisierkommode und wühlte ihn durch. »Ich weiß doch, dass ich da was zu essen drin hatte.«
»Warum rufst du nicht den Zimmerservice an?«
Marylou seufzte tief. »Wenn die in diesem Ding Zimmerservice haben – was ich bezweifle –, ist das Essen wahrscheinlich ungenießbar. Mäusefritten und Mickyburger. Garantiert aus richtigen Mäusen.«
»Die Restaurants im World Showcase sollen gut sein.«
Marylou machte »hm«.
»Ehrlich. Erinnerst du dich, dass die Newtons vor ein paar Jahren herkamen? Sie fanden die Restaurants wirklich gut.«
»Stimmt«, sagte Marylou. »Aber wir haben nicht den Schimmer einer Ahnung, was für einen Standard die haben. Soviel wir wissen, könnte meine Mutter, die Fastfoodqueen, ein Gourmet sein im Vergleich zu denen.«
Stoner streckte sich auf dem Bett aus, die Hände hinter dem Kopf verschränkt, und betrachtete ihre Freundin. »Schön zu sehen, dass du dich vom Flug erholt hast.«
»Erholt?«, fragte Marylou, wobei ihre Stimme eine Oktave höherrutschte. »Erholt? Das war ja wohl das Widerlichste, was mir in meinen fünfunddreißig Jahren auf diesem Planeten passiert ist. Davon erhol ich mich nie.«
Stoner grinste sie an. »Ich wette, in genau diesem Moment sagen ein paar Stewardessen das Gleiche.«
»War doch ihre Entscheidung, diesen Job zu machen. Ich lass mir da keine Schuldgefühle einreden. Außerdem«, sie rümpfte stolz die Nase, »finde ich, ich hab mich mustergültig benommen.«
Stoner tat so, als dächte sie ernsthaft darüber nach. »Schon. Nur beim Start und bei der Landung, da hast du dich nicht gerade zurückgehalten.«
Von der Minute an, als das Flugzeug auf die Startbahn zurollte, hatte Marylou angefangen, den anderen Passagieren laut und unüberhörbar Vorträge zu halten. »Wir spinnen doch alle. Wir sitzen hier in einer Metallröhre, die nie im Leben unser Gewicht aushält, mit verriegelten Ausgängen. Es gibt keinen Ausweg. Habt ihr den Piloten gesehen? Ich schon. Letzte Woche in Mysteriöse Unglücksfälle. Ist euch klar, dass dieser Mann eigenhändig acht Menschen umgebracht hat? Und wisst ihr, wie? Er hat sie mitgenommen in einem Privatflugzeug und ist rausgesprungen. Rausgesprungen. Hat sie im Fegefeuer verschmoren lassen …«
Die Stewardess, eine quirlige Brünette in hautenger Uniform und mit der einzigen echten Schmachtlocke, die Stoner außer auf alten Fotos in Life-Heften aus den Fünfzigern je gesehen hatte, stürzte sich gurrend auf Marylou wie eine Mutter auf ein verängstigtes Kind. »Na, na, ist ja guut …«
»Behandeln Sie mich nicht so gönnerhaft, gute Frau«, fuhr Marylou sie an. »Die fliegen uns hier meilenweit in die Höhe, und dann fallen wir runter wie ein Stein. Ich hab keine Lust, mich in so einem Augenblick gönnerhaft behandeln zu lassen.«
An dem Punkt hatte Stoner versucht zu leugnen, dass sie Marylou je zuvor gesehen hatte. Was schwierig war, denn Marylou saß zwischen Stoner und Gwen, und ihre diversen kleinen Zuneigungsgesten über Marylous Schoß hinweg machten es recht unwahrscheinlich.
»Geht schon in Ordnung«, sagte Gwen und ließ ein wenig von ihrem Georgia-Akzent durchklingen, denn es war ein Delta-Flug und die Stewardess wahrscheinlich aus Atlanta, »das ist ihr erster Flug.«
Sie tätschelte Marylou die Hand, während sie die Frau ernst ansah. »Sie ist erst seit ein paar Tagen draußen, wissen Sie.«
Die Stewardess, auf deren Namensschild Ellen stand, ein guter, beständiger, beruhigender und zuverlässiger Name, setzte wieder ihre professionell kompetente und besorgte Maske auf. »Draußen?«, fragte sie und schaffte es nicht so ganz, blasiert zu klingen.
»Aus der …«, Gwens Hand machte Kreise in der Luft, »… aus der … der … na, Sie wissen schon.«
»Oh«, sagte Ellen. »Aus der … Sie wissen schon.«
»Nichts Ernstes«, erklärte Gwen beruhigend. »Ein kleines Problem mit ihrer Impulsivität, das ist alles.«
Ihretwegen werden wir noch aus dem Flugzeug geschmissen, dachte Stoner. Aber die schmeißen einen nicht aus Flugzeugen. Nicht in dreißigtausend Fuß Höhe. Oder?
Gwen wühlte in ihrer Handtasche und zog einen Beutel Kamillentee hervor. »Wenn Sie ihr den machen könnten, geht’s ihr mit Sicherheit besser.«
»Gut«, sagte Ellen. »Wenn Sie meinen. Aber wir können nicht zulassen, dass die anderen Passagiere …«
»Natürlich nicht«, sagte Gwen. Als Ellen außer Hörweite war, nahm sie sich Marylou vor. »Wenn du dich nicht auf der Stelle zusammenreißt«, sagte sie, »red ich nie wieder ein Wort mit dir.«
Mit dem Ergebnis, dass Marylou vor sich hin grollte, bis sie zur Landung auf dem Orlando International Airport ansetzten. Da verkündete sie, dass sie jetzt mit Lichtgeschwindigkeit zur Erde sausen und den Druckabfall mit anschließender Explosion nie überleben würden.
»Ich frag mich nur«, sagte Stoner, als Marylou anfing, die Vibratoren in einem Muster zu arrangieren, das sie ästhetisch ansprechender fand, »wie wir dich wieder nach Hause kriegen.«
»Ich komm nicht mehr heim«, erklärte Marylou. »Ich wickle unsere Geschäfte telefonisch ab von unserer Zweigstelle in Kissimmee oder wo auch immer.«
»Das ist nicht witzig«, meinte Stoner leicht genervt.
»WITZIG?«, kreischte Marylou. »Seh ich so aus, als hätte ich Spaß?«
»’tschuldige«, murmelte Stoner, obwohl sie sich immer noch ärgerte, aber sie wollte keinen Streit riskieren.
»Als wir das Reisebüro aufgemacht haben, hab ich dir gesagt, dass ich alles tue, was in meiner Macht steht, um anderen Menschen zu helfen – auch Fremden, sogar Fremden, die ich nicht mag –, damit sie einen unvergesslichen und sorgenfreien Urlaub haben. Aber nie und nimmer werd ich selber reisen. Ich hasse es, Stoner. Ich hasse es wirklich.«
Auf Marylous Augenrändern zitterten kleine Tränchen, und Stoner war verloren. Sie hatte es noch nie ertragen können, Marylou unglücklich zu sehen. Sie stand auf und legte einen Arm um sie. »Ist schon in Ordnung.«
»Ist eben nicht in Ordnung.« Eine Träne gab der Schwerkraft nach und rollte auf Marylous Wange talwärts. »Schlimm genug, nicht machen zu können, was alle Menschen auf der ganzen Welt gern machen, aber das eine Mal, wo ich meinen ganzen Mut zusammennehme und es versuche, lande ich ausgerechnet hier auf diesem gottverlassenen Riesenrummelplatz voller – voller Kreaturen oder wie die heißen …«
»Figuren«, sagte Stoner.
»Ich komm vielleicht nie mehr heim, und hier gibt’s nicht mal Zimmerservice.«
»Hier gibt’s bestimmt Zimmerservice«, sagte Stoner beruhigend und gab Marylou ein Papiertaschentuch.
»Gibt’s eben nicht.« Marylou schniefte und putzte sich die Nase.
Stoner strich ihr das Haar aus dem Gesicht. »Doch, ganz bestimmt. Wenn nicht, besorg ich dir was.«
»Das ist nicht der Punkt. Wir stecken hier in einem Hotel fest, in dem das Konzept von Zimmerservice unbekannt ist. Wenn die das nicht verstehen, weiß Gott, was die sonst noch nicht verstehen. Hier ist es … ist es primitiv.«
»Marylou, dieser Erholungs- und Vergnügungspark ist technisch auf dem neuesten Stand und der modernste im ganzen Land. Auf der ganzen Welt wahrscheinlich.«
»Technisch auf dem neuesten Stand«, schnaubte Marylou. »Du klingst wie ein Yuppie. Reagan und Bush sind weg und machen sich einen schönen Lenz mit dem, was sie in zwölf Jahren Gier zusammengerafft haben, Yuppies sind out – und jetzt fängst du an, wie einer zu klingen.«
»Ich versuch nur, auf dem Laufenden zu bleiben«, murmelte Stoner.
Marylou schmiss das feuchte Taschentuch in den Papierkorb und aß das letzte Päckchen Erdnüsse aus dem Flugzeug auf. »Hast du gesehen, wie sie die Büsche beschnitten haben? Du lieber Himmel.«
»Klar hab ich das gesehen.«
»Seeschlangen. Elefanten. RATTEN!«
»Ich glaub, das war Micky Maus.«
»Wir sind noch nicht mal im Hotel und schon sehen wir lauter Mutanten.«
»Das waren doch nur Büsche.«
»Pflanzen sind Pflanzen«, erklärte Marylou, »und Kreaturen sind Kreaturen …«
»Figuren«, sagte Stoner.
»… und jeder, der Pflanzen züchtet, die wie Kreaturen aussehen, ist krank. Wir sind hier eingesperrt und der Gnade KRANKER HIRNE ausgeliefert.«
»Das ist ein Vergnügungspark, Marylou. Disney World ist ein Vergnügungspark. Vergnügungsparks sind so.«
»Ja, und was kommt als Nächstes?« Sie wühlte sich noch tiefer in den ausgeleerten Inhalt ihrer voluminösen Tasche und fand tatsächlich eine kleine Schachtel Godiva-Pralinen. »Als Nächstes schleppst du mich noch nach Dollywood. Oder in das Christliche Zentrum von diesen beiden Predigern, Jim und Tammy Fay.«
»Die haben ihr Zentrum verkauft.«
»Ach, es gibt bestimmt was, wo’s genauso grässlich ist.« Sie packte eine Praline aus und warf sie in den Mund. »Nein, du kriegst keine ab.«
»Ich steh nicht auf Designerschoko«, sagte Stoner.
»Ruhe. Ich hab grad einen Höhepunkt.«
Sie wartete, bis Marylou mit der Praline fertig war, ein weiteres Mal fasziniert, wie eine einfache Süßigkeit die Spannung aus dem Gesicht ihrer Freundin zauberte. Wie wenn man jemandem zusah, der kurz vor dem Herzinfarkt stand und sich etwas Nitroglyzerin einwarf. Sie wünschte, ihre Probleme wären auch so einfach loszuwerden.
»Ich werd nie verstehen«, sagte Marylou, während sie liebevoll das Pralinenpapier zusammenfaltete und es ehrfürchtig in den Papierkorb warf, »wie du den amerikanischen Alltag ertragen kannst, bei dem, was du isst.«
»Ich esse so ziemlich das Gleiche wie alle anderen«, meinte Stoner.
»Und sieh dir mal an, was ›alle anderen‹ aus dieser Welt gemacht haben.« Sie seufzte. »Gott, wenn ich mir vorstelle, dass ich Boston nie wiedersehe! Den Stadtpark! Das Isabella Stewart Gardiner Museum, das Kunstmuseum! Das Fenway Park-Stadion!«
Nun musste Stoner wirklich lachen. »Du hast in deinem Leben keinen Fuß ins Fenway Park-Stadion gesetzt.«
»Aber ich hätte es machen können.«
»Wir kriegen dich schon wieder nach Hause«, sagte Stoner. »Warum amüsierst du dich solange nicht einfach? Wir haben eine ganze Woche, wir können uns wunderbar ausruhen und amüsieren.«
»Amüsieren«, murrte Marylou. »Umzingelt von Kreaturen.«
»Figuren.«
Marylou fing wütend an auszupacken. »Ich weiß nicht, wieso ich mich von dir hab überreden lassen.«
»Ich hab dir nicht den Arm verrenkt. Ich hab dir keine Knarre an den Kopf gehalten. Ich hab sogar versucht, es dir auszureden.«
»Sie haben uns Rabatt gegeben«, räumte Marylou ein.
»Wir kriegen ständig Rabatt. Für alles Mögliche.«
»Nicht für Disney World.« Sie zog einen paillettenbestickten schwarzen BH aus ihrem Koffer und knallte ihn in eine Schublade.
Jetzt war Stoner richtig neugierig. »Mal im Ernst, warum hast du dich entschieden mitzukommen?«
»Einfach so.«
»Ich kenn dich seit über fünfzehn Jahren. Du hast noch nie was ohne Grund gemacht. Vielleicht war der Grund bescheuert, oder vielleicht hat sich später rausgestellt, dass der Grund nicht war, für was du ihn gehalten hast. Aber einen Grund hast du immer gehabt.«
Marylou verstaute eine Handvoll roter Spitzenslips in der Schublade. »Also gut. Ich hab mich ausgeschlossen gefühlt.«
»Ausgeschlossen?« Es war schwer, sich Marylou ausgeschlossen vorzustellen. Sie hatte ständig Gesellschaft oder war auf dem Weg zu jemandem oder verabredete sich – mit Freundinnen oder Freunden, mit einem Lover oder mit KundInnen, um sich deren Urlaubsdias anzugucken. Marylou gehörte zu den Menschen, die mühelos und anscheinend furchtlos Freundschaften schlossen. Nicht so wie ich, dachte Stoner.
»Du fährst ständig wohin, wo’s toll ist, und machst aufregende Sachen, weil du keine Angst hast zu reisen. Und ich muss ständig zu Hause bleiben.«
Stoner war schockiert. »Wo’s toll ist? Das Spukhaus in Maine? Du spinnst ja.«
»Na ja«, räumte Marylou ein, »das vielleicht grad nicht.«
»Ein halbes Dutzend Mal bin ich fast umgebracht worden. Das war vielleicht aufregend, aber es war nicht toll.«
»Nicht direkt.«
»Und wenn du richtig Spaß und Gaudi haben willst, lass dich doch mal in ein anderes Jahrhundert versetzen. Das ist wirklich toll.«
Marylou hob die Hände. »Okay. Vielleicht hattest du dabei keinen Spaß, aber dir passieren wenigstens Sachen. Mir ist noch nie was passiert.«
Stoner musste zugeben, dass das stimmte. Marylou passierte nur sehr wenig. Stoner hatte sie immer darum beneidet. »Na«, meinte sie, »jetzt ist dir was passiert.«
»Kannste laut sagen.« Marylou klang selbstzufrieden. »Und das macht mehr als wett, was ich bisher verpasst hab. Aber ich habe noch keinen Mordfall oder Rätsel lösen müssen.«
»Okay«, sagte Stoner, »hier ist eins. Vor ein paar Minuten hat bei uns im Zimmer das Telefon geklingelt. Als ich ranging, sagte eine Frauenstimme ›Hilf mir‹. Zweimal. Klang, als sei jemand in Schwierigkeiten.«
»Ganz einfach«, sagte Marylou. »Sie hat verzweifelt den Zimmerservice gesucht.«
»Marylou, ich versprech dir, in Disney Worlds Contemporary Hotel gibt es Zimmerservice.« Sie schüttelte entsetzt den Kopf. »Ich kann nur sagen, ich bin gottfroh, dass du mit deiner Mutter zusammen pennst und nicht bei uns.«
»Oh ja.« Marylou verdrehte die Augen. »Dr. Edith Kesselbaum, Psychiaterin par excellence. Das klingt nach Spaß. Wie fändest du eine Woche im Magischen Königreich mit deiner Mutter?«
Eine Woche in der Hölle wäre Urlaub dagegen, dachte Stoner. »Deine Mutter ist nicht wie meine.«
»Das sagst du nur, weil sie deine Seelenklempnerin war.«
»Das stimmt nicht, Marylou. Das ist ewig her. Das haben wir hinter uns.«
»Du vielleicht«, meinte Marylou, »aber verlass dich mal nicht auf Edith. Sie nimmt diesen Therapiekram sehr ernst. Wenn du’s am wenigsten erwartest, beugt sie sich rüber zu dir und flüstert heiser: ›Wie geht’s dir denn wirklich?‹« Sie schaute sich im Spiegel an. »Oh Gott, Stoner, warum hast du mir nicht gesagt, dass ich so fett geworden bin?«
»Bist du nicht. Du hast in den letzten drei Jahren kein Pfund zugenommen.«
»So seh ich schon drei Jahre aus?«
»Du siehst prima aus.«
Marylou trat ein paar Schritte zurück, drehte sich und schaute sich an. »Ich muss Diät machen.«
Es machte Stoner traurig, wenn Marylou von Diäten anfing. Marylou sein hieß gerne essen und zeigen, wie gern sie aß. Ihre Art zu essen hatte etwas Sinnliches, als wäre Nahrungsaufnahme das absolut Aufregendste, Phantastischste und Eleganteste, was frau an Erfahrung machen konnte. Marylou in dünn wäre nicht Marylou. Wenn sie von Diäten anfing, hatte Stoner das Gefühl, als rede sie vom Sterben.
»Ich mag dich, wie du bist«, sagte sie.
Marylou betrachtete sich mit einem letzten kritischen Blick. »Na, dann muss ich noch mal Fett und Feminismus lesen.« Liebevoll tätschelte sie ihren Busen. »Wann kommt deine Tante an?«
Stoner hob einen Hitachi Classic hoch und studierte ihn. »Erst zum Abendessen. Sie besucht noch ihre Freundinnen im Spiritistencamp in Cassadaga.«
»Wirklich?« Marylou hob eine gezupfte rabenschwarze Augenbraue. »Ich dachte, die sind ihr zu konservativ.«
»Sie kennt sie noch von früher. Aber sie war schon ein bisschen nervös. War sich nicht sicher, wie ihre Konvertierung zum Hexenkult bei denen ankommen würde.«
»Bestimmt nicht gut. Die sind ziemlich verbohrte Christen, nicht? Aber immer noch besser als die jüdischen Mystiker. Die sind furchtbar fanatisch.«
Es klopfte an der Tür.
»Herein«, trällerte Marylou.
Gwen trat ein. »Stoner, da war wieder dieser Anruf.«
»Genau wie vorhin?«
»Nicht genau. Ich meine, da war ein Anruf, und als ich ranging, hatte ich das Gefühl, dass jemand dran war – du weißt ja, wie man so was spürt –, aber niemand sagte was. Ich hab versucht, den Anruf zurückzuverfolgen, aber sie konnten mir nur sagen, dass er von außerhalb des Hotels kam.« Ihr Blick fiel auf Marylous Vibratorkollektion. »Marylou, hast du was Größeres vor?«
»Was meinst du dazu?«, fragte Stoner.
»Ich glaube nicht, dass wir Marylou auf diesem Trip viel zu sehen kriegen.«
»Ich meine zu dem Anruf.«
Gwen ging zum Fenster und schaute hinaus. »Ich denke, es könnte ein Streich sein, auch wenn der Anruf nicht aus dem Hotel kam. Wir haben hier ein hochtechnologisiertes Telefonsystem und tausend Hektar Kinderschwemme. Wenn es kein Streich ist, können wir nicht viel machen, ehe wir nicht mehr Informationen haben, und ich hab keine Ahnung, wie wir die kriegen könnten. Du?«
»Nein.«
»Dann schlage ich vor, wir genießen unseren Urlaub und warten weitere Entwicklungen ab.«
»Da hast du wohl recht.« Stoner stellte sich neben sie. Das Zimmer sah auf die Swimmingpools und die Lagune dahinter. Kleine hellgelbe Motorboote flitzten wie Wasserflöhe auf dem glitzernden See hin und her. In der Ferne glitten ein paar Segelboote dahin. In der Mitte der Lagune legte eine mit Besuchern vollgepackte Fähre von einer Dschungelinsel ab. Die tiefstehende Oktobersonne brannte rosa durch den feuchten Dunst. »Was sollen wir als Erstes machen?«
»Ich weiß nicht. Marylou?«
»Guckt mich nicht an«, sagte Marylou. »Ich bin noch nie verreist.«
Stoner beugte sich zu Gwen. »Ich glaube, das wird sie auch nie wieder tun.«
»Komm schon«, sagte Gwen zu Marylou. »Es ist magisch hier.«
Marylou brummelte etwas Unzusammenhängendes.
»Na«, sagte Gwen, »ich hab jedenfalls vor, Mr. Disney eine Chance zu geben. Wieso springen wir nicht auf die Monorail und verschaffen uns einen Überblick über die Attraktionen? Stoner?«
»Prima. Marylou, kommst du?«
»Ich hab gerade einen todesverachtenden Flug überlebt, und jetzt wollt ihr mich auf einen Zug schleppen, der rumrast wie ein Geschoss. Vielen Dank, aber ich glaub, ich warte auf Edith.«
»Wir hätten dich wirklich gern dabei«, sagte Stoner, damit Marylou sich nicht als fünftes Rad am Wagen vorkam, weil Gwen und Stoner ein Paar waren.
»Wirklich«, bestätigte Gwen.
»Ganz ehrlich, ihr Süßen, ich muss mich erst mal einrichten.« Sie machte eine ausholende Handbewegung, die den ganzen Raum, das Gepäck und das Bett voller Vibratoren umfasste. »Vor allem muss ich diese Dingerchen verschwinden lassen, bevor meine Mutter ankommt.«
»Deine Mutter hat bestimmt schon Vibratoren gesehen«, meinte Gwen. »Vielleicht nicht so viele auf einmal.«
»Die sexuell befreite Dr. Dipl.-Psych. E. Kesselbaum ist eine Sache«, bemerkte Marylou. »Edith K., Mutter von Marylou, ist was anderes. Edith K., Mutter von Marylou, wäre schockiert und sprachlos.«
Sprachlos? Stoner hatte noch nie erlebt, dass Edith Kesselbaum die Worte fehlten. Wie Edith ihr als ihre Therapeutin während der langen und erfolgreichen Behandlung vor zehn Jahren erklärt hatte, war das auch der Grund dafür, dass sie nie als klientenorientierte Therapeutin arbeiten könnte. »Die sitzen einfach nur da«, hatte sie gesagt, »nicken und grübeln wie senile Hunde.«
»Wenn sie auf Mutter macht, verwandelt sie sich in Donna Reed«, erklärte Marylou. »Kein schöner Anblick.« Sie gab den beiden einen Stups in Richtung Tür. »Los. Geht. Amüsiert euch.«
»Wenn du dich langweilst«, meinte Gwen, »kannst du ja das Menü vom Zimmerservice studieren.«
»Das WAS?«
Gwen zog unter Marylous abgegriffenem People Magazine auf dem Nachttisch die Informationsmappe des Hotels hervor und gab sie ihr.
»Du«, sagte Marylou und drückte die Mappe an den Busen. »Du bist echt eine Heilige. Lasst euch Zeit mit dem Heimkommen.«
Bei der Tour durch den Grand Canyon hatte man ein tiefes, gedämpftes Gefühl, als wäre die Schlucht mit Teppich ausgelegt. Oder die Grand Central Station mit Läufern, dachte Stoner, als die Magnetbahn einschwebte und ihre Ladung Passagiere ausspie, die sofort anfingen zu schieben und zu drängeln. Hotelzimmer türmten sich in Reihen fünfzehn Stockwerke hoch, und Herren in Anzügen beugten sich mit Drinks in der Hand über die Balkonbrüstungen. Irgendwie passten die Kongressteilnehmer in ihren Anzügen nicht zu dem fast dreißig Meter hohen Kachelmosaik mit süßen, pausbäckigen, kulleräugigen Indianerkindern. Niedliches und Anzüge passten nicht zusammen.
Die süßen, glücklichen, kulleräugigen Indianerkinder warfen sogar ein reichlich zweifelhaftes Licht auf Disneys kulturelle Sensibilität.
Anders als die Grand Central Station oder eine mit Teppich ausgelegte Schlucht war dieser Ort erfüllt von Licht, Farben und Luft. Die gelbgestreifte Magnetbahn verschwand wie eine Geisterbahn in einer Öffnung, die Himmel und Bäume rahmte wie ein trapezförmiges Bild. Oder vielleicht war es nur ein Cartoon mit Himmel und Bäumen. Das Terrace Cafe in der Nähe war ein Gartencafé im Stil des Südwestens, man konnte reingehen, um sich sein Essen zu holen, und sich dann zum Essen nach draußen setzen, was aber eigentlich drinnen war. Im Contemporary Hotel schien es eine Menge Draußen zu geben. Stoner vermutete, dass das von Disney so beabsichtigt war. Um einem die Sinne zu verwirren. Um einen in eine reale/unreale Welt zu verwickeln, in der man beides nicht mehr auseinanderhalten konnte.
Vielleicht hatte Marylou recht. Vielleicht war das alles Produkt eines kranken Hirns.
Gwen war weitergegangen. Stoner schaute sich panisch nach ihr um und sah sie auf den Lift zugehen. Sie rannte, um sie einzuholen. »Was machst du denn?«
»Ich dachte, wir holen gleich unsere Disney World-Pässe, wenn wir schon mal hier sind. Außerdem geht’s hier hoch zur Monorail.«
»Lauf mir nicht noch mal weg«, keuchte Stoner. »Ich hab gerade einen Kulturschock.«
Gwen nahm Stoners Hand. »Tut mir leid. Ich pass schon auf, dass du nicht verloren gehst.«
Das stimmt, dachte Stoner, als sie hinter ihr hertrottete, Gwen passt auf, dass ich nicht verloren gehe.
Das hatte sie schon seit dem Tag gemacht, als sie sich in Wyoming im Grand Teton National Park getroffen hatten. Als Stoner von der Schönheit der Berge und dem aufregenden ersten Anblick des Westens überwältigt war, und von Gwens umwerfender und wunderbarer Präsenz.
Kapitel 2
Es gab noch andere Lesben in der Monorail. Zwei. Händchenhaltend im Angesicht von Gott, Micky Maus und einer statistisch durchschnittlichen Traditionsfamilie aus Papa, Mama, Oma und zwei Gören.
Stoner suchte Blickkontakt. Registriert.
Ein Lächeln. Erwidert.
Sie machten Smalltalk und tauschten ihre Namen aus.
Pauline war groß und blond und sah aus wie eine Außenfeldspielerin. Nicht zu athletisch, aber in der Lage, sich beim Softball zu bewähren, solange sie in einem Team mitspielte, das nicht zu stark auf Sieg aus war. Die Farbe ihrer Augen erinnerte an den Himmel, wenn er sich am Spätnachmittag in der Lagune spiegelte, ein lila schillerndes Blau. Ihren Lebensunterhalt verdiente sie mit Aluminiumverschalungen und wurde »Stape« genannt.
Stapes Partnerin oder »Freundin«, wie sie mit Rücksicht auf die durchschnittliche Traditionsfamilie sagte, die steif und geschrubbt nach Mittelwesten aussah, hieß Georgia. Sie war klein, hatte lohfarbenes Haar und sah aus, als könnte sie beim Softball höchstens den Spielstand notieren, war aber wahrscheinlich eine gemeine Fangmaschine, mit der sich sogar bei Wettkämpfen lieber niemand anlegte. George – wie sie sich nach ihrer Lieblingsfigur aus den Nancy Drew-Büchern nannte – arbeitete für Disney World, wich aber aus, als sie fragten, was genau sie machte. Stoner tippte auf Sicherheitsdienst.
Stoner erzählte, dass sie und Gwen aus Boston kämen, dass sie Reiseverkehrskauffrau sei und Gwen Geschichtslehrerin an der Highschool, Unterstufe – worauf Stape und George mitfühlende Geräusche machten. Gwen fügte hinzu, es sei sogar noch schlimmer, als sie sich vorstellen könnten.
Eins der Durchschnittskinder rollte die Augen. »Lehrer! Krass!«, murmelte es.
Gwen lächelte die Eltern lieb an. Die hatten immerhin den Anstand, peinlich berührt zu gucken.
»Sie können ja keine richtige Lehrerin sein«, meinte Oma, »wenn Sie im Oktober Urlaub kriegen.«
»Ich habe aus Krankheitsgründen noch Resturlaub«, erklärte Gwen und fügte freundlich hinzu: »Ich dachte schon, ich bring noch eins um, wenn ich nicht da wegkomme.«
Der Junge betrachtete sie mit erneutem Interesse – und wahrscheinlich Respekt. »Sie haben mich rausgenommen«, erklärte er freimütig und zeigte auf seine Eltern.
»Wie schön für sie«, sagte Gwen. »Gibt es einen besonderen Anlass für Ihren Besuch in Disney World?«
»Die Motels sind billiger«, brummte Oma, zeigte mit dem Kopf auf den Vater und schniefte. »Er wollte Geld sparen.« Der Schwiegersohn, schloss Stoner. Als sie die Einfahrt zur Lagune überquerten, wo die Türme von Cinderella’s Castle im disneyschen Abendrot rosa glänzten – Stoner fragte sich, ob es wohl ein echter Sonnenuntergang war oder ein Spezialeffekt –, hatte Stape ihnen ihre Visitenkarte mit ihrer Nummer in Kissimmee gegeben und vorgeschlagen, sich abends mal zu treffen und sich von ihnen »die Sehenswürdigkeiten« zeigen zu lassen.
Traditionsdaddy zog seine Tochter dichter an sich. Stoner vermutete, dass seine Durchschnittsphantasie gerade mit ihm durchging.
»Die meisten Leute sehen ja nur die Hälfte von dem, was es hier zu sehen gibt«, sagte George. »Die kommen nie aus Disney World raus. Kaum jemand geht ins Tupperware-Museum.«
»Ins Tupperware-Museum?«, fragte Gwen neugierig.
George grinste. »Interessiert dich?«
»Natürlich! Wie könnte ein Tupperware-Museum mich kalt lassen?«
Stoner rutschte tiefer in ihren Sitz und machte sich unsichtbar.
»Du solltest mal die blauen Kostüme sehen, die die Museumsführerinnen tragen«, meinte Stape. »Süß. Und die sind richtig nett. Ganz normale Mädels, nichts Aufgedonnertes. Fühlst dich bei ihnen wie zu Hause.«
Mutter und Oma lehnten sich unbewusst ein wenig vor. Stoner lächelte sie an.
Verspannt lächelten sie zurück.
»Da gibt’s ein komplettes Haus im Museum«, erklärte George. »Küche, Esszimmer, Wohnzimmer. Sie zeigen dir, wie du Tupperware in jedem Zimmer haben kannst – kein Witz. Es gibt sogar Babyspielzeug aus Tupperware. Du glaubst nicht, was die alles herstellen.«
»George möchte ein Kind haben«, sagte Stape zu Stoner. »Ich weiß nicht. Was denkst du?«
Stoner zuckte die Achseln. »Kommt drauf an, denk ich.« Sie kannte ein paar Lesben mit Kindern – Jungen. Eine befreundete Hebamme hatte ihr mal erklärt, dass die meisten IVF-Kinder Jungen waren. Sie fand, die Welt brauchte nicht noch mehr Jungen. Kleine Jungs wuchsen meist zu größeren Jungs heran. Danach gingen die Dinge meistens ziemlich schnell bergab.
»Es gibt jetzt eine ganz neue Produktlinie«, sagte George gerade. »Für die Mikrowelle. Sie heißt Tupperwelle.«
Die Frauen aus dem Mittelwesten hingen an ihren Lippen.
»Hast du sie schon ausprobiert?«, fragte Gwen.
»Benutz ich ständig. Die verschiedenen Teile kannst du stapeln und ein ganzes Menü auf einmal drin kochen. Hast du eine Mikrowelle?«
Gwen schüttelte den Kopf. Sie hatte mal mit Stoner darüber diskutiert, damals, als sie sich mit ihrer Großmutter überworfen hatte, weil sie Lesbe war, und sich eine eigene Wohnung nahm. Sie waren sich einig gewesen, dass Mikrowellen in kleinen Wohnungen und bei einem aktiven Lebensstil ideal waren. Sie waren sich auch einig gewesen, dass sie ihnen Angst machten.
»Ihr solltet euch eine anschaffen«, sagte Stape. »Verändert euer Leben. Verschafft euch Zeit für andere Sachen.«
Daddy malte sich aus, was diese »anderen Sachen« wohl waren. Der Mann war reif für einen Herzinfarkt, wenn er seine Phantasien nicht in den Griff bekam.
»Kommen wir denn nie an?«, jammerte Traditionstöchterchen. Mutti brachte sie zum Schweigen.
»Ich hasse es hier«, nörgelte die Kleine.
»Ach was«, sagte Oma.
»Jawohl.«
Sie versuchten, sie zu ignorieren. Begierig auf mehr Haushaltstechnik wandten sie ihre Aufmerksamkeit wieder George und Gwen zu.
»Du kannst damit nichts falsch machen«, versicherte George, »solange du dich nicht total blöd anstellst und versuchst, deine Wäsche darin zu trocknen, oder die Katze oder so was reintust.«
»Ich hab Hunger«, jammerte Töchterchen.
»Du hast gerade gegessen«, zischte Mutti.
»Wie wär’s«, erklärte Stape. »Kommt doch mal zum Essen in unseren Wohnwagen. Dann prüfen wir die Tupperwelle auf Herz und Nieren.«
Gwen sah Stoner an.
»Klar«, sagte Stoner. »Gern.«
»Wir sind allerdings mit ein paar Freundinnen da«, gab Gwen zu bedenken. »Wir müssten uns noch absprechen.«
»Quatsch«, sagte Stape. »Bringt sie mit.«
Stoner konnte sich Marylous Gesicht vorstellen, wenn sie ihr erzählte, dass sie zu einem Tupperwellendinner eingeladen war. Es würde sich fast lohnen, dafür Eintrittskarten zu verkaufen.
»Ich weiß nicht«, meinte Gwen. »Die sind bisschen hart drauf.«
»Ich muss mal klein«, wimmerte Töchterchen.
»Kannste aber nicht«, fuhr Traditionssohn sie an und pikste seiner Schwester mit dem Finger auf die Blase.
»Muttiii! Davey schlägt mich!« Ihr Schrei weckte Tote auf.
»Hör auf, sie zu ärgern«, befahl Mutti.
Daddy erwachte lang genug aus seinen Phantasien, um »Lass den Jungen in Ruh« zu murmeln.
Töchterchen schniefte laut.
Mutti sah Gwen an und lächelte entschuldigend. Die lächelte zurück.
»Ich wüsste gern«, sagte Mutti zögernd und nahm all ihren Mut zusammen, »ob Sie mir sagen könnten, wo dieses Museum ist.«
»Ganz simpel«, antwortete George. »Gleich außerhalb von Kissimmee an der 441, direkt südlich von Beeline. Wenn Sie zum Flughafen müssen, fahren Sie einfach ein paar Stunden früher los und machen dort halt.«
»Kriegt man da Pröbchen?«, wollte Oma wissen.
»Schälmesser«, sagte Stape. »Die funktionieren sogar.«
Mutti und Oma nickten einander entschlossen zu, deutliches Signal für Daddy, dass er tief in der mittelwestlichen Scheiße steckte, wenn er es wagte, sich vor diesem kleinen Ausflug zu drücken.
»Was gibt es hier sonst noch zu sehen?«, fragte Oma, plötzlich offen für die Möglichkeiten Zentralfloridas.
»Es gibt den Geisterberg beim Lake Wales. Da können Sie Ihr Auto auf Leerlauf stellen, sich still hinsetzen, und ihr Auto fährt von ganz allein rückwärts den Berg hoch.«
»Darüber hab ich schon mal was gesehen«, sagte Oma. »Vor einem Jahr oder so auf CNN.«
»Das hab ich auch gesehen«, bestätigte Stape. »Allerdings hab ich die Erklärung nicht verstanden.«
»Ich auch nicht«, gestand Mutti.
Daddy sah aus, als müsste er kotzen. Seine Frauen – seine Frauen – machten es sich nett mit diesem Haufen von … eine Schande war das.
»Im Winter«, sagte George, »könnten Sie das Passionsspiel in Black Hill sehen. Aber das läuft jetzt nicht.«
»Hab ich schon gesehen«, erklärte Oma etwas selbstgefällig. »Sind dafür extra nach South Dakota gefahren. Hat mich sehr bewegt.«
»Geweint hat sie«, sagte Mutti. »Brach uns richtig zusammen und hat geweint, beim Annageln.«
»Yeah, war eklig!«, gab der Sohn seinen Senf dazu. »Voll Blut und so. War bloß bisschen wenig.« Er verfiel in Schweigen, um über bisschen wenig ekliges Blut und so nachzudenken.
»Da ist etwas Unglaubliches passiert«, sagte Mutti, »als Er da oben am Kreuz hing und starb. Da kam direkt hinter dem Amphitheater ein Sturm auf. Mit Donner, Blitz und allem. Wir haben daheim jede Menge Gewitter, aber das mitten bei der Kreuzigung, ich bin ja vor Angst direkt wieder in die Kirche gegangen.«
»Ja«, sagte Gwen, »ich kann mir vorstellen, dass das so eine Wirkung haben kann.«
Der Zug glitt in die Haltestelle Polynesian Village Hotel. Die Familie sammelte ihre diversen Pullover, Jacken, Socken und schicken Micky-Einkaufstaschen zusammen und drängte zur Tür hinaus.
»Schöne Reise noch, Mädels«, rief Oma ihnen von weitem zu.
Gwen winkte. »Und nicht vergessen – Tupperware!«
»Bist du aus dem Süden?«, fragte Stape, als die Türen sich schlossen.
»Aus Georgia. Jefferson. Aber ich wohne schon Jahre nicht mehr da.«
Stape überlegte angestrengt, runzelte die Stirn. »Jefferson.«
»Nordwestlich von Atlanta«, erklärte Gwen. »Ein kleines Kaff. Du hast vielleicht noch nicht davon gehört.«
»Nein, nicht dass ich wüsste.« Stape sah George an, die den Kopf schüttelte. »Tut mir leid.«
»Man spricht nur darüber, wenn es da eine Ku-Klux-Klan-Versammlung gibt. Die letzte muss vor mindestens zehn Jahren gewesen sein. Inzwischen gibt es dort auch irgendein Museum für medizinische Technologie, aber ich war noch nicht da.«
Sie passierten die massiven weißen Veranden und rot geziegelten Dächer des Grand Floridian Hotels. Elegant und verschnörkelt. Stoner versuchte sich vorzustellen, wie Kinder durch seine Korridore rannten oder Saufgelage an seinem Strand stattfanden, aber es fiel ihr schwer. Sie versuchte sich vorzustellen, wie sie sich in dieser steifen viktorianischen Atmosphäre wohl fühlte. Unmöglich. Obwohl die Reiseführer es als freundliches Hotel beschrieben – genau wie die anderen Hotels, mit Geschäften und Eiscafés, Videospielen und Snackbars. Aber wenn man Stoner in eine Lobby mit bemalten Glaskuppeln und Kronleuchtern setzte, fühlte sie sich wie ein gestrandeter Delfin, sie würde um sich schlagen und verzweifelt nach Luft schnappen.
Vermutlich weil es genau die Art Hotel war, die ihre Mutter liebte.
Und auch weil ihr dort jeden Tag, jede Stunde und jede Minute bewusst wäre, dass sie Lesbe war.
Es machte ihr nichts aus, Lesbe zu sein. Was ihr was ausmachte, waren Situationen, die dich an der Kehle packen und MISSGEBURT – MISSGEBURT – MISSGEBURT schreien, bis du durch einen Spalt im Fußboden sickern willst.
Das Grand Floridian Beach Resort Hotel sah genau danach aus.
Manche Leute, sogar wohlmeinende Mitmenschen und manche jüngere Lesben, verstanden es nicht, aber Lesbe sein war ein Ganztagsjob. Du stehst morgens auf, schaust in den Spiegel, und zurück schaut eine Lesbe. Manchmal schaust du sie an und willst vor Freude jubeln. Manchmal willst du auf die Knie fallen und wem auch immer danken, der in diesem Universum als Gott durchgeht, dass du eine von den Glücklichen bist. Und manchmal willst du einfach nur sterben.
Stoner kannte beide Szenarios. Seit sie mit Edith Kesselbaums Hilfe gelernt hatte, ihr Lesbischsein zu akzeptieren, wollte sie nicht mehr oft sterben. Aber sie konnte sich an die Zeit erinnern, als ihre Angst und ihr Selbsthass noch so tief verwurzelt waren, dass sie ständig unter der Oberfläche lauerten, um durch einen kalten Blick getroffen zu werden oder dadurch, dass sie sich in eine andere Frau verliebte. Oder manchmal überkam sie wie aus heiterem Himmel dumpfe Depression. Auch jetzt noch konnte die alte Qual in ihr aufsteigen, wenn nur die entsprechenden Umstände mit der entsprechenden Kraft zusammentrafen.
Edith Kesselbaum sagte, das sei verständlich. »Wenn man einen verrückten Menschen mit einem gesunden zusammen in einem Raum einsperrt«, hatte sie mal mitten in einer Diskussion über das Abendessen gesagt, »wird der gesunde früher oder später verrückt. Genauso geht es einer selbstbewussten Lesbe und einem homophoben Menschen. Der Homophobe wird sein Bewusstsein wahrscheinlich nicht erweitern, aber du kannst sicher sein, dass die Lesbe vorübergehend ein wenig von diesem homophoben Dreck annehmen wird. Das liegt in der Natur der Dinge.« Nachdenklich begutachtete sie einen ihrer lackierten Fingernägel. »Willst du lieber zu Burger King oder was bei Pizza Hut bestellen?«
Manchmal machten die Hasser sie verrückt, schafften es, dass sie den Hass gegen sich selbst richtete. Wahrscheinlich würde es immer so bleiben. Wie eine alte Narbe schmerzt, wenn das Wetter sich ändert, oder eine gerissene Sehne, die nie wieder dieselbe Belastung aushält wie vor dem Riss. In einer Familie aufzuwachsen, die Lesben hasste, in einer Stadt, die Lesben hasste, in einem Land, das Lesben hasste, hatte sie empfindlich gemacht.
Sie versuchte Hassern aus dem Weg zu gehen und sich selbst zu vergeben, wenn sie sie zum Weinen brachten.
»Stoner?« Sie fühlte eine Hand auf ihrer. Sanft, fragend. Sie schaute zu Gwen auf. »Entschuldige. Ich hab nachgedacht.«
»Schon gut«, sagte Gwen, »wir müssen nicht im Floridian wohnen.«
Stoner verzog das Gesicht. »Ich hasse es, wenn du meine Gedanken liest.«
»Ich hab deine Gedanken nicht gelesen. Ich hab das Gleiche gedacht. Meine Großmutter würde dieses Hotel lieben.« Sie drehte sich zu Stape und George um. »Meine Großmutter hat seit meinem Coming-out nicht mehr mit mir gesprochen.«
»Oje«, murmelte Stape.
»Meine Eltern waren am Anfang auch so«, sagte George. »Aber sie haben kapiert, dass sie mich so nie wiedersehen, und inzwischen haben sie sich dran gewöhnt.« Sie zuckte die Achseln. »Eine Weile war es ziemlich heikel. Aber Familien halten hier unten zusammen.«
»Meine Großmutter zeigt keine Anzeichen von Versöhnlichkeit«, sagte Gwen. »Ich bin nicht einmal sicher, ob ich es will.«
»Du willst es«, sagte Stoner.
»Vermutlich.« Sie wandte sich George zu. »Wie ist es, hier als Lesbe zu arbeiten?«
»Als was?«, fragte George, und Stape lachte schallend.
»Oh«, sagte Gwen. »So schlimm?«
Die Monorail glitt in die Station Magisches Königreich. Über dem Jahrhundertwendebahnhof ragten die Türme von Cinderella’s Castle in den Abendhimmel. Menschenmengen, Baumwipfel, Luftballons, alles wimmelte in einem Gemisch aus Farben und Bewegung.
Stoner hielt den Atem an. »Das ist ja überwältigend.«
»Ich beneide dich«, sagte George, als sie ihre Sachen zusammensuchte. »Ich wünschte, ich könnte es auch wieder zum ersten Mal sehen.«
»Macht nicht alles auf einmal«, riet Stape. »Macht einen Tag hier und einen in EPCOT und entscheidet dann, wo ihr noch mal hinwollt.« Sie setzte eine Schirmmütze auf. »Wie lange bleibt ihr?«
»Wir haben für eine Woche reserviert«, erwiderte Gwen.
Stape stieß einen Pfiff aus. »Das muss euch ein Jahresgehalt gekostet haben.«
»Nicht direkt«, sagte Stoner. »Wir haben einen Sonderrabatt, weil ich Reisekauffrau bin.«
»Ihr Glücklichen«, sagte George. »Hier kriegen nicht mal die Angestellten Sonderrabatt. Also gut, sagt uns Bescheid, wann ihr zum Essen kommen wollt.«
»Oder wenn ihr was braucht«, fügte Stape hinzu. »Zum Beispiel Aluminiumverschalungen.«
Sie gingen rechts durch die Türen hinaus, eine neue Menschenmasse drängte sich schon durch die Türen auf der linken Seite herein.
»Wahnsinn«, sagte Gwen. »Wir sind wirklich überall.«
»Na?«, wollte Marylou wissen. »Seid ihr jetzt orientiert?«
»Absolut«, sagte Gwen. »Wir haben das Magische Königreich durch die Bäume gesehen, eine Horrorfamilie aus dem Mittelwesten kennengelernt, uns vom Grand Floridian total einschüchtern lassen und Kontakt mit zwei ansässigen Lesben aufgenommen.«
»Klingt nach einem lohnenden Ausflug. Es wird euch freuen zu hören, dass meine Mutter angekommen ist und total scharf ist auf ihre Workshops. Tante Hermione hat angerufen, ob wir gut angekommen sind – sie sagt, sie weiß es zwar schon, aber Stoner glaubt ja lieber, dass sie ihre Informationen durch weltliche Kanäle bezieht wie alle anderen auch.«
Stoner ließ sich aufs Bett fallen. »Schon gut, Marylou.« Sie fühlte sich überfordert und erschöpft. Wohl die Hitze und die Luftfeuchtigkeit. Zu Hause in Boston war es jetzt grau und nieselte, Einmummelwetter.
Depriwetter. Hier war es tropisch. Vielleicht ein bisschen zu tropisch, irgendwie drückend auf der Brust, feucht, der Atem blieb einem weg …
»Übrigens hab ich auf euer Telefon geachtet«, sagte Marylou. »Keine mysteriösen Anrufe.«
»Wie willst denn du das wissen?«, fragte Gwen, während sie ihr T-Shirt auszog und sich Wasser ins Gesicht spritzte. »Du hattest bestimmt alle Vibratoren gleichzeitig laufen.«
Marylou zog es vor, sie zu ignorieren. »Allerdings hab ich was Aufregendes zu berichten. Wir haben Eintrittskarten für die Polynesische Revue. Umsonst.«
Stoner richtete sich auf einem Ellenbogen auf. »Die was?«
»Die Polynesische Revue. Im Polynesian Village Hotel.«
»Und was soll das sein?«
»Essen. Polynesisches Essen. Und Unterhaltung. Hulatänzerinnen. Feuerschlucker.«
Gwen holte sich ein Hemd aus dem Schrank. »Wie ist denn die polynesische Küche?«
»Ich weiß nicht«, sagte Marylou. »Aber es klingt exotisch. Und hört euch das an. Normalerweise muss man die Karten Monate vorher bestellen, und uns hat sie jemand einfach gegeben. Umsonst.«
»Wer?«, fragte Stoner.
»Das Management. Sie wurden unter eurer Tür durchgeschoben.«
»Warum machen die so was?«
»Wahrscheinlich haben wir den Wettbewerb schrägste Familie in Disney World gewonnen«, meinte Gwen.
Marylous silberne Armreifen klapperten erregt. »Ihr seid doch unmöglich. Da bietet uns wer eine wunderbare, aufregende, einmalige Erfahrung, und ihr benehmt euch, als hätte man euch beleidigt.«
»Tut mir leid«, sagte Stoner. »Ich glaube, ich bin müde und genervt.«
Marylou ließ sich neben ihr aufs Bett fallen und versuchte sie zu kitzeln. »Komm schon, Stoner. Du bist im Urlaub. Freu dich.«
»Für eine, die Reisen hasst«, grummelte Stoner, als sie sich umständlich aufrichtete und zur Dusche ging, »amüsierst du dich ja prächtig.«
»Allmählich komm ich auf den Geschmack.«
»Na klar«, sagte Gwen. »Du wirst sie lieben, die Monorail.«
Marylou kreischte und schmiss ein Kissen nach ihr.
Der Weg zum Luau war von Fackeln gesäumt, aus trägen gelben Flammen quoll Rauch in die feuchte Floridanacht. Das Restaurant war brechend voll mit Familien, Frauen in rückenfreien Tops und Shorts, Männern in Hawaiihemden und Kindern mit Micky-Maus-Ohren und Micky-Maus-T-Shirts.
Eine Kellnerin in farbenprächtigem Sarong und einer Orchidee im Haar kam auf sie zu und führte sie an ihren Tisch.
Stoner fühlte sich am Ärmel gezupft und blieb etwas zurück.
»Da stimmt was nicht«, sagte Tante Hermione. »Ich kann es fühlen.«
Stoner sah das besorgte Gesicht ihrer Tante und spürte ein kurzes Gefühl von Traurigkeit. Ihr Haar schien grauer, ihre Falten tiefer. Die weiche, glatte Haut ihrer Wangen hatte etwas Durchsichtiges an sich, als würde sie sich jeden Moment in Luft auflösen. Tante Hermione wurde älter. »Ist alles okay mit dir?«, fragte sie.
»Na sicher, Liebes.« Ihre Tante lachte kurz auf. »Alte Freundinnen besuchen ist immer anstrengend. Besonders wenn auch noch all ihre helfenden Geister auf einen Schwatz vorbeikommen wollen. Manchmal ist das schlimmer als ein Hochzeitsempfang.«
Stoner musste lächeln. »Ich liebe dich, Tante Hermione.«
»Ich liebe dich auch, mein Schatz. Und ich hab nicht vor zu sterben, also hör auf, dir Sorgen zu machen. Dafür ist noch Zeit genug.«
»Tante Hermione, wie oft hab ich dich schon gebeten, nicht meine Gedanken zu lesen?«
Ihre Tante schüttelte den Kopf. »Tut mir wirklich leid, Stoner. Ich vergesse es manchmal. Schließlich hatten wir nie Geheimnisse voreinander.«
»Wie könnte ich Geheimnisse vor dir haben?«, fragte Stoner mit gespielter Empörung. »Du und Gwen. Ständig stochert ihr mir im Kopf rum.«
»Ach, Liebes«, sagte die ältere Frau und lachte ein wenig, »das glaubst du doch selber nicht. Wie die meisten Menschen hast du vor allem weißes Rauschen im Kopf. Viele tiefe Gedanken, deine Intuition ist manchmal wirklich brillant, ein paar wirklich bizarre und sexuell stimulierende Phantasien. Aber meistens …«, sie zuckte die Achseln, »ist es weißes Rauschen.«
»Ich bring dich noch um«, murmelte Stoner, ihr Kopf so rot wie die Passionsblumen auf dem Sarong der Hostess.
»Das bezweifle ich, aber darüber können wir später diskutieren.« Sie lehnte sich vor und senkte die Stimme. »Stoner. Jemand ist in Gefahr. In ernsthafter Gefahr.«
»Hier?« Hunderte von Menschen drängten sich im Licht der Fackeln an den Tischen, lachten und tranken.
»Nein, nicht hier. Obwohl einige hier in der nächsten Zeit interessante und einigermaßen gefährliche Erlebnisse haben werden.« Missbilligend spitzte Tante Hermione die Lippen. »Und ein paar haben sich in diesem Leben erbärmlich aufgeführt und sollten mal drüber nachdenken. Aber die werden es einfach noch mal durchleben müssen, so lange, bis sie’s verstanden haben, nicht? Nein, ich meine jemanden von uns.«
»Wen?«
»Genau das macht mir Sorgen. Ich krieg’s nicht raus. Diese Person ist sehr gut im Abblocken. Ich spüre etwas eindringen, aber nicht das Ziel.«
»Ist es ein Medium wie du?«
Tante Hermione hielt nachdenklich inne. »Nicht unbedingt«, sagte sie schließlich. »Manche Menschen mit geringen spirituellen Fähigkeiten können lernen, sie abzublocken. In der Regel empfehle ich ihnen das sogar. Es gibt nichts Schlimmeres, als geringe spirituelle Fähigkeiten zu haben. Das führt zu unerwünschten Wahrnehmungen und zur Reizüberflutung aus der Astralebene. Diese Leute neigen dazu, in alle Richtungen zu rennen, nachts jagen sie irgendwelchen gefährdeten Seelen hinterher – manche von denen sind bereits verschieden, aber sie weigern sich, das zu akzeptieren. Viel kann man auf dieser Ebene natürlich nicht anrichten, aber es ist sehr beunruhigend. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, den trieb es vor einigen Jahren auf Missionen der Barmherzigkeit durchs Land. Wenn er es nicht machte, kriegte er Schuldgefühle, was genauso schlimm war. Irgendwann brach er völlig zusammen. Ich musste darauf bestehen, dass er eine praktische, bodenständige Beschäftigung aufnahm. Ich glaube, er hat jetzt eine Stelle in einem Haushaltswarengeschäft und macht sich recht gut.«
Eine Kellnerin kam mit einer Platte Gemüse mit Dip vorbei. Stoner fühlte Hunger wie ein lebendiges Wesen in ihrem Magen aufwachen. Sie folgte der Kellnerin mit den Augen. »Tante Hermione …«
»Manche wiederum sind einfach nicht besonders gescheit. Sehr schwer, in einen Kopf einzudringen, wenn der Inhalt nur ein leises Summen ist. Was soll man da schon finden? Nicht viel.«
»Tante …«
»Aber nehmen wir mal jemanden mit echten spirituellen Fähigkeiten, mit gut entwickelten spirituellen Fähigkeiten, nicht wie deine, beträchtlich, aber inaktiv. Hab ich erzählt, dass meine Freundin Grace Kurse zu spiritueller Entwicklung gibt?«
»Hast du«, sagte Stoner. »Oft.«
»Noch immer nicht so weit. Schade.« Tante Hermione seufzte tief. »Aber wie ich schon sagte, nehmen wir mal eine Person mit starken spirituellen Kräften und der Fähigkeit abzublocken – plus ohne Skrupel, ihre Fähigkeiten zu nutzen … also, dann ist alles möglich.«
Ein Tablett mit etwas, das nach Chow Mein aussah, schwebte vorbei. Stoner starrte ihm sehnsüchtig nach. »Vermutlich.«
Tante Hermione ging in Richtung ihres Tisches. »Aber was haben wir hier? Eine Bedrohung. Starke Schwingungen. Negative Energie. Böse Absichten, wenn wir so wollen, die gegen eine oder mehrere noch nicht bekannte Personen gerichtet sind.«
Eine oder mehrere noch nicht bekannte Personen?
»Ich dachte, du guckst diese Perry Mason-Spätwiederholungen nicht mehr an.«
Ihre Tante tätschelte ihr den Arm. »Versuch, dich zu konzentrieren, Liebes. Was wir wissen, ist, diese Person steht mit einer von uns in Verbindung. Eine von uns hat Feinde …«
»Jede von uns hat wahrscheinlich einen Feind oder zwei.«
»Schon«, sagte Tante Hermione bedeutungsvoll, zog einen Stuhl zurück und setzte sich. »Aber von diesem Kaliber? Wer? Und warum?«
Die berühmte Dr. Edith Kesselbaum sah blendend aus in ihrem Hängerkleid in Schwarz, Neonpink und Neongrün. Sie nippte an einem riesigen tropischen Drink und nickte begeistert einem großen schlanken Mann mit Glatzenneigung und Sigmund-Freud-Bart zu. Der sich prompt entfernte, als sie näher kamen. »Schön, dich wiederzusehen, John«, rief Edith ihm fröhlich winkend hinterher. Sie drehte sich wieder zum Tisch und rollte die Augen himmelwärts. »Mein Gott, Psychiater sind die langweiligsten Menschen der Welt.«
Vielleicht ist es Edith, dachte Stoner. Jemand hat es auf sie abgesehen. Berufliche Eifersucht. Unzufriedener Patient. »Das Risiko«, hatte Edith Kesselbaum ihr mal erklärt, »liegt darin: Je höher das Podest, auf das ein Patient dich am Anfang der Behandlung stellt, desto tiefer fällst du am Ende. Es ist der Mutterarchetypus, der da Probleme macht. Am Anfang, in den Flitterwochen, bist du muttermäßig alles, wovon sie je geträumt haben, aber wenn du sie enttäuschst, was unweigerlich passiert«, sie schauderte, »na, sagen wir mal, das ist eine Erfahrung, die du hoffentlich nie machen musst.«
Wenn es Edith war, dann war Stoners Chance, es von ihr zu erfahren, die eines Schneeballs in Ecuador. Edith Kesselbaum war so verschwiegen, wie eine Therapeutin nur sein konnte. Klar, manchmal nahm sie Bezug auf Probleme, mit denen sie zu tun hatte, als Lehrstück oder um einen Standpunkt zu beschreiben, aber Stoner hatte häufig den nagenden Verdacht, dass sie sie erfand. Wenn sie das nicht tat, dann hatte Edith Kesselbaum das Glück, dass ihre Patienten jeden Standpunkt, den sie erklären wollte, als Beispiel illustrierten. Es war sogar sehr wahrscheinlich, dass Edith Kesselbaum ihre Schlüsse über das Leben aus ihren Patienten zog. Eine einzigartige Vorgehensweise, die Stoner noch nicht bei vielen Therapeuten beobachtet hatte.
Nicht dass sie viele Therapeuten kannte. Da gab es diesen Haufen in der Nervenklinik oben in Maine, in die sie sich hatte einliefern lassen, um Claire Rasmussen zu suchen. Wahrscheinlich zählten die nicht, denn die waren nur dort, um unlautere Aktivitäten zu vertuschen. Andererseits hatte Edith die Qualifikationen von einigen überprüft und festgestellt, dass sie echt waren. Ziemlich beunruhigend, wie Menschen therapeutische Berufe benutzten, um sich die Taschen zu füllen. Obwohl Edith ihr versicherte, dass das gar nicht so ungewöhnlich war. »Stoner, das hängt alles von der Perspektive ab. Manche werden kriminell, andere verlangen exorbitante Honorare. Es gibt welche – ich will keine Namen nennen, auch wenn ich sehr versucht bin –, die schröpfen ihre Patienten um eineinhalb bis zwei Dollar pro Minute. Und das ist ganz legal. Weißt du, bevor ich jemandem zwei Dollar die Minute für meine Perlen der Weisheit abnehme, lerne ich lieber, Blinde sehend und Lahme gehend zu machen, und lasse die Toten wieder auferstehen.«
Eine Kellnerin im Bastrock und nicht viel mehr bot Stoner etwas an, das Hühnerpagopago hieß und aussah wie die Reste eines Chop Suey. »Danke«, sagte sie schnell und wandte den Blick vom Busen der Frau, der nur von großen roten Hibiskusmutanten bedeckt schien.
Gwen begegnete ihrem Blick und schenkte ihr ein liebes, verständnisvolles Lächeln.
Gwen. Vielleicht war die unbekannte Person/waren die unbekannten Personen hinter Gwen her? Gwen?!
Gwen hatte keine richtigen Feinde. Außer ihrer Großmutter, die mit Gwens Erklärung, dass sie in Stoner verliebt sei, nicht besonders gut umgegangen war und die sie deswegen seit fast fünfzehn Monaten nicht gesehen hatte.
Ihr Exmann mochte sie im Moment wahrscheinlich auch nicht besonders, schließlich hatten sie und Stoner zu seinem Tod beigetragen. Aber in seinem augenblicklichen Zustand konnte er nicht viel tun, und selbst wenn er auf der Stelle reinkarniert würde, wäre er zu jung, um Schaden anzurichten.
Das galt auch für Larch Begay unten in Arizona … »Was ist?«, fragte Gwen, als sie laut auflachte.
»Mir ging grad durch den Kopf, dass alle, die dir was Böses antun, anscheinend sterben.«
»Das lass dir eine Lehre sein«, sagte Gwen freundlich. Sie roch an Stoners Teller. »Willst du das wirklich essen?«
»Klar. Warum nicht?«
»Sieht aus wie Diarrhö.«
»Was ist Diarrhö?«
»Durchfall. Und wenn’s kein Durchfall ist, macht es garantiert welchen.«
»Sei nicht albern.« Sie stocherte auf ihrem Teller herum. »Schau, Edith isst es auch.«
»Edith isst es auch«, sagte Gwen. »Edith Kesselbaum, die Frau mit dem kulinarischen Instinkt und dem eisernen Magen einer Bergziege.«
Gwen nicht. Keine richtigen Feinde. Was war mit Marylou?
Wen konnte Marylou beleidigt haben?
Da gab es immerhin die Möglichkeit geplatzter Flugtickets. Die machten Leute zu Killern. Verständlich. Der heutige Luftverkehr mit zunehmendem Risiko, engen Sitzen, ungenießbarem Essen in Winzportionen, verspäteten oder gestrichenen Flügen und Preisen höher als die Flughöhe … Alles, was den Leuten zu einem zünftigen Amoklauf fehlte, war, sich auf einen falschen oder nichtexistenten Flug gebucht zu finden.
Aber sie hatten in den letzten zehn Jahren keinen einzigen Flug verpatzt. Keine von beiden. Eigentlich sollten sie sich das zum Motto machen: Kesselbaum & McTavish, Reiseagentur, Zehn Jahre ohne geplatzte Tickets.
Aber wie war das mit ihrem Privatleben? Marylou stand auf Sex und fand Männer da recht nützlich. Aber die verliebten sich dann immer sofort in sie und wollten mehr, was Festes, wollten KINDER mit ihr. Marylou Kesselbaum mit Kindern war … war … na, war einfach nix. Ein paar von ihren Exfreunden waren deswegen etwas aufdringlich geworden. Gegen einen lief sogar eine gerichtliche Verfügung. Er hing ständig vor der Wohnung in Cambridge rum, wo Marylou mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater wohnte. Er machte eigentlich gar nichts. Hing einfach nur rum. Ging ihr nach. Starrte zu ihrem Fenster hoch. Schrieb Gedichte auf tränenfeuchtem Papier. Schließlich hatte Max – Marylous Stiefvater und pensionierter FBI-Agent – erklärt, genug ist genug, und die Cops gerufen.
Aber das war vor zwei Jahren gewesen. Sechs Monate danach hatte sie nur noch einen kurzen Brief von ihm gekriegt, in der er sich für sein schlechtes Benehmen entschuldigte und versprach, in eine Männergruppe zu gehen, um den »Wilden Mann« in sich zu entdecken. Erschreckender Gedanke, aber es hatte ihn offenbar von seiner Marylou-Obsession geheilt.
Und Stoner bezweifelte, dass Wilde Männer durch die Korridore von Disney World pirschten und ihre bösen Gedanken in andere Köpfe projizierten. Die hatten genug mit der Dschungelbahn und den Karibikpiraten zu tun.