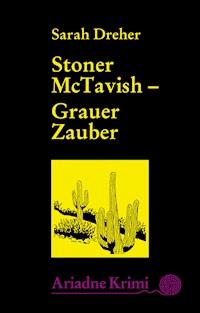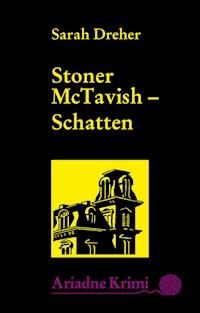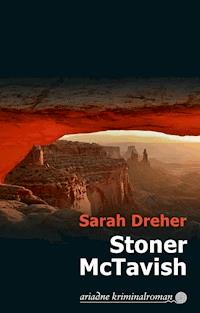Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Argument Verlag mit Ariadne
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Mit einem Brief fängt alles an: Eine gewisse Sherry Dodder bittet Stoner McTavish um Hilfe. Als Honorar bietet sie freie Kost und Logis im Frauenferienhaus The Cottage für Stoner plus Begleitung. Gwen ist von der Aussicht auf romantische Ferien begeistert, also läßt sich Stoner darauf ein, in das exklusive Cottage zu fahren, der dort probenden Frauentheatergruppe beizutreten und undercover zu ermitteln, wer da warum Böses treibt. Aber selbst Berufspessimistin Stoner hätte sich nicht träumen lassen, daß im heimeligen Cottage so viel auf dem Spiel stehen könnte: Binnen kurzem werden aus leidigen Zwischenfällen bösartige Attacken, dann lebensbedrohende Fallen. Noch dazu versucht eine andere, Stoner ihre geliebte Gwen abspenstig zu machen – und das offenbar mit Erfolg. Ein flott inszeniertes Stoner-Abenteuer mit viel Humor und furiosem Showdown.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 524
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sarah Dreher
Stoner verkehrt in schlechten Kreisen
Stoner McTavish 6
Deutsch von Monika Brinkmann
Ariadne
Titel der amerikanischen Originalausgabe: Bad Company
© 1995 by Sarah Dreher
Deutsche Erstausgabe
Alle Rechte vorbehalten
© Argument Verlag 1997/2022
Glashüttenstraße 28, 20357 Hamburg
Telefon 040 / 40 18 00 0 – Fax 040 / 40 18 00 20
Umschlaggrafik: Johannes Nawrath
ISBN 978-3-86754-797-0 (E-Book)
Inhalt
Für all unsere Schurken.
Was täten die Schreibenden ohne sie?
Kapitel 1
»Liebe Stoner McTavish …«
Der Brief war in triumphierenden Fettbuchstaben auf Geschäftspapier getippt. Bei dem Geschäft handelte es sich um ein Gasthaus und Naherholungsziel unweit des Sebago Lake in Maine. Wahrscheinlich wieder so ein Werbebrief, den sie würde beantworten müssen. Seit sie und ihre Freundin und Geschäftspartnerin Marylou Kesselbaum beschlossen hatten, den Wintern in Boston und der städtischen Klientel Lebwohl zu sagen und das Reisebüro Kesselbaum & McTavish in die Wildnis von West-Massachusetts zu verlegen, ertranken sie fast in Werbebriefen. Und sie mussten sie alle beantworten, weil sie es sich nicht leisten konnten, Kontakte zu verlieren, jetzt, da sie noch einmal von vorne anfingen.
Marylou beharrte darauf, dass das plötzliche Interesse nichts mit ihrem Umzug zu tun hatte, sondern mit der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit in der Region. »Die strampeln sich zurzeit alle ab«, sagte sie gern und ließ zur Bekräftigung ihre silbernen Armreifen klirren. »Sogar die Kreuzfahrtgesellschaften, der Teufel soll sie holen. Die sollten lieber ihre Tarife senken, wenn du mich fragst.«
Trotzdem musste sie jeden davon lesen, selbst wenn das hieß, beim Abendessen mit Gwen in einem Restaurant die Post durchzusehen.
»Ihren Namen habe ich von einer Freundin im Frauenzentrum Cambridge«, ging der Brief weiter.
Frauenzentrum Cambridge? Ihre alten Jagdgründe. Interessant.
»Ich weiß, dass Sie sicher furchtbar viel zu tun haben, und es ist mir sehr unangenehm, Sie zu behelligen, aber ich fürchte, ich brauche Ihre Hilfe.
Ich bin Eigentümerin und Leiterin von The Cottage, einer historischen Herberge mit Ferienhaus- und Pensionsbetrieb nur für Frauen.«
Nur für Frauen? Äußerst interessant.
»Seit einem Monat laufen hier die Proben einer Laiinnentheatergruppe. Ein Wahnsinnsteam, echt toll! (Ich bin übrigens die Produzentin.) Aber neuerdings geht allerhand schief. Unerklärliche Zwischenfälle, Missgeschicke und dergleichen. Bisher nichts allzu Ernstes. Aber wir fürchten alle, es könnte etwas zu bedeuten haben, und unser aller Nerven liegen bloß, wie Sie sicher verstehen werden. Mir wurde gesagt, Sie hätten einige Erfahrung darin, Leuten in Not beizustehen, und könnten auch uns vielleicht weiterhelfen. Was meinen Sie? Natürlich würde ich Ihnen freie Kost und Logis gewähren, und Ihrer Begleitperson auch, falls Sie sich Unterstützung mitbringen möchten.
Ich habe den Theaterfrauen noch nichts davon gesagt, da ich sie nicht beunruhigen will – oder nichts verraten, falls die Schuldige unter uns zu suchen ist (Göttin bewahre!). Angenommen, Sie geben vor, Urlaub im Cottage zu machen, und bieten sich der Truppe als ehrenamtlich Mitwirkende an, glaube ich, dass Sie keinen Verdacht erregen würden.
Hätten Sie womöglich Interesse? Ich hoffe es aufrichtig. Es wäre eine gewaltige Erleichterung für mich (für uns alle natürlich).
Mit schwesterlichen Grüßen
Ihre
Sherry Dodder«
»Du sabberst ja schon beinahe«, bemerkte Gwen und lachte. »Was gibt es?«
Stoner reichte den Brief über den mit Mosaikfliesen belegten Tisch und türmte sich noch eine Hühnchen-Fajita auf.
»Klingt gut«, sagte Gwen, während sie den Brief überflog. »Hast du Lust?«
»Vielleicht, aber …«
»Aber?«
»Ich kann mich nicht einfach davonmachen und das ganze Putzen und Packen Marylou aufhalsen. Das wäre nicht richtig.«
»Ich wette, sie hätte nichts dagegen.«
Sie schüttelte den Kopf. »Sie würde sagen, es geht in Ordnung, aber sie würd’s nicht ernst meinen.«
»Stoner, Liebste«, sagte Gwen, »ich weiß nicht recht, wie ich es dir sagen soll, aber …«
»Was?«
»Nun ja, Packen ist keine deiner starken Seiten.«
»Hier ist noch ein Prospekt«, sagte sie rasch, um zu vertuschen, dass sie sich wie eine Idiotin vorkam. Sie breitete das Faltblatt zwischen ihnen aus.
Es war in Sepiatönen auf cremefarbenes Strukturpapier gedruckt, geschmackvoll. Die Vorderseite zeigte einen Steinbau mit Glastüren, die sich auf eine geflieste Veranda öffneten. Im Inneren ein förmlich wirkender Wohnraum mit Ohrensesseln in Plaudergrüppchen-Aufstellung und steifen, thronähnlichen antiken Stühlen an den Wänden entlang. Der Speisesaal schien (soweit sie das auf den Fotos erkennen konnte) einen Blick über Gärten hinweg auf wellige Hügel in der Ferne zu bieten. Die Tische waren mit Leintüchern und Servietten eingedeckt, auf jedem stand in der Mitte eine kleine Porzellanvase mit Nelken. Das Cottage war fraglos sehr stilvoll. Und furchterregend formell.
In der Broschüre stand: »Das Cottage ist den um die Jahrhundertwende in den Adirondacks und Berkshires von wohlhabenden New Yorkern erbauten eleganten Landsitzen nachempfunden, den sogenannten Cottages. Kultiviertes Leben in ländlicher Umgebung mit den Annehmlichkeiten eines New Yorker First-Class-Hotels.«
»Ist dir schon aufgefallen«, fragte Gwen, »dass man immer ›um‹ die Jahrhundertwende sagt? Es heißt nie ›zur‹ oder ›während‹ der Jahrhundertwende. Immer ›um‹. Meinst du, das hat mit dem Wort ›Wende‹ zu tun?«
»Keine Ahnung«, sagte Stoner und starrte auf das Foto vom Speisesaal. Das Cottage ähnelte keinem der Frauenferienhäuser, die sie bisher gesehen hatte. Frauenferienhäuser und Frauenhotels waren normalerweise bescheiden möbliert, abgenutzt und reparaturbedürftig – wobei zur Behebung von Letzterem Gäste gegen Preisnachlass ermutigt wurden. Wenig Etikette, viel Privatsphäre. Das Cottage sah ganz nach einem Ort aus, wo man sich gesellig zu geben hatte. »Ich weiß nicht recht. Vielleicht ist das hier ein bisschen zu üppig für meinen Magen.«
Gwen lehnte sich über den Tisch, um besser sehen zu können. »Schwer zu sagen, eigentlich.«
»All dieses Getue von wegen ›Annehmlichkeiten‹ und ›elegant‹. Irgendwie krieg ich davon Sodbrennen.«
»Nicht unbedingt der Stil der Anzeigen im Lesbenkurier«, stimmte Gwen zu. »Ich frage mich, ob das Geschäft gut läuft.«
Stoner dachte darüber nach. »Wäre möglich. Ich meine, es gibt wahrscheinlich viele Lesben, denen es auf elegante Annehmlichkeiten ankommt. Wir kennen nur keine.«
»Von ›nur für Lesben‹ steht da nichts«, sagte Gwen und kratzte mit einem Tortilla-Chip den letzten Rest scharfe Soße aus der Steinschüssel.
»Schon, aber wie viele Heteras suchen sich einen Nur-für-Frauen-Urlaubsort aus?«
»Marylou würde das tun. Schließlich leben wir in den Neunzigern.«
»Marylou würde einfach alles tun.«
»Wohl wahr«, sagte Gwen. »Isst du deine Guacamole nicht mehr?«
Stoner schüttelte den Kopf. Mit widerstreitenden Gefühlen betrachtete sie den Prospekt. Wenn sie sich darauf einließ … Sie war schwer in Versuchung. Nicht leicht, den Hilferuf einer Schwester abzuweisen. Sie konnte es sich nicht vorstellen. Und die Umgebung schien wirklich schön zu sein. Sie sah sich schon zwischen uniformierten Blumenbeeten auf einer geschnitzten Holzbank lümmeln, die Landschaft betrachten und über ihren nächsten Zug nachdenken. Aber die Einrichtung … Wie sollte sie einen klaren Gedanken fassen in einem Speisesaal, wo man in vollendeter Haltung auf harten, hölzernen Stühlen hockte, mit Blumenvasen auf dem Tisch? Wie sollte sie die Verantwortung übernehmen – was ihrer Erfahrung nach ärgerlicherweise unbedingt dazugehörte, wenn man Fälle löste oder Menschen rettete oder Vermisste aufspürte oder was immer sie gerade zu tun hatte – in diesem steifen, plüschigen Queen-Anne-Salon? Wie soll man klar denken, wenn man sich dem Mobiliar unterlegen fühlt?
Natürlich wusste sie, wo das wirkliche Problem lag. Das Cottage war trotz seines irreführend rustikalen Namens genau der Ort, von dem ihre Mutter entzückt wäre.
Nun ja, jedenfalls von der Einrichtung. Nichts brachte die Augen ihrer Mutter so zum Glänzen wie ein mit Antiquitäten vollgestopfter Raum. Und sie würde genau wissen, welche echt waren und welche Kopien und auf welche man sich unbesorgt setzen konnte …
Stoner würde garantiert den ersten Stuhl, auf dem sie Platz nahm, zum Einsturz bringen. Selbst wenn es eins von diesen großen, schweren Ungetümen war. Mit Antiquitäten hatte sie es. Schon immer. Nicht, dass sie etwa unachtsam war. Sie wurde einfach heimgesucht von diesem perversen Unvermögen, das Richtige zu tun. Wahrscheinlich ein Fluch aus einem früheren Leben.
Und was scherte sie überhaupt ihre Mutter? Sie ging auf die vierzig zu, verflucht noch mal. Seit sie mit sechzehn von zu Hause weggelaufen war, hatte sie ihre Eltern kaum gesehen, geschweige denn mit ihnen zusammengelebt. Sie hatten es aufgegeben, den Kontakt mit ihr zu suchen, fanden wohl, dass es ihrer Tante Hermione – bei der Stoner lebte und die sie innig liebte – recht geschah, sie auf dem Hals zu haben, weil sie sie bei sich aufgenommen hatte. Was machte es also, wenn ihre Mutter beim Anblick vom Cottage feucht wurde?
Außerdem wäre ihre Mutter entschieden abgestoßen von der Idee einer Pension nur für Frauen. Ganz zu schweigen von einer Frauentheatergruppe. Wenn es etwas gab, worin Dot McTavish (ihr Name war Dorothy, aber sie bildete sich ein, als »Dot« wirke sie fidel und ›voll dabei‹) absolut keinen Sinn sah, dann war das jede Form von Nur-für-Frauen-Zusammenhängen.
Die Frauenbewegung hatte die denkbar geringste Auswirkung auf die Erwachsenen im Haushalt McTavish gehabt. Genauer gesagt hätte Stoner wetten mögen, dass ihre Mutter, die sich nie im Leben einer Organisation angeschlossen hatte (abgesehen von patriotischen Damenlesezirkeln), eingetragenes Mitglied auf Lebenszeit bei den Besorgten Frauen fürs Vaterland war. Und ihres Vaters Wahrnehmung der feministischen Revolution beschränkte sich auf die schlüpfrigen Witze im Legionärsmagazin.
»Und, was denkst du?«, fragte Gwen. Sie hatte eine unversehrte Teighülle in den Überresten von Stoners Mahl entdeckt und belud sie mit dem verbliebenen Salat und Käse und Zwiebeln und Guacamole und Salsa und Bohnen und was sie sonst auf beiden Tellern finden konnte. Sie rollte das Ganze zusammen, schlug die Enden um und biss hinein. »Himmel, ist das gut.«
»Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der Abfall isst«, bemerkte Stoner mit einem liebevollen Lächeln.
»Stimmt nicht«, sagte Gwen. »Edith Kesselbaum isst auch Abfall.«
»Das behauptet Marylou. Meinungen von Töchtern zählen nicht.«
»Glaub mir«, beharrte Gwen, »Taco Bell ist Abfall. Hast du dich entschlossen, oder ist es dir zu bedrückend?«
Stoner spielte mit dem Prospekt. »Meine Gedanken sind bedrückend. Was das hier angeht …« Sie zuckte mit den Schultern. »Was meinst du, was soll ich tun?«
»Habe ich doch schon gesagt. Pack die Gelegenheit beim Schopf. Wo liegt das Problem?«
»Ich glaube nicht …« Es wollte ihr nicht über die Lippen. Sie schämte sich zuzugeben, warum sie zögerte, selbst vor Gwen – schließlich glaubte sie fest daran, dass angesichts der gemeinsamen Unterdrückung alle Lesben Schwestern waren, dieselben Ängste und Sorgen hatten, und es kam ihr nicht zu, einer anderen zu sagen, was sie tun und lassen sollte, sofern sie nie in ihrer Haut gesteckt hatte …
Gwen schaute sie an. »Was denn?«
»Die Leute, die da hinfahren … Na ja, manchmal habe ich eben Probleme mit Yuppie-Lesben in Stöckelschuhen.«
»Niemand sagt heutzutage noch Yuppies. Schließlich leben wir in den Neunzigern.«
»Hörst du jetzt mal auf, alle zwei Minuten ›schließlich leben wir in den Neunzigern‹ zu sagen?«
»Es wird von uns erwartet, es alle zwei Minuten zu sagen. Schließlich leben wir in den Neunzigern.« Gwen nahm einen Schluck Wasser. »Weißt du, wann ich diesen Satz zum ersten Mal gehört habe? Am ersten Januar 1990, eine Minute nach Mitternacht.«
Stoner kniff die Augen zusammen und gab sich finster. »Da warst du bestimmt mit diesem Mann zusammen, nicht?«
»Mit welchem Mann?«
»Diesem Kerl Bryan Oxnard.«
»Meinem Gatten?« Sie rechnete nach. »Glaube schon. Wir waren noch nicht verheiratet, aber wir arbeiteten daran.« Sie lachte. »Ich glaube, der Beginn des neuen Jahrzehnts hat sich auf mein Leben mehr ausgewirkt als er. Im Gegensatz zu der Auswirkung, die du auf ihn hattest.«
»Ich wollte ihn nicht töten«, sagte Stoner. »Es war ein Versehen.« Sie blickte auf und sah die Kellnerin direkt neben sich stehen. Es war nicht die junge Frau, die ihnen das Essen serviert hatte. Sie hatten wohl wieder mal einen Schichtwechsel abgesessen.
»Darf ich dann abräumen?«, fragte die Frau munter.
»Öh, ja, sicher«, murmelte Stoner. »Wissen Sie, was Sie da gerade gehört haben … Es ist nicht so, wie es sich anhört … Ich meine, es war Notwehr. Er versuchte sie umzubringen, und …«
»Echt cool«, sagte die Frau und griff nach Gwens Teller.
Gwen packte den Teller mit beiden Händen und drückte ihn auf den Tisch zurück. »Den kriegen Sie erst, wenn Sie sich drin spiegeln können«, knurrte sie.
»Wie Sie meinen, Ms. Owens«, die Kellnerin lachte. »Freut mich, dass Sie noch ganz die Alte sind.«
»Und mich freut, dass Sie es nicht mehr sind«, sagte Gwen. Sie tätschelte den Arm der jungen Frau herzlich. »Sie waren eine der … unkonzentriertesten … Heranwachsenden, die ich je unterrichtet habe.«
»Und Sie waren die gnadenloseste Lehrerin von allen.«
Stoner blickte erstaunt auf.
»Ich musste doch ein bisschen einschüchternd auftreten«, sagte Gwen zur Erklärung. »Jugendliche im Highschool-Alter haben nicht mal sich selbst unter Kontrolle. Wenn die Lehrerschaft die Kontrolle verliert, herrscht die nackte Anarchie. Hat sich Ihre Unkonzentriertheit so weit gelegt, dass Sie mal übers College nachdenken konnten?«
Die junge Frau nickte. »Uni. Boston. Fange nächsten Monat mein drittes Semester an. Ich will …« Sie zögerte und errötete ein wenig. »… Geschichtslehrerin werden, wie Sie.«
Gwen schlug sich die Hände vors Gesicht. »Ich habe versagt.«
»Wie Sie früher immer sagten, Ms. Owens: Das kommt ganz auf den Standpunkt an. Darf ich Ihnen noch etwas bringen?«
»Kaffee?«, fragte Stoner.
Gwen nickte.
Die Kellnerin zog sich zurück.
»Ich glaube, du hast sie eingeschüchtert«, sagte Stoner.
»Das bezweifle ich.« Gwen nahm einen weiteren Bissen ihrer Kreation. »Weißt du, ich bin wirklich hocherfreut. Carol hat mir immer Sorgen gemacht. Sie war so flatterhaft, fast hyperaktiv. Ich war sicher, dass sie Probleme zu Hause hatte, aber ich bekam nichts aus ihr heraus. Die einzige Möglichkeit, zu ihr durchzudringen, waren geharnischte Standpauken.«
»Sie scheint sich gut zu machen«, sagte Stoner. »Und wenn ich bedenke, wie sie rot wurde, als sie erzählte, dass sie in deine Fußstapfen treten will, würde ich sagen, du hast etwas erreicht.«
»Hm-hm.« Gwen Blick wanderte in Richtung Küche. »Unterrichten ist ein merkwürdiges Geschäft. Für ein paar Jahre hast du diese intensive, emotionsgeladene Beziehung zu den Kindern. Jeder Tag bringt eine Krise oder einen Triumph. Jeder Augenblick, alles, was du sagst und tust, und mag es noch so unbedeutend sein, erscheint schrecklich wichtig … als ginge es um Leben und Tod. Und dann kommt der Juni, und sie verschwinden, und meist siehst du sie nie wieder.«
»Ich weiß nicht, ob ich das könnte«, sagte Stoner.
»Für dich wär’s schwer. Du bist so anhänglich, du würdest mit jedem Kind in Verbindung bleiben wollen.«
Stoner schüttelte den Kopf. »Ich meinte, weil ich Angst vor Kindern habe. Sie sind mir zu – na ja, zu planlos.«
»Planlos sind sie, das ist wohl wahr.«
Manchmal versuchte Stoner sich vorzustellen, wie es gewesen wäre, Gwen als Lehrerin zu haben. Ihre ganze Schulzeit über hatte die Verliebtheit in die eine oder andere Lehrerin sie zu Höchstleistungen angespornt. Was vermutlich der Grund dafür war, dass ihre Noten so extrem ausfielen – in einem Jahr lauter Einser in Englisch, dann im Jahr darauf in Mathe, während Englisch auf Drei absackte. Ein halbes Jahr lang glänzte sie in Sozialkunde, doch das endete abrupt, als Miss Collins heiratete und die Schule verließ. Sie hatte keine angeborene Begabung für Naturwissenschaften, doch der erste Blick auf Mrs. Lurie verwandelte sie in ein Genie, was wiederum bewies, dass angeborene Begabung nicht unbedingt von Bedeutung ist. Natürlich litten alle anderen Fächer, wenn sich ihre Aufmerksamkeit auf eine Lehrerin konzentrierte, doch das scherte sie wenig. Ihr schlechtestes Jahr war die zehnte Klasse gewesen, als sie in niemanden verknallt war und am Ende mit einem netten, langweiligen Durchschnitt von Drei-minus dastand.
Aber wäre Gwen Owens ihre Lehrerin gewesen …
Es wäre wahrscheinlich eine Katastrophe geworden. Denn Gwen war von so sanfter Schönheit, so gewitzt und klug, mit dieser wunderbaren beruhigenden Stimme und diesen braunen Augen zum Drin-Verlieren … Stoner wusste, dass sie mit der Unbeholfenheit und Unsicherheit ihrer Pubertät vor Bewunderung und Verlangen wie gelähmt gewesen wäre. Manchmal war sie es heute noch. Jetzt und hier zum Beispiel, mitten im Chili’s, mitten in Cambridge, an einem Freitagabend, an einem Ort, der sich langsam mit biertrinkenden Studenten des Sommersemesters füllte.
»Also«, sagte Gwen, derweil sie ihrer Fajita den Garaus machte. »Was wirst du nun mit diesem Brief anstellen?«
»Ich weiß es nicht.«
»Wollen wir bei Marylou vorbeifahren und ihr die Sache unterbreiten?«
»Ich weiß, was sie sagen wird«, murmelte Stoner. »Sie versucht seit Wochen, mich irgendwohin zu schicken, damit sie endlich den Umzug startklar kriegt.«
»Sie WAS?«
»Sie versucht seit …«
»Ich hab dich schon verstanden«, sagte Gwen. »Das war ein rhetorisches WAS. Warum hast du dann nicht wenigstens Urlaub genommen?«
»Das wäre nicht richtig.«
Gwen verschluckte sich an einem Salatblatt samt Sauerrahm. »O Himmel, ich bin wirklich in eine Wahnsinnige verliebt.«
»Es wäre nicht richtig«, wiederholte Stoner ein wenig gekränkt.
»Stoner, Liebste, niemand auf dieser Welt würde deine Grundsätze oder deine Manieren infrage stellen. Aber manchmal solltest du die Gefühle anderer Leute in Erwägung ziehen.«
»Das weiß ich selber«, grummelte Stoner.
Gwen nahm ihre Hand. »Ich liebe dich wie verrückt, Steinchen, und ich wollte dich auch nicht kritisieren oder deine Gefühle verletzen. Aber verstehst du denn nicht …?«
»Doch, doch«, sagte Stoner und kam sich vor wie der letzte Trottel. »Du hast ja recht. Du hast ja immer recht.«
»Das ist nicht wahr«, sagte Gwen. »Ich habe Bryan Oxnard geheiratet. Nicht du.«
»Na ja, in kleinen Dingen hast du immer recht.«
Gwen überdachte das. »Ja«, sagte sie dann. »Ich glaube, damit hast du recht.«
Stoner sah sie an, und ein Schwall von Emotion traf sie wie ein sommerwarmer Windstoß. »Gwen, ich … meine Gefühle für dich sind so stark, dass es mir Angst macht.«
»Und ich liebe dich so sehr«, sagte Gwen mit ihrer leisen Samtstimme, »dass es mich zu Tode erschreckt.« Sie lachte zärtlich auf – und sexy – und verstärkte ihren Druck auf Stoners Hand.
Stoners Körper reagierte prompt, ihre Haut prickelte und kribbelte.
Na toll, dachte sie. Wollust mitten in Cambridge. Sie räusperte sich. »Ich wette, deine Ex-Schülerin kann es kaum erwarten, heimzukommen, sich ans Telefon zu hängen und allen zu berichten, dass ihre ehemalige Geschichtslehrerin in aller Öffentlichkeit mit einer Frau Händchen hält.«
»Ich wette, sie kann es kaum erwarten, zu berichten, dass ihre ehemalige Geschichtslehrerin mit der Frau Händchen hält, die ihren Gatten ermordet hat.«
»Ich habe ihn nicht ermordet, Gwen. Es war Notwehr.«
»Ich weiß«, sagte Gwen, drückte Stoners Hand leicht und ließ sie dann los. »Aber so klingt es viel lustiger. Schließlich leben wir in den Neunzigern.«
Dessert und Kaffee – serviert von wieder einer anderen Kellnerin – brachte sie einer Entscheidung nicht näher.
»Hör zu«, sagte Gwen, als sie das Trinkgeld abzählte. »Du weißt genau, dass du es machst, also lass uns bei Marylou vorbeischauen, da wir schon mal in Cambridge sind, damit du dich überzeugen kannst, dass es ihr wirklich nichts ausmacht.«
»Tja …«
Gwen sah sie prüfend an. »Da ist noch etwas, nicht? Außer schlechtem Gewissen.«
»Irgendwie schon.« Sie konnte sich nicht mehr erinnern, ab wann sie Gwen nichts mehr hatte vormachen können. Im Laufe ihrer vier gemeinsamen Jahre als Freundinnen und dann als Paar hatte Gwen sie ziemlich genau kennengelernt. Eigentlich traf es das nicht ganz. Stoner hatte Gwen erlaubt, sie ziemlich genau zu kennen. Sie bereute es nicht, aber manchmal war es ein wenig irritierend. »Um ganz ehrlich zu sein …«
»Immer eine gute Idee!«, setzte Gwen ermutigend nach.
»Es sind nicht bloß die Yuppies oder so … in Wirklichkeit hab ich irgendwie Angst vor den Möbeln.« Sie fuhr sich mit der Hand durchs Haar. »Ich meine, vor der Art Ambiente, wo es solche Möbel gibt.«
Gwen warf noch einen Blick auf den Prospekt. »Ich ahne, was du meinst. Andererseits, vielleicht hilft es dir, deine Angst vor der Vergangenheit zu überwinden.«
»Ganz bestimmt nicht so. Ehrlich. Ich komme aus Rhode Island. Rhode Island ist randvoll mit Vergangenheit. Rhode Island stinkt förmlich nach Vergangenheit. Von Vergangenheit umgeben sein hilft überhaupt nicht gegen meine Angst vor der Vergangenheit.«
»Na ja«, Gwen seufzte. »Ich fürchte, da bin ich dir keine große Hilfe. Daheim in Georgia ist Vergangenheit das, womit alle am besten klarkommen.« Sie stand auf und nahm die Rechnung. »Stoner, du weißt so gut wie ich, dass du es machen wirst.«
Stoner atmete tief ein. »Ja, okay, aber nur, wenn …«
»Wenn?«
»Wenn du mitkommst.«
»Ich dachte schon, du fragst nie.«
* * *
Marylou war hingerissen. Mehr als hingerissen. »Du ahnst ja nicht, wie ich darum gebetet habe«, sagte sie. »Endlich kann ich unser Chaos in Ordnung bringen.«
»Da ist noch die Sache mit dem fehlenden Tidrow-Koffer«, setzte Stoner an.
Ihre Freundin tat das mit einer Handbewegung ab. »Hab ihn gestern aufgespürt.«
»Der Charterflug nach Neapel sieht nicht gut aus …«
»Ich hab alles unter Kontrolle, Stoner.«
»Weißt du nicht mehr, das Marokko-Desaster? Diese Flugzeugentführung?«
Ihre Freundin sah sie nachsichtig an. »Das waren Terroristen, Stoner, keine Reisebüros.« Sie stand vom Schreibtisch auf und streifte dabei einen Stapel geheimnisvoller Zettel, die verdächtig nach Kopien von Flugtickets der letzten sechs Monate aussahen.
»Marylou, wenn das das ist, was ich denke …«
»Ist es.«
Stoner fühlte einen hysterischen Anfall keimen. »Die müssten wir längst weggeschickt haben, Marylou. Die Dinger sind bares Geld. Wenn die anfangen, unsere Bücher zu überprüfen …«
»Ach komm, reg dich ab.« Marylou kramte in einem Karton mit der Aufschrift »zerbrechlich« und förderte eine Packung Leckerland – Luzifers Lieblingsnaschereien zutage. »Das sind Kopien von den Kopien. Du weißt doch, dass ich die Originalkopien jede Woche losschicke.«
»Oh.«
»Ich bin viel effizienter, als du denkst, Stoner. Ich hätte gedacht, dass dir das in den letzten neunzehn Jahren irgendwann klar geworden wäre.«
Stoner staunte. »So lange kennen wir uns schon?«
»Und ob.« Marylou zog einen Keks aus der Packung und verzehrte ihn hingebungsvoll.
»Und in all der Zeit hast du mir nie einen Keks angeboten.«
»Stimmt, und das werde ich auch nie. Zucker ist nicht gut für dich.«
»Na, für dich etwa?«
»Und ob.« Marylou rieb die Fingerspitzen aneinander, um die Krümel abzustreifen. »Ich habe einen Stoffwechsel.«
»Jeder Mensch hat einen Stoffwechsel.«
»Nicht so einen wie ich.«
Stoner schaltete ihren Computer ein, um nachzusehen, wie es um American Airlines stand. Offenbar gab es verfügbare Sitzplätze wie Sand am Meer. Sie rief den Stand vom Freitag auf. Genau dasselbe. »Was ist mit American los?«
Marylou kam um den Schreibtisch herum und linste auf den Monitor. Sie roch nach Schokolade und nach Brombeer-Duschgel aus dem Body Shop. »Keine Ahnung. Hab keine Gerüchte gehört. Check mal bei United.«
Sie loggte sich bei United Airlines ein. Völlig ausgebucht. Sie versuchte es bei Delta. Ebenso.
»Eigentümlich«, sagte Marylou.
»Ja. Redest du noch mit dem Typ, der am Flughafen die American-Tickets verkauft?«
»Natürlich rede ich noch mit ihm«, sagte Marylou empört. »Ich war ja noch nicht mit ihm aus.«
Marylou war überzeugt, dass eine Verabredung der beste Weg war, einen lästigen Verehrer loszuwerden. »Das ruiniert den Nimbus des Geheimnisvollen«, sagte sie gern.
Stoner fand das schwer nachvollziehbar, weil sie Marylou lieber mochte, je länger und besser sie sie kannte. Nach all der Zeit war Marylou noch immer imstande, sie zu überraschen. Vermutlich lag es daran, dass Marylou Veränderungen und Erweiterungen gernhatte und man nie vorher wissen konnte, welche Richtung die nehmen würden. Außerdem war ihre Loyalität gegenüber Stoner unverbrüchlich wie ein Felsbrocken, was für Stoner mehr als alles andere wog.
Männer, vermutete sie, waren wohl an anderem interessiert. Nicht ausschließlich an Sex – obwohl ihr Interesse daran fast pathologisches Ausmaß annahm –, sondern anscheinend suchten sie in einer Frau recht unirdische, ja mythische Eigenschaften.
»Unfug«, erklärte Marylou einmal. »Sie wollen die Mutter, die sie ihrer Einbildung nach mal hatten, aber nie wirklich.«
Da Marylou Kesselbaum nicht beabsichtigte, irgendeines Mannes Mutter zu sein, wirklich oder sonst wie, war sie ihnen eine ständige Enttäuschung.
»Ruf ihn doch mal an«, schlug Stoner vor. »Frag ihn, ob er weiß, was los ist.«
»Gute Idee.« Marylou griff sich noch einen Keks und stürzte sich aufs Telefon.
Stoner wandte sich wieder ihrem Schreibtisch zu. Der Haufen zu erledigender Dinge war nicht kleiner geworden, seit sie ihm den Rücken gekehrt hatte. Vielmehr schien er gewachsen zu sein und hatte fast den kritischen Punkt erreicht. Das Schlimmste war das Aussortieren, die Entscheidung, was sie behalten mussten und was wegkonnte. Sie wusste, sobald sie beschloss, dass etwas nutzlos war – zum Beispiel die Quittungen über das Geld, das sie einer Gruppe Charterurlaubern erstattet hatten, als Pan Am pleiteging – und es wegwarf, würde das Finanzamt wie Krähen über einem Kornfeld auf sie niederstoßen und sämtliche Belege ihrer Steuererklärung von vor zehn Jahren sehen wollen.
Also wanderten die Quittungen in die Umzugskartons. Womit sie in Marylous Zuständigkeitsbereich landeten, weil die Umzugsfirma am Vierzehnten dieses Monats anrücken würde, genau fünf Tage nachdem Stoner die Reiseagentur im Stich gelassen hatte wie eine Ratte das sinkende Schiff, um Detektivin zu spielen für Leute, die sie nie im Leben gesehen hatte. Schuldgefühle überschwemmten sie, Besorgnis folgte. Es war nicht fair, egal wie oft Marylou erklärte, es sei ihr schnuppe, die ganze Verantwortung aufgehalst zu bekommen. Nicht die Bohne fair. Außerdem würde sie wahrscheinlich mit den Leuten von der Umzugsfirma ins Plaudern kommen und sie dazu bringen, sie in eins ihrer Lieblingsrestaurants einzuladen, und all ihre wertvollen Dokumente würden im Regen auf der Straße stehen oder gar …
»Sie machen Witze«, hörte sie Marylou in den Hörer sagen. »Sie machen keine Witze? Sie müssen Witze machen.«
»Was?«, sagte Stoner lautlos.
»Sekunde«, sagte Marylou in den Hörer. »Da ist jemand in der anderen Leitung.« Sie hielt den Hörer zu. »Streikgerüchte.«
»Wirklich?«
»Nur Gerüchte.«
»Wer streikt?«
»Halt dich an deinem BH fest«, sagte Marylou. »Ein Schock steht ins Haus.« Sie machte eine dramatische Pause. »Das Catering-Servicepersonal.«
Stoner lachte schallend. »Niemand macht einen Bogen um eine Fluglinie, bloß weil er dort vielleicht kein Essen bekommt. Nicht bei diesen Fluglinienmenüs.«
»Du hast recht.« Sie wandte sich wieder dem Telefon zu. »Verzeihung, dass es etwas länger gedauert hat. Also schön, Sie haben Ihren kleinen Scherz platziert. Was steckt wirklich dahinter?« Sie hörte zu. »Ach, deshalb. Na ja, irgendetwas ist es immer, nicht wahr?« Sie blickte in Stoners Richtung und formte lautlos das Wort »Bombendrohung«.
Bombendrohungen. Irgendwas war heutzutage immer los. Sie wünschte wirklich, die Menschen würden sich abregen und ihren Angelegenheiten nachgehen und aufhören, Unbeteiligte hineinzuziehen, die nicht mal wussten, worum es eigentlich ging. Aber auf dem Planeten Erde hatten Testosteron-Vergiftungen Konjunktur, und Gewalt regierte.
Tante Hermiones spirituelle Leitfiguren versicherten, dies sei das letzte Aufbäumen des sterbenden Patriarchats, das nicht willens war, kampflos aufzugeben, und bessere Zeiten stünden bevor. Das Neue Zeitalter dämmere schon mit heftigen Geburtswehen, da die Erde aus dem Dunklen Zeitalter in die Ära von Liebe, Licht und Leben eintrete. Das Problem war nur, die Leitfiguren hatten keinerlei Gefühl für Zeit-wie-wir-sie-kennen und lieferten folglich keinen Hinweis darauf, wie lange man darauf noch würde warten müssen. »Vielleicht nicht mehr in diesem Leben«, sagte Tante Hermione, »wobei das natürlich auch nur ein künstliches Konzept ist, da alle Zeit simultan stattfindet, also dämmert die neue Ära jetzt, in dieser Minute.«
Gespräche über Zeit und Raum bewirkten in Stoners Kopf den Effekt eines Fernsehbildschirms, wenn man das Antennenkabel rauszog – nur noch grauer Schnee und Rauschen.
»Heiliger Strohsack«, empörte sich Marylou, als sie auflegte. »Warum teilt uns das keiner mit? Was würde es schon kosten, so was in den Zentralcomputer einzugeben? Was sollen wir denn bitte schön tun, den ganzen Tag vor dem Nachrichtenkanal hocken, damit wir wissen, was wir unseren Kunden raten sollen? Was, wenn wir jetzt in diesen Flügen Plätze gebucht hätten? Und unsere Kunden zum Flughafen eilen, nur um festzustellen, dass ihre Maschine nicht geht? Wen würden sie wohl verantwortlich machen? Uns arme Säue in den Schützengräben und sonst niemanden.«
»Ich stimme dir voll und ganz zu«, sagte Stoner. »Wie soll das bloß nach dem Umzug werden? Dann sind wir noch weiter ab vom Schuss als jetzt schon. Die ganze Tourismusbranche könnte dichtmachen, und wir würden nichts davon mitkriegen.«
»Es wird besser werden«, verkündete Marylou. »In kleinen Städten verbreiten sich Neuigkeiten viel schneller.«
»Schon«, sagte Stoner. »Aber wenn das nur die regionalen Neuigkeiten betrifft? Ich meine, vielleicht interessieren sich die Leute in Shelburne Falls weniger für Fluglinienklatsch. Am Ende verlieren wir total den Anschluss.«
»Unfug«, schnurrte Marylou optimistisch. »Sie lieben jede Form von Klatsch und Tratsch. Hast du nie Sinclair Lewis gelesen?«
Das hatte sie nicht, wohl aber Shirley Jackson. Und was sie bei Shirley Jackson gelesen hatte, förderte nicht gerade ihren Glauben an Kleinstädte.
Die ganze Besorgnis wegen ihres gemeinsamen Entschlusses, die sie normalerweise verdrängte, drang mit Wucht auf sie ein. »Marylou? Meinst du, wir machen einen Fehler?«
»Keine Spur. Du hasst die Stadt. Gwen will eine Pause vom Lehrbetrieb. Tante Hermione sehnt sich nach einem Ort mit besseren Schwingungen. Dieses Gebäude wird in Eigentumswohnungen umgewandelt – gut fünf Jahre nach Abflauen der Nachfrage ein sicheres Rezept für eine Bauchlandung, wenn du mich fragst. Und ich muss endlich lernen, allein zu leben.«
Stoner lächelte. »Du wirst nicht gerade allein leben. Wir alle zusammen in einem riesigen alten Haus.«
»Ja«, sagte Marylou. »Aber es wird mein Haus sein und nicht das meiner Mutter. Das scheint mir doch ein Schritt nach vorn.«
Das war es wohl, räumte sie im Stillen ein. Obwohl sie nie gefunden hatte, dass an Marylous Wohnverhältnissen irgendetwas verkehrt oder neurotisch war. Nicht mehr als an ihren mit Tante Hermione. Marylou und Edith mochten einander wirklich, wie Stoner und ihre Tante. Es war praktisch, und nichts sprach dagegen. Was ihr hingegen Sorgen bereitete, war das Zusammenziehen mit Gwen – das erste Mal, dass sie und eine Geliebte miteinander leben würden. Sicher, sie alle hatten sich geeinigt, das Arrangement nicht als ZUSAMMENLEBEN aufzufassen, sondern als gemeinsames Bewohnen eines Hauses. Aber das änderte nichts an der Tatsache, dass sie unter einem Dach leben würden, tagtäglich, mit Mahlzeiten, Müllrausbringen, Spülen und Putzen, jede würde die Musik der anderen hören, wissen, wer was im Fernsehen anschaute und wie viel Zeit jede im Badezimmer verbrachte …
Sie hätte laut schreien mögen.
»Du siehst schlimm aus«, sagte Marylou.
»Ich habe Angst.«
»Alles wird gut«, sagte Marylou mit einem Handwedeln. »Es wird ein voller Erfolg.« Sie biss in ihren Keks und krümelte auf den Schreibtisch. »Ein Blick auf dich und Gwen, und die gesamte lesbische Bevölkerung von Massachusetts drängelt sich auf unserer Fußmatte.«
»Vielleicht«, sagte Stoner. »Aber vielleicht ist es da draußen politisch nicht korrekt, ein Reisebüro zu frequentieren.«
»Dann halten wir uns eben an die Senioren und Seniorinnen. Ältere Leute mögen dich. Ich glaube, das kommt, weil du immer so höflich bist.«
»Was, wenn die ihr trautes Heim nur verlassen, um den Winter in Florida zu verbringen?«
Marylou benetzte ihren Finger und tupfte Krümel auf. »Trotzdem müssen sie irgendwie hinkommen, nicht? Und Tante Hermione verschafft uns Kundschaft aus ihrer Klientel und auch aus der Kolleginnenschaft. Bestimmt reisen die nicht alle nur körperlos.« Sie schob den Rest Krümel zu einem kleinen Häufchen zusammen. »Mein Beitrag wird sein, an nachbarschaftlichen Aktivitäten teilzunehmen und reiche, wichtige Leute kennenzulernen. Vielleicht werde ich ja eingeladen, vor dem Rotary Club zu sprechen.«
Trotz ihrer Ängste musste Stoner lächeln. Sie sah Marylou schon einen Kuchenbasar für die Mädchengruppe organisieren. Bei der Benefizflohjagd des Tierschutzvereins helfen. Mit den Pfadfinderinnen Nachtwanderungen machen. Bei der ›PflegeheimGlückliches AbendrotWeihnachtstombola‹ einspringen …
»Na«, gab Stoner schließlich zu, »was auch passiert, langweilig wird es nicht.«
»Nicht für eine Sekunde. Versprochen.« Sie rollte den Krümelhügel zu einer weichen Kugel und warf sie sich in den Mund.
Stoner zog eine Grimasse. Gwen hatte nur halb recht. Beide Kesselbaums aßen Müll. »Du wirst sie vermissen. Deine Mutter, meine ich.«
»Zweifellos«, sagte Marylou. »Aber du machst dir keine Vorstellung, wie es ist, eine Psychiaterin zur Mutter zu haben.«
»Nein, aber ich weiß, wie es ist, deine Mutter zur Psychiaterin zu haben. Sie war sehr verständnisvoll.«
»Genau das meine ich«, sagte Marylou mit lebhaftem Armreifenklimpern. »Sie ist zu verständnisvoll. Sie versteht und versteht, bis ich Schreikrämpfe davon kriege.«
»Ich dachte immer, das wäre eine gute Eigenschaft.«
»Bei einer Seelenklempnerin schon. Nicht bei einer Mutter. Gott, die Pubertät war die Hölle. Es gab einfach nichts, was sie dazu gebracht hätte, mal einen Aufstand zu machen.«
»Als du entführt wurdest, hat sie einen ziemlichen Aufstand gemacht«, warf Stoner hilfreich ein.
»Sicher«, gab Marylou zurück, »und wenn sie denkt, dass ich mich laufend in Gefahr begebe, nur damit sie zu ihrem Aufstand kommt, dann kann sie sich unaufgestanden begraben lassen.«
»Das ist bei den meisten Menschen so. Das Auferstehen kommt nämlich erst danach.«
Marylou riss eine Packung Dino-Fruchtgummis auf und warf eins davon in Stoners Richtung.
»Himmel, wo hast du die denn her?«, fragte Stoner. Dino-Fruchtgummis waren definitiv nicht Marylous Stil.
»Hat so ein Heidenkind auf meinem Schreibtisch liegen lassen. Die Mutter versuchte, einen Trip zur Mall of America zu buchen. Das Kind wollte lieber zum Jurassic Park.«
»Kann ich ihm nicht verdenken.« Stoner schauderte beim Gedanken an die gewaltigste Kommerzmeile des Landes – ein gigantomanes Shopping- und Amüsierspektakel.
»Die Mall of America ist meine Vorstellung vom Himmel auf Erden«, sagte Marylou.
»Vielleicht kommst du ja mal hin.«
»Sicher, nach meinem Tod. Sofern ich nicht auferstehe.« Sie fing an, Kataloge in zwei Stapel zu sortieren, einen auf ihrem Schreibtisch, den anderen auf dem Fußboden.
Stoner sah ihr eine Weile zu. »Interessantes System«, bemerkte sie.
»Ist ganz einfach. Die da«, sie wies auf den Schreibtischstapel, »behalten wir. Und die da«, sie zeigte auf den Fußboden, »sind die Verlierer – und tschüss.« Sie warf ein paar ekelhaft bunte Faltblätter auf den Verliererstapel. »Wie geht’s zu Hause mit dem Packen voran?«
»Gut. Tante Hermione hat alles im Griff. Ich tue nur, was sie mir sagt.«
Marylou blickte auf. »Du tust, was sie dir sagt, und ich kann mir eher die Pulsadern aufschneiden, als dir auch nur einen winzigen Vorschlag zu machen?«
»Das heißt doch nicht, dass ich deinem Urteil nicht traue«, beeilte sich Stoner zu versichern. »Das meiste Zeug im Haus gehört ihr, das ist alles.«
»Es verblüfft mich immer wieder«, sagte Marylou, während sie rasch eine Handvoll Prospekte durchsah, »wie du so viel Bürokram ansammeln kannst und so wenig persönliche Habe.«
Stoner dachte darüber nach. »Ich nehme an, bei meinen Sachen weiß ich, was davon wichtig ist, aber hier –«, sie schwenkte den Arm durchs Büro, »das könnten wir alles noch mal brauchen.«
»Verstehe«, sagte Marylou tiefernst. »Die Strategie lautet: Was dir am meisten Angst einjagt, wird aufgehoben.«
»So in der Art.«
»Dann sollten Gwen und ich dringend unsere Einschüchterungstaktik optimieren.«
Sie musste lachen. »Darum geht es nicht, Marylou. Es geht um Sachen. Sachen machen mir Angst.«
Marylou sah sie an wie eine Geisteskranke und bot ihr schweigend einen Kaugummi an. Sie lehnte ab.
Es stimmte schon, so verrückt es auch klang. Sachen, Dinge machten ihr Angst. Sie hatten ein Eigenleben und funktionierten nach Regeln, die nichts mit denen der Menschen zu tun hatten. Sie konnten sich zum Beispiel nach Lust und Laune in etwas völlig anderes verwandeln. Sie hatte erlebt, wie Zwanzigdollarscheine innerhalb ihres Portemonnaies zu Kreditkartenquittungen mutierten. Dinge konnten nach Belieben auftauchen und verschwinden. Musikkassetten und CDs beherrschten das besonders gut. Einmal war eine fremde Platte in ihrer Sammlung aufgetaucht. Sie hatte sie nicht gekauft. Niemand hatte sie ihr geschenkt. Sie gehörte keiner ihrer Bekannten. Sie gab sich als Klassik aus, von einem Komponisten, von dem sie nie gehört hatte, gespielt von Musikern, von denen sie nie gehört hatte. Sie lag oben auf dem Stapel und war, als sie ihn zuletzt durchgesehen hatte, nicht da gewesen.
Tante Hermione erklärte, das nenne sich »Apport« und die Platte sei aus einem Paralleluniversum herübergerutscht.
Auch nicht besonders tröstlich.
Aber das Schlimmste an Dingen war ihre Fähigkeit, sich zu tarnen. Bring fünf oder sechs Dinge zusammen, und sie verbinden sich zu sinnlosen Haufen aus Farbe und Form, so ununterscheidbar, dass du keine Chance mehr hast zu finden, was du suchst – wie den unbeantworteten Brief oder die unbezahlte Rechnung in einem Berg Reklame.
Zu diesem Phänomen leistete sich Tante Hermione einen erstaunlich terrestrischen Standpunkt und meinte, vielleicht komme Stoner in das Alter, wo es sich lohne, über eine Brille nachzudenken.
»Stoner.«
Sie schaute auf.
»Ist dir klar, dass du seit zehn Minuten dasitzt, ohne dich zu rühren?«
»Ehrlich?«
Marylou kam herüber und setzte sich auf den Rand von Stoners Schreibtisch. »Hör mal«, sagte sie. »Wenn dich dieser Umzug den Verstand kostet, blasen wir ihn ab.«
»Dafür ist es zu spät. Wir haben schon alle Termine fest–«
»Termine sind nicht in Granit gemeißelt. Und wenn wir sie nicht storniert bekommen, ziehen wir um, drehen uns einmal im Kreis und ziehen wieder zurück.«
Ja, dazu wäre sie imstande. Stoner verspürte einen gewaltigen Anfall von Zuneigung und Dankbarkeit. »Es ist nicht der Umzug. Nicht allein. Es ist … ich weiß es nicht.«
»Tja«, sagte Marylou entschieden. »Ich weiß es. Es ist der Wechsel.«
»Du meinst, die Wechseljahre?«
»Der Tapetenwechsel. Du hast Angst vor Veränderung. Schon immer.«
Stoner starrte auf ihren Schreibtisch hinab. »Vielleicht.«
»Nix vielleicht.« Sie fuhr Stoner durch die Haare. »Wenn du mal wen oder was findest, was sich für dich sicher anfühlt, dann klammerst du dich daran wie der Hund ans Kotelett.«
»Woher willst du das wissen?«, sagte Stoner gereizt. Sie wusste, Marylou hatte recht, und das machte sie verlegen und grantig. »Du hattest doch nie einen Hund.«
»Nein«, Marylou stellte sich hinter sie und massierte ihren Nacken. »Aber ich wette, innerhalb eines Monats nach dem Umzug werde ich mit einem zusammenwohnen.« Sie legte einen Finger unter Stoners Kinn und hob ihren Kopf, damit sie ihr in die Augen sehen konnte. »Oder etwa nicht?«
»Kann sein.« Ein Hund. Sie würden auf dem Land leben, und sie konnte einen Hund haben.
»Oder ist es etwas anderes?«, fragte Marylou.
»Ist was etwas anderes?«
»Das, was dir solche Sorgen macht.«
Stoner schüttelte den Kopf. »Mir geht’s gut.«
»Dir geht’s nicht gut«, verkündete Marylou.
Sie hatte recht. Es ging ihr nicht gut. Sie wollte diesen Umzug, das war das Problem. Wollte ihn so sehr, dass sie ihn den anderen förmlich aufgedrängt hatte. Wollte ihn so sehr, dass sie die anderen vielleicht manipuliert …
»Die Verantwortung«, erriet Marylou. »Du fühlst dich für uns alle verantwortlich. Du denkst, wir wollen im Grunde gar nicht umziehen und tun es nur dir zuliebe, und du wirst es lebenslänglich auf dem Kerbholz haben, wenn wir kreuzunglücklich werden.«
»Du weißt zu viel«, knurrte Stoner und blickte wütend zu Boden. »Ich wette, du hast in den Fallakten deiner Mutter spioniert.«
»Leider nicht. Die hält sie im Kofferraum ihres Autos unter Verschluss. Ich kenne dich, liebste Freundin. So einfach ist das. Und du kennst mich. Kannst dich genauso gut an diesen Gedanken gewöhnen. Ehrlich gesagt gefällt mir das.«
»Na ja«, sagte Stoner widerwillig. »Mir wohl auch.«
»Dann lass die Sorgen los, Stoner. Geh und löse das Rätsel des friedlosen Frauentheaters. Wenn du zurückkommst, ist das Schlimmste überstanden.«
Stoner täuschte ein misstrauisches Stirnrunzeln vor. »Berühmte letzte Worte«, sagte sie.
Kapitel 2
Die Eingangshalle des Cottage hatte den Konflikt zwischen formeller Empfangsatmosphäre und zwanglosem Treffpunkt-Charakter zugunsten des Formellen gelöst. Statt eines Hoteltresens gab es einen antiken Schreibtisch mit aufgeschlagenem Gästebuch (in Leder gebunden), Löschwiege, Federkiel und Tischklingel. Es war niemand zu sehen.
Marylou zupfte Finger für Finger ihrer ellbogenlangen weißen Handschuhe ab und blickte sich sichtlich anerkennend um. Normalerweise hasste sie reisen – ›sich transportieren lassen‹ nannte sie es –, aber ihre Neugier hatte gesiegt. Wo sie sich nun schon darauf eingelassen hatte, hatte sie sich dem Anlass gemäß in Schale geworfen, wie sie von Boston bis Bangor alle fünf Meilen betonte. Ein altmodischer Staubmantel, dazu ein breitkrempiger Hut mit wehendem Schleier und eine Sonnenbrille. Gwen schwor, ihr Gebrauchthonda habe dadurch einen völlig neuen Existenzsinn erlangt.
Stoner betrat die Eingangshalle krumm unter der Last ihrer Koffer und rief sich in Erinnerung, dass auch sie für die Fahrt passend gekleidet war. Besonders im Fall einer Reifenpanne. Sie hatte den Löwenanteil des Vormittags mit Waschen und Bügeln ihres liebsten Standard-Siebzigerjahre-Feministinnen-Arbeitshemdes verbracht und ihre Standard-Feministinnen-Wanderstiefel poliert. Ihre Jeans waren neu, aber nicht steif. »Ich mache damit ein Statement«, hatte sie Gwen erklärt. »Ich lehne es ab, mich von Möbeln einschüchtern zu lassen.« Das Problem war, sie hatte den Verdacht, dass sie genau wie eine Person aussah, die eingeschüchtert ist und sich nichts anmerken lassen will.
Tatsächlich war Gwen die Einzige von ihnen, die einen wirklich angemessenen Eindruck machte. In leichten Baumwollhosen, hauchdünnem Hemd und Turnschuhen war sie für den Sommer gewappnet. Den heißen Sommer ohne Klimaanlage.
Das Cottage war heiß. Und hatte keine Klimaanlage.
Marylou nahm schwungvoll den Hut ab, drehte eine Besichtigungsrunde und erklärte das Cottage für einfach vollkommen.
»Schön, dass es dir gefällt«, sagte Stoner. »Du kannst gern meinen Platz einnehmen.«
»Unfug«, sagte Marylou. »Sie wollen dich. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, mit Fremden unter einem Dach zu schlafen.«
»In Disney World hast du das doch auch getan«, führte Gwen ins Feld.
»So ist es. Und wenn ihr euch recht erinnert, war es eine hochgradig unerfreuliche Erfahrung.«
»Ich dachte, du fandest es lustig, entführt zu werden.«
»Es gab bange Momente«, sagte Marylou. »Dies ist nicht das Jahr für bange Momente.«
Stoner stellte rumpelnd ihre Koffer ab. »Ich seh mal nach, ob ich jemanden finde.«
»An Orten wie diesen«, verkündete Marylou, »huscht man nicht auf der Suche nach Bediensteten durch die Gänge.«
»Sie hat F. Scott Fitzgerald gelesen«, sagte Stoner erklärend zu Gwen.
»Wenn das so ist, müssen wir natürlich das Passende tun, nicht wahr?«, entgegnete Gwen. Sie schlug mit der offenen Hand auf die Tischklingel.
Stoner wand sich.
In einiger Entfernung schlug eine Tür. Eine fröhliche Stimme zwitscherte: »Komme!« Schritte trappelten einen Gang entlang.
Stoner stählte sich. Also schön, sie war hier, um etwas zu erledigen, einer Gruppe Lesben – oder zumindest Frauen – aus der Patsche zu helfen. Ungeachtet der Einrichtung und wie gut die ihrer Mutter gefallen würde, musste sie ihre Unsicherheit überwinden und die Sache deichseln.
»Sherry hier!«
Die Frau war klein und dünn mit runden Bäckchen und runden Augen. Ihr lockiges rotblondes Haar umgab ihr Gesicht wie eine Aura. Eine ziemlich gesunde Aura, dachte Stoner. Viel Farbe, viel Tiefe. Allerdings ziemlich rotstichig, und Tante Hermione empfahl immer Vorsicht beim Deuten einer roten Aura. »Manchmal ein Zeichen von Lebenskraft und Leidenschaft, aber oft auch ein Hinweis auf Wut«, sagte sie gerne. »Man muss den Einzelfall betrachten. In der unsichtbaren Welt wie in der sichtbaren. Oder umgekehrt?«
Sherry trug einen langen, fließenden Brokatrock – Rosen auf schwarzem Untergrund – und eine weiße Seidenbluse mit langen Ärmeln und Perlenknöpfen. Sie hatte einen rosa Schal um den Hals und Glanzlederschuhe an den Füßen. Erstaunlicherweise schwitzte sie nicht. Wie ein Gemälde, das Porträt einer Lady aus dem 19. Jahrhundert. Sehr heimisch im Cottage. Alles, was ihr fehlte, war ein lässig in ihrer Armbeuge ruhendes Rosenbukett.
»Entschuldigen Sie, dass ich Sie nicht gleich willkommen geheißen habe«, sagte Sherry. »Eine kleine Katastrophe in der Küche.«
Marylou nickte selbstgefällig und warf Stoner einen Blick zu, der besagte: »Wusste ich doch, dass nur ein Notfall die Eigentümerin eines solchen Gasthauses davon abhalten konnte, uns persönlich zu empfangen.«
»Die Molkerei hat gesalzene Butter geliefert. Können Sie sich das vorstellen? Ich habe denen schon tausend Mal gesagt: ›Wir benutzen keine gesalzene Butter im Cottage.‹ Das ist so profan. Darf ich Ihnen ein Glas Wein anbieten?«
»Aber gern!« Marylou brüllte fast vor Begeisterung. Offensichtlich war Sherry Dodder ganz ihr Fall.
»Burgunder oder Chablis?«
»Chablis, bitte«, sagte Marylou. »Es ist viel zu heiß für Burgunder.«
»Eine Frau nach meinem Herzen.« Sherry zog einen uralten Schlüssel aus ihrer Rocktasche und machte sich daran, eine kleine Tür mit Porzellanknauf unter der Treppe aufzuschließen. Fragend sah sie zu Stoner und Gwen.
»Danke nein«, sagte Gwen.
Stoner schüttelte den Kopf. Sie würde sich hier völlig fehl am Platz fühlen. Das Cottage war grässlich und garantiert bis unters Dach voller grässlicher Leute. Diese ominöse Frauentheatergruppe – die lasen bestimmt in ihrer Freizeit Molière oder diskutierten über Kunst und ob Shakespeares siebenundvierzigstes Sonett einem damals gängigen Reimschema folgte oder seiner Zeit weit voraus war, so was in der Art jedenfalls.
Die kleine schwere Tür schwang geräuschlos auf und offenbarte einen winzigen Schrank. Er war gut bestückt mit Gläsern, Likörflaschen und vornehmen Knabbereien wie in Honig gerösteten Mandeln. »Ich hätte da ein feines Tröpfchen«, sagte Sherry gerade. »Aber ohne Boursin entfaltet er nicht sein volles Potenzial, nicht wahr?«
»Aber ganz gewiss nicht«, sagte Marylou. Ihre Augen glitzerten. Sie drehte sich zu Stoner um. »So etwas brauchen wir in unserem neuen Büro.« Sie zeigte auf einen kleinen Kühlschrank unter den Postfächern. »Sieh dir das an, Stoner.«
Sherry fuhr herum. »Stoner McTavish?« Sie streckte ihre Hand aus. »Entschuldigen Sie. Ich hätte Sie gleich erkennen sollen.«
Stoner fragte sich, woran sie auf den ersten Blick erkennbar sein sollte. Ihre Kleidung? Ausstrahlung? Hatte sie eine deutlich problemlösende Art an sich? Sie merkte, dass Gwen sie anstupste, und ergriff Sherrys Hand. »Freut mich, Sie kennenzulernen«, sagte sie.
Sie hatte nicht erwartet, dass der Händedruck dieser Frau so fest und sicher sein würde. Sie kam ihr mehr wie der ›Grabschen-und-sofort-wieder-loslassen‹-Typ vor. Oder der ›Immer-ein-wenig-Luft-dazwischen-lassen‹-Typ. Oder sogar der Schlaffes-Händchen-Typ. Aber Sherry Dodders Händedruck war – also, ehrlich gesagt, butch. Geradezu kerlig. »Und dies ist Gwen Owens«, sagte sie rasch, aus Höflichkeit und um ihre Verwirrung zu verbergen. »Und meine Geschäftspartnerin Marylou Kesselbaum.«
Marylou zog eine Visitenkarte aus ihrem Handtäschchen. »Kesselbaum und McTavish, Reiseagentur. Reisen oder Zuhausebleiben – mit uns fast dasselbe Vergnügen.«
Die Frau nahm die Karte und lachte. »Das ist wundervoll. Sie müssen also die Seniorpartnerin sein.«
Stoner schaute Marylou an. »Musst du das?«
»Die Reihenfolge der Namen«, erklärte Marylou geduldig. »Eigentlich sind wir gleichberechtigte Partnerinnen. Wir haben diese Reihenfolge gewählt, weil es so rhythmischer klingt.«
»Verstehe«, sagte Sherry. Sie schaute wieder Stoner an. »Stoner. Ein ungewöhnlicher Name.«
»Ich bin nach Lucy B. Stone benannt«, sagte Stoner.
»Oh, da beneide ich Sie. Ich fürchte, ich wurde nach einem alkoholischen Getränk benannt.« Sie wandte sich an Gwen. »Gwen Owens, richtig?«
»Ja«, sagte Gwen. Stoner glaubte ein wenig Spannung in der Luft zu spüren.
»Das ist ein englischer Name?«
»Walisisch.« Ja, ganz eindeutig Spannung, und mehr als nur ein wenig. Gwen war verärgert und ihr Ärger nahm zu.
»Entschuldigen Sie bitte vielmals«, sagte Sherry und schien das auch zu meinen. »Das war wirklich tollpatschig von mir. Abscheuliche Sache, diese ganze England-Wales-Angelegenheit. Erinnert mich daran, beim Abendessen nicht auf die Queen zu trinken.« Sie lachte herzhaft. »Nur ein Scherz.«
Gwen schenkte ihr ein schmallippiges, unaufrichtiges Lächeln.
Sherry bemerkte es nicht. Sie goss ein wenig Wein in ein dünnstieliges Glas und reichte es Marylou.
Marylou kostete und seufzte erfreut. »Perfekt. Genau die richtige Temperatur.« Sie setzte sich auf den Rand eines rosshaargepolsterten Stuhls mit gerader Rückenlehne. »Zum Wohl.«
»Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was für eine Erleichterung es ist, dass Sie gekommen sind«, sagte Sherry. »Die Sorgen rauben mir schier den Verstand.«
»Wie leid mir das tut«, sagte Gwen, in ihrer Stimme klirrten Eiszapfen.
Stoner drückte warnend ihre Hand. »Gab es schon wieder neue Vorfälle?«, fragte sie.
»Nichts richtig Greifbares. Natürlich auch die üblichen Theaterkrisen. Gestern war es eine Bank, die am Tag zuvor neu gestrichen worden war. Dachten wir jedenfalls. Doch als unsere Hauptdarstellerin sich daraufsetzte, war die Farbe frisch. Ihre Kleidung war ruiniert. Niemand bekannte sich dazu.« Sie zuckte mit den Schultern. »Kleine Dinge dieser Art. Nichts Gefährliches, aber lästig und zeitraubend. Wir hinken dem Zeitplan bereits drei Tage hinterher.«
»Wie lange sind Sie denn schon dabei?«
»Dies ist mein erstes Jahr als Produzentin«, sagte Sherry. »Das kommt, weil wir uns abwechseln, damit jede Frau Gelegenheit bekommt, zu lernen und zu teilen.«
»Und letztes Jahr taten Sie was?«
Sherry sah zu Boden, als scheue sie sich, es auszusprechen. »Na ja, ich prahle nicht gern, aber ich war die Hauptdarstellerin.«
»Vermissen Sie das Rampenlicht nicht?«, fragte Gwen.
»Gute Güte, nein!«, rief Sherry mit einem kleinen Lachen. »Es ist eine schrecklich große Verantwortung, die man da trägt.«
»Das Produzieren aber auch«, bemerkte Stoner.
»Aber man macht die Fehler nicht vor den Augen des Publikums. Außerdem ist es nicht so anders, als das Cottage zu leiten. Organisieren, den Kleinkram und die Leute handhaben. Das fällt mir von Natur aus leichter.«
»Ja«, sagte Gwen. »Das ist kaum zu übersehen.«
Was war hier los? »Alles in Ordnung mit dir?«, murmelte Stoner.
Gwen wirkte erschrocken. »Sicher.«
»Wahrscheinlich müde von der Fahrt«, sagte Marylou, die die Ohren gespitzt hatte. »Die war endlos.« Sie hielt ihr Glas hoch. »Könnte ich wohl noch ein winziges Schlückchen bekommen?«, fragte sie. »Um mich für die Rückfahrt zu stärken.«
Sherry füllte eifrig ihr Glas nach.
»Marylou reist nicht gerne«, erklärte Stoner. »Es kostet sie große Überwindung.«
»Würden Sie gern hier übernachten?«, fragte Sherry mit besorgt zusammengezogenen Augenbrauen. »Wir haben Zimmer im Überfluss.«
»Nein danke«, sagte Marylou. »Meine Mutter holt mich ab. Sie hält drüben in Bangor einen Workshop.«
»Dr. Kesselbaum ist Psychiaterin«, sagte Stoner.
»Ach so«, sagte Sherry. »Da sollte ich wohl aufpassen, was ich sage, wenn sie da ist.«
»Erzählen Sie ihr bloß keine Träume«, warnte Marylou. »Zwei Fragmente eines Traumes, und sie kennt die ganze Lebensgeschichte.«
»Natürlich kennt sie deine Lebensgeschichte«, sagte Gwen. »Sie ist deine Mutter.«
»Das zeigt, wie genau sie zu treffen versteht«, sagte Marylou augenrollend.
»Gibt es außer den Theaterfrauen noch andere Gäste?«, fragte Stoner. »Falls nicht, werden wir wohl auffallen …«
»Keine Sorge«, sagte Sherry munter. »Auf der zweiten Etage haben wir ein junges Paar. Sie haben gerade eine Bindungszeremonie hinter sich, deshalb bezweifle ich, dass wir sie oft zu Gesicht bekommen werden. Außerdem eine fünfköpfige Gruppe von den Wanderlesben.«
»Wanderlesben?«
»Mit Rucksack und Mountainbike unterwegs. Eine Art ›Entdeckt-eure-Natur‹-Club. Was in diesem Kontext womöglich ein wenig doppeldeutig ist.«
Darüber musste sogar Gwen lachen.
»Wenn sie zum Wandern hier sind, werden wir von ihnen wohl auch nicht allzu viel sehen«, sagte Stoner.
»Die werden Sie sehen«, sagte Sherry. »Die kommen nämlich jedes Jahr hierher, um die Termine für das nächste Jahr zu planen. Als eine Art Auszeit-Hafen.« Sie wandte sich dem Gästebuch zu. »Ich bringe Sie in Zimmer 114 auf der ersten Etage unter. Die meisten Theaterfrauen wohnen im selben Stockwerk, so können Sie sie unauffällig beobachten. Wir haben zwar einige Zimmer im Parterre, aber die sind für unsere älteren und behinderten Gäste reserviert.« Sie lächelte entschuldigend. »Ich fürchte, wir sind politisch nicht ganz korrekt – keine Aufzüge. Aber ich plane für das nächste Jahr eine Totalrenovierung, um das Cottage auf den allerneuesten Stand zu bringen. Ich hoffe nur, dass das keine schlafenden Geister weckt.«
»Geister?«, fragte Stoner. »Hier spukt es?«
»Soweit ich weiß, nicht. Jedenfalls nicht so, dass man damit Werbung machen könnte. Aber diese alten Gemäuer …«
»Stoner mag Gespenster«, sagte Marylou. »Ihre Tante ist ein Medium.«
»Sie ist kein Medium, Marylou, sie ist Hellseherin. Und ich mag Gespenster nicht, ich fühle mich in ihrer Gegenwart unwohl. Und ich wünschte wirklich, du würdest sie Geister nennen und nicht Gespenster. Das ist einfach nicht … nicht …«
»Politisch korrekt?«, schlug Marylou vor.
»Würdevoll. Respektvoll.«
»Tja, jedenfalls gibt es hier, glaube ich, keine«, sagte Sherry.
Stoner zögerte. Sie schnitt furchtbar ungern ein so unfeines Thema wie Geld an, aber da drückte ihr noch etwas schwer auf die Seele. »Hören Sie«, sagte sie. »Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie uns Kost und Logis umsonst anbieten, aber … schneidet das nicht gewaltig in Ihr Budget, ein Zimmer so wegzugeben, ganz zu schweigen von den Mahlzeiten …«
Sherry lachte. »No problemo, meine Lieben. Wie Sie bald bemerkt hätten, ist das Cottage nicht voll belegt, also können Sie schwerlich zahlende Gäste verdrängen. Den Löwenanteil meiner Einnahmen mache ich im Winter. Wir haben einige Abfahrtski-Pisten ganz in der Nähe und Loipen direkt vor der Tür. Ich öffne mein Gasthaus dann für Familien.« Sie zwinkerte ihnen verschwörerisch zu. »Man könnte sagen, ich sorge dafür, dass die Heteros die Frauenszene subventionieren. Eine hübsche Ironie, nicht?«
»Entzückend«, murmelte Gwen.
»Und das Theater zahlt mir eine kleine Summe – nicht genug, um die Auslagen wieder reinzubekommen, eigentlich mehr ein Honorar. Ich schätze, das bedeutet, dass das Patriarchat alternative Kunst subventioniert. Jesse Helms wäre außer sich.«
Stoner musste lachen. »Erzählen Sie von der Theatergruppe«, sagte sie.
»Sie heißt Demeter im Aufstieg, ein Frauentheater für Bestätigung und Handlungsfreude.«
»Eingängiger Titel«, sagte Marylou.
»Das ist der Name der Gruppe. Das Stück ist Bislang ohne Titel.«
»Hm«, sagte Marylou. »Ich kenne mich mit Theater nicht so aus, aber ich weiß, dass man zeitig mit der Öffentlichkeitsarbeit anfangen muss. Und ihr seid schon bei den Proben. Solltet ihr euch nicht langsam um einen Titel kümmern?«
»Das ist der Titel: Bislang ohne Titel. Ein originelles, intelligentes, satirisches, feministisches Musical in der Tradition von Noel Coward.«
»Verstehe«, sagte Stoner. Noel Coward? Sie suchten sich Inspiration bei einem Mann? Einem talentierten und sehr witzigen und dem Ruf nach schwulen Mann, nicht gerade Norman Mailer – aber trotzdem …
»Es wird im Kollektiv geschrieben«, sagte Sherry. »Wir arbeiten schon seit letztem Jahr daran.«
Stoner nickte mitfühlend. »Ich weiß, wie zermürbend so etwas sein kann.« Therapiegruppen, Selbsthilfeprojekte, sogar Zwölf-Stufen-Entzugsprogramme waren an weniger gescheitert.
»Aber so erfrischend«, sagte Sherry. »Die Hälfte der Zeit lachen wir uns tot. Wer sagt, Feminismus sei humorlos?«
»Ich nicht«, warf Marylou ein. »So etwas habe ich nie gesagt. Stoner, hast du mich je so etwas sagen hören?«
»Nur als du die Wahl in den Vorstand der regionalen Frauengruppe verloren hast.«
Irgendwo im hinteren Teil des Gasthauses schlug eine Tür.
»Ups«, sagte Sherry, schaute sich um und senkte die Stimme. »Wir bekommen Gesellschaft.« Sie reichte Stoner den Füllfederhalter und wies auf das Gästebuch. »Tragen Sie sich bitte ein, Stoner und Gwen, dann zeige ich Ihnen Ihr Zimmer«, sagte sie laut. »Wir haben zurzeit auch eine Frauentheatergruppe hier. Wenn Sie möchten, frage ich, ob Sie bei einer Probe zuschauen dürfen.«
»Das wäre nett.« Stoner gab ihr den Stift zurück und raunte tonlos: »Gut gedacht.«
»Ich glaube nicht, dass Sie jemand stören wird«, fuhr Sherry fort, während Gwen sich eintrug. »Ab und an wird die Stimmung abends etwas ausgelassen. Theaterspielen ist so eine anstrengende, disziplinierte Arbeit, dass wir ein wenig Dampf ablassen müssen …«
»Endorphine«, sagte Marylou erklärend.
»Aber wir feiern grundsätzlich in der Scheune.«
»Sehr weise«, sagte Marylou beifällig.
Sherry wandte sich ihr zu. »Sie sind übrigens herzlich zum Essen eingeladen, wenn Sie wollen.«
»Vielen Dank, aber das hängt davon ab, wann meine Mutter eintrifft.«
»Wenn es Umstände macht«, sagte Stoner eifrig und beobachtete, wie Marylous Hand auf die Speisekarte zukroch, die unter dem Gästebuch auf dem kleinen Schreibtisch lag, »kann Marylou gern meinen Platz haben. Ich bin überhaupt nicht hungrig. Bin ich sowieso selten. So bin ich nun mal.«
»Bist du nicht«, sagte Marylou. Ihre Finger berührten die Speisekarte. »Du hast bloß Angst, dass da Sachen draufstehen, die du nicht aussprechen kannst. Du hasst Essen, das du nicht aussprechen kannst.«
»Nun«, sagte Sherry lächelnd, »ich bin sicher, dass Sie das Essen hier ausgesprochen mögen werden.« Gwen gab ihr den Füller zurück. »Das wäre alles. Sie haben Zimmer 114. Folgen Sie mir.«
Als Sherry sich abwandte, um voranzugehen, schnappte Marylou sich die Speisekarte und ließ sie unter ihrem weiten Staubmantel verschwinden.
* * *
»Also«, sagte Marylou, während sie auf einem der beiden Einzelbetten mit den beigen Bettpfosten lag und die stibitzte Speisekarte überflog. »Was meint ihr?«
»Scheint ganz nett zu sein«, sagte Stoner. Sie schaute sich im Zimmer um und versuchte, ein Gefühl dafür zu bekommen. Der Holzfußboden war gebohnert, seine Härte gemildert von einem großen geknüpften Teppich. Der war ziemlich alt, Stroh oder Pferdehaare oder was auch immer staken heraus. Einzelbetten mit weißen Chenille-Überdecken … eigentlich mochte sie Einzelbetten nicht. Sie hatten die Kunst des Liebemachens darin gemeistert, ohne herauszufallen. Aber in Einzelbetten zu kuscheln war unbequem und schwierig.
»Ich meinte eigentlich eure Gastgeberin.«
Stoner zuckte die Achseln und hielt zwei Paar Socken ins Licht. Inspiriert von Gwen, der Göttin des makellosen Kofferpackens, hatte sie geschworen, ordentlicher zu sein, und so räumte sie ihre Socken nach Farben sortiert in die Kommode. Es war nicht leicht, da die meisten schwarz oder marineblau waren. »Ich nehme an, sie ist ganz okay. Schwer zu sagen nach einer Viertelstunde.«
»Nicht für Gwen«, sagte Marylou. »Sie hat nur zehn Sekunden gebraucht, um sich ihre Meinung zu bilden.«
»Ich mag sie nicht«, murmelte Gwen. Sie feuerte eine Handvoll Unterwäsche in eine Schublade und ging mit einem Bügel auf ein Hemd los.
»Das war deutlich«, sagte Marylou.
»Diese Getue mit dem Wein, Lucy B. Stone, der walisisch-englische Kram. Die Frau buhlt förmlich um Gunst.«
»Natürlich tut sie das. Sie ist Geschäftsfrau. Als Geschäftsfrau musst du buhlen. Schließlich leben wir in den Neunzigern.«
»Ich wette, Stoner tut das nicht.«
»Stoner bringt das nicht fertig. Deshalb muss sie auch verschwundenes Gepäck aufspüren und Kreuzfahrtbuchungen bestätigen lassen. Dafür braucht man niemandes Gunst.«
»Und ob man die braucht«, Stoner wollte sich keinen Mangel unterstellen lassen. »Ich bin bloß so gut im Buhlen, dass du es nicht mal mitkriegst.«
Gwen stopfte das Hemd samt Bügel in den Schrank und misshandelte das nächste. »Also ich hasse so was. Es ist so … so …«
»Amerikanisch?«, schlug Marylou vor.
»Schäbig.«
»Mag sein. Aber doch nicht gleich in der Kategorie Drogenhandel. Warum regt es dich so auf?«
»Es ist unehrlich«, sagte Gwen. Sie visierte ein weiteres Hemd an. »Manipulativ.«
»Manipulation«, sagte Marylou, »ist ebenfalls amerikanisch.«
»Dir macht das nichts aus, weil du diejenige warst, um deren Gunst es ging«, bellte Gwen sie an.
»Tatsächlich ist sie uns allen gleichermaßen um den Bart gegangen«, entgegnete Marylou ruhig.
Gwen schaufelte den Rest ihrer Unterwäsche in eine Schublade, griff dann ihren leeren Koffer und marschierte zum Wandschrank. »Ich mag sie nicht, und ich muss sie auch nicht mögen, wenn ich sie nicht mag.«
»Natürlich musst du das nicht«, sagte Stoner. Sie schaute sich suchend nach einem Platz für ihre Bücher, ihren Notizblock, ihre Kamera, Stifte und all die anderen Dinge um, die sie daheim in der zivilisierten Welt nie benutzte, aber schrecklich vermissen würde, da war sie sicher. Der einzige Tisch wurde fast vollständig von einem großen antiken Krug samt Schüssel eingenommen. »Ich erledige nur einen Job für sie, ich will sie nicht mit nach Hause nehmen.«
»Dem Himmel sei Dank für die kleinen Gnaden.«
»Wenn ich mal etwas bemerken darf«, ging Marylou dazwischen. »Ich finde, dass du eine winzige Spur überreagierst.«
Aus dem begehbaren Wandschrank kam keine Reaktion.
Stoner sah sich in einer ungewohnten Zwickmühle, denn sie teilte Marylous Ansicht. Gwen reagierte über, und zwar sehr ungwenmäßig. Normalerweise war es Gwen, die Leuten auf Anhieb traute und sie mochte, ob es angebracht war oder nicht. Tatsächlich bedurfte es erheblichen Aufwands, Gwens Abneigung oder Misstrauen auf sich zu ziehen. Dieser Umstand hatte sie mehr als einmal in ernste Schwierigkeiten gebracht.
»Gwen?« Stoner ließ eine Ladung persönlicher Gegenstände auf das Bett fallen, das Marylou nicht mit Beschlag belegte. Sie ging zur Wandschranktür. »Ist irgendwas?«
»Aber nein. Alles in bester Ordnung«, antwortete Gwen in einem Ton, der besagte, dass eindeutig nichts in Ordnung war.
»Komm schon, was ist los?«
»Es ist einfach zu lustig«, sagte Gwen, »wenn man als Einzige etwas sieht, was alle anderen nicht mitkriegen.«
»Das kenne ich«, sagte Stoner, die selbst schon öfter in die Lage gekommen war. »Hör mal, kann ja sein, dass du recht hast. Vielleicht stimmt mit Sherry irgendwas ganz und gar nicht. Wäre doch trotzdem kein Drama.«
»Wenn es kein Drama ist, warum reitet Marylou dann darauf herum?«
»Ihr reitet beide darauf herum.«
»Ich reite mehr darauf herum als Gwen«, sagte Marylou, schnappte sich Stoners Kugelschreiber und machte am Rand der Speisekarte einen Vermerk. »Ich weiß auch nicht, wieso eigentlich.«
»Dann hört jetzt bitte beide auf«, sagte Stoner. »Mir ist es hier auch so schon unbehaglich genug. In solchen Situationen zähle ich auf euch zwei, um mich bei Verstand zu halten. Wenn es euch also nichts ausmacht …«
Gwen linste aus dem Wandschrank heraus. Marylou sah sie an. Dann schauten beide Stoner an.
»Es tut mir leid«, sagte Gwen und berührte ihren Arm. »Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist.«
»Ich auch nicht«, sagte Marylou. »Vielleicht spukt es hier. Böse Geister, die auf der Lauer liegen, fiese Schwingungen absondern, einen Keil zwischen Freundinnen treiben – der ganze Spuk eben.«
Stoner versuchte, verborgene Schwingungen im Raum zu erspüren. Sie konnte nichts feststellen. »Ich fühle nichts.« Nicht, dass das irgendetwas bedeutete. Sie hatte kein Talent für das Erspüren unsichtbarer Energien – abgesehen von denen, die schlechtgelaunte Leute ausstrahlten. Die erspürte sie mit unfehlbarer Sicherheit. Aber Tante Hermione versicherte ihr, dass sie solche Fähigkeiten erlernen konnte, wenn sie ordentlich übte und fest dran glaubte. »Nichts«, sagte sie und versuchte, fest zu glauben.