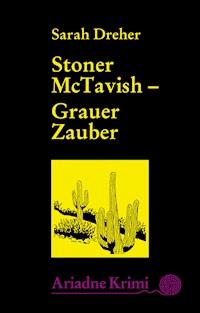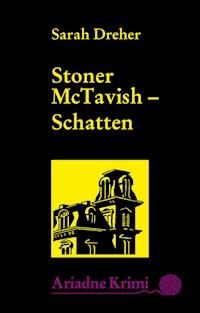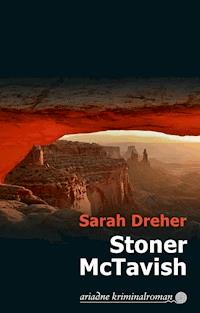Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Argument Verlag mit Ariadne
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Stoner McTavish fährt in ihrem Auto eine Landstraße entlang, die sich in nichts von einer beliebigen Straße Ende des 20. Jahrhunderts unterscheidet. Doch dann geschieht etwas Merkwürdiges – und plötzlich steckt Stoner mitten in einem prä-urbanen Wildwest-Drama: Eine Postkutsche donnert übers Land, erreicht eine Siedlung. Das modernste Gerät weit und breit ist ein Trommelrevolver. Einiges allerdings erscheint vage vertraut: Ein schurkiger Demagoge von Priester prangert Leute an, die auch in Stoners gewohnter Wirklichkeit nur zu gern stigmatisiert werden; und natürlich sind es die Frauen, die die Probleme des täglichen Lebens lösen müssen. Aber das Verwirrendste von allem ist subtiler, als der erste Blick enthüllt: Manche der Siedlerinnen, in deren Schicksal Stoner sogleich unerbittlich verstrickt wird, tragen unverkennbar Charakterzüge von Menschen, die Stoner äußerst vertraut sind! Besonders irritierend ist, dass ein halbwüchsiger Junge sie fatal an ihre Liebste Gwen erinnert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 502
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sarah Dreher
Gefangene der Zeit
Stoner McTavish 4
Ariadne
Titel der US-Originalausgabe: A Captive in Time
Copyright © 1990 by Sarah Dreher
Aus dem Amerikanischen von Doris Janhsen
Die deutsche Erstausgabe erschien beim Orlanda Frauenverlag unter dem Titel Stoner goes West
Neu überarbeitet von Hiltrud Bontrup
Argument Verlag 2000/2022
Glashüttenstraße 28, 20357 Hamburg
Telefon 040/4018000 – Fax 040/40180020
www.argument.de
Umschlaggrafik & Signet: Martin Grundmann
ISBN 978-3-86754-798-7 (E-Book)
Inhalt
Kapitel 1
Im Halbschlaf ließ Stoner ihre Hand auf den Alarmknopf fallen und brachte den Wecker zum Schweigen. Ihr Körper fühlte sich an wie ein Wasserbett, jede Zelle war fest und geschmeidig und kribbelte ein bisschen. Ein vertrautes Gefühl, die Nachwirkungen einer Liebesnacht. Sie schlug die Augen auf.
Gwen lag neben ihr, das Haar ein Durcheinander auf dem Kopfkissen. »Was ist?«, murmelte sie im Schlaf.
»Schlaf ruhig weiter«, sagte Stoner leise.
»Amerikanische Geschichte«, murmelte Gwen.
Stoner lächelte. »Heute ist Samstag. Du musst nicht unterrichten.«
»Touristen.«
»Genau.« Sie berührte Gwens Gesicht und schob ihr Haar mit einem Finger sanft zur Seite. »Kesselbaum & McTavish, den Bürgerinnen und Bürgern von Boston seit 1981 in Reiseangelegenheiten zu Diensten, haben heute geöffnet. Ich muss los.«
»Yuppies«, knurrte Gwen.
»Hm-hm. Samstag ist Yuppie-Tag.«
Gwen drehte sich auf den Rücken und rieb sich die Augen. »Was würdest du tun«, fragte sie schläfrig, »wenn ich aufhören würde zu unterrichten?«
»Rund um die Uhr mit dir schlafen.«
»Geht nicht.«
»Wieso nicht?«
»Für den Kaffee müssten wir ’ne Pause einlegen.«
Stoner grinste. »Hab schon verstanden.« Sie schob die Bettdecke zurück und setzte sich auf. Der kalte Boden unter ihren Füßen machte sie schlagartig wach. »Darf es eine bestimmte Sorte sein?«
»Jamaica Blue Mountain.«
»Wow!«, sagte Stoner. »Du scheinst heute Nerven wie Drahtseile zu brauchen.«
»Ich muss Halbjahresnoten vergeben. Ich glaube, ich hasse Teenager.« Gwen stützte sich auf einem Ellbogen auf und versuchte, Ordnung in ihr Haar zu bringen. »Warum sieht mein Haar immer so aus, als hätten Eichhörnchen drin genistet?«
Stoner fuhr mit den Füßen in ihre Hausschuhe. »Das tut es nicht.«
»Doch, jeden Morgen.«
»Mir gefällt’s.«
»Du hast keinen Geschmack.«
»Was du nicht sagst.« Sie beugte sich hinunter und küsste Gwen sanft auf die Stirn. »Ich bringe dir den Kaffee, bevor ich gehe.«
»Du verwöhnst mich.« Mit einem leichten Flattern fielen ihr die Augen wieder zu. Ihre Gesichtszüge wurden weicher vor Schläfrigkeit. »Ich liebe dich, Stoner McTavish.«
»Und ich liebe dich.«
Stoner betrachtete sie einen Moment lang. Dann zwang sie sich, dem Tag in die Augen zu sehen.
Samstag. Der Rest der Welt würde wieder das Wochenende genießen, während sie und Marylou, das Dynamische Duo McTavish & Kesselbaum, Seite an Seite mit verpatzten Reservierungen, verloren gegangenem Gepäck und Kreuzfahrten kämpften.
Sie hasste es, Kreuzfahrten zu buchen. Hätte sie die Wahl, würde sie alle Charter, Europatouren, FITs und DITs und selbst die Frühjahrsfahrten nach Disney World auf sich nehmen, wenn ihr nur die Kreuzfahrten erspart blieben. Aber schließlich waren es die Kreuzfahrten, die die Welt des Tourismus in Schwung hielten, und Marylou konnte sie nicht alle alleine machen.
Schon gar nicht in diesem Jahr.
In diesem Jahr mussten sie dank Hurrikan Hugo alle Buchungen zweimal machen.
Es liegt daran, dass sie ihn nach einem Mann benannt haben, dachte sie, als sie unter die Dusche schlüpfte und sich von den eiskalten, prasselnden Wasserstrahlen restlos wecken ließ. Die Natur hatte ihnen das übelgenommen und ihre Wut auf die Weise ausgedrückt, die sie am besten beherrschte – indem sie die Dächer von allen Häusern riss, die ihr in die Quere kamen.
Alle Kreuzfahrten in die Karibik, die sie im Mai und Juni eifrig gebucht hatten, waren jetzt reine Glückssache. Damit nicht genug: Anfragen bei beliebten Urlaubzielen auf den Inseln erbrachten Auskünfte, die bestenfalls suspekt zu nennen waren. Niemand war bereit zuzugeben, dass die Urlaubssaison für dieses Jahr gelaufen war. Das war nachvollziehbar, aber frustrierend. Denn wenn Mr. und Mrs. US-Tourist an ihrem Urlaubsziel eintrafen und herausfanden, dass ihr Hotel ein einziger Trümmerhaufen ohne Dach war, wen würden sie dafür geradestehen lassen?
Dreimal darfst du raten! Kesselbaum & McTavish, wen sonst?
Dazu kamen die Stornierungen und Umbuchungen. Eine ungeheure Fehlerquelle, denn sie standen unter enormem Zeitdruck. Einmal im Jahr war das zu ertragen, aber zweimal? Und das Chaos hatte natürlich auch Folgen. Man kann ruhig mal Arbeitspläne, Konten und gelegentlich selbst medizinische Diagnosen verwechseln. Aber der Himmel stehe dir bei, wenn du Urlaubsziele durcheinanderbringst. Urlauberinnen und Urlauber, die auf der Royal Viking nach Rio fahren wollen, erwarten, auf der Royal Viking nach Rio zu fahren. Sie wollen sich nicht auf der Cunard Princess mit Kurs auf Mexiko wiederfinden. Und wenn unzufriedene Urlauberinnen und Urlauber nach Hause kommen, gehen sie zuerst zu …
Exakt.
Marylou schien spielend damit fertigzuwerden. Sie plapperte am Telefon munter drauflos, jonglierte mit Tickets wie mit Orangen, glättete die Wogen und ließ ganz nebenbei die Bemerkung fallen – nur unter uns, versteht sich –, dass gerade dieser bislang unerschlossene Winkel im mexikanischen Dschungel in spätestens einem Jahr der Urlaubshit der westlichen Hemisphäre sein würde, und wer würde sich nicht die Finger danach lecken, ihn als Erste entdeckt zu haben? Gleichzeitig war sie ständig auf der Suche nach neuen und exotischen Restaurants, Rezepten und Männern. Und fand auch noch die Zeit, Stoner in Sachen Safer Sex Nachhilfe zu geben.
Für Stoner jedoch war die Kreuzfahrtsaison ein Albtraum in Fortsetzungen. Sie lebte in der ständigen Angst, alles zu vermasseln. Konnte vor lauter Sorgen nicht schlafen. War schlecht gelaunt, reizbar und zu nichts anderem zu gebrauchen als zum Anschauen alter Cagney und Lacey-Videos.
Am schlimmsten war St. Croix. St. Croix war nach Hugo praktisch verschwunden. Sie würden sich mit einer Menge wohlhabender, enttäuschter Leute auseinandersetzen müssen. Und eine Enttäuschung hat auf einen Yuppie etwa dieselbe Wirkung wie Benzin auf ein Buschfeuer. Mit Sicherheit würde Marylou nicht zulassen, dass sie die St. Croix-Buchungen übernahm.
Stoner wickelte ein Handtuch um ihr nasses Haar und warf einen Blick in den Kleiderschrank. Dieser Tag verlangte etwas Praktisches, Kompetentes. Ein Ich-mach-das-schon-Outfit.
Sie entschied sich für den hellen Liz-Claiborne-Jeans-Overall, den Gwen in der Outlet-Mall in Kittery entdeckt hatte. Wenn du dich schon mit Yuppies herumschlagen musst, sagte sie sich, kannst du dich ebenso gut mit Designer-Labels bewaffnen. Sie wünschte, sie hätte dem Video, das sie bei J.C. Penney gesehen hatten, mehr Beachtung geschenkt, jenem Video, das dreißig Varianten zeigte, einen Liberty-Schal zu binden. Nach ihrer Rückkehr hatte sie es zusammen mit Gwen versucht, aber das Beste, was sie zustande brachten, war eine Art Cowboy-Knoten, der für einen Banküberfall ausreichen würde, für mehr aber auch nicht. Schließlich waren sie in Gelächter ausgebrochen, und eins führte zum anderen, bis sie lang ausgestreckt auf dem Wohnzimmerboden landeten, woraufhin Gwen verkündete, dies sei das erste Mal, dass sie unter einem Bridgetisch Sex gehabt hätte.
Stoner hatte versucht, sich cool zu geben, und behauptet, schon andere Frauen unter einem Bridgetisch geliebt zu haben, doch Gwen hielt das für pure Angeberei. Sie würde eine Bridgetisch-Jungfrau auf den ersten Blick erkennen. Also hatten sie beschlossen, sich auf, über, unter und in jedem Möbelstück in Gwens Wohnung zu lieben. Stoner fragte sich, ob dieses Verhalten für zwei Frauen in den Dreißigern angemessen war, aber Gwen hatte behauptet, sie wäre in ihren Zwanzigern zu kurz gekommen, weil sie sich für straight gehalten hätte, und sie dächte gar nicht daran, für den Rest ihres Lebens enthaltsam zu leben.
Sie beschloss, den Schal heute wegzulassen.
Unten im Haus machte Tante Hermione sich bereits in der Küche zu schaffen. Tante Hermione arbeitete auch samstags, um für jene Kundinnen und Kunden da zu sein, deren Terminplan es nicht erlaubte, sich für solch gewagte Vorhaben wie den Besuch bei einer Hellseherin oder die Suche nach dem Sinn des Lebens freizunehmen.
Stoner fuhr sich mit dem Kamm durch das feuchte Haar und trottete nach unten zum Frühstück.
Ihre Tante stand im Nachthemd am Herd und machte Rührei.
Stoner trat hinter sie und nahm sie in den Arm. »Guten Morgen.«
»Alle Achtung«, sagte Tante Hermione. »Der Sex letzte Nacht muss großartig gewesen sein.«
»Um Himmels willen!« Stoner merkte, dass sie rot wurde, und wandte sich schnell ab, um den Kühlschrank zu durchstöbern.
»Was ist denn, meine Liebe? Du bist ja rot wie ein gekochter Hummer. Hast du Hitzewallungen?«
Sie fand die luftdichte Kaffeedose mit dem sorgfältig beschrifteten Etikett. »Ich habe keine Hitzewallungen. Für Hitzewallungen bin ich mindestens zehn Jahre zu jung.« Sie nahm die Dose heraus und kämpfte mit dem Verschluss. »Es liegt an deiner Wortwahl!«
Ihre Tante schürzte die Lippen und runzelte nachdenklich die Stirn. Sie sah aus wie eine Schnee-Eule. »Ich weiß nicht, wieso du das so anstößig findest, Stoner. Grace meint, es macht sie an. Ich glaube, so hat sie es ausgedrückt – ›freizügige Sprache macht mich an‹. Ja, genau das hat sie gesagt.«
»Na ja, du und Grace, ihr seid …«, sie schlug den Verschluss gegen die Spüle, »… älter.«
»Um einiges. Und freizügiger. Ich schätze, es liegt daran, dass wir Hexen sind. Wir wissen das Leben zu genießen.« Tante Hermione häufte die Eier auf einen Teller, der bereits mit Bratkartoffeln, Speck und Hafergrütze mit einem Klecks Butter garniert war. Sie bot ihn Stoner an. »Möchtest du? Ich kann noch einen machen.«
»Nein danke.« Sie presste ihre Hand auf den Deckel und drehte ihn. Durch die Reibung schürfte sie sich die Haut auf. »Verdammt.«
»Wenn ich eine persönliche Bemerkung machen darf …«
»Warum solltest du keine persönliche Bemerkung machen dürfen? Ich lebe seit sechzehn Jahren mit dir zusammen –«
»Siebzehn.«
»– und in diesen siebzehn Jahren hast du ununterbrochen persönliche Bemerkungen gemacht.« Wütend starrte sie das Glas an. »Auf eine persönliche Bemerkung mehr kommt es nicht an.«
»Wenn du zur materiellen Sphäre des Lebens ein etwas entspannteres Verhältnis entwickeln könntest, würde sie dir bestimmt nicht so viele Probleme bereiten.«
Stoner holte tief Luft und drehte. Der Deckel gab nach und sprang ab. Kaffeebohnen flogen in alle Richtungen. »Oh ja«, sagte Stoner, als sie sich bückte, um die Bohnen aufzulesen. »Gib dem Opfer die Schuld.«
»Genau das tue ich hoffentlich nicht.« Tante Hermione knabberte an einer Scheibe Schinken. »Ich finde nur, dass du mit den irdischen Dingen so oft auf Kriegsfuß stehst. Als Steinbock liebst du natürlich die Ordnung und hast einen Hang zum Gegenständlichen. Aber ich wünschte, du könntest das ein bisschen mehr genießen.«
Stoner warf die Handvoll Kaffeebohnen in den Mülleimer. »Ich versuche es ja. Wirklich. Aber Gwen hätte gern Jamaica Blue Mountain und –«
»Als Gwen das letzte Mal Jamaica Blue Mountain wollte«, sagte Tante Hermione, »habe ich einfach normalen Kaffee gemacht und einen halben Teelöffel Instant dazugegeben. Sie hat den Unterschied gar nicht bemerkt.«
Stoner musste lachen. »Das hast du wirklich getan?«
Ihre Tante nickte.
»Kein Wunder, dass sie hier nicht einziehen will.«
»Sie will hier nicht einziehen, weil sie dir ihre Anfälle von schlechter Laune nicht zumuten will. Hat sie gesagt.«
Stoner maß die Bohnen ab, gab sie in die Kaffeemühle und biss in Erwartung des Lärms die Zähne zusammen. »Und ich hab gedacht, sie hätte Angst vor meiner schlechten Laune.«
»Nun«, meinte Tante Hermione, während sie in ihrem Tee rührte, »wenn die Zeit reif ist, werdet ihr zusammenleben.«
Stoner schaltete die Kaffeemühle ein. Es klang, als würde Kies gemahlen. »Mein Gott, wie ich dieses Geräusch hasse.«
»Das war schon immer so. Selbst als Kind hast du jedes laute oder unangenehme Geräusch gehasst.« Tante Hermione lächelte. »Jedes Mal, wenn deine Mutter den Müllschlucker angestellt hat, hast du dir die Ohren zugehalten und bist geflüchtet.«
»Ich hatte Angst, dass sie mich reinstecken würde«, sagte Stoner, als sie die Kaffeemaschine füllte und einschaltete.
»Aber wieso denn?«
»Manchmal hat sie mir damit gedroht.« Sie sah ihre Tante kurz an. Hermione schien bereit, einen Mord zu begehen. »Es war nicht erst gemeint.«
»Was Erwachsene amüsant finden, ist für ein Kind noch lange nicht lustig. Kinder wissen Bescheid. Sie bringen den Geist der Weisheit in diese Welt, aber wir demütigen sie, bis sie ihn vergessen. Ich habe schon oft gedacht, dass die Welt lebenswerter wäre, wenn Kinder das Sagen hätten.«
Stoner empfand eine plötzliche Welle großer Zuneigung für ihre Tante. Sie legte den Arm um sie. »Ich liebe dich, Tante Hermione. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich mich wahrscheinlich schon vor meinem zwanzigsten Geburtstag umgebracht.«
Tante Hermione drückte ihre Hand. »Als ich dich bei mir aufnahm, habe ich gedacht, ich würde dich nur vor meiner erbärmlichen Schwester und ihrem Nichtsnutz von Ehemann retten. Du ahnst nicht, welch unerwartete Freude du in mein Leben gebracht hast.«
Einen Augenblick lang hielten sie sich in den Armen. »Stoner«, sagte ihre Tante schließlich, »in den nächsten Tagen wird dir irgendetwas passieren. Ich bin mir nicht sicher, was es ist. Ich habe nur so eine Vorahnung. Bitte versprich mir, dass du dich in Acht nimmst.«
Stoner wich zurück und sah sie an. »Wovor soll ich mich in Acht nehmen?«
»Ich wünschte, ich wüsste es. Aber ich spüre, dass dich Gefahr umgibt. Eine eigenartige Gefahr. Es ist sehr verwirrend.«
Stoner spürte das Kribbeln einer dunklen Vorahnung. Sie versuchte es abzuschütteln. »Ich werde vorsichtig sein.« Sie zwang sich zu einem Lachen. »Ich wette, ich weiß, was es ist. – Die Kreuzfahrten.«
Marylou steckte bis über beide Ohren in den gefürchteten Kreuzfahrt-Buchungen, als Stoner sich durch die Tür des Reisebüros schob.
»Göttin sei Dank, die Kavallerie ist endlich da.« Marylou seufzte. Sie griff nach einem Bagel mit Frischkäse und Räucherlachs aus dem Delikatessengeschäft gleich um die Ecke.
»Tut mir leid, dass ich zu spät bin.« Stoner hängte ihren Mantel in den begehbaren Kleiderschrank und überprüfte ihr Spiegelbild auf Windschäden. »Gwen hat verschlafen.«
»Aha. Die lustige Witwe. Erzähl, wie war’s?«
»Ja, wir haben zusammen geschlafen. Ja, es war fantastisch.«
Marylou kam hinter dem Schreibtisch hervor und versperrte ihr den Weg aus dem Kleiderschrank. »Einzelheiten!«
»Nein.«
»Bitte.«
»Nein.«
»Du bist fast jede Nacht mit ihr zusammen. Und erzählst nie etwas.«
»Da gibt es kaum etwas zu erzählen. Meistens schläft sie ein.«
»Während ihr euch liebt?« Marylou war erschüttert.
»Während wir fernsehen. Sie schläft selbst bei China Beach ein.«
Marylou schnalzte mitfühlend mit der Zunge.
»Die Schule ist schuld. Das September-bis-Thanksgiving-Höllenmarathon an der Watertown Junior High.«
»Also keine Probleme zwischen euch beiden?«
Stoner lächelte in der Erinnerung an diesen Morgen, an die letzte Nacht. »Absolut keine Probleme.«
»Eine heiße Nacht, hm?« Marylou leckte sich den Frischkäse von den Fingerspitzen.
»So kann man es nennen.«
»Erzählst du’s mir, wenn ich alle Schiffsumbuchungen mache?«
Stoner war in großer Versuchung. »Nein.«
»Dann bleib doch im Schrank«, sagte Marylou schmollend, schloss die Tür und ließ Stoner im Dunkeln stehen.
Stoner öffnete die Tür und folgte ihr an den Schreibtisch.
»Du weißt, dass ich über diese persönlichen Dinge nicht reden kann, Marylou.«
»Schon gut, vergiss es.« Marylou wühlte in der braunen Papiertüte, bis sie einen Mohn-Bagel gefunden hatte, und gab ihn Stoner. »Du hättest die Gelegenheit gehabt, mit ein paar pikanten Details meinen tristen grauen Tag aufzuhellen. Aber mach dir nichts draus. Ich werde es schon ertragen.«
Stoner brach ein Stück Bagel ab und bestrich es mit Käse. »Was ist los? Die Kreuzfahrten?«
»Die Kreuzfahrten hab ich im Griff. Es ist wegen meiner Mutter.«
Stoner sah auf. »Geht’s ihr nicht gut?«
»Oh, es geht ihr gut. Der berühmten Psychoanalytikerin Dr. Edith Kesselbaum geht es gut. Der berühmten Psychoanalytikerin Dr. Edith Kesselbaum geht es einfach prima. Die berühmte Psychoanalytikerin Dr. Edith Kesselbaum schwebt auf Wolke siebzehn. Der Rest der Welt leidet, nicht aber Dr. Edith Kesselbaum.«
»Marylou …«
»Meine Mutter«, verkündete Marylou im Rhythmus ihrer klimpernden silbernen Armreifen, während sie vorgab, sich die Haare zu raufen, »hat beschlossen zu kochen.«
»Du machst Witze.«
»Meine Mutter, Königin des Fast Food, Liebling der Pizza Huts und Vorzeigekind der Burger Kings, hat verkündet, dass die Neunzigerjahre die Rückkehr zu traditionellen Werten einläuten.«
»Das war in den Achtzigerjahren«, unterbrach Stoner sie.
»Du kennst meine Mutter. Ihre Uhr geht anders. Auf jeden Fall soll es zu Ehren von RTW – wie Max und ich es nennen – jede Woche mindestens drei gemeinsame Mahlzeiten geben, die sie zubereiten will.«
»Ich weiß nicht recht«, sagte Stoner. »Sie scheint mir ja nicht gerade ein June-Cleaver-Typ zu sein.«
Marylou verdrehte die Augen.
Stoner biss noch ein Stück von ihrem Bagel ab. »Ich gebe ihr eine Woche. Höchstens zehn Tage. Was sagt Max zu der Sache?«
»Er ist genauso entsetzt wie ich. Aber ich glaube, er kommt langsam auf die Idee, Grillpartys im Garten zu veranstalten. Stoner, ist dir klar, was das heißt?«
Stoner schüttelte den Kopf.
»Die Kesselbaums«, sagte Marylou mit leicht hysterischer Stimme, »die Kesselbaums befinden sich zurzeit an der Schwelle der Fünfzigerjahre.«
»Klingt doch gut«, meinte Stoner. »Du sähst einfach hinreißend aus in Petticoat und Riemchenschuhen.«
Marylou funkelte sie böse an. »Mach dich sofort an die Arbeit.«
Stoner ging zu dem Regal mit den Prospekten, nahm die Trans-Canada-Bahntouren aus der Abteilung Europa, wo irgendjemand sie vergessen hatte, und stellte sie in das Nordamerika-Regal, wo sie hingehörten. »Äh, Marylou …«
»Nein, du musst mir heute nicht bei den Kreuzfahrten helfen.«
»Da wartet ein ganzer Stapel mit anderen Sachen auf mich, weißt du«, sagte sie schuldbewusst und warf ›Besuchen Sie das bezaubernde historische Charleston‹ in den Papierkorb.
»Ich weiß.«
»Vor allem FITs und DITs …«
»Ja«, sagte Marylou. »Tatsächlich habe ich mir heute Morgen, als ich durch die Tür kam, gesagt: ›Heute wäre doch der ideale Tag für Stoner, sich um die Individualreisen im In- und Ausland zu kümmern.‹ Genau das waren meine Worte.«
»Ich bin gut darin. Ich liebe es wirklich, diese Sachen nachzuschlagen.«
»Das stimmt.«
»Und ich liebe es, mich mit Leuten zusammenzusetzen und herauszufinden, was sie wollen, und es in die Tat umzusetzen.«
»Deshalb bist du auch so gut darin«, sagte Marylou.
»Wahrscheinlich bin ich nur ins Reisegeschäft eingestiegen, um FITs und DITs zu machen.«
»Das habe ich mir immer schon gedacht.«
»Aber vielleicht sollte ich –«
»Stoner McTavish!«, kreischte Marylou. »Hast du mir überhaupt zugehört?«
»Was?«
»Die DITs und FITs liegen auf deinem Schreibtisch!«
»Oh.« Stoner sah auf und grinste dümmlich. »Danke.«
»Keine Ursache. Ich habe bei dir was gut.«
Sie nahm die Martinson-Broschüre und ihren Ordner über Baja California zur Hand.
»Gestern Abend«, sagte Marylou düster, »ist sie zur Bücherei gegangen und hat Campbells Suppenkochbuch ausgeliehen. Vielleicht muss ich ausziehen.«
Marylou ging früh zum Lunch und erklärte, dass sie – jetzt, da dies die einzige anständige Mahlzeit am Tag sei – das Beste draus machen müsste.
Stoner winkte ihr zum Abschied zu und machte sich daran, eine Individualreise in den Mittleren Osten zusammenzustellen, die Landschaft, Geschichte, Bezahlbarkeit und Sicherheit miteinander verband.
Die Agentin von COTAL rief an, um ihr zu sagen, dass das Infopaket über Lateinamerika-Touren, das sie angefordert hatten, unterwegs sei.
Mike Szabo, einer ihrer Lieblingskunden, rief an. Er sei mit seiner Frau auf einer Autotour zur Westküste gewesen, als plötzlich der Cousin seiner Frau gestorben sei und sie nach Hause hätten fliegen müssen. Ob sie oder Marylou vielleicht jemanden kennen würden, der bereit wäre, nach Denver zu fliegen und ihr neues Auto abzuholen? Er würde für die Zeit und die anfallenden Kosten aufkommen. Stoner versprach ihm, sich gemeinsam mit Marylou darüber den Kopf zu zerbrechen, sobald sie vom Lunch zurück sei.
Das tschechoslowakische Reisebüro rief an, um ihnen mitzuteilen, dass die Lage ein wenig unsicher wäre, aber sie würden alles tun, um sicherzustellen, dass die Touristen ihre Anschlussflüge nicht verpassten. Der Mann fügte hinzu, dass sie trotz »administrativer Umstellungen« weiterhin an amerikanischen Geschäftsverbindungen interessiert seien.
Trump Shuttle rief an, um sie zur Feier anlässlich der neuen Flugverbindung zwischen Boston und Atlantic City einzuladen. Stoner versprach, ihn zurückzurufen, und fragte sich beim Auflegen, ob sie es wagen könnte, sich an einen Spielautomaten zu setzen, oder ob sie in der Hoffnung, zu plötzlichem Reichtum zu kommen und deshalb nicht noch einen Winter in dieser Stadt verbringen zu müssen, die Ersparnisse von Jahren verspielen würde.
Sie wollte gerade Tante Hermione anrufen und sie bitten, ein paar übersinnliche Schwingungen zu dieser Frage aufzufangen, als die Carharts hereinrauschten.
Glenn Carhart war Hightech vom Scheitel bis zur Sohle. Anthrazitfarbener Anzug mit Weste und passendem Mantel. Stahlgraue Augen, die metallisch glänzten. Schwarzes, im Wallstreet-Stil zurückgekämmtes Haar im Wet-Look – eine Frisur, die auf Stoner immer wirkte, als sei ihr Träger entweder ein alternder Gigolo aus einem Billardsalon (einschließlich der Packung Lucky Strike in seinem aufgerollten T-Shirt-Ärmel) oder als sei er gerade im Bostoner Hafen über Bord gegangen.
Ellen Carhart verlieh dem Wort ›beige‹ eine völlig neue Bedeutung. Sie war groß und blond, trug formlose, in Variationen von Kremweiß bis Hellbraun aufeinander abgestimmte Kleider und rundete das Ganze mit einem blassen Make-up ab. Die Haut unter dem dicken Puder war trocken und spannte. An ihrem Körper war jeder Knochen sichtbar. Stoner hätte Ellen Carhart gern bemitleidet, denn sie sah wirklich nicht so aus, als hätte sie viel Freude am Leben, aber diese Frau fühlte sich der breiten Masse so offensichtlich überlegen, dass Mitgefühl kaum aufkommen konnte.
Die Carharts fuhren ein schwarzes BMW-Cabriolet mit CD-Player und Stereoboxen. Sie aßen nur in Restaurants mit französischen Namen, Blumenampeln und Kleidervorschriften und tranken für gewöhnlich Weißwein oder Perrier mit einem Spritzer Limone. Sie fuhren jedes Jahr nach St. Croix und verbrachten zwei Wochen im Pirate’s Cove. Das Pirate’s Cove war im Birnbaum als ›sehr teuer‹ eingestuft. Tatsächlich war es eine jener ›Wenn-du-erst-fragen-musst-kannst-du-es-dir-nicht-leisten‹-Spielwiesen. Stoner schätzte, dass sie und Tante Hermione mit dem, was die Carharts in ihrem zweiwöchigen Urlaub im Pirate’s Cove ausgaben, mindestens ein Jahr lang mehr als bequem über die Runden kämen. Umgeben von glitzerndem Sand und Regenwald, einheimischen Dörfern und alten Zuckerplantagen, die von der Geschichte der Sklaverei nur so strotzten, verbrachten sie, abgesehen von den verrückten, spontanen Abstechern zur Heilquelle, ihre Tage am liebsten damit, zwischen den drei Stränden des Pirate’s Cove und dem Golfplatz zu pendeln. Soweit Stoner wusste, hatten sie ihren Urlaub nie irgendwo anders verbracht. Sie hatten nicht einmal den Gedanken geäußert, ihn vielleicht einmal irgendwo anders zu verbringen.
Stoner fragte sich oft, warum sie ihre Reisen bei Kesselbaum & McTavish buchten. Vielleicht gefiel ihnen ihre persönliche Art. Vielleicht entsprach dies ihrer Yuppie-Vorstellung davon, sich auf gefahrlose Weise unters gemeine Volk zu mischen. Vielleicht saßen sie mit ihren Freunden bei Weißwein und Perrier mit einem Spritzer Limone zusammen und erzählten sich köstliche Geschichten über »diese beiden Frauen aus dem Reisebüro – wirklich, ihr müsstet sie mal sehen – wie aus einem Steinbeck-Roman, so putzig und volkstümlich …«
Stoner rang sich ein Lächeln ab, das gerade noch als charmant durchgehen konnte, und sagte: »Ja, bitte?«
»Ihre Partnerin«, sagte Glenn Carhart. »Die andere …«
»Marylou. Ja.«
»… hat darauf bestanden, dass wir mal vorbeischauen.«
Ellen Carhart schaltete sich ein. »Es gibt da ein kleines Problem mit St. Croix.«
Stoner nickte verständnisvoll. »Ja, St. Croix ist im Moment schwierig.«
»Diese andere«, übernahm Glenn wieder das Wort. »… Marylou? … scheint der Meinung zu sein, dass wir unsere Pläne ändern sollten.«
»Das wäre wahrscheinlich eine gute Idee.«
»Das können wir auf gar keinen Fall«, sagte Ellen Carhart mit Nachdruck, während sie Stoners Overall taxierte. Für einen Augenblick geriet sie aus dem Gleichgewicht, doch als sie erkannte, dass es ein Modell vom Vorjahr war, nahm sie wieder ihre überlegene Pose ein.
»Sie können nicht?«
»Wir fahren immer zum Pirate’s Cove.«
»Ich verstehe«, sagte Stoner. »Aber … nun ja, die Situation auf St. Croix ist im Moment ziemlich chaotisch.«
»Wir haben im Pirate’s Cove angerufen«, erklärte Glenn. »Im November werden sie den Betrieb wieder aufnehmen.«
Stoner nickte. »›Den Betrieb wieder aufnehmen‹ ist eine Sache. Ich meine, einige der Zimmer mögen ja wieder bewohnbar sein, aber das muss nicht heißen, dass der Betrieb wieder wie gewöhnlich läuft. Und soweit ich es beurteilen kann, ist die Vegetation auf der ganzen Insel ziemlich verwüstet …«
Ellen Carhart schenkte ihr ein blitzendes Lächeln. Stoner fühlte sich unbehaglich. Es war eines jener Lächeln, die sagen wollten: »Ich habe hier das Sagen und ich werde meinen Kopf durchsetzen, egal was du davon hältst.« Ein Lächeln wie jenes, das dieser schmierige Versicherungsvertreter ihr zugeworfen hatte, als er Tante Hermione gegen Stoners offensichtliche Einwände eine überflüssige Hauseigentümer-Versicherung verkauft hatte – ein Lächeln wie jenes, das er ihr nicht zuwarf, als er herausfand, dass Tante Hermione und Stoner als Lockvögel für den Verbraucherschutz arbeiteten.
Stoner griff nach dem Telefon. »Ich kann versuchen, dort anzurufen …«
»Es ist ein Trick, nicht wahr?«, fragte Carhart.
»Ein Trick?«
»Um die Preise in die Höhe zu treiben. Sie haben ›Auslagen‹, ›ernste Verluste‹ …« Er tat es mit einem Schulterzucken ab. »Hey, Geschäft ist Geschäft. Ich kann das verstehen.«
»Sie hatten einen Hurrikan«, sagte Stoner.
»Das wissen wir«, gab Ellen Carhart ungeduldig zurück. »Wir haben es im Fernsehen gesehen.«
»Dann wissen Sie ja, wie es dort aussieht.«
»Das wissen wir«, sagte Ellen. »Diese Leute sind Amok gelaufen. Haben geplündert und gestohlen. Keine Selbstdisziplin.« Sie schüttelte ihr schmuckbehangenes Handgelenk. »Genau das, was ich erwartet hatte.«
»Was Sie erwartet hatten?«, wiederholte Stoner. Sie weigerte sich, ihren Ohren zu trauen.
»Diese Eingeborenen.« Ellen Carhart schüttelte sich.
Stoner versuchte, nicht die Beherrschung zu verlieren. »Die Eingeborenen.«
»Zumindest sind wir im Pirate’s Cove nicht ihrer Bettelei ausgeliefert.«
Stoner sah in der Hoffnung auf ein Anzeichen der Verlegenheit zu Glenn hinüber. Er nickte selbstzufrieden.
»Es ist ihre Insel«, sagte Stoner mit einem letzten Rest an Selbstbeherrschung.
»Sie kommen schon zurecht«, verkündete Glenn Carhart. »Mit dem guten alten Yankee-Dollar.«
»Mit dem Hurrikan sind sie ganz sicher zurechtgekommen«, warf Ellen ein. »Zumindest die, die nicht zu faul waren, in ein Geschäft zu laufen und dort zu stehlen, was immer sie wollten.«
»Entschuldigen Sie mal!« Stoner explodierte. »Ist Ihnen schon mal der Gedanke gekommen, dass Leute, die in Armut leben und deren Existenz von der Gnade einiger Touristen mit weißer Hautfarbe und dicken Brieftaschen abhängt, vielleicht – aber auch nur vielleicht – ein bisschen Groll hegen? Und ist Ihnen schon mal der Gedanke gekommen, dass ihnen, als die Dächer von ihren Häusern geflogen sind, auch der Kragen geplatzt sein könnte?« Sie beugte sich vor. »An Ihrer Stelle, Mr. und Mrs. White Yankee Carhart, wäre mir nämlich ein klein wenig unwohl dabei, wenn ich gerade jetzt nach St. Croix fahren sollte. Oder nach St. Thomas. Oder nach Puerto Rico. Oder an irgendeinen anderen Ort in der Karibik. Denn, Mr. und Mrs. White Yankee Carhart, ab einem gewissen Punkt ist für jede und jeden das Maß voll. Und offen gestanden glaube ich nicht, dass ›diese Leute‹ reiche und bigotte Menschen wie Sie brauchen, die sich auf ihren Ständen breitmachen.«
Beleidigt rauschten sie von dannen. Stiegen in ihren falsch geparkten schwarzen BMW mit CD-Player und Stereoboxen und schossen davon, wobei sie den Wagen, der hinter ihnen parkte, mit Kies bespritzten.
Stoner schloss die Augen. »Oh Shit.«
»Was ist los, meine Liebe?« Marylou kam frisch und vergnügt herein und griff nach den Telefonnotizen. »Waren das nicht die Carharts?«
»Ja.«
»Hast du die St. Croix-Sache geklärt?«
»Ähm … ja, ich habe sie geklärt.«
Marylou warf ihr einen kurzen Blick zu. »Es gefällt mir nicht, wie du das sagst.«
Stoner erzählte ihr, was passiert war.
Marylou schüttelte den Kopf. »Du solltest aufhören, Designing Women zu sehen. Was Julia Sugarbaker sich in Atlanta ungestraft erlauben darf, kann sich Stoner McTavish in Boston noch lange nicht leisten.«
Stoner bot ihr an, die Carharts anzurufen. Um die Sache wieder in Ordnung zu bringen.
Marylou hielt ihr stattdessen die Nachricht der Szabos unter die Nase. »Ich werde mich um die Carharts kümmern. Die Szabos brauchen ihren neuen Wagen. Du fährst nach Denver.«
* * *
Die Rockies lagen hinter ihr, weit im Westen. Richtung Osten hielt der letzte Zipfel Colorados dem zinnfarbenen Novemberhimmel stand. Kornfelder und Präriegras, angesichts des nahenden Winters in silbergraue Stoppeln verwandelt, zogen sich über Meilen an beiden Seiten des Highways entlang. Ein scharfer Wind fuhr in die staubige Getreidespreu und wirbelte sie auf.
Stoner steuerte den Wagen gegen die plötzlichen Böen an und warf einen Blick auf den Himmel. Ein Schwarm Gänse, kleinen Punkten gleich, zog in einem gezackten V eilig gen Süden. Sie griff nach der Straßenkarte, die aufgeschlagen auf dem Beifahrersitz lag, und legte sie über das Lenkrad, obwohl sie wusste, dass ihr Verhalten dumm und lebensgefährlich war, und sie tat es auch nur, weil sie zehn Meilen in jede Richtung sehen konnte und die Straße für sich allein hatte. Himmel, war sie allein auf dieser Straße! Sie war in den letzten drei Stunden, seit dem Lunch, allein auf dieser Straße gewesen. Wenn sie es sich recht überlegte, war der Lunch auch nicht gerade eine Massenveranstaltung gewesen. Ein fast leeres Restaurant, in dem es nach Chlor und WC-Lufterfrischer roch – eine Mischung, die sie garantiert zum Würgen brachte. Ein matschiger Double-Cheeseburger, eine kleine Cola und pappige Pommes frites, serviert von einer Vierzehnjährigen, deren Verdienst, typisch republikanisch, unter dem Mindestlohn lag und die eigentlich in der Schule hätte sein sollen, aber wahrscheinlich eine alleinstehende Mutter aus einer abtreibungsfeindlichen Familie war und aus einer Stadt kam, in der die Sozialleistungen den Gramm-Rudmann-Haushaltskürzungen zum Opfer gefallen waren.
Sie wischte den Staub von der Karte und markierte ihre jetzige Position. Anscheinend befand sie sich in der Nähe von einer von vier Städten, deren Einwohnerzahl insgesamt weniger als tausend Seelen betrug. Nicht dass sie vorgehabt hätte, einen kurzen Abstecher zu machen, nein danke. Aber sie begann an einer Highwaytitis zu leiden, diesem schleichenden Gefühl, dass sie schon tot und zur Hölle gefahren sei, wo sie zur Strafe für ihre Sünden, die zu zahlreich und zu schrecklich waren, um einzeln aufgezählt zu werden, dazu verdammt war, bis in alle Ewigkeit die Interstate 70 entlangzufahren.
Versuch es von der positiven Seite zu sehen, sagte sie sich, als der Highway etwas kreuzte, das vorgab, ein Feldweg zu sein, aber eher einem trockenen Flussbett glich, das nur darauf wartete, sich mit Wasser zu füllen, sobald sich ein geeignetes Opfer fand. Vor dir liegen Kansas, die Heimat von John Brown (sein’ Leich’ im Grab vergeh’nd), die Menninger Foundation (falls die Vernunft sich verabschiedet) und Topeka. Vor allem Topeka. Topeka hat, neben der bereits erwähnten Menninger Foundation, Motels. Motels und Restaurants. Motels, Restaurants und Telefonzellen. Und Telefonzellen bedeuten, dass ich Gwen anrufen kann.
Sie trat aufs Gas. Vielmehr gab sie ›voll Stoff‹, wie es Jungen jeden Alters nannten – eine ziemlich leichtfertige Beschreibung für ein Verhalten, das nicht nur rechtswidrig, sondern auch gefährlich, gedankenlos, rücksichtslos und unverantwortlich war.
Sie nahm etwas Gas zurück.
Die Landschaft zog in tödlicher Eintönigkeit vorbei.
Stoner stellte das Radio an und drückte den Suchlauf. Da wirkten die Wunder der modernen Technologie und die eindrucksvollen Leistungen des Mikrochips schon mit vereinten Kräften – und alles, was sie bieten konnten, waren ein Country-und-Western-Sender, eine Hass-Talkshow und ein Radioprediger, der anscheinend Kapital daraus schlug, leidenden Menschen zu erzählen, dass sie ihr Leiden verdient hätten, weil sie der letzte Dreck seien.
Das Radio besaß auch einen Kassettenrekorder. Sie wünschte, sie hätte die neueste Melissa Etheridge mitgebracht. Oder zumindest ein paar frühe Alben von Dory Previn.
Hier sind wir also, ich und niemand. Mitte November mitten im Nirgendwo. Auf dem Weg nach Irgendwo.
* * *
Irgendetwas huschte vor ihr über die Straße, eine undefinierbare Gestalt, die sie aus ihren Gedanken riss. Sie nahm den Fuß vom Gaspedal und verlangsamte die Fahrt. Sie kniff die Augen zusammen. Wahrscheinlich nur ein Stück Papier, das der Wind vor sich herwehte. Oder eine Feldmaus oder ein Präriehund oder vielleicht auch ein Backenhörnchen – falls es hier draußen in der Ebene überhaupt Backenhörnchen gab. Leben Backenhörnchen in Gegenden, in denen es keine Bäume gibt? Wenn ja, gefällt es ihnen dort? Unterscheidet sich ihr Bewusstsein von dem der Waldeichhörnchen, Holzstapelhörnchen und Maisspeicherhörnchen? Ob sie sich, falls sie aufeinandertrafen, nach fünf Minuten nichts mehr zu sagen hätten?
Die schwarze Gestalt blieb genau in der Mitte ihrer Spur stehen und schien sie direkt anzublicken.
Sie trat voll auf die Bremse.
Natürlich ging der Motor aus.
Das kleine Tier, das sich als Schlange entpuppte, senkte den Kopf und glitt nonchalant von der Straße. Es verschwand in einem Dickicht stoppeliger Getreidehalme.
Na schön, dieser Gnadenakt sollte mein karmisches Strafmaß um ein paar Lebzeiten reduzieren.
Sie drehte den Zündschlüssel und wurde von Stille begrüßt.
Sie drehte ihn ganz zurück und versuchte es erneut.
Nichts.
Verdammt.
Sie schaltete die Warnblinklichter ein – wenigstens funktionierte die Elektrik noch – und stieg aus dem Auto, um einen Blick unter die Motorhaube zu werfen.
Der Motor war genauso neu wie der Wagen und roch nach Öl und verbrannter Farbe. Es roch nicht nach ausgelaufenem Benzin.
Stoner prüfte das Öl – alles in Butter, wie es so schön heißt – und griff nach dem Kühlerdeckel, als ihr Schutzengel ihr auf die Schulter tippte und sie daran erinnerte, dass es keine gute Idee war, bei einem heißen Motor den Kühlerdeckel aufzudrehen. Absolut keine gute Idee.
Sie ließ die Motorhaube zufallen und setzte sich wieder auf den Fahrersitz. Die Benzinuhr zeigte einen halb vollen Tank an. Die Temperatur war nicht höher, als sie sein sollte. Alles andere schien auch normal zu sein.
Großartig. Mit dem Wagen ist alles in Ordnung, bis auf die Tatsache, dass er nicht anspringt.
Aber er könnte bald alles andere als in Ordnung sein, wenn er weiterhin bei Einbruch der kalten Dunkelheit am Rande Colorados mitten auf der I-70 stand.
Sie legte den Leerlauf ein, öffnete die Tür, stieg aus und schob den Wagen an den Straßenrand.
Und nun?
Nun könnten wir darauf warten, dass er von selbst wieder in Ordnung kommt. Autos sind für spontane Akte der Selbstheilung bekannt.
Allerdings stellen sich diese spontanen Akte der Selbstheilung meist nur ein, wenn drei junge Automechaniker um den Wagen herumstehen und du ihnen dieses »komische Geräusch« vorführen willst, das dich fast um den Verstand gebracht hat.
Wir könnten ja einen Barmherzigen Samariter anhalten. Der wird sich dann wahrscheinlich als ein Axtmörder auf der Suche nach seinem nächsten Opfer entpuppen.
Oder wir könnten zwanzig Anstandsminuten abwarten und dann lostraben.
Sie nahm die Straßenkarte zur Hand und betrachtete sie finster. Sie wünschte, sie wüsste, wie weit sie von der Zivilisation entfernt war. Selbst von einer rückständigen Zivilisation. Zumindest war sie in einer Farmgegend, in der es – wenn sie nur eine noch so kleine Stadt finden würde – eine Werkstatt geben würde.
Der letzte Orientierungspunkt, an den sie sich erinnern konnte, war der südliche Arm des Republican River (kein gutes Omen). Aber das war mehr als eine Stunde her.
Und das bedeutete, dass das Tageslicht in kürzester Zeit schwinden würde.
Es war jetzt schon kalt. Zu kalt für ihre Daunenweste. Eine Daunenweste war perfekt für kurze Protestmärsche im Herbst, dafür, Tee ins Frauenzentrum Cambridge zu bringen oder auf einen Drink, ein kurzes Billardspiel oder einen kleinen Engtanz mit Gwen zu Indigo hinüberzulaufen, aber für einen Tag in der großartigen Novembernatur von Colorado war sie ganz sicher nicht geeignet.
Sie beschloss, ihren Koffer aus dem Kofferraum zu holen und ihren Parka zu suchen. Damit würde etwas Zeit vergehen.
Es reichte für etwa fünf Minuten.
Sie überlegte, trotz des kläglichen Angebots das Radio einzuschalten, entschied sich aber dagegen. Es könnte eine lange Nacht werden, und dann würde sie den Strom brauchen.
Sie summte vor sich hin und trommelte mit den Fingern auf das Lenkrad. Damit vergingen etwa neunzig Sekunden.
Sie holte einen Notizblock aus ihrem Rucksack, fand aber keinen Stift. Damit vergingen zwei Minuten, höchstens.
Stoner seufzte und stieg wieder aus dem Wagen. Sie ging den Seitenstreifen auf und ab, zählte kaputte Bierflaschen und Dosen und zerknüllte Zigarettenschachteln.
Der Himmel verdunkelte sich.
Zeit der Angst.
Hier draußen würde die Nacht schnell und unerbittlich hereinbrechen. Keine lange, zögernde Dämmerung, die es erlaubte, noch schnell das letzte Stück Rasen zu mähen, das Werkzeug zu finden, das man im Garten vergessen hatte, oder einen letzten Hotdog auf den Grill zu werfen.
Es wurde einfach Nacht, plötzlich und furchtbar.
Aus irgendeinem Grund fiel die Temperatur plötzlich in den Keller.
Verdammt.
Sie ging zum Wagen zurück und versuchte es noch einmal. Nichts. Sie überprüfte alle Anzeigen, Skalen, Knöpfe und LCD-Anzeigen und blätterte das Handbuch und die Anleitung für die Störungssuche durch.
Nichts.
Mist, Mist, Mist.
Im Osten verblasste der Himmel mit rasender Geschwindigkeit. Im Westen saugte die untergehende Sonne die rot gesäumten Wolken an und zog sie zum Horizont. Ein tiefes Purpurrot ergoss sich in den schieferfarbenen Dunst. In einer Stunde würde sie nichts mehr sehen können.
Das Vernünftigste wäre, sitzen zu bleiben und auf ein Auto oder einen LKW oder selbst auf eine Polizeistreife zu warten. Aber es könnte Stunden oder Tage dauern, bis irgendjemand auftauchte. Nach dem, was sie heute an Verkehr gesehen hatte, könnte es Frühjahr werden, bevor Hilfe eintraf. Nach dem, was sie heute an Verkehr gesehen hatte, war das Armageddon bereits eingetreten, und sie war die Einzige, die noch auf Erden übrig war. Außerdem musste sie etwas tun. Sie konnte nicht einfach hier herumsitzen und auf Rettung hoffen. Manche Leute, das wusste sie, hielten es für eine absolut legitime Strategie, aus Vernunftgründen an einem Ort sitzen zu bleiben und auf Rettung zu hoffen. Wäre die Frage »Was ist in dieser Situation zu tun?« das Thema von Family Feud, so wäre Sitzenbleiben und Abwarten sicherlich die Antwort Nummer eins.
Aber ihr war auch klar, dass sie, wenn sie hier herumhockte und nichts unternähme – auch wenn die meisten Leute das für eine strategische Tätigkeit hielten –, völlig den Verstand verlieren würde. Denn es war ihr noch nie im Leben passiert, dass ihr jemand einfach so zu Hilfe kam. Anderen Leuten eilte man zu Hilfe. Manche Leute wurden von Hilfsbereitschaft geradezu überschwemmt. Manche Leute bekamen Nervenzusammenbrüche, nur um den heraneilenden Scharen von Hilfsbereiten eine Beschäftigung zu bieten.
Dieses Problem hatte sie noch nie gehabt.
Sie versuchte noch einmal, den Wagen zu starten.
Stille.
Er wurde Zeit, loszulaufen.
Sie überprüfte den Inhalt ihres Rucksacks. Sie entschied sich für die Brieftasche, den Kamm, ein paar Sachen zum Wechseln (zwei T-Shirts, Unterwäsche und Socken), ihre Zahnbürste, den Quarzkristall, das Erste-Hilfe-Päckchen für Rucksackreisen inklusive Schlangenbissbesteck und Nähzeug. Packte auch ihre Daunenweste ein. Überprüfte den Inhalt ihrer Hosentaschen – ein Milky-Way-Papier (hierlassen), ein Susan-B.-Anthony-Glücksdollar (mitnehmen, man kann nie wissen, wann man Glück braucht), eine Packung Clove-Kaugummi (unangebrochen – ein Geschenk für Marylou, die süchtig danach war), ein alter Einkaufszettel, den sie das letzte Mal nicht gefunden hatte, als sie im Laden stand. Sie überprüfte die Taschen ihres Parkas – nichts als Fussel und Krümel, frisch aus der Reinigung.
Okay. Dann mal los.
Als sie den Wagen abgeschlossen hatte und aufblickte, bemerkte sie auf einer leichten Anhöhe etwas, das ihr vorher nicht aufgefallen war.
Es sah aus wie ein Schild. Ein altes, verwittertes, morsches Schild.
Hey, was soll daran schon besonders sein? Ein Schild ist ein Schild. Schilder bedeuten für gewöhnlich, dass irgendetwas in der Nähe ist. Irgendetwas, weswegen man ein Schild aufgestellt hat. Information. Information ist die Essenz eines Schildes. Und Information ist in diesem Moment genau das, was du brauchst.
Genauso wie ein Abendessen, vorzugsweise mit einem guten Manhattan als Aperitif. Aber wie die Dinge liegen, wird die Information ausreichen müssen.
Sie stapfte durch die Getreidestoppeln und versuchte, sich nicht allzu bildlich vorzustellen, was in diesem Augenblick sonst noch ungesehen neben ihr über das Stoppelfeld stapfen, huschen oder kriechen mochte. Colorado spielte ihr den netten, für den amerikanischen Westen so typischen Streich, die Entfernungen teleskopartig zu verkürzen, so dass die Dinge weiter weg waren, als es den Anschein hatte. Sie hätte den Außenspiegel ihres Wagens mitnehmen sollen, in dem die Gegenstände weiter weg und kleiner wirkten, als sie tatsächlich waren. Das wäre vielleicht der Ausgleich für …
Es war wirklich schrecklich kalt.
Als sie das Schild erreichte, war es fast zu dunkel, um es zu lesen.
Tabor
Tja, klang nicht schlecht. Tabor. Eine Stadt namens Tabor? Leute namens Tabor? Vielleicht ein wildes Tier, das in dieser Gegend beheimatet war und Tabor genannt wurde?
Was immer es auch sein mochte, es war vier Meilen entfernt, immer den Feldweg entlang. Sie sah zum Wagen zurück, doch die Dunkelheit hatte die Straße schon verschluckt. Sie wusste, dass der Wagen da war, konnte ihn aber nicht sehen. Ebenso wenig wie irgendwelche netten kleinen Lichter von anderen Autos, die den Highway entlangbrausten. Nicht einmal ein Axtmörder war zu sehen.
Am Ende des Feldwegs, zweifellos in trügerischer Entfernung – vier trügerische westliche Meilen im Gegensatz zu verlässlichen, vorhersehbaren östlichen Meilen entfernt –, meinte sie ein Licht ausmachen zu können. Vielleicht ein Haus. Vielleicht zwei Häuser. Wenn sie näher käme, würde sie vielleicht hunderte von Häusern finden. Cafés, Neonlichter, Videotheken, Einkaufszentren. Und Telefonzellen.
Wenn sie jetzt losginge, würde sie nach Einbruch der Dunkelheit die Straßenlaternen erkennen können, die ihr einen ersten Hinweis auf die Größe und die Art dieses Ortes geben würden.
Was hätte sie auch sonst tun können?
Kapitel 2
Der Karren, von einem alten Maultier gezogen und von einem Jungen gelenkt, tauchte wie aus dem Nichts auf. Im schwindenden Tageslicht sah der Junge wie fünfzehn aus. Er hielt das Fuhrwerk neben ihr an und wartete.
»Hi«, sagte Stoner. »Schöner Abend.«
Der Junge nickte.
»Ich hab drüben auf dem Highway Probleme mit meinem Wagen gehabt. Weißt du, wo ich eine Werkstatt finde?«
Er starrte sie verständnislos an.
»Eine Werkstatt«, wiederholte sie geduldig. »Ich brauche eine Autowerkstatt.«
Der Junge starrte sie einfach weiter an.
»Sprichst du Englisch?«, fragte sie.
»Klar«, sagte er mit einer Stimme, die noch nicht umgeschlagen war. »Bin ja nicht blöd.«
»Kannst du mir dann vielleicht sagen, wo ich eine Werkstatt finde? Für meinen Wagen?«
Der Junge zuckte die Schultern. »Nicht dass ich wüsste.«
Allmählich wurde sie ungeduldig. »Okay. Ist das da drüben eine Stadt?«
Er sah in die Richtung, in die sie zeigte. »Tabor.«
»Ja, Tabor. Da will ich hin. Ist es eine große Stadt?«
»Die größte in dieser Gegend. Sind Sie der Marshall?«
»Welcher Marshall?«
»Der U.S.-Marshall. Nach dem sie wegen der Brände geschickt haben.«
»Nein. Tut mir leid.«
Er schien erfreut über ihre Antwort. »Dann müssen Sie die sein, wegen der Blue Mary mich hergeschickt hat.«
Stoner schüttelte den Kopf. »Ich kenne niemanden namens Blue Mary.«
Der Junge stand vom Kutschbock auf und suchte mit den Augen die wogende Prärie ab. Er sah sie wieder an. »Sonst niemand zu sehen.«
»Ich sehe auch niemanden«, stimmte Stoner ihm zu.
»Dann müssen Sie’s sein. Ich heiße Billy. Steigen Sie auf.«
Stoner kletterte auf den harten Kutschbock. »Nett, dass du mich mitnimmst, aber ich fürchte, ich bin nicht diejenige, die du suchst.«
»Blue Mary macht keine Fehler«, murmelte der Junge. »Sie hat gesagt, Sie wär’n hier. Sie sind nicht der Marshall, und Sie sind hier.«
* * *
Von einer leichten Anhöhe aus sah sie in weiter Ferne die Stadt liegen. Goldgelbe Lichter wie von Kerzen oder Petroleumlampen erhellten die Fenster. Über ihr funkelten die Sterne an einem kobaltblauen Himmel.
Der Karren rumpelte an einem abgebrannten Haus vorbei. »War das der Brand, den du erwähnt hast?«, fragte sie.
Billy nickte. »Einer davon.«
»Hat es viele gegeben?«
»Einige.«
Sie konnte viel zu gut sehen. Obwohl es nahezu dunkel war, konnte sie Schatten und Umrisse ausmachen. Sie konnte sie im Mondlicht erkennen, obwohl der Mond nicht mehr voll war.
Ihr wurde klar, woran das lag. Tabor besaß keine Straßenlaternen. Und keine schmierige, rotgelbe, krank aussehende Abgasglocke, die den Himmel in das Szenario eines futuristischen Weltuntergangsfilms verwandelte.
Zweifellos eine Haushaltskrise.
Dafür hatte Tabor eine einzige unbefestigte Straße mit tiefen Fahrspuren, an der sich rohe, ungestrichene Holzgebäude aneinanderreihten. Gehwege aus durchgebogenen Holzplanken. Äste, an modrige Holzpfähle genagelt, die als Pfosten zum Anbinden von Pferden dienten. Ein Mietstall am einen, ein Brunnen am anderen Ende der Stadt und dazwischen an der Ostseite der Straße ein Saloon namens Dot’s Gulch (Dot’s Schlucht – ein Name, der Bilder von ausgetrockneten Flussbetten, ausgebleichten Knochen und riesigen Bussarden hervorrief), ein Sattler – von der Häuserreihe abgetrennt durch einen Pfad, der in die Prärie hinausführte und sich dort verlor –, ein Grundbuchamt, ein Postkutschendepot und ein paar heruntergekommene Gebäude ohne erkennbare Funktion. Ungefähr eine Viertelmeile entfernt, ein wenig höher gelegen als der Rest der Häuser, stand eine weiß getünchte Kirche.
An der Westseite der Straße gab es ein Warenhaus, eine chinesische Wäscherei und Schneiderei, ein Postamt und eine Bank, einen Barbier, ein Einzellengefängnis und mehrere Gebäude, die aussahen wie Lagerhäuser oder Vorratsschuppen. Im zweiten Stock des Warenhauses erleuchtete eine Öllampe ein einzelnes Fenster. Auf der Scheibe konnte sie gerade noch den handgemalten Schriftzug »J. Kreuger, Dr. med. für Mensch und Vieh. Schmerzloses Zähneziehen. Haarschnitte und Kredite« entziffern. Tabors Version eines Ärztehauses. Durch die Türen des Saloons drang Licht. Die Abwesenheit von Menschen war verwirrend.
Es sah aus wie eine Filmkulisse oder eine Geisterstadt nach der Touristensaison.
Sie warf einen Blick auf den Jungen neben sich. Er mochte ja noch ein Junge sein, aber er war männlichen Geschlechts, und sie saß einfach da und hatte das Angebot eines Fremden angenommen, sie mitzunehmen. Selbst wenn sie entkommen sollte, ohne vergewaltigt oder ausgeraubt zu werden, würde sie sich nie wieder in der postfeministischen Feministische-Spiritualität-Gruppe (ehemals Selbsterfahrungsgruppe) im Frauenzentrum Cambridge blicken lassen können.
»Okay, das reicht schon«, sagte sie mit fröhlicher und, wie sie hoffte, energischer Stimme. »Ich steige hier aus.«
»Sie wollen nicht zu Blue Mary?«
Sie beschloss, so zu tun, als sei sie sich ihrer Sache sicher. »Ich muss vorher noch etwas in der Stadt erledigen.«
Er zögerte, zuckte dann aber die Schultern.
Stoner sprang vom Wagen auf die staubige Straße. »Danke fürs Mitnehmen.«
Ohne zu antworten schnalzte der Junge dem Maultier zu und verschwand in der Dunkelheit.
Sie sah sich um. Alle Häuser konnten einen Anstrich vertragen. Einige sahen aus, als würden sie lediglich durch ihre eigene Trägheit zusammengehalten. Nur in ein paar Fenstern, meist in denen der Geschäfte, waren Glasscheiben. Der Rest war mit Holzbrettern zugenagelt. Ein erbärmlicher Ort. Selbst der Dreck wirkte armselig.
Wieder einmal vermisste sie Gwen, die diese Stadt wahrscheinlich lieben und aus gegebenem Anlass ein paar Zeilen von Shirley Jackson zitieren würde, irgendetwas Markiges wie: »Schon oft hab ich gedacht, dass ich mit ein bisschen Glück ein Werwolf geworden wäre«, oder sogar: »Ich frage mich, ob ich ein Kind essen könnte.«
Nicht dass hier ein Kind zu sehen gewesen wäre. Oder ein Erwachsener oder ein Hund oder eine Katze oder irgendein anderes Lebewesen.
Besonders beunruhigend war das Fehlen von Telefonmasten oder Leitungen jeglicher Art. Außerdem fand sich nicht die Spur einer Werkstatt oder eines Autohändlers, ja nicht einmal – und das beunruhigte sie noch mehr – eines Bahngleises oder eines Getreidesilos.
Was trieben die Leute in dieser Stadt?
Welche Leute?
Ein kalter Windstoß blies ihr den Staub ins Gesicht und fegte die Straße hinunter.
Sie dachte daran zu rufen oder zu schreien. Aber beim Rufen und Schreien kam sie sich immer idiotisch vor. Gwen hatte damit keine Probleme. Schon gar nicht in Lebensmittel- oder Discountläden. Mehr als einmal war Stoner in der peinlichen Lage gewesen, ihren eigenen Namen quer durch Gänge voller Tomatendosen und Frischhaltefolie dröhnen zu hören. Einmal hatte Gwen sie in einem Ames in – wo genau, daran konnte sie sich nicht erinnern, aber das spielte ohnehin keine Rolle, weil einer wie der andere aussah, jedenfalls waren sie unterwegs gewesen und hatten angehalten, um sich die Beine zu vertreten, und Stoner hatte sich von einem Regal mit unansehnlichen, spottbilligen Flanellhemden mit schiefen Karos ablenken lassen, während Gwen zur Toilette gegangen war – einmal also hatte Gwen sie ausrufen lassen. Ausrufen lassen! Zusammen mit den Sonderangeboten der Woche, den Preisnachfragen und den Sicherheitscodes.
»Stoner McTavish, bitte melden Sie sich bei der Kundeninformation!«
Sie hatte sich hinter einer Auslage mit Strandspielzeug aus Plastik versteckt, bis die anderen Kundinnen und Kunden sich nicht mehr umsahen, und sich dann zum Ausgang geschlichen.
»Warum hast du das getan?«, fragte sie Gwen später, als sie nach einem drittklassigen Dinner bei Papa Gino’s wieder auf die Straße traten.
»Ich konnte dich nicht finden«, sagte Gwen, als sei das die selbstverständlichste Sache der Welt.
Stoner rutschte tiefer in ihren Autositz. »Ich hab mich so geschämt.«
»Du liebe Güte«, sagte Gwen und sah sie aus dem Augenwinkel an. »Andere Leute machen das ständig.«
»Wenn ihre Kinder verloren gehen.«
»Na ja, was die anderen Leute betrifft, hättest du doch mein Kind sein können. Sie haben doch gar nicht auf dich geachtet.«
»Kann schon sein«, murmelte Stoner. Seitdem hatte sie sich in einem Supermarkt nie wieder ablenken lassen.
Nein, Rufen würde hier nichts bringen. Nicht in Tabor. Tabor erschien ihr nicht wie eine Stadt, in der man schrie. Das Logischste wäre, loszugehen und irgendjemanden zu suchen – Dot’s Gulch wäre eine Möglichkeit, denn es war besser beleuchtet und sah freundlicher aus als alles andere, was Tabor sonst zu bieten hatte.
Sie lief darauf zu und zögerte dann.
Wenn dort niemand ist, werde ich nicht rufen. Ich werde losbrüllen. Was mitten in der Großen Unbewohnten Einöde natürlich eine sinnlose Übung wäre.
Aus dem Augenwinkel nahm sie eine Bewegung wahr. Das Herz schlug ihr bis zum Hals.
Sie sah genauer hin. Ein zerknitterter und vom Regen verwaschener Zeitungsfetzen.
Stoner zwang sich zu einem Lachen. Wenn das so weitergeht, dachte sie, als sie den Abfall aus Gewohnheit aufhob und in die Tasche steckte, bringe ich mich selbst um den Verstand, bevor irgendjemand mich auch nur angefasst hat.
Sie holte tief Luft und ging entschlossen weiter in Richtung Gulch.
Auf der Straße lagen tiefe Schatten, hart umrissen und undurchdringlich. Was von weitem wie Gassen ausgesehen hatte, wirkte jetzt wie schwarze geheimnisvolle Tunnel. Wenn sie in einen dieser Tunnel hineinsah, würde sie wahrscheinlich den Eingang zur Hölle erblicken.
Sie vergrub die Hände tief in den Taschen ihrer Jeans und nahm sich vor, Gwen zu sagen, dass sie die Horrorfilme im Nachtprogramm nicht mehr sehen wollte.
Vor dem Saloon blieb sie stehen. Es war ein zweistöckiges Gebäude. Die Fenster im Erdgeschoss waren mit schweren Vorhängen aus Sackleinen verhängt. Die Fenster im ersten Stock waren mit Spitze umrandet und führten auf Holzbalkons hinaus. Das Gebäude selbst bestand aus verwitterten Planken, die aussahen, als seien sie nie gestrichen worden. Aus seinem Innern drangen keine Geräusche, nur der Geruch von verschüttetem Bourbon und altem Tabak. Aber das Licht war hell und einladend. Sie schob sich durch die Schwingtüren.
Es war eine altmodische Westernbar mit Pokertischen, die mit grünem Filz bespannt waren, und Leuchtern aus Wagenrädern, in denen Öllampen steckten. Eine Treppe führte zu den oberen Räumen, und ein alter, silbriger, gold umrandeter Spiegel wurde von Reihen verstaubter Schnapsflaschen flankiert. Eine geschlossene Tür, die wahrscheinlich in einen anderen Raum oder nach draußen führte, duckte sich unter die Balustrade. Hinter der Bar stand eine große, kräftige, breitschultrige Frau mittleren Alters in einem tief ausgeschnittenen, bodenlangen grünen Kleid aus staubigem Velourssamt. Ihr Haar, zum Teil schon grau, hatte sie zu einer hohen Steckfrisur aufgetürmt; nur ein paar widerspenstige Strähnen an ihrem langen Nacken hatten sich gelöst. Sie polierte Gläser mit einem Baumwolltuch.
Die Frau hielt inne und starrte sie an.
Stoner schlenderte auf die Bar zu. »Hi.«
Die Frau stellte das Glas ab, stemmte ihre Hände in die Hüften und musterte sie langsam von oben bis unten. »Jee-sus!«, stieß sie hervor.
»Hi, ich bin Stoner McTavish und habe drüben auf dem Highway Probleme mit meinem Wagen gehabt. Können Sie mir sagen, wo …«
Ihr wurde bewusst, dass sie in den Lauf einer glänzenden, perlmuttbesetzten Pistole blickte. »Entschuldigen Sie«, stammelte sie.
»Wie wär’s, wenn wir die Sache ’n bisschen langsamer angehen?«, sagte die Frau. »Und leg deine Hände so hin, dass ich sie sehen kann.«
»Ja. Klar.« Sie legte die Hände oben auf den Tresen. »Ich wollte nicht … ich meine …«
Die Frau zeigte auf ihren Rucksack. Stoner streifte ihn ab und reichte ihn ihr hinüber. Ohne hinzusehen, warf die Frau ihn unter die Theke.
»Na schön, dann lass uns mal von vorn anfangen. Wie war dein Name noch mal?«
»Stoner McTavish.«
Die Frau schien ihr geistiges Namensverzeichnis durchzugehen. Sie hatte wachsame braune Augen; Hände und Unterarme waren wettergegerbt.
»Bist du sicher?«
»Ich denke schon«, entgegnete Stoner verwundert.
Die Frau kniff die Augen zusammen. »Du würdest es nicht wagen, mich für dumm zu verkaufen, oder, Belle?«
Stoner sah sie verdutzt an. »Belle?«
Die Frau nickte langsam.
»Ich kenne keine Belle«, sagte Stoner, »aber wenn ich ihr ähnlich sehe …« Sie wies mit dem Kopf auf die Pistole. »Sie sind der Boss.«
»Hier schon«, erwiderte die Frau gleichmütig.
»Ja«, meinte Stoner. »Ist … äh … Belle eine Freundin von Ihnen?«
»Freundin?«
»Hm-hm.«
»Kaum.«
Eine lange Minute verging mit Schweigen.
»Na schön«, sagte die Frau schließlich. »Auch wenn du so komische Klamotten trägst, kannst du nicht Martha Jane Cannary sein. Außer du hast seit dem letzten Mal ein paar Jahre zugelegt.«
»Nein.« Stoner war zwischen der schrecklichen Pistole und den freundlichen Augen der Frau hin- und hergerissen. »Martha Jane bin ich bestimmt nicht.«
»Langer Weg von Texas hierher, was?«
»Ich bin noch nie in Texas gewesen.«
»Wirklich?«
Stoner nickte heftig. »Klinge ich, als wäre ich aus Texas?«
Das brachte die Frau endlich zum Nachdenken. »Nein. Aber du könntest ja eine ganz gerissene Person sein.«
»Das bin ich nicht«, meinte Stoner. »Ehrlich. Da können Sie fragen, wen sie wollen.«
»Soweit ich sehe, ist niemand hier zum Fragen.«
Stoner seufzte. »Es ist doch immer dasselbe.«
»Da hast du verdammt recht.« Die Frau schien sich ein wenig zu entspannen. »Schätze, dann bist du wohl doch nicht Miss Belle. Zu schade. Ich hoffe, dass ich sie eines Tages treffe, falls der Sheriff sie nicht zuerst erwischt.«
»Meinen Sie etwa Belle Starr?«, fragte Stoner.
»Genau die. Kennst du sie?«
»Ich fürchte nein.« Sie lächelte freundlich.
Die Frau lächelte kurz zurück. »Woher kommst du?«
»Aus Boston, Massachusetts.« Sie wünschte, die Frau würde die Pistole weglegen. »Das hier ist eine Filmkulisse, stimmt’s?«
»Nein.«
»Eine Touristenstadt?«
»Nein.«
Die Unterhaltung erstarb. Und jetzt? »Tja«, sagte sie zögernd, »einen gemütlichen Laden haben Sie hier.«
»Geht so. Boston, hast du gesagt? Ganz schön weit weg von zu Hause, was?«
»Kann man wohl sagen«, stimmte Stoner ihr zu. »Ich bin gestern nach Denver geflogen, und heute bin ich den ganzen Tag gefahren.«
Die Frau entsicherte die Pistole mit einem scharfen Klick. »Das musst du mir noch mal erklären, Freundchen.«
Stoner lachte. »Sie haben echt Routine. Ich wette, die Kinder lieben das.«
Die Kugel schoss dicht an ihrem Ohr vorbei und schlug in die gegenüberliegende Wand ein. »Zwing mich nicht, das noch mal zu machen. An Kiefernbretter ist schwer ranzukommen.«
Whoa! Verrückte soll man nicht provozieren. »Okay. Tut mir leid.«
»Wirst du gesucht?«
»Gesucht?«
»Auch wenn du nicht Belle Starr bist, bist du noch lange keine ehrliche Haut. Ist der Sheriff hinter dir her?«
Stoner schüttelte den Kopf. »Nicht dass ich wüsste.« Allmählich wurde es ungemütlich. Sie bekam es mit der Angst zu tun. »Hören Sie, wenn Sie möchten, dass ich mich ausweise oder so, sehen Sie in meinem Rucksack nach. Da ist mein Führerschein drin.«
»Ein Schein für dies, ein Schein für das«, schnaubte die Frau, während es ihr gelang, den Inhalt des Rucksacks auf die Bar zu kippen, ohne Stoner aus den Augen zu lassen. »Das ist das Problem mit euch Stadtmenschen, viel zu viel Recht und Ordnung.«
»Zugegeben«, meinte Stoner. »Aber was soll man machen. Solange der Kongress nicht wagt, sich gegen den Nationalen Schusswaffenverband zu stellen, kann sich doch jeder Verrückte eine Waffe besorgen.«
Sie blickte auf die Pistole, die die Frau in der Hand hielt, und bereute es sofort, das Thema angesprochen zu haben. »Sturmgewehre. Ich meine Angriffswaffen. Nichts gegen Pistolen. Am rechten Platz sind sie okay. Als Sammlerstücke. Ein nettes, harmloses Hobby. Geschichte. Verfassungsrechte und all das Zeug. Selbstverteidigung. Hey, denken Sie nur an all die Gangs und Dealer auf der Straße. Eine Frau braucht jeden Schutz, den sie kriegen kann. Ich meine, ›Sag einfach nein‹ mag für Nancy Reagan ja schön und gut sein. Die hat ihre Leibwächter auf Lebenszeit. Aber der Rest von uns –«
»Kleine, du redest wirres Zeug«, sagte die Frau. »Bist du gerade irgendwo abgehauen?«
»Nein. Ehrlich nicht. Ich meine, sehen Sie …« Vorsichtig, mit einer, wie sie hoffte, unbedrohlichen Bewegung griff sie nach ihrer Brieftasche und klappte sie bei ihrem Führerschein auf. »Hier ist mein Führerschein. Das bin ich. Das Bild ist nicht sehr gut, aber was kann man von Passfotos schon anderes erwarten?«
Die Frau schielte auf den Führerschein. »Ja, das ist ein verdammt schlechtes Bild. Du hättest dein Geld zurückverlangen sollen.«
»Ja«, meinte Stoner. »Das werde ich beim nächsten Mal tun.«
»Mr. Brady hat mir mal angeboten, ein Porträt von mir zu machen«, sagte die Frau. Sie lachte. »Hat jedenfalls behauptet, er wäre Mr. Brady. Ich musste natürlich drauf reinfallen. Obwohl die Geschichte erstunken und erlogen war.« Sie zuckte die Achseln. »Was soll’s? Da war ich noch jung und unschuldig. Ist nichts passiert.« Sie zog Stoners Scheckkarte der Bank of New England hervor. »Was ist das denn?«
»Eine Art Kreditkarte.«
»Was macht man damit?«
»Wenn man Geld braucht, steckt man sie in den Schlitz des Geldautomaten und gibt die persönliche Geheimzahl und die gewünschte Summe ein, und dann gibt die Maschine das Geld aus.«
»Was du nicht sagst. Bei uns nennt man so was Banküberfall.«
»Nach Geschäftsschluss und an Wochenenden ist es ganz praktisch, wissen Sie, wenn man vergessen hat, zur Bank zu gehen. Ich vergesse immer, zur Bank zu gehen – Marylou meint, es liegt daran, dass ich der Bank gegenüber feindlich gesinnt bin, weil sie ein Symbol des Patriarchats darstellt. Wahrscheinlich hat sie recht. Auf jeden Fall hat’s mir eine ganze Menge peinlicher Situationen erspart.«
Die Frau steckte die Karte zurück und inspizierte die restlichen Dinge in ihrer Brieftasche – Kreditkarten, Blankoschecks, drei Quittungen von Stop & Shop, eine Saisonkarte für Crane Beach, einen Kontoauszug (zwei Monate alt), fünf Gutscheine, die sie in der Skee-Ball Alley in Old Orchard Beach gewonnen hatte, Fahrkartenabschnitte von Amtrak und ihren Büchereiausweis. Sie hielt den Rucksack hoch, schüttelte ihn aus, wühlte in den herausgefallenen Gegenständen und starrte hinein. »Keine Pistole«, sagte sie in missbilligendem Tonfall.
»Ich habe keine Pistole«, sagte Stoner. »Ich finde, es ist … gefährlich, wenn man nicht weiß, was man tut.«
»Selbst wenn man’s weiß, ist es gefährlich«, sagte die Frau und legte die Pistole auf die Bar. »Aber du spielst mit dem Feuer, wenn du dich in diesen Territorien unbewaffnet rumtreibst.«
Territorien? Die Fähigkeit dieser Frau, ihrer Rolle treu zu bleiben, beeindruckte Stoner allmählich. Falls es tatsächlich eine Rolle war. Es bestand immerhin die – bei längerem Nachdenken beängstigende – Möglichkeit, dass diese Calamity Jane tatsächlich davon überzeugt war, im Wilden Westen zu leben, mit Waffen und allem, was dazugehörte. In diesem Fall war eine Menge Vorsicht und Freundlichkeit gefragt. Sie räusperte sich. »Wie soll ich Sie nennen, Ms., Mrs., Miss …?«
Die Frau lachte. Ein volles, heiseres, sexy, whiskyraues, ›Ich-hab-schon-alles-erlebt‹-Lachen. Ein Lachen, das für Frauen mittleren Alters typisch war und Stoners Knie immer vor Aufregung ein bisschen weich werden ließ.
»Nenn mich Dot, wie alle andern auch. Na ja, die meisten nennen mich Big Dot – weil ich so imposant bin –, aber das musst du nicht.«
»Dann sind Sie also nicht verheiratet?«
»War ich mal. Mit einem Sheriff namens Paul Gillette, damals in Kansas City. Aber er war ein fauler Hund, also hab ich mich aus dem Staub gemacht. Und wie steht’s mit dir?«
Uups. »Na ja, ich bin … äh … nun ja, nicht verheiratet, aber ich lebe in einer Beziehung, wenn Sie wissen, was ich meine.«
Dot schüttelte den Kopf. »Kann ich nicht gerade behaupten.«
Und nun? Sehe ich dieser bewaffneten, wahrscheinlich verrückten Frau in die Augen und sage ihr, dass ich lesbisch bin? »Eine Freundschaft«, sagte sie zweideutig.
»Na, schön für dich. Die Welt ist kalt ohne Freunde.«
»Ich meine, es ist … na ja, eine enge Freundschaft.«
In der Hoffnung auf eine Eingebung studierte Dot einen Augenblick ihre Pistole. »Eine enge Freundin?«
»So ungefähr«, gab Stoner zu.
»Das solltest du in dieser Gegend besser für dich behalten«, meinte Dot mit leiser Stimme. »Auf so was reagieren die Leute hier nämlich sehr merkwürdig.«
»Ja«, sagte Stoner. »Das kann ich mir denken.«
»Sieh mal, du bist unbewaffnet und hast keinen Mann, der auf dich aufpasst. Damit bist du in einer verletzlichen Position.«
»Ich werd’s mir merken.«
»Hier draußen gibt’s ein paar schreckliche Leute.«
»Na ja«, sagte Stoner, um Höflichkeit bemüht, »schreckliche Leute gibt es überall.«
Dot nickte. »Sieht aus, als hättest du einen anstrengenden Weg hinter dir.«
Stoner schnippte ein paar Spritzer Colorado-Dreck von ihrer Jeans. »Ja, es war ein langer Tag. Und die Fahrt mit dem Pferdekarren war ziemlich staubig.«
»Mit welchem Pferdekarren?«
»Ein Junge hat mich fünf Meilen vor der Stadt aufgelesen.«
»Welcher Junge?«