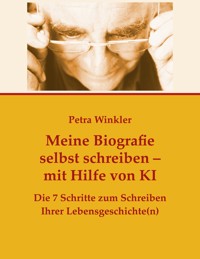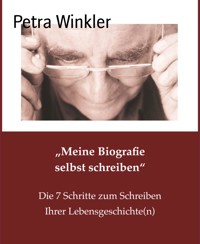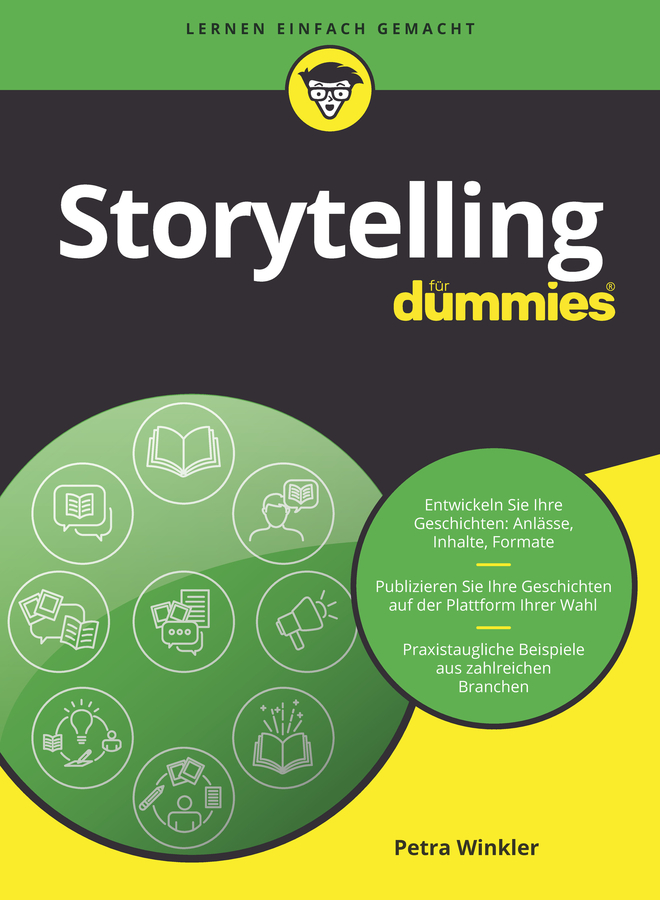
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: ...für Dummies
- Sprache: Deutsch
Sie haben ein Unternehmen gegründet und möchten sich selbst vermarkten? Sie möchten nicht einfach nur ein Produkt anbieten, sondern Erlebnisse ermöglichen und Welten öffnen? Dann ist es Zeit für Storytelling. Sie haben nicht viel Zeit und nur ein kleines Budget zur Verfügung? Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie mit wenig Aufwand Ihre ganz persönliche Geschichte entwickeln und welches Format und welche Plattform für Sie richtig sind. Lassen Sie sich von den zahlreichen praxistauglichen Beispielen in diesem Buch inspirieren und bauen Sie einen ganzen Geschichten-Fundus auf. Für Ihre Bedürfnisse und die Ihrer Kunden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Storytelling für Dummies
Schummelseite
Fakten oder Geschichten
Viele Unternehmen wollen bei der Vermarktung ihrer Produkte immer noch mit Argumenten und Fakten punkten. Doch es ist wirkungsvoller, die Botschaft in eine Geschichte zu verpacken:
Fakten geraten in Vergessenheit.
Eine gute Geschichte bleibt im Gedächtnis.
Geschichten verpacken Fakten in eine anschauliche, lehrreiche, unterhaltsame und fesselnde Form und bieten damit Infotainment (also eine Kombination aus Information + Entertainment).
Bestandteile von Geschichten
Was braucht es denn, um eine spannende Geschichte zu erzählen? Eigentlich nicht viel:
den Helden,
ein oder zwei Gegenspieler,
vielleicht noch weitere Figuren,
den Konflikt (je größer, desto besser),
die Handlung
sowie die Transformation/Veränderung.
Mögliche Themen
»Was sollen wir denn erzählen, wir haben keine Themen«, heißt es oft. Sie werden bestimmt fündig. Mit einem frischen Blick auf diese Bereiche:
das Unternehmen und seine Geschichte(n)
die Menschen im Unternehmen
die Leistungen oder Produkte
die Kunden und ihre Erfahrungen
Lieferanten und Kooperationspartner
und: was im Alltag so passiert, wofür Sie sich einsetzen, wogegen Sie kämpfen, welche Erfolge und welche Misserfolge Sie erleben, kurz gesagt, die großen und kleinen Geschichten rund um Ihr Unternehmen
Merkmale und Eigenschaften guter Geschichten
Was eine gute Geschichte ausmacht, wollen Sie wissen? Gute Geschichten sind:
einfach und leicht verständlich
emotional berührend, warmherzig oder humorvoll
spannend, überraschend und inspirierend
sinnstiftend (das ist dann die Kernbotschaft)
konkret und anschaulich
glaubwürdig
Vorteile von Geschichten
Die Vorteile von Storytelling fürs Marketing: In einer Welt austauschbarer Dienstleistungen und Produkte auf der einen Seite und informationsüberfluteter, werbebelästigter Kunden auf der anderen Seite bietet Storytelling viele Vorteile fürs Marketing:
Gute Geschichten sorgen für Neugier und gewinnen die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden.
Gute Geschichten machen komplexe Zusammenhänge verständlich.
Gute Geschichten helfen, aus der Uniformität des Wettbewerbs herauszukommen und unverwechselbar zu werden.
Gute Geschichten sprechen die unbewusste und emotionale Ebene an und bleiben besser im Gedächtnis haften.
Gute Geschichten machen abstrakte Informationen anschaulich und leicht verständlich.
Gute Geschichten schaffen eine emotionale Nähe, sie lösen im Idealfall positive Gefühle aus und liefern gleichzeitig rationale Argumente.
Berührt uns eine Geschichte emotional, bleibt sie eher in unserem Gedächtnis hängen.
Gute Geschichten bewegen – sie wirken!
Risiken und Nebenwirkungen
Auch wenn Storytelling eigentlich ganz einfach ist, achten Sie bitte auf diese Risiken:
Storytelling ist nicht geeignet für Aufschneidereien und platte Werbebotschaften, darunter leidet Ihre Glaubwürdigkeit.
Sie polarisieren sehr stark und verärgern Ihr Publikum oder einen Teil davon – möglicherweise entwickelt sich auf Social-Media-Kanälen ein sogenannter Shitstorm, den es einzudämmen gilt.
Sie berichten namentlich und/oder mit Foto über Menschen und verletzen Datenschutz und Persönlichkeitsrecht – sichern Sie sich bitte dagegen ab.
Storytelling für Dummies
Petra Winkler
1. Auflage
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage 2019
© 2018 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This book published by arrangement with John Wiley and Sons, Inc.
Alle Rechte vorbehalten inklusive des Rechtes auf Reproduktion im Ganzen oder in Teilen und in jeglicher Form. Dieses Buch wird mit Genehmigung von John Wiley and Sons, Inc. publiziert.
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Coverfoto: © bearsky23 – stock.adobe.com
Korrektur: Isolde Kommer
Satz/ePub: Reemers Publishing Services GmbH, Krefeld
Print ISBN: 978-3-527-71493-3
ePub ISBN: 978-3-527-81582-1
mobi ISBN: 978-3-527-81581-4
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelseite
Impressum
Vorwort
Geschichten verbinden – und führen zum Erfolg
Einführung
Storytelling als Schubkraft fürs Marketing
Über dieses Buch
Törichte Annahmen über die Leser
Konventionen in diesem Buch oder: Was der Leser von diesem Buch nicht erwarten kann
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Teil I: Geschichten und ihre Bestandteile
Kapitel 1: Storytelling? Geschichten? Worum geht es da?
Was ist Storytelling und wo wird es genutzt?
Arten von Storytelling
Was ist eigentlich eine Geschichte?
Gemeinsamkeiten von Geschichten
Wie Geschichten im Gehirn wirken
Kapitel 2: Die einzelnen Bausteine einer Geschichte
Keine Handlung ohne handelnde Personen
Der Zündstoff: Konflikte als Auslöser der Handlung
Darf's noch mehr sein? Weitere Elemente von Geschichten
Nicht zu vergessen: der Erzähler
Kapitel 3: Struktur und Aufbau von Geschichten
Modelle für den Aufbau von Geschichten
Aufbau und Struktur zusammengefasst
Sorgt für den Nervenkitzel: Dramaturgie und Spannungsbogen
Teil II: Planen Sie Ihre Geschichte(n)
Kapitel 4: Strategisches für den Anfang
Strategische Überlegungen zur Frage »Was bieten Sie«?
Strategische Überlegungen zur Frage »Was wollen Ihre Kunden«?
Strategische Überlegungen zu Ihren Kanälen
Eine Kommunikationsstrategie entwickeln
Kapitel 5: Die einzelne(n) Geschichte(n) planen
Die (allgemeine) Kommunikationsstrategie und die (konkrete) Geschichte
Geschichte(n) und ihre Kernbotschaft
Kapitel 6: Mögliche Themen für größere Geschichten
Entdecken Sie die bereits vorhandenen Geschichten
Die Geschichten rund um das Unternehmen
Die Geschichte des Gründers
Die Produktgeschichte(n)
Die Geschichten Ihrer Mitarbeiter und Kollegen
Aus einem externen Blickwinkel erzählt
Weitere Arten von Geschichten
Kapitel 7: (Alltags-)Praktische Impulse für kleine Geschichten
Ideen & Anregungen für alle Branchen
Ideen & Anregungen für einzelne Branchen
Teil III: Produzieren und publizieren Sie Ihre Geschichte(n)
Kapitel 8: Produzieren Sie Ihre Geschichte(n)
Zunächst: Aktivieren Sie Ihren inneren Geschichtenerzähler
Vom mündlichen zum schriftlichen Erzählen
Formate für Ihre Geschichte(n)
Fürs Auge: visuelle Medien
Einzelbilder
Animierte Bilder
Foto- oder Bilderstrecken
Dynamische Bilder
Geht aufs Ohr: auditive Medien
Fürs Hirn: textbasierte Medien
Pressemitteilungen
Weitere Medien für Auge, Ohr und Hirn
Kapitel 9: Geschichte(n) entwickeln in vier Schritten
Schritt 1: Greifen Sie auf Ihre Planung zurück
Schritt 2: Entwickeln Sie Ihre Geschichte
Schritt 3: Schreiben Sie Ihre Geschichte(n)
Schritt 4: Nochmals aus der Distanz betrachten
Kapitel 10: Publizieren Sie Ihre Geschichte(n)
Kategorien von Kanälen
Plattformen oder Kanäle für Ihre Geschichte(n)
Websites, Blogs und Nachrichten-Kanäle
Presseportale
Welche Kanäle für welche Zielgruppe(n)?
Weitere Tipps fürs Publizieren
Teil IV: Praxiserprobt: Die Beispiele für die Praxis
Kapitel 11: Leckeres zum Essen
Über den Praxisteil
LUKAS Bäcker
love me cakes
Fruchteria
Elfenküche Suppenmanufaktur
Metzgerei Claus Böbel
MeinekleineFarm.org
Kapitel 12: Genussreiches zum Trinken
Kelterei Possmann
Brauerei Kundmüller
Weingut Wirsching
Weingut Schwarz
Kapitel 13: Für Freizeit und Hobby
Spielwaren Oppeneiger
Buchhandlung Wolf
Gitarrenbau Zeal Guitars
Anita Heß, Personal Fitness Trainerin
Hundeschule Elementar
Kapitel 14: Verreisen und entdecken
Hotel Kaiserhof
Puckels Pension
Prachtlamas
Baumwipfelpfad Steigerwald
Auto- & Traktor-Museum Bodensee
Kapitel 15: Immer gut angezogen
Mey & Edlich
»Die Rockmacherin«
Spitz Maßdesign
Schuh Keller
Elten Sicherheitsschuhe
Optiker am Dom
Kapitel 16: Schöne Dinge
Manufactum
DAVOSA Uhren
Alexander von Bronewski
Mondschein
Kapitel 17: Für Haus und Garten
Kerstin Mumm Immobilien
Umzüge Wüst
Die Möbelmacher
Bettdecke.de
design@garten – Alfred Hart
Arctic Garden
Zinco
Kapitel 18: Technische Produkte und Leistungen
AfB
Beispiel zurückgezogen
Cosmo Consult
Paul Hildebrandt AG
Ingenieurbüro Stoll+Kollegen
Kübler Spedition
Kapitel 19: Wirtschaftliches und Geschäftliches
EK-Consult Unternehmensberatung GmbH
commma Unternehmensberatung GmbH
RWS Verlag
Timo Lutz Werbefotografie
»chartflipper« Thorsten Ohler
Zum Abschluss noch ein Paradebeispiel
Teil V: Der Top-Ten-Teil
Kapitel 20: 10 Punkte für die Checkliste
Thema der Geschichte und Konflikt
Der Held
Der Gegenspieler
Anfang und Einstieg
Aufbau und Struktur
Das Ende
Der Erzählstil
Das Publikum
Das Format
Der Kanal oder die Kanäle
Kapitel 21: (Fast) 10 Punkte, die Sie meiden sollten
Sich selbstverliebt zeigen
Zu detailverliebt schreiben
Unglaubwürdig oder falsch berichten
Auf Social Media zu viel Unterhaltsames teilen
Die Wiederkehr des Immergleichen
Botschaft oder Bezug nicht erkennbar
Sich zu sehr politisch positionieren
Zu schnell aufgeben
Kapitel 22: 10 Fragen, die oft gestellt werden
Warum wirken Geschichten so gut?
Alles schön und gut, aber wir sind ein kleines Unternehmen, woher sollen wir die Zeit für Storytelling nehmen?
Geht es nicht auch ohne Storytelling?
Wie oder wo kann ich Themen und Anregungen finden?
Das Kreativsein und Ideenentwickeln liegen mir nicht, was kann ich tun?
Wie wichtig ist eigentlich diese Heldenreise?
Muss ich denn richtig lange Geschichten schreiben?
Wie menschlich oder privat soll es denn sein?
Was ist, wenn negative Reaktionen kommen?
Hätten Sie noch einen letzten Tipp?
Stichwortverzeichnis
Endbenutzer-Lizenzvereinbarung
Tabellenverzeichnis
Kapitel 4
Tabelle 4.1:
Die Motivationssysteme im Vergleich
Kapitel 5
Tabelle 5.1:
Geschichten in der Kommunikationsstrategie
Kapitel 9
Tabelle 9.1:
Telling und Showing im Vergleich
Kapitel 10
Tabelle 10.1:
Insgesamt sind 52 Prozent der Nutzer männlich, 48 Prozent weiblich. Vor allem in der Altersgruppe zwischen 18 und 44 Jahren ist der Männeranteil höher als der Frauenanteil, ab 45 Jahren ist kein Unterschied feststellbar.
Tabelle 10.2:
Mehrfachnennungen waren möglich, generell liegen YouTube und Facebook weit vorne, in Österreich und in der Schweiz sind Social-Media-Kanäle sogar noch beliebter als in Deutschland.
Tabelle 10.3:
Die bei XING publizierten Daten sind leider weniger detailliert: Für Deutschland werden rund 13 Mio. Mitglieder gemeldet, für Österreich und die Schweiz je 1 Mio. Mitglieder, insgesamt also 15 Mio. Nutzer. Rund 2,5 Mio. Nutzer sind wöchentlich aktiv, meldet die ARD-ZDF-Onlinestudie.
Abbildungsverzeichnis
Kapitel 3
Abbildung 3.1: Der 5-Akte-Aufbau: Eigentlich ist die Entwicklung nicht so geradlinig wie bei einer Pyramide, sondern meist verläuft die Entwicklung zum Höhepunkt eher wellenförmig. Auch die abfallende Handlung verläuft durch die retardierenden Momente nicht exakt linear.
Abbildung 3.2: Der »Goldene Kreis« nach Simon Sinek: Zunächst kommt das »Warum«, dann das »Wie« und erst ganz zum Schluss das »Was«.
Abbildung 3.3: So baut sich ganz viel Spannung auf: Der Held wagt einen ersten Versuch – und scheitert. Er nimmt einen zweiten Anlauf – und scheitert. Die Ressourcen werden knapp – ob es beim dritten Versuch endlich klappt?
Kapitel 4
Abbildung 4.1: Ein einfacher Medienplan könnte ungefähr so aussehen. Der Tausender-Kontakt-Preis (TKP) lässt sich errechnen, indem Sie die Kosten durch die Auflage oder Höhe der Reichweite teilen und mit 1000 multiplizieren. Wenn Sie eine Anzeige gestalten lassen und dafür 500 EUR bezahlen und wenn Sie die Anzeige in einer Lokalzeitung mit einer Auflage von 40.000 Exemplaren drei Mal schalten lassen und dafür 3 x 500 EUR zahlen, liegen die Kosten bei insgesamt 2.000 EUR, die Reichweite bei insgesamt 120.000 Stück. Der Tausender-Kontakt-Preis beträgt dann 2.000 EUR geteilt durch 120.000 mal 1.000, also bei knapp 17 EUR.
Abbildung 4.2: Beispiel für einen Redaktionsplan für verschiedene Social-Media-Kanäle. Diesen Plan können Sie unter www.buchprojekt-storytelling.de/red-plan herunterladen und mit eigenen Inhalten füllen.
Kapitel 7
Abbildung 7.1: Eine der kleinen Meldungen über das, was in Puckels Pension passiert. (Mit freundlicher Genehmigung der Puckels Pension)
Abbildung 7.2: Es muss nicht unbedingt ein Foto sein – auch eine Zeichnung in der Art einer Karikatur kann Interesse und Sympathien wecken. Hier als Beispiel ein Selbstporträt des »Chartflippers« Thorsten Ohler. (Mit freundlicher Genehmigung von Thorsten Ohler)
Abbildung 7.3: Zeigen Sie Ihren Kunden, woher Sie Ihre Waren beziehen – und wenn die enge Zusammenarbeit schon seit vielen Jahren so glücklich verläuft wie zwischen Optiker am Dom in Mainz und ihrem Lieferanten Dieter Funk aus Kinsau, dann umso besser … (Mit freundlicher Genehmigung von Optiker am Dom)
Abbildung 7.4: Sie oder Ihr Lieferant haben eine neue, verbesserte Produktvariante entwickelt – ein guter Anlass für eine Geschichte. Hier ein Auszug aus dem Blogbeitrag »Auf einen Schweinetee bei Gut Hirschaue«, www.meinekleinefarm.org/blogs/news/auf-einen-schweinetee-bei-gut-hirschaue. (Mit freundlicher Genehmigung von meinekleinefam.org)
Abbildung 7.5: Kundenlob mit 10 Gründen – mit diesem Beitrag erreichte Schuh Keller auf Facebook auf einen Schlag 13.500 Leser. (Mit freundlicher Genehmigung von Schuh Keller)
Abbildung 7.6: Der Höhepunkt der Jahreskonferenz von Cosmo: 500 Mitarbeiter bauen ein riesiges Floß zusammen. (Mit freundlicher Genehmigung von Cosmo)
Abbildung 7.7: Mit einer Fotoaktion hat DAVOSA seine Kunden aufgerufen, auf Instagram unter dem Hashtag #apneaworldtour und #DAVOSAmoment ihre Erlebnisse und schönen Momente mit den Uhren zu posten, und daraufhin sind viele tolle Fotos eingegangen. (Mit freundlicher Genehmigung von Davosa)
Kapitel 8
Abbildung 8.1: Ein kurzer Text mit einer Erklärung und dann ein eindrucksvolles Bild – auch wenn mit dem Bild keine komplette Geschichte erzählt wird, wird der Betrachter über die Größenunterschiede der Traktoren angeregt nachzudenken, wie die beiden wohl verladen wurden, woher sie kommen, wohin sie gehen oder was hinter der Geschichte der beiden Traktoren steckt – der Betrachter wird involviert und wenn es ihn richtig fasziniert, wird er auch die Ausstellung besuchen … (Mit freundlicher Genehmigung des Auto & Traktor Museums Bodensee)
Abbildung 8.2: Auch Infografiken können eine Geschichte erzählen. Diese Infografik von »Chartflipper« Thorsten Ohler erzählt zum Beispiel, was rund um das Jahr auf einem Erdbeerfeld passiert. (Mit freundlicher Genehmigung von Thorsten Ohler)
Abbildung 8.3: So könnte ein Storyboard beispielsweise aussehen.
Abbildung 8.4: Social Media geht auch offline: die Online-Beiträge ausgedruckt am Eingang zum Ladengeschäft der Metzgerei Böbel für die Kunden, die überhaupt nicht oder nicht regelmäßig im Internet sind. (Mit freundlicher Genehmigung der Metzgerei Böbel)
Kapitel 9
Abbildung 9.1: Sie müssen nicht nur über Erfolge erzählen – zeigen Sie doch auch einmal, gegen welche Schwierigkeiten und Hindernisse Sie kämpfen müssen oder was Ihren Zeitplan ruiniert (wie bei einer solchen Panne). (Mit freundlicher Genehmigung von Umzüge Wüst)
Abbildung 9.2: Sogar bei Ingenieurbüros können witzige Situationen auftreten, zum Beispiel wenn ein Kfz-Sachverständiger ein Auto besichtigen will und ihm bestätigt wird, das Auto stehe zum Besichtigen in der Garage – bei einem so humorvoll aufbereiteten Kurzformat ist Unterhaltungswert garantiert. (Mit freundlicher Genehmigung von Stoll + Kollegen Ingenieurbüro)
Guide
Cover
Inhaltsverzeichnis
Fangen Sie an zu lesen
Seitenliste
1
2
3
4
7
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
85
86
87
89
90
91
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
241
242
243
244
245
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
263
264
265
266
267
268
269
271
272
273
274
275
277
278
279
280
281
282
283
284
285
287
288
289
290
291
292
293
294
295
297
298
299
300
301
302
303
305
306
307
309
311
312
313
315
316
317
318
319
321
322
323
324
Vorwort
Geschichten verbinden – und führen zum Erfolg
Menschen mögen Geschichten. Das war früher so, das ist auch heute noch so. Und diese Macht und Magie von Geschichten können auch kleinere und mittlere Unternehmen für sich nutzen.
Über die Erfolge des Storytelling kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Nachdem ich den elterlichen Betrieb in der Baubranche übernommen habe, begann ich bald, meine ersten Geschichten auf dem Blog zu erzählen.
Vor rund fünf Jahren bin ich nochmals intensiver ins Storytelling eingestiegen, weil es mir Spaß machte und weil ich den Spannungsbogen um eine Geschichte besser nutzen wollte. Das Schreiben von Geschichten ist inzwischen fester Bestandteil meines Berufslebens. Warum auch nicht? Das Leben selbst schreibt Geschichten. Jede Baustelle schreibt Geschichte. Jedes Haus schreibt Geschichte. Die jeweiligen Besonderheiten herauszuarbeiten, kitzelt meinen Forscherdrang und bringt zudem tiefere Einsichten.
Auch wenn der Erfolg nicht unbedingt in Zahlen messbar ist, bekomme ich viele Rückmeldungen durch Weiterempfehlungen von Kunden. Wenn ich in einer Geschichte über eine bestimmte Aufgabe erzähle, merken sich die Menschen da draußen diese Geschichten und verbinden die Aufgabe mit der Firma Eberle, sodass sie früher oder später auf uns zukommen und ihren Bedarf verkünden.
Meiner Erfahrung nach trägt Storytelling dazu bei, in einer durch und durch technisierten Welt ein Gegenangebot zu entwickeln, um die Welt etwas menschlicher zu machen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Menschen gut auf Geschichten ansprechen – denn Geschichten verbinden, schaffen ein Gefühl der Nähe. Und das ist heute wichtig, sogar sehr wichtig.
Ich möchte Sie ermutigen, Ihr Marketing mit Geschichten zu bereichern. Nutzen Sie das noch brachliegende Potential in Ihrem Unternehmen, nutzen Sie die vielfältigen Anregungen dieses Buches und legen Sie direkt los! Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei und vor allem viel Erfolg!
Heike Eberle
Eberle Bau
Einführung
»Wir ertrinken in Informationen, aber hungern nach Wissen«, sagte John Naisbitt vor bald 50 Jahren. Und die Flut an Informationen wird immer stärker, nicht zuletzt durch die immer größere Anzahl an Kanälen im Internet.
Neben dem Internet gibt es (laut Wikipedia) in Deutschland zudem rund 120 frei empfangbare, überregionale Fernsehsender und über 80 Sender im Bezahlfernsehen. In Österreich sind es fast 30 und in der Schweiz fast 40 Fernsender. Die Zahlen für die Zeitungen und Zeitschriften mit ihren Werbebeilagen gehen in die Tausende, dazu noch Plakatwände, Bannerwerbung, Werbemails usw. – unsere Aufmerksamkeit ist wertvoll.
Noch vor wenigen Jahren waren die Menschen etwa 3.000 Werbebotschaften am Tag ausgesetzt, inzwischen dürften es 5.000 sein und manche Schätzungen gehen sogar von 10.000 Werbebotschaften aus, die täglich auf uns einprasseln – und nur die wenigsten werden überhaupt noch wahrgenommen.
Storytelling als Schubkraft fürs Marketing
In unserem schnelllebigen, multifokussierten Alltag zwischen Computer, Smartphone und ständigen Ablenkungen ist unsere durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne (so eine Studie aus dem Jahr 2015) von zwölf auf acht Sekunden abgesunken. Hingegen sollen es Goldfische schaffen, sich ganze neun Sekunden auf eine Sache zu konzentrieren. Kein Wunder, dass Spötter sagen, die Aufmerksamkeitsspanne des Menschen sei unter die Konzentrationsfähigkeit eines Goldfischs gesunken.
Für das Marketing von Unternehmen bedeutet das: Entweder können Sie Ihr Publikum innerhalb weniger Sekunden fesseln oder Ihr Publikum taucht nur kurz auf und verschwindet gleich wieder. Sie müssen also einen Angelhaken auswerfen, der schnell neugierig macht auf mehr.
Wenn es eine Eier legende Wollmilchsau für die Kommunikation oder die Übermittlung von Botschaften gibt, dann sind das Geschichten. Geschichten haben unendlich viele positive Eigenschaften und Vorteile:
Geschichten wecken unsere Neugier und Anteilnahme, bieten Unterhaltung und Entspannung, verschaffen Aufmerksamkeit.
Sie helfen, alle Sinne anzusprechen, was im neuronalen Netz für Impulse sorgt.
Sie wecken Assoziationen, sie geben Raum für Interpretationen und sorgen so dafür, dass sich im Gehirn etwas »bewegt«.
Sie sprechen eine größere Zahl an Lesern oder Zuhörern an (nicht nur die Kern-Zielgruppe, sondern z. B. auch Journalisten).
Abstrakte Informationen werden anschaulicher und leichter verständlich, gute Geschichten zeigen Zusammenhänge auf und wirken sinnstiftend.
Geschichten können harte Fakten oder komplexe Sachverhalte spannend verpackt und in vereinfachter Form unaufdringlich vermitteln.
Sie sprechen unsere unbewusste Seite an, sie fesseln das Hirn und berühren vielleicht sogar das Herz, beeinflussen unser Denken und Handeln und bleiben eher im Gedächtnis.
Und auch ganz wichtig: Gute Geschichten tragen dazu bei, sich aus der Vielzahl der Wettbewerber deutlich abzuheben und unverwechselbar zu werden.
Die Macht und Magie von Geschichten nutzen
Unternehmen können Geschichten nutzen und damit zeigen
wer hinter dem Unternehmen steht, wie die Menschen sind, die für das Unternehmen arbeiten,
für welche Werte das Unternehmen steht, welcher Vision/Mission das Unternehmen folgt,
wie ihre Produkte oder Leistungen ein Problem/einen Konflikt lösen oder einen Wunsch erfüllen.
Über dieses Buch
Warum bei einem Buch über Storytelling nicht mit einer Story beginnen? Lassen Sie uns mit meiner Geschichte beginnen: Seit mehr als 20 Jahren arbeite ich als Texterin, entweder für Agenturen oder für eigene Kunden. Vor rund 15 Jahren habe ich für Auftraggeber aus der IT ab und zu Kundenberichte (im Marketing-Denglisch auch Case Study oder Success Story genannt) getextet und (damals eher unbewusst) darauf geachtet, die Geschichten spannend zu gestalten, mit Hindernissen oder Zeitdruck oder anderen Herausforderungen. Bei diesen Kundenberichten damals ist mir bewusst geworden, dass es viel wirksamer ist, Nutzen und Vorteile eines Produkts nicht per Imagewerbung zu kommunizieren, sondern in Form einer Geschichte.
»Storytelling für Dummies« für mich
Vor mehr als 10 Jahren wollte ich mehr über Storytelling lernen und habe an einem Seminar teilgenommen. Die Dozentin war sehr nett, die Seminarinhalte waren gut ausgewählt, allerdings waren mir die Inhalte bereits weitgehend aus dem Studium der Sprach- und Literaturwissenschaft bekannt, sodass ich nicht viel Neues gelernt habe.
Das Thema Storytelling hat mich aber nicht losgelassen. Und so habe ich in den folgenden Jahren zwischen den verschiedenen Aufträgen immer mal wieder ein Fachbuch gekauft und gelesen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Beispiele in den meisten Storytelling-Büchern entweder von großen Konzernen oder aus Hollywood-Spielfilmen stammen – jedenfalls dürfte das Budget für Planung, Verfilmung und Verbreitung dieser »Stories« entsprechend hoch gewesen sein.
Was soll ein kleines Unternehmen mit kleinem Budget mit diesen Beispielen anfangen? Über viele Jahre hinweg habe ich kein Buch über Storytelling für das Marketing entdeckt, das für kleinere Unternehmen eine passende Auswahl an praxistauglichen und umsetzungsfähigen Beispielen zu bieten hatte. Und irgendwann kam der Impuls: Dann muss dieses Buch über Storytelling für kleine Unternehmen endlich einmal geschrieben werden.
»Storytelling für Dummies« für Sie
Das war in Kurzform die Geschichte zur grundlegenden Idee für das Buch, das Sie nun in Ihren Händen halten. Es soll ein Buch über Storytelling sein, das bei Ihnen eine ganz eigene Erzählung in Gang setzt: nämlich die Geschichte, wie Sie Storytelling für sich entdecken und einsetzen.
Ein kleiner Mann in meinem Ohr flüstert mir gerade zu, welche Vorbehalte oder Einwände Sie vermutlich ins Feld führen werden. Wenn ich mit kleinen Unternehmen im Gespräch bin, bekomme ich häufig folgende Argumente zu hören:
»Geschichten erzählen? Wir verkaufen doch bloß unsere Produkte und haben gar keine Geschichten, die wir erzählen können!« »Geschichten erzählen? Nee, was bei uns passiert, interessiert doch niemanden da draußen!« »Geschichten erzählen? Jemand wie ich kann so etwas doch gar nicht!«
Mit diesem Buch möchte ich Ihnen zeigen, dass es vielen kleinen Unternehmen möglich ist, mit einfachen Bordmitteln und etwas Geschick ihr eigenes Storytelling zu betreiben. Mit diesem Buch möchte ich Ihnen Mut machen, das Geschichtenerzählen für sich auszuprobieren. Und so werden Sie in diesem Buch ein wenig theoretischen Hintergrund kennenlernen und natürlich auch die obligatorische Heldenreise. Kein Storytelling-Buch kommt ohne diese Heldenreise aus. Aber muss Storytelling wirklich diesem oder einem anderen Schema folgen? Kann Storytelling nicht sehr viel simpler und einfacher sein? »Storytelling einfach gemacht« ist die Devise dieses Buchs und so werden Sie neben Theorie und Modellen vor allem viele Ideen und Anregungen für die Umsetzung in der Praxis finden. Folgen Sie mir einfach durch die weiteren Seiten hindurch.
Törichte Annahmen über die Leser
Vermutlich hat jeder Buchautor ein Bild seiner Leser vor Augen, wenn er (oder sie) mit dem Schreiben beginnt: Wer ist der Leser bzw. die Leserin? Welche Fragen bewegen ihn oder sie? Welche Antworten erwartet er oder sie von dem Buch? Kurz und gut: Für wen ist dieses Buch eigentlich gedacht?
Gedacht ist das Buch vor allem für alle Unternehmen, die keine große Marketingabteilung mit einer Handvoll versierter Marketingprofis haben und die ihr Storytelling aus eigener Kraft (bei womöglich recht kleinem Budget) neben dem Alltagsgeschäft stemmen müssen:
angefangen bei Solo-Selbstständigen oder kleinen Unternehmen, in denen sich der Chef oder die Chefin höchstpersönlich (und vielleicht noch eine Bürokraft) um das Marketing kümmert – aber das zusätzlich zum Kerngeschäft und den eigentlichen Aufgaben …
bis zu mittleren Unternehmen, in dem es zwar Mitarbeiter für das Marketing gibt, die jedoch als Allrounder alle Marketingaufgaben von der Gestaltung der Broschüre bis zur Pflege der Website stemmen müssen und die aus diesem Grund bislang nur wenig Zeit hatten, sich intensiv mit Storytelling-Fragen zu beschäftigen
Und nicht zuletzt: Existenzgründer – wer noch in den Startlöchern zur Existenzgründung steht oder vor Kurzem frisch angefangen hat, könnte sich den Start in ein gutes Marketing erleichtern, indem er Storytelling nutzt – gerade die Frage, warum es zur Gründung kam, könnte eine richtig gute Geschichte ergeben.
Die meisten Vollblut-Marketingprofis haben sich vermutlich bereits mit Storytelling beschäftigt und einige Bücher oder Artikel gelesen. Dennoch hoffe ich, dass sie in »Storytelling für Dummies« noch die eine oder andere nützliche Anregung finden.
Konventionen in diesem Buch oder: Was der Leser von diesem Buch nicht erwarten kann
Eben ging es um die Frage, für wen das Buch gedacht ist und welche Fragen es beantworten kann. Ehrlicherweise wäre noch zu ergänzen, was dieses Buch nicht leisten kann und welche Fragen oder Themen nicht ausgeführt werden:
Sprachliche Fragen I
Männer und Frauen in beiden grammatischen Formen explizit zu nennen, mag im Sinne einer Gleichstellung wichtig sein. Aber die Nennung beider grammatischer Geschlechter (ob in beiden Formen oder mit Unterstrich oder Sternchen oder wie auch immer) verringert die Lesbarkeit und Verständlichkeit von Texten. Aus diesem Grund soll im Buch künftig ganz allgemein der Leser angesprochen werden – und gleichzeitig ist natürlich jede einzelne Leserin ebenfalls gemeint (und natürlich auch die Menschen, die sich weder dem einen noch dem anderen Geschlecht eindeutig zugehörig fühlen).
Sprachliche Fragen II
Die Verwendung der Marketingfachsprache mit der Vielzahl englischer Begriffe folgt in diesem Buch der Regel »so viel wie nötig und so wenig wie möglich« – weitere Einzelheiten können Sie unter www.buchprojekt-storytelling.de/marketingbegriffe nachlesen.
Technische Fragen
Es würde den Umfang des Buches ausufern lassen, wenn bei den Abschnitten über Blogs oder Social-Media-Kanäle oder beim visuellen Storytelling eine Erklärung folgen müsste, wie Sie als Leser einen Social-Media-Kanal eröffnen und einrichten oder wie Sie mit Ihrer Kamera einen Film bearbeiten und bei YouTube hochladen können – diese und ähnliche Fragen kann das Buch nicht abdecken. Daher hoffe ich, Sie haben bereits Ihre Social-Media-Plattformen in Betrieb genommen oder können die Einrichtung Ihrer Social-Media-Kanäle bei Facebook, Twitter, YouTube & Co. selbst in die Wege leiten. Auch zu anderen technischen Fragen über Fotos oder Videos oder Grafiken werden Sie in diesem Buch keine Anleitung finden.
Weitere inhaltliche Fragen
Das Manuskript ist sehr umfangreich geworden, am Ende wurden daher die Inhalte auf eine begleitende Website ausgelagert, die für die praktische Anwendung weniger wichtig sind. Diese Inhalte sind zu finden unter www.buchprojekt-storytelling.de unter verschiedenen Links – besonders interessante Inhalte sind in besonderer Form www.buchprojekt-storytelling.de/xxxxx typografisch hervorgehoben.
Rechtliche Fragen
Allgemeine Hinweise auf rechtliche Aspekte finden Sie unter www.buchprojekt-storytelling.de/rechtliches, aber es sind nur allgemeine Hinweise. Um auf der sicheren Seite zu sein, sollten Sie sich selbst einen Überblick verschaffen über die rechtlichen Rahmenbedingungen für das Publizieren von Inhalten in Bild und Text wie beispielsweise das Urheber- bzw. Nutzungsrecht beim Verwenden fremden Bildmaterials, das Persönlichkeitsrecht für die Abbildung identifizierbarer Personen und natürlich auch die Vorgaben des Datenschutzes. Nicht zu vergessen das Wettbewerbsrecht. Weitere Einzelheiten finden Sie bei einer gründlichen Recherche im Internet und bei Detailfragen wenden Sie sich am besten an einen Juristen.
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Das Buch ist in fünf Teile gegliedert, die nicht unbedingt in ihrer Reihenfolge gelesen werden müssen. Sie können sich gern das herauspicken, was für Sie besonders interessant oder wichtig ist. An einigen Stellen finden Sie auch auf Links zur Website oder Querverweise zu vorigen oder späteren Kapitel oder Abschnitten, die Sie bei Bedarf nachschlagen können.
Teil I: Geschichten und ihre Bestandteile
Im ersten Teil finden Sie wichtige Details über Geschichten, ihre Bausteine und Elemente sowie über Struktur und Aufbau zahlreicher Erzählmodelle.
Teil II: Planen Sie Ihre Geschichte(n)
Im zweiten Teil wird es zunächst etwas theoretisch, aber nach den strategischen Überlegungen erhalten Sie einen ganzen Werkzeugkoffer voller Ideen und Impulse über mögliche Themen – zunächst eher allgemein, danach mit vielen branchenübergreifenden und branchenspezifischen Tipps für die Praxis.
Teil III: Produzieren und publizieren Sie Ihre Geschichte(n)
Vom Planen übers Produzieren zum Publizieren: In Teil 3 finden Sie alle wichtigen Schritte sowie viele weitere Tipps fürs Umsetzen.
Teil IV: Die Praxis-Beispiele
Storytelling für Dummies will nicht nur Wissen vermitteln, sondern vor allem praktische Hilfe bieten. Daher gibt es noch einen Praxisteil mit vier Dutzend Beispielen von Unternehmen vieler Größen und Branchen. Ob Sie selbst ein Einzelunternehmer sind oder ob Sie im Marketing für ein größeres Unternehmen tätig sind, ob Sie Produkte herstellen und verkaufen oder ob Sie Dienstleistungen erbringen: Nutzen Sie die Praxisbeispiele zum Herumstöbern und lassen Sie sich inspirieren.
Teil V: Der Top-Ten-Teil
Kein für-Dummies-Buch ohne einen Top-Ten-Teil! Die jeweils 10 Tipps, Fragen und Hinweise in diesem Teil liefern nicht nur 10 Punkte für eine Checkliste, sondern auch Tipps, um Fehler und Fettnäpfchen zu vermeiden, und am Ende noch 10 Fragen, die oft gestellt und hier beantwortet werden.
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
In diesem Buch werden Sie verschiedenen Symbolen begegnen, die Ihnen besondere Inhalte anzeigen. Die Bedeutung der Symbole erklärt sich (fast) von selbst:
Dem Symbol mit dem Techniker begegnen Sie etwas häufiger, dieser zeigt Ihnen wichtige Fragen oder Themen an.
Mit diesem Symbol wird eine Definition oder grundlegende Erklärung kenntlich gemacht.
Das Symbol für einen Tipp lässt Ihnen bei der praktischen Umsetzung ein Licht aufgehen.
Immer wenn Sie dieses Symbol sehen, werden Sie ein besonders prägnantes Beispiel finden (wobei es im Buch von Beispielen nur so wimmelt).
Sie suchen nach einer Übung? Bei diesem Symbol werden Sie fündig.
Nur selten wird Ihnen dieses Symbol begegnen: nämlich für Randbemerkungen, die eher nebenbei interessant sind.
Wie im echten Leben signalisiert das Ausrufezeichen einen wichtigen Hinweis, vielleicht sogar einen Warnhinweis.
Wie es weitergeht
Fangen Sie am besten jetzt schon an zu erzählen! Über sich und Ihr Unternehmen, Ihre Produkte, Ihre Kunden, Ihre Mitarbeiter und alles Mögliche, was im betrieblichen Alltag passiert. Sie müssen damit nicht warten, bis Sie das Buch von der ersten bis zur letzten Seite durchgelesen haben.
Sie zögern noch, weil Sie nicht so recht wissen, wie das Geschichtenerzählen geht? Sie wollen zuerst mehr erfahren, um mit mehr Mut Ihr Storytelling zu starten? Dann können Sie zumindest damit anfangen, erste Ideen und Notizen aufzuschreiben und zu überlegen, welche Besonderheiten oder Ereignisse es bei Ihnen zu erzählen gibt.
Probieren Sie auch den Einstieg, Ihre ersten Geschichten mündlich in einem Gespräch zu erzählen, einfach so aus dem Bauch heraus. Stellen Sie sich vor, jemand fragt Sie nach der Gründungsgeschichte oder nach dem, was Sie oder Ihre Produkte leisten, was die Produkte bewirken und was Ihre Kunden damit schon erlebt haben. Auch das mündliche Erzählen kann als guter Einstieg dienen …
Teil I
Geschichten und ihre Bestandteile
IN DIESEM TEIL …
… Ihres Dummies-Buches geht es um die Grundlagen des Storytellings und des Geschichtenerzählens. Zur Einführung streifen wir kurz die verschiedenen Bereiche und Arten des Storytellings. Und wir schauen uns an, was eine Geschichte ist und welche Gattungen, Formen und Gemeinsamkeiten es gibt. Zu den Grundlagen des Storytellings gehört auch die Frage, warum Geschichten in unserem Gehirn so gut wirken. Also schweifen wir kurz ab in die Gehirnforschung und kehren dann zurück zu dem, was Storytelling ausmacht, und zur Frage, warum Geschichten von Menschen für Menschen auf dem Markt so wichtig sind.
Im zweiten Kapitel geht es um die Bestandteile oder die Bausteine von Geschichten und hier vor allem um Helden, Gegenspieler sowie andere handelnde Personen. Ein wichtiger Abschnitt widmet sich den Konflikten als Auslöser der Handlung. Und zum Ende sollten wir auch den Erzähler selbst nicht vergessen.
Das dritte Kapitel geht sehr detailliert auf die Möglichkeiten für Aufbau und Struktur von Geschichten und bewährte Erzählmodelle ein. Und damit es richtig spannend wird, geht es in diesem Kapitel anschließend um die Frage von Dramaturgie und Spannung.
Kapitel 1
Storytelling? Geschichten? Worum geht es da?
IN DIESEM KAPITEL
Was ist Storytelling, wo wird es eingesetzt und welche Arten gibt es?
Was sind Geschichten? Welche Gemeinsamkeiten weisen sie auf?
Welche Wirkung haben Geschichten im Gehirn?
Und was hat das alles mit Ihrem Marketing zu tun?
Gleich am Anfang geht es um Grundlagen zum Storytelling für das Marketing kleiner und mittlerer Unternehmen. Das beginnt logischerweise bei der Frage, was Storytelling überhaupt ist und wo diese Form des Geschichtenerzählens eingesetzt wird. Und natürlich stellt sich die Frage: Was ist eigentlich eine Geschichte? Gibt es vielleicht Gemeinsamkeiten, die für alle Geschichten zutreffen? Nicht zu vergessen die Frage, warum unser Gehirn so auf Geschichten programmiert ist und wie sich das fürs Marketing nutzen lässt.
Was ist Storytelling und wo wird es genutzt?
Der Begriff Storytelling bedeutet nichts anderes als das Erzählen von Geschichten, er setzt sich zusammen aus den englischen Wörtern für Geschichte (story) und Erzählen (telling).
Storytelling wird übrigens nicht nur im Marketing eingesetzt, sondern in vielen weiteren Bereichen wie in der Pädagogik (wo Wissen mithilfe von Geschichten vermittelt wird), in der Psychologie (wo es beispielsweise in einer Therapie darum geht, sich mit der eigenen biografischen Geschichte auseinanderzusetzen) und im Journalismus (wo Informationen oder Argumente in Form beispielhafter Geschichten transportiert werden).
Storytelling in Unternehmen
Storytelling wird auch in Unternehmen eingesetzt, und das in vielfältiger Weise: So kann es im Rahmen der Wissensvermittlung genutzt werden (auch Knowledge Management genannt), beispielsweise wenn Nachwuchskräften über die bisherige Entwicklung des Unternehmens erzählt wird. Ein ähnlicher Einsatzbereich wäre, wenn der Belegschaft über künftige Entwicklungen erzählt, also wohin die Reise gehen soll und aus welchem Grund (auch als Change Management bezeichnet).
Ein breites Einsatzfeld bietet das sogenannte Leadership Storytelling, das von Unternehmens- oder auch Teamleitern genutzt wird, um entweder intern vor Mitarbeitern oder vor einem externen Publikum für das Unternehmen und die weitere Entwicklung oder für ein Produkt zu begeistern.
Und schließlich gibt es noch das Marketing Storytelling, bei dem es darum geht, Kunden die Produkte und Leistungen des Unternehmens näher zu bringen. Viele große Unternehmen nutzen es gezielt, um beispielsweise mit ihrer Gründungsgeschichte zu punkten. Sie kennen das ja: Da sind ein oder zwei junge IT- oder Elektronik-Profis mit einer Vision von günstiger und benutzerfreundlicher Software oder Computern oder einem anderen Gerät. Weil am Anfang kein Geld da ist, werden die ersten Teile in Papas Garage zusammengeschraubt. Irgendwann reicht das Geld für ein kleines Büro und quasi über Nacht findet das Produkt so viele begeisterte Anhänger, dass es nach wenigen Jahren auf der ganzen Welt zu finden ist.
Diese Geschichten, wie aus einer Garage ein multinationales Unternehmen entsteht, weckt Emotionen, schafft Sympathien – und genau aus diesem Grund werden solche Gründungsgeschichten von großen Unternehmen erzählt. Aber ist auch Storytelling für kleinere Unternehmen möglich? Und wenn ja, wie geht das? Genau diese Frage wird hier in den folgenden Kapiteln beantwortet. Aber zunächst noch ein wenig Grundlagenwissen …
Arten von Storytelling
Speziell im Bereich Storytelling fürs Marketing haben sich in den letzten Jahren verschiedene Kategorien oder Arten von Storytelling entwickelt:
Wichtig ist die Unterscheidung zwischen dem traditionellen linearen Lesen und dem nicht-linearen Lesen, das sich durch die Entwicklung von Hypertext und Hyperlinks verbreitet hat. Wer sich weiter in dieses Thema vertiefen will, findet unter www.buchprojekt-storytelling.de/storytelling-arten zusätzliche Informationen.
Häufig genutzt wird der Begriff Digital Storytelling – in der Regel handelt es sich um eine normale Geschichte, die linear als Text, Bild oder Film erzählt und in digitaler Form präsentiert wird.
In den letzten Jahren ist der Textanteil immer kleiner geworden, die meisten Geschichten werden stärker in Form von Fotos oder Videos erzählt und diese visuell orientierte Erzählform wird unter dem englischen Begriff Visual Storytelling zusammengefasst. Wie das in der Praxis genutzt werden kann, wird später im Kapitel 8 im Abschnitt Formate für Geschichten gezeigt.
Mithilfe von Data Storytelling (www.buchprojekt-storytelling.de/data) werden Zahlen oder Fakten in eine Geschichte eingebunden, um damit die Aufmerksamkeit und die Erinnerungsfähigkeit des Lesers oder Betrachters zu erhöhen. Beispiele dafür finden Sie in Kapitel 7 im Unterabschnitt Mit Statistiken spielen.
Das transmediale Storytelling dürfte für die meisten KMU-Unternehmen weniger interessant sein, weil es ziemlich viel Ressourcen bindet. Falls Sie sich dennoch dafür interessieren, finden Sie unter www.buchprojekt-storytelling.de/transmedial vertiefende Informationen. Ähnlich verhält es sich mit dynamischem Storytelling, bei dem jemand eine Geschichtenwelt erschafft, aber eine Fangemeinde diese Geschichten aufgreift und eigenständig weiterentwickelt. Auch das dürfte bei den meisten kleineren Unternehmen nicht passen. Ein umfangreiches Beispiel für ein von der Fangemeinde weiterentwickeltes Computerspiel ist unter www.buchprojekt-storytelling.de/dynamisch-beispiel zu finden.
Was für KMU-Unternehmen hingegen passen könnte, ist das crossmediale Storytelling, bei dem eine Geschichte über mehrere Medien oder Kanäle erzählt oder fortgeführt wird. Mehr dazu unter www.buchprojekt-storytelling.de/crossmedial und später noch Kapitel 8 im Unterabschnitt Den Medienmix nutzen.
Was ist eigentlich eine Geschichte?
Jetzt ist bereits mehrere Male der Begriff »Geschichte« aufgetaucht, aber was ist eigentlich damit gemeint? In der Literaturwissenschaft steht dieser Begriff für eine mündliche oder schriftliche Erzählung, die auf einem realen oder einem fiktiven Geschehen beruht und dieses Geschehen in einer nachvollziehbaren Reihenfolge (logisch bzw. chronologisch) wiedergibt. Diese nüchterne Definition erklärt aber nicht das Geheimnis von Geschichten. Für unser Storytelling dienlicher wäre folgende Erklärung:
Geschichten sind Erzählungen, die uns neugierig machen auf den Hintergrund oder die Vorgeschichte und vor allem, wie es weitergeht. Häufig weisen sie uns auf Probleme und Konflikte hin, und wie diese gelöst werden können. Nicht zu vergessen: Bei kleineren Geschichten geht es weniger um eine wichtige Botschaft, sondern oft nur darum, uns in unserem Alltag kurz nachdenklich oder auf etwas aufmerksam zu machen oder uns eine kurze Form von Unterhaltung zu bieten.
Geschichten gibt es in ganz unterschiedlichen Formen oder Gattungen. Diese vielfältigen Gattungen oder Genres weisen zum Teil sehr große Unterschiede auf, nicht nur in ihrer Form, sondern vor allem auch im Umfang. Eine Fabel kann in wenigen Sätzen eine ganze Geschichte erzählen, ein Roman kann mehrere Hundert Seiten umfassen. Eine Geschichte kann eine Anekdote oder einer Ballade sein, ein Bilderbuch, ein Theaterstück oder ein Hörspiel. Wer sich über die zahlreichen literarischen und journalistischen Gattungen informieren möchte, findet unter www.buchprojekt-storytelling.de/gattungen eine Zusammenstellung.
Fürs Storytelling interessant zu wissen: Wer eine Geschichte erzählt, will in der Regel auch eine bestimmte Botschaft übermitteln. vielleicht eine wichtige Erfahrung oder eine neue Idee. Manchmal geht es aber nicht um eine bestimmte Botschaft, sondern manchmal will eine Geschichte einfach nur unterhalten, ein Rätsel aufgeben oder angenehm überraschen. Schon im alten Rom unterschied Horaz die Textfunktionen prodesse (nützen) und delectare (unterhalten).
Im Idealfall verbindet eine Geschichte beide Funktionen: Sie ist nützlich und unterhaltsam zugleich – heutzutage auch bekannt unter dem Schlagwort Infotainment (aus Information und Entertainment zusammengesetzt).
Sie möchten jetzt schon aktiv werden? Beginnen Sie mit einer einfachen Aufgabe: Sammeln Sie Geschichten für ein Kuriositätenkabinett – kurze Stichpunkte reichen. Mit der Zeit entwickelt sich ein Geschichten-Fundus und wenn längere Zeit gar keine Geschichte aus Ihrem betrieblichen Alltag zu finden ist, können Sie hin und wieder eine Geschichte aus Ihrem Fundus herausholen und erzählen.
Gemeinsamkeiten von Geschichten
Trotz aller Unterschiede gibt es einige Elemente oder Bestandteile, die immer wieder in Geschichten vorkommen. So enthält eine Geschichte in der Regel
einen Anfang oder die Ausgangssituation,
eine handelnde Person (auch Held oder Protagonist genannt),
häufig auch einen Gegenspieler (Antagonist genannt),
ein Ereignis oder ein Problem oder eine Herausforderung, wodurch der Held in eine Konfliktsituation gerät.
Durch den Konflikt kommt es zu einer Veränderung (Transformation).
Am Ende steht (im Vergleich zur Ausgangssituation) eine veränderte, neue Situation.
Der Anfang, der Held, vielleicht ein Gegenspieler, der Konflikt, die Veränderung mit dem Ende – diese Bausteine zeigen sich auch im dramaturgischen Aufbau. Die Geschichte ist gekennzeichnet von einem Prozess, der mit dem Anfang beginnt, durch den Konflikt und getragen von einem Spannungsbogen auf einen Höhepunkt zusteuert (siehe auch der Abschnitt Dramaturgie und Spannungsbogen in Kapitel 3) und am Ende zur Lösung führt. Wichtig dabei sind der zeitliche Verlauf und vielleicht auch die Kausalität der Ereignisse: Was ist wann warum passiert?
Eine Geschichte ist zudem noch eingebettet in einen zeitlichen und auch örtlichen Rahmen, also wann spielt die Geschichte (Vergangenheit, Gegenwart oder als Vision für die Zukunft?) und wo spielt die Geschichte (in einem bestimmten Raum, in einer Stadt, in einem Wald, auf den Stationen einer Reise etc.). Diese Hintergründe spielen aber nur in längeren Geschichten eine Rolle, kürzere Erzählungen gehen meist gar nicht darauf ein.
Möglicherweise ist die Geschichte auch personell in einem größeren Rahmen zu sehen, wo neben den handelnden Personen noch weitere Figuren (Mitarbeiter einer Firma, Besucher eines Festes etc.) auftreten und eine Nebenfigur darstellen oder eine Statistenrolle spielen. Aber zunächst zu der wichtigen Frage, warum Geschichten uns so fesseln – das liegt nämlich an der Wirkung in unserem Gehirn …
Wie Geschichten im Gehirn wirken
Die Frage, wie unser Gehirn funktioniert, Impulse von außen wahrnimmt und verarbeitet, ist faszinierend – ganze Bücher lassen sich mit dieser Frage füllen. In diesem Buch soll es jedoch mehr um das Storytelling für das Marketing gehen, daher die wichtigsten Punkte in Kurzform (wer weitere Infos nachlesen möchte, kann unter www.buchprojekt-storytelling.de/gehirn weitere Details entdecken):
Grob gesagt erhält unser Gehirn laufend frische Impulse über das Sehen, Hören, Riechen, Tasten oder auch Schmecken – diese Impulse werden jeweils in den Zentren für die Sinneseindrücke verarbeitet.
Viele Impulse werden aber nicht nur in einem Zentrum verarbeitet, sondern in mehreren Hirnzentren – das Wort »Erdbeere« beispielsweise löst im visuellen Zentrum einen Reiz aus (wir sehen eine Erdbeere), aber auch einen taktilen Reiz (wie fühlt sich eine Erdbeere an) und einen gustatorischen Reiz (wie schmeckt eine sonnengereifte Erdbeere) – und wenn wir mit einer süßen Erdbeere eine positive Erinnerung verbinden, so wird auch dieses neuronale Netzwerk aktiviert.
Im Gegensatz dazu lösen Zahlen oder Fakten in der Regel keine Reize aus, die uns emotional berühren – die Information, ob ein Gerät 300 oder 400 mm hoch oder breit ist, berührt uns weniger stark. Was uns berührt, wäre die Frage, ob uns das Gerät einen Nutzen bringt oder einen Wunsch erfüllt.
Eine weitere Besonderheit im Gehirn sind die Spiegelneuronen: Nervenzellen im Gehirn, die beim Beobachten einer Handlung die gleichen neuronalen Zentren aktivieren, als würden wir diese Handlung selbst ausführen (deshalb erlernen wir zum Beispiel eine handwerkliche Tätigkeit leichter, wenn wir diese Tätigkeit beobachten können).
Diese Spiegelungen im neuronalen Netz betreffen aber nicht nur Handlungen, die eine andere Person ausführt – die Spiegelungen umfassen (teilweise ganz unbewusst) auch die Gedanken oder Gefühle einer anderen Person. Zum Beispiel über die Körpersprache oder die Mimik können wir (je nach Einfühlungsvermögen) recht gut abschätzen, wie sich die Person fühlt – und erstaunlicherweise übertragen sich diese Gefühle auch auf uns, indem wir uns (meist unbewusst) in den anderen Menschen hineinversetzen, uns mit ihm identifizieren.
Dieses Sich-in-Andere-Hineinversetzen funktioniert übrigens nicht nur, wenn wir dem betreffenden Menschen persönlich gegenüberstehen – es funktioniert auch, wenn wir Impulse mittels Text oder Bild bekommen, wie es dem anderen Menschen geht, wie er oder sie sich fühlt, was in der Forschung auch affektive Theory of Mind genannt wird … Sofern wir nicht emotionale Klötze sind, können wir über Geschichten die Erlebnisse anderer gut mitfühlen und miterleben.
Außer der affektiven Theory of Mind gibt es übrigens noch die kognitive Theory of Mind: Hier geht es darum, sich in die Gedankenwelt eines anderen Menschen hineinzuversetzen.
Das Hineinversetzenkönnen in die Gedanken- und auch Gefühlswelt führt dazu, dass wir uns mit anderen Menschen identifizieren – vor allem dann, wenn es weitere Gemeinsamkeiten gibt (wer zum Beispiel selbst schon Frust und Ärger beim Lesen einer Bedienungsanleitung erlebt hat, kann sich sehr leicht hineinversetzen, wenn ein anderer Mensch darüber erzählt).
Bei einer längeren Erzählung können wir so tief eintauchen, dass wir Raum und Zeit um uns herum vergessen – dieser Zustand wird auch als Flow oder Immersion bezeichnet …
Mit diesen Hintergrundinformationen dürfte verständlich sein, warum gut erzählte Geschichten eine so starke Faszination auf uns ausüben. Was vielleicht auch noch wichtig ist zu wissen: Da wir von frühester Kindheit an mit Geschichten »gefüttert« werden, bilden wir in unserem Gehirn im Lauf der Zeit bestimmte Mustervorlagen aus – sowohl hinsichtlich der Struktur als auch bei den Figurmodellen.
So sind wir gewohnt, dass ein Märchen mit einem Happy End aufwartet und dass am Ende eines Krimis der Täter gefasst wird. Diese Struktur ist als Mustervorlage fest abgespeichert. Ähnlich ist es mit den handelnden Figuren: Der Gegenspieler ist oft genug ein finster blickender Schurke oder eine intrigante Frau gewesen, sodass wir bei diesen Merkmalen insgeheim denken, wir hätten ihn oder sie damit identifiziert. Oder denken Sie an die biblische Mustervorlage von David und Goliath: der Schwache ist (meist) der Gute und der Starke der Böse – eine weitere klassische Mustervorlage, die bis in unsere heutige Zeit überlebt hat.
Warum Storytelling so wirkungsvoll ist
Die Wirkung von Geschichten auf unser Gehirn lässt sich vielleicht durch unsere Entwicklungsgeschichte erklären: Ganz früher saßen die Menschen abends ums Lagerfeuer und erzählten sich Geschichten. Die Älteren in der Runde tauschten sich über Lebens- oder Jagdgeschichten oder über den Umgang mit Krankheiten bei Mensch und Tier aus – und die Jüngeren hörten zu. Oder anders ausgedrückt: Beim Geschichtenerzählen ging es nicht nur um den reinen Unterhaltungswert, es ging auch darum, aus den Erfahrungen der Erzähler zu lernen. Vermutlich ist in dieser Zeit unser Hirn darauf geprägt worden, neugierig auf Geschichten zu sein und vom Erfahrungswissen der Sippe zu profitieren. Es ging aber nicht nur darum, von den Überlebensstrategien der Älteren im Kampf oder auf der Jagd zu lernen. Auch die Ideale und Werte der Gemeinschaft wurden so überliefert – zum Beispiel in Geschichten über das Miteinander, über das Verhältnis von Jung und Alt oder die Rollenbilder von Mann und Frau oder wie auf verschiedene Ereignisse reagiert werden kann.
Geschichten zeigen Konflikte und Herausforderungen und den Umgang damit. Was ist gut, was ist böse, was ist Recht und was ist Unrecht, was bringt Lob und Anerkennung beziehungsweise Erfolg oder Misserfolg – in Geschichten werden gemeinschaftliche Werte und Normen, die Grundlage für Moralvorstellungen, Glaube und Rechtsprechung vermittelt.
Weil das Erzählen so fest zur kulturellen Entwicklung dazugehört, ist die Welt inzwischen voller Gattungen von Geschichten: Göttergeschichten, Mythen, Epen (z. B. die Nibelungen), Legenden und Sagen (z. B. König Artus), Bibelgeschichten, Novellen, Romane, Märchen usw. Modernere Formen von Geschichten sind in Comics, in Zeitungen und Magazinen zu finden, in TV-Serien und Kinofilmen und nicht zuletzt in (Computer-)Spielen.
Wir alle wachsen mit Geschichten auf. Von den ersten Bilderbüchern und Märchen bis zu Abenteuerromanen, von den Geschichten im Kino und im Fernsehen bis zu dem, was in Zeitungs- oder Online-Artikeln erzählt wird. Unser Gehirn wird geprägt von den Strukturen und Mustern in diesen Geschichten – und es giert immer wieder nach neuen Geschichten.
Geschichten für Märkte
Eigentlich gehörte das Geschichtenerzählen schon immer zum Marketing dazu. Das war bereits vor Tausenden von Jahren so, wenn Bauern oder Händler auf dem Markt mit ihren Waren handelten. Händler und Kunden waren im Gespräch – oft genug erzählten die Händler ihren Kunden überzeugende Geschichten über die Herkunft oder die Machart der Waren.
Je größer die Märkte und je vielfältiger die Waren wurden, desto weniger blieb die Möglichkeit für ein persönliches Gespräch mit den Käufern. Bereits in den ersten Hochkulturen gab es die ersten Werbetafeln über das aktuelle Angebot an Waren. Im Mittelalter (als es nur wenige gebildete Menschen gab, die lesen konnten) informierten Marktschreier über das Produktangebot, mit Beginn der Neuzeit kamen die ersten Laden- und Werbeschilder, danach die ersten Anzeigen und Werbezettel. Nachdem in Deutschland die Schul- bzw. Unterrichtspflicht eingeführt worden war und (fast) jeder Bürger lesen konnte, stieg vor allem ab dem 19. Jahrhundert die Zahl der Zeitungen und damit auch die Zahl der Werbeanzeigen unaufhörlich.
Mit der weiteren Professionalisierung der Werbewelt und der Unternehmenskommunikation kam das Erzählen von Geschichten gänzlich aus der Mode. Erst als das Storytelling in den 1990er-Jahren für das Wissensmanagement und für das Leadership oder Change Management neu entdeckt wurde, ist es auch wieder für die Marketingkommunikation salonfähig geworden.
Märkte sind Gespräche: das Cluetrain-Manifest
Die Wiederentdeckung der Märkte als Gespräche war auch das zentrale Thema des Cluetrain-Manifests, veröffentlicht 1999 unter www.cluetrain.com von Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls und David Weinberger (es gibt auch eine deutsche Übersetzung unter www.cluetrain.com/auf-deutsch.html).
Auch wenn die Social-Media-Kanäle in der heutigen Form im Jahr 1999 noch nicht existierten, so war doch durch die Entwicklung von Webseiten, Mailinglisten und Diskussionsforen deutlich geworden, wie stark sich Marktteilnehmer über das Internet vernetzen konnten.
In Anlehnung an Martin Luthers Thesenanschlag postuliert das Cluetrain-Manifest in 95 Thesen, wie sich Interessenten und Kunden durch den Einfluss der neuen technischen Möglichkeiten untereinander austauschen können –über Produkte und ihre Erfahrungen damit, über die Hersteller und Händler. Da die Distanz zwischen den Marktteilnehmern schrumpft, geraten die gewohnten Marketingstrategien mit den einseitigen Kommunikationswegen an ihre Grenzen. Die Monologe der Unternehmen sollten zu echten Dialogen zwischen Herstellern oder Händlern und ihren Kunden werden.
Das Cluetrain-Manifest beschreibt deutlich, dass Märkte auf Beziehungen basieren – und zwar sowohl auf den Beziehungen der Menschen untereinander als auch auf den Beziehungen zwischen Unternehmen und Menschen. Das Credo des Cluetrain-Manifests lautet daher nicht umsonst: Märkte sind Gespräche.
Allerdings hat sich das einstmals offene Internet im Lauf der Jahre stark verändert. Neue Technologien wurden entwickelt, Plattformen und Apps wurden geschaffen, die als in sich abgekapselte Personendaten-Silos agieren. Social-Media-Kanäle wie Facebook oder Twitter sind nicht das Internet, sie sind nur über die Struktur des Internets mit ihren Nutzern verknüpft und versuchen, ihren Nutzern möglichst alles auf ihrer Plattform zu bieten, damit diese möglichst lange und viel auf der Plattform bleiben (um ihnen dann passende Werbung zu präsentieren).
Angesichts dieser Entwicklung veröffentlichten Doc Searls und David Weinberger im Jahr 2015 die »New Clues«. In diesen 121 neuen Thesen beschäftigen sie sich mit der ursprünglich sehr freien und offenen Struktur des Internet, deren einstmals unendliche Weite durch die Kommerzialisierung des World Wide Web immer stärker begrenzt wird. Die großen Internet-Giganten sowie die Apps und Trackingtools erzeugen seit dem Erscheinen des Manifests unsichtbare Zäune, hinter denen sich Konsumenten einfrieden lassen, sehr zum Missfallen der Cluetrain-Autoren:
… die Schwungräder des Business as usual drehen sich weiter, sie (d. h. die Unternehmen) betreiben Tracking und Targeting, sie fangen und akquirieren, managen und verwalten »ihre« Kunden, als ob wir Sklaven oder Vieh wären,
kommentiert Doc Searls in einem Interview, publiziert im Wirtschaftsmagazin brand eins, Ausgabe Februar 2012.
Merke: Wer die kommerzielle Absicht zu sehr in den Vordergrund stellt und seine Kunden als Vieh auf dem Markt betrachtet, führt kein wirkliches Gespräch. Daher sind Gespräche als reine Marketingmasche keine echte Kommunikation unter Menschen.
Ins Gespräch kommen – und im Gespräch bleiben
Zurück von falschen zu echten Gesprächen. Die modernen Märkte quellen über mit attraktiven Angeboten und viele Käufer sind werbemüde. Viele Menschen haben ihrer visuellen Wahrnehmung antrainiert, die Werbeangebote im Internet und anderswo einfach auszublenden. Klar, ab und zu dringt etwas durch und bleibt vielleicht sogar im Gedächtnis haften. Dennoch funktioniert Werbung nicht mehr so gut wie zu ihrer Anfangszeit, als Werbebotschaften noch auf offene Ohren trafen.
Wenn Botschaften, Positionierungen und die Imagebildung auf den überfüllten Märkten nicht mehr weiterhelfen, wird es Zeit, sich wieder auf das Erzählen guter Geschichten zu besinnen. Vor allem die Geschichten, die Gespräche anstiften und am Laufen halten. Auf diese Weise fällt es nicht nur leichter, ins Gespräch zu kommen – sondern auch im Gespräch zu bleiben.
Gespräche zwischen Menschen klingen menschlich. Sie werden mit einer menschlichen Stimme geführt. Cluetrain-Manifest
Der Knackpunkt dabei ist: Diese Gespräche müssen authentisch sein – als Kommunikation von Mensch zu Mensch.
Und wer könnte diese Kommunikation von Mensch zu Mensch besser als kleine Unternehmen? Wenn der Chef oder die Chefin oder jemand von den Mitarbeitern von Begebenheiten im Betrieb erzählt, wirkt das ehrlich und glaubwürdig.
Gerade für kleine Unternehmen oder für Dienstleister bietet Storytelling daher viele Vorteile. Weil Geschichten direkt auf neurologischer Ebene wirken, weil sich im Hirn des Rezipienten etwas bewegt, helfen sie beim Bekanntmachen und Vermarkten von Produkten oder Leistungen. Mit dem richtigen Hebel sind Geschichten sehr kraftvolle Werkzeuge fürs Marketing.
An dieser Stelle jetzt ein Aber: Storytelling bringt nur einen echten wirtschaftlichen Erfolg, wenn das Produktangebot für Ihre Geschichte auf Interessenten stößt. Als Beispiel: Gehört zu Ihrem Produktangebot das Buch »Die Grundzüge der lateinischen Grammatik« und erzählen Sie Geschichten dazu, wird sich der Umsatz durchs Geschichtenerzählen nicht so steigern wie mit einer Geschichte zu einem Buch mit dem Namen »IT mit Spaß« oder »5 Wege zum Reichtum« – die Zielgruppe ist hierfür deutlich höher als für ein Lateinbuch.
Bei einer entsprechend großen Zielgruppe jedoch lassen sich mit Geschichten sehr viel spürbarer emotionale Bezüge zur eigenen Person und Leistung schaffen – was sich kurz- oder langfristig auch im Umsatz bemerkbar macht. Je nach Zielgruppe oder Situation oder gewünschter Botschaft mag es sogar hilfreich sein, gute Geschichten in einem Archiv zu sammeln und somit in petto zu haben, um sie bei passender Gelegenheit zu erzählen.
Kapitel 2
Die einzelnen Bausteine einer Geschichte
IN DIESEM KAPITEL
das Personal mit Haupt- und Nebenfiguren
Konflikte lösen etwas aus
weitere Elemente einer Geschichte
und schließlich: der Erzähler
Aus welchen Bausteinen setzt sich eine Geschichte zusammen? Welche Bausteine sind ein Muss, welche sind verzichtbar? Welche Figuren braucht es? Wie hängen Konflikt und Botschaft zusammen? Was könnte noch eine Rolle spielen? Und vor allem: Welche Möglichkeiten gibt es, den Erzähler darzustellen? So viele Fragen, aber keine Bange: Alle Antworten kommen in diesem Kapitel.
Keine Handlung ohne handelnde Personen
Eine Geschichte erzählt von Ereignissen und Begebenheiten; etwas passiert. Aber wer ist der Träger eines Ereignisses oder wer agiert als Treiber für die ganze Handlung? Hierfür braucht es Figuren oder Charaktere. Dieses Personal umfasst sowohl Hauptfiguren und gegebenenfalls deren Gegenspieler, die die Handlung vorantreiben, als auch Nebenfiguren, die, wie ihr Name schon sagt, eher am Rand stehen.
Ohne sie geht nichts: die Hauptfiguren
Das wichtigste Element in einer Geschichte sind natürlich die Hauptfiguren. Sie bestimmen die Handlung, treiben diese voran oder bremsen sie ab.
Die Heldenfigur
Die wichtigste Hauptfigur ist der Held oder Protagonist. Der Held (und auch die anderen Figuren) können reale Figuren sein oder auch Beispielfiguren (zum Beispiel der Fuchs oder der Bär in einer Fabel). Durch den Helden wird der Leser in das Zentrum der Geschichte/des Themas geführt. Der Held ist nicht austauschbar. In den meisten Genres durchlebt er einen Konflikt, steht vor einer Prüfung oder muss sich in einer entscheidenden Situation bewähren. Der Held darf nicht passiv bleiben, er muss aktiv werden und handeln.
Vor allem in längeren Erzählungen durchläuft der Held häufig eine Veränderung: Am Anfang erleben wir ihn in seiner Alltagswelt, dann kommt der Konflikt mit der Herausforderung, der Held wächst mit seinen Aufgaben, am Ende ist er klüger, weiser, lebenserfahrener, vielleicht haben sich seine Ansichten verändert und er erscheint anders als am Anfang. Mehr dazu in 7 Plots oder in der Heldenreise in Kapitel 3.
Wichtig zu wissen: Im normalen Sprachgebrauch wird der Begriff Held oft für die Hauptperson in einer Geschichte verwendet, die Heldentaten vollbringt und Siege über den oder die (bösen) Gegner erringt – man denke nur an Odysseus oder König Artus. Hier steht der Begriff Held jedoch generell für die Hauptperson – ganz unabhängig davon, ob die Person ein strahlender Sieger oder ein niedergeschlagener Verlierer ist. Prinzipiell muss der Held auch nicht der Gute sein, er kann auch zu den Bösen gehören oder unbeabsichtigt böse Kräfte aktivieren.
Sie sollten daher im Hinterkopf behalten, dass mit dem Wort Held nicht unbedingt ein strahlender Siegertyp gemeint ist. Stattdessen kann der Held einer Geschichte auch ein ganz normaler Mensch mit all seinen Stärken und Schwächen, Fehlern und Vorzügen sein.
Der Held im Storytelling
Wer ist in einer Marketing-Geschichte der Held? Das können Sie selbst sein – es könnte aber auch je nach Zielrichtung der Geschichte ein Kunde oder Auftraggeber sein, der Geschäftsführer oder der Lehrling oder auch einer der Mitarbeiter oder ein Kooperationspartner. Auch eine Gruppe oder ein Team könnte die Heldenrolle spielen. Wichtig ist, dass der Held (oder das Heldenteam) sympathisch ist, damit der Leser oder Zuhörer sich mit dem Helden oder mit der Botschaft des Helden identifizieren kann.
Wichtig: Falls Sie Geschichten erzählen, in denen Sie der Held (bzw. die Heldin) sind, dann vermeiden Sie unbedingt Eigenlob oder »Fishing for Compliments«, noch schlimmer wäre übertriebene Selbstbeweihräucherung. Eine solche Selbsterhöhung macht Sie nicht sympathisch, sondern erzielt eher eine gegenteilige Wirkung.
Weitere Hauptfiguren
Zu den Hauptfiguren zählt übrigens nicht allein ein Held, sondern neben dem Helden (oder der Heldin) kann eine zweite Person eine weitere Hauptfigur bilden. In vielen Geschichten in Büchern oder Filmen ist das ein (Liebes-/Lebens-)Partner oder ein guter Freund. Häufig findet sich auch die Rolle eines weisen und lebenserfahrenen Mentors oder Ratgebers und/oder ein treuer Helfer oder Gefährte. In Geschichten über ein Unternehmen kann ein Ausbilder oder der Seniorchef die Ratgeber- oder Mentorenrolle ausfüllen, ein Kollege könnte als der Partner oder der zuverlässige Helfer auftreten.
Spielen auch eine tragende Rolle: die Gegenspieler
David gegen Goliath, Hänsel und Gretel gegen die böse Hexe – in der Regel gibt es nicht nur die Helden als Hauptpersonen, sondern auch ihre Gegenspieler (auch Antagonisten genannt). Held und Gegenspieler stehen in einem Konflikt miteinander, vielleicht haben beide das gleiche Ziel oder der Held will etwas erreichen oder erhalten, was der Gegenspieler verhindern will. Steht der Gegenspieler für das Böse, dann steht der Held für das Gute. Beide Kräfte kontrastieren sich gegenseitig.
Je mächtiger der Gegenspieler in dem Konflikt erscheint, desto schwächer steht der Held zunächst da – das sorgt für Spannung und der Leser oder Zuschauer fiebert mit dem Helden mit.
Es gibt jedoch auch Konstellationen, in denen zwar ein Held erscheint, der Gegenspieler aber nicht als Person. Hier kann der Gegenspieler eine unsichtbare oder ungreifbare Macht sein wie beispielsweise ein Sturm, durch den das Leben des Helden durcheinandergewirbelt oder sogar zerstört wird. Oder es gibt innere Gegenspieler, zum Beispiel eine tiefgründige Angst, der sich der Held stellen muss. Am Ende steht Sieg oder Niederlage.