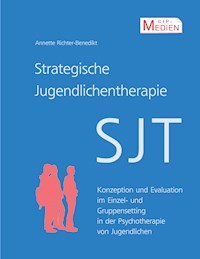
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Unter Berücksichtigung der spezifischen Entwicklungsphase der Adoleszenz wird mit der Strategischen Jugendtherapie, einem Therapiekonzept, das Einzel- und Gruppenelemente kombiniert, die SBT (Strategisch-Behaviorale Therapie) altersentsprechend adaptiert. Schwerpunkte der Strategischen Jugendtherapie bestehen dabei vor dem Hintergrund eines differenzierten Störungsverständnisses in der konkreten Symptomtherapie und in der makroanalytisch begründeten Förderung funktionaler Emotionsregulation bzw. einer befriedigenderen Beziehungsgestaltung. In der hier dargestellten Evaluationsstudie wurde die Wirksamkeit der Strategischen Jugendlichentherapie (SJT) anhand jugendlicher Patienten mit multiplen Diagnosen unter klinisch repräsentativen Bedingungen überprüft. Vor dem Hintergrund des naturalistischen Studiendesigns ist in Anbetracht der Ergebnisse dabei davon auszugehen, dass das Behandlungskonzept der SJT als praktisch hoch relevant einzuschätzen ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danksagung
Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Menschen bedanken, ohne die diese Arbeit nicht zustande gekommen wäre.
Mein besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr. Dr. Serge Sulz, der mich während der gesamten Promotionszeit sehr unterstützend und fördernd begleitete und dessen therapeutischer Ansatz mich hinsichtlich meiner fachlichen, beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung sehr prägte. Vielen Dank dafür!
Auch Frau Dr. Annette Hoenes, Frau Dr. Ute Graeff-Rudolph und Herrn Dr. Gernot Hauke, die für mich bedeutende Supervisoren und Dozenten hinsichtlich der Vermittlung der Strategischen Kurzzeittherapie bzw. der Strategisch-Behavioralen Therapie darstellten, gilt mein Dank.
Ich möchte zudem den Herrn Prof. Dr. Hans-Ludwig Schmidt, Prof. Dr. Carl Heese und Herrn Prof. Dr. Siegfried Höfling für Ihre Unterstützung danken.
Darüber hinaus danke ich meinen Kolleglnnen des CIP und des CIPM, die mich einerseits durch ihr Interesse an meiner Arbeit und zum anderen durch anregende Denkanstöße immer wieder dazu motivierten, das Projekt der Dissertation über einen bewegten beruflichen und privaten Alltag hinweg nicht aus den Augen zu verlieren und die mich, eingebettet in ein sehr warmherziges und kollegiales Arbeitsumfeld, bei Laune hielten. Danke sehr!
Eva Vietz möchte ich sehr dafür danken, dass sie mir bei methodischen Fragen geduldig und sehr kompetent mit Rat und Tat zur Seite stand.
Ich bedanke mich an dieser Stelle auch herzlichst bei meiner Familie und meinen Freunden für so manch liebevolle Nachsicht, die Unterstützung und die Aufmunterungen, am Ball zu bleiben und mich (beruflich) zu entfalten.
Ein weiterer Dank gilt den Jugendlichen und den Eltern dieser Studie, die ich auf einem Teil ihres Weges begleiten durfte.
Zusammenfassung
Die Strategische Jugendlichentherapie (SJT) ist als ein integrativ-behavioraler Therapieansatz zu verstehen, der bei einem differenzierten therapeutischen Störungsverständnis mit ätiologisch intraindividuell und interpersonell relevanten Variablen neben der Symptomarbeit die kognitive, die emotionale, die Verhaltens- und die Körperebene symptomunabhängig bzw. störungsübergreifend behandelt. Letztlich soll dem Jugendlichen durch die SJT ermöglicht werden, (relativ) symptomfrei adaptiv-funktional mit sich selbst und seiner Umwelt umzugehen, sodass adoleszentenspezifische Entwicklungsaufgaben angegangen werden können und letztlich eine salutogene Persönlichkeitsentwicklung möglich wird. Der in die therapeutische Arbeit mit den Jugendlichen eingebetteten Elternarbeit sowie der Kombination aus Einzel-Gruppen-Setting räumt die Strategische Jugendlichentherapie (SJT) dabei einen zentralen Stellenwert ein.
Als Pilotstudie ist dabei das Untersuchungsdesign zu dem an die Strategisch-Behaviorale Therapie nach Sulz (2001, 2005) angelehnten therapeutischen Konzept vor allem darauf ausgerichtet, die klinische Versorgungsrealität im Bereich der Jugendlichentherapie aufzugreifen. Die externe Validität soll den praktischen Nutzen bzw. Aussagen über die Anwendungseffektivität der Strategischen Jugendlichentherapie (SJT) gewährleisten, was das hier kurz skizzierte Studiendesign erklärt: In der vorliegenden Evaluationsstudie wurde die Wirksamkeit der SJT anhand jugendlicher Patienten mit multiplen Diagnosen unter klinisch repräsentativen Bedingungen überprüft. Zu diesem Zweck wurde eine Behandlungsgruppe (n=14) mit einer Wartegruppe (n=16) in einer Reihe von Variablen zu zwei Messzeitpunkten (vor und nach Therapie bzw. nach sechsmonatiger Wartezeit) verglichen.
Es zeigte sich in den erhobenen Symptommaßen sowohl im Selbst- als auch im Fremdurteil hierbei eine hohe Wirksamkeit der SJT in der untersuchten Patientenstichprobe mit Effektgrößen bis 0.8. Vor dem Hintergrund des naturalistischen Studiendesigns ist in Anbetracht der Ergebnisse davon auszugehen, dass das Behandlungskonzept der Strategischen Jugendlichentherapie (SJT) als praktisch hoch relevant einzuschätzen ist. Weitere Forschungsarbeiten zur praktischen Anwendung des SJT-Ansatzes im Kinder- und Jugendbereich erscheinen entsprechend sehr bedeutsam.
Inhalt
I. EINLEITUNG UND PROBLEMSTELLUNG
II. THEORETISCHER TEIL
2.1 Eine Theorie menschlicher Entwicklung
2.1.1 Entwicklung im Jugendalter: Anlage oder Umwelt?
2.1.1.1 Anlagetheorien der Adoleszenz
2.1.1.2 Umwelttheorien der Adoleszenz
2.1.1.3 Interaktionstheorien der Adoleszenz
2.1.1.3.1 Sigmund und Anna Freud
2.1.1.3.2 Erik H. Erikson
2.1.1.3.3 Peter Blos
2.1.1.3.4 Adoleszente Persönlichkeitsentwicklung im Kontext
2.1.2 Die „Klinische Entwicklungspsychologie“
2.1.2.1 Theoretischer Hintergrund
2.1.2.2 Der konstruktivistische Ansatz in der Klinischen Entwicklungspsychologie
2.1.2.3 Die klinische Bedeutsamkeit eines entwicklungsorientierten Stufenmodells
2.2 Adaptation der Strategisch-Behavioralen Therapie nach Sulz an das Jugendalter: Strategische Jugendlichentherapie als therapeutisches Konzept für Entwicklungsförderung
2.2.1 Wegbereiter der affektiv-kognitiven Entwicklungstheorie nach Sulz
2.2.1.1 Die Entwicklungstheorie J. Piagets
2.2.1.1.1 Der Entwicklungsprozess und seine Mechanismen
2.2.1.1.2 Die vier Stufen kognitiver Entwicklung
2.2.1.1.2.1 Die Stufe der sensumotorischen Intelligenz
2.2.1.1.2.2 Die Stufe der voroperationalen Intelligenz
2.2.1.1.2.3 Die Stufe der konkreten Operationen
2.2.1.1.2.4 Die Stufe der formalen Operationen
2.2.1.1.3 Die emotionale Entwicklung nach Piaget
2.2.1.2 Die Stufen der moralischen Orientierung nach L. Kohlberg
2.2.1.2.1 Die Charakteristika des Kohlbergschen Modells
2.2.1.2.2 Sechs Stadien des moralischen Urteils auf drei Hauptstufen
2.2.1.2.2.1 Das präkonventionelle Niveau
2.2.1.2.2.2 Das konventionelle Niveau
2.2.1.2.2.3 Das postkonventionelle Niveau
2.2.1.3 Kritische Betrachtung der kognitiven Theorien Piagets und Kohlbergs
2.2.1.4 Die Entwicklungsstufen des Selbst nach R. Kegan, ihre Formen von Beziehungsgestaltung, ihre Konfliktthemen und deren Lösungen – differenziert durch S. Sulz
2.2.1.4.1 Einverleibende Entwicklungsstufe (Stufe 0)
2.2.1.4.2 Impulsive Entwicklungsstufe (Stufe 1)
2.2.1.4.3 Die souveräne Entwicklungsstufe (Stufe 2)
2.2.1.4.4 Die zwischenmenschliche Entwicklungsstufe (Stufe 3)
2.2.1.4.5 Die institutionelle Entwicklungsstufe (Stufe 4)
2.2.1.4.6 Die überindividuelle Entwicklungsstufe (Stufe 5)
2.2.2.1 Die Relevanz der „Überlebensregel“ als handlungsleitendes affektiv-kognitives Schema im Rahmen der Beziehungsgestaltung
2.2.2.2.1 Sieben Zugehörigkeitsbedürfnisse
2.2.2.2.2 Sieben Selbst- bzw. Autonomiebedürfnisse
2.2.2.2.3 Sieben Homöostasebedürfnisse
2.2.2.3 Zentrale Ängste und Wutimpulse des Menschen und ihre Bedeutung für die individuelle Entwicklung
2.2.2.4 Persönlichkeitstypen, deren jeweilige Überlebensregel und Form der Beziehungsgestaltung
2.2.2.4.1 Die selbstunsichere Persönlichkeitsentwicklung
2.2.2.4.2 Die dependente Persönlichkeitsentwicklung
2.2.2.4.3 Die zwanghafte Persönlichkeitsentwicklung
2.2.2.4.4 Die passiv-aggressive Persönlichkeitsentwicklung
2.2.2.4.5 Die histrionische Persönlichkeitsentwicklung
2.2.2.4.6 Die schizoide Persönlichkeitsentwicklung
2.2.2.4.8 Die emotional-instabile Persönlichkeitsentwicklung
2.2.2.4.9 Die paranoide Persönlichkeitsentwicklung
2.2.2.4.10 Die schizotypische Persönlichkeitsentwicklung
2.2.2.4.11 Die dissoziale Persönlichkeitsentwicklung
2.2.2.5 Emotion und Persönlichkeit
2.3 Die Adaptation der affektiv-kognitiven Entwicklungstheorie und deren therapeutischer Implikationen an das Jugendalter: Strategische Jugendlichentherapie (SJT)
2.3.1 Der therapeutische Ansatz und seine einzelnen Komponenten
2.3.1.1 Ansatz an der Symptomebene
2.3.1.2 Ansatz an der Ebene der Emotion
2.3.1.3 Ansatz an der Ebene der Kognition
2.3.1.5 Ansatz an der Körperebene
2.3.2.1 Inhaltliche Planung und Gestaltung der Therapiesitzungen
2.3.2.1.2 Gruppenmodus: Inhalt und Ablauf
2.3.3 Fallkasuistik – Darstellung der Strategischen Jugendlichentherapie (SJT) anhand eines konkreten Therapiefalls
2.3.3.1 Angaben zur Symptomatik und zur Lebensgeschichte von Sarah
2.3.3.2 Diagnose, Bedingungsanalyse, Therapiezielbestimmung
2.3.3.3 Therapieverlauf und Elternarbeit im Einzelmodus
2.3.3.4 Therapieverlauf im kombinierten Einzel- und Gruppenmodus
2.3.3.5 Verlauf des Elterntrainings
2.4 Zusammenfassende Darstellung für die vorliegende Arbeit relevanter bisheriger Forschungstätigkeit in der Kinder- und Jugendpsychotherapie
III. EMPIRISCHER TEIL
3.1 Die der SJT-Evaluationsstudie zugrunde gelegten Hypothesen und Fragestellungen
3.2. Forschungsdesign zur Überprüfung der Wirksamkeit der Strategischen Jugendlichentherapie (SJT)
3.2.1 Rolle der Autorin der vorliegenden Arbeit im Rahmen der Evaluationsstudie
3.2.2 Einschlusskriterien für die Patienten(-familien) zur Teilnahme an der vorliegenden Studie
3.3.1 Definition von Messzeitpunkten und Therapie-/Kontrollgruppendesign
3.3.2.1 Die zur indirekten Veränderungsmessung eingesetzten Messinstrumente und damit assoziierte Variablen
3.3.2.1.1. Die Darstellung des Brief Symptom Inventory (BSI)
3.3.2.1.2 Globalbeurteilung des psychosozialen Funktionsniveaus nach ICD-10 anhand der Einschätzung durch die behandelnde Therapeutin und durch kinder- und jugendpsychiatrische Fremdurteile von t
1
zu t
2
3.3.2.1.3 Erhebung frustrierenden Elternverhaltens mittels des VDS24-J
3.3.2.1.5 Erhebung der zentralen Angst mittels des VDS28-J
3.3.2.1.6 Erhebung der zentralen Wut mittels des VDS29-J
3.3.2.1.7 Die Erhebung der jeweiligen (maladaptiv-dysfunktionalen) Persönlichkeitszüge mittels des VDS30-J
3.3.2.1.8 Die Erhebung der jeweiligen Entwicklungsstufe mittels des VDS31-J
3.3.2.2 Das zur direkten Veränderungsmessung eingesetzte Messinstrument und damit assoziierte Variablen: Der Veränderungsfragebogen des Erlebens und Verhaltens (VEV)
3.3.3 Darstellung der Stichproben
3.3.3.1 Beschreibung der Behandlungsgruppe
3.3.3.2 Beschreibung der Warte-Kontrollgruppe
3.3.3.3 Beschreibung signifikanter Unterschiede zwischen Behandlungs- und Kontrollgruppe
3.3.3.4 Drop-outs
3.3.4 Statistische Analyse der erfassten Daten
3.3.4.1 Definition von Therapieerfolg mittels einer Differenzierung zwischen statistisch bzw. klinisch relevanten Veränderungen
3.3.4.2 Definition von Therapieerfolg mittels Erhebung von Effektstärken
3.3.4.2.1 Die statistische Erfassung von Prä-Unterschieden zwischen der Therapie- und der Wartegruppe
3.3.4.2.2 Die statistische Erfassung von Post-Unterschieden zwischen derTherapie- und der Wartegruppe
IV. ERGEBNISDARSTELLUNG
4.2 Studie 1: Ein Vergleich der Behandlungsgruppe mit der Warte-Kontrollgruppe nach der Therapiephase
4.2.1 Veränderung der psychischen Belastung – gemessen anhand des GSI des BSI und anhand des allgemeinen psychosozialen Funktionsniveaus zu t
2
4.2.1.1 Der GSI des BSI zu t
2
4.2.1.1.1 Betrachtung der Reliabilitäten des GSI zu t
2
4.2.1.1.2 Betrachtung der Effektstärken des GSI zu t
2
4.2.1.2 Das kinder- und jugendpsychiatrische Fremdrating zum allgemeinen psychosozialen Funktionsniveau und zur generellen Veränderung zu t
2
4.2.1.3 Das therapeutische Rating durch die Behandlerin zum allgemeinen psychosozialen Funktionsniveau und zur generellen Veränderung zu t
2
4.2.1.4 Vergleich von Therapeuten- und Fremdrating zum allgemeinen psychosozialen Funktionsniveau zu t
2
4.2.1.5 Betrachtung der Medikation als Indikator für Reduktion von Symptomatik
4.2.2 Veränderung der zentralen Bedürfnisstruktur/-lage in Bezug auf die Überlebensregel zu t
2
4.2.2.1 Veränderung der zentralen Bedürfnisstruktur/-lage zu t
2
: Gesamt-Bedürfnisstruktur
4.2.2.2 Veränderung der zentralen Bedürfnisstruktur/-lage zu t
2
: Zugehörigkeits- bedürfnisse und das Ausmaß an maladaptiv-dysfunktionalem Umgang mit selbigen
4.2.2.3 Veränderung der zentralen Bedürfnisstruktur/-lage zu t
2
: Autonomiebedürfnisse und das Ausmaß an maladaptiv-dysfunktionalem Umgang mit selbigen
4.2.3.1 Veränderung der zentralen Angststruktur/-lage zu t
2
: Angststruktur (gesamt) und das Ausmaß an maladaptiv-dysfunktionalem Umgang mit selbiger
4.2.3.2 Veränderung der zentralen Angststruktur/-lage zu t
2
: Angststruktur- Subskalenbetrachtung
4.2.3.2.2 Die Angst vor Trennung/Alleinsein zu t
2
4.2.3.2.3 Die Angst vor Kontrollverlust über andere zu t
2
4.2.3.2.5 Die Angst vor Liebesverlust zu t
2
4.2.3.2.6 Die Angst vor Gegenaggression zu t
2
4.2.3.2.7 Die Angst vor Hingabe zu t
2
4.2.4 Veränderung der zentralen Wutstruktur/-lage zu t
2
4.2.4.1 Wutstruktur (gesamt) und das Ausmaß an maladaptiv-dysfunktionalem Umgang mit selbiger
4.2.4.2 Veränderung der zentralen Wutstruktur/-lage zu t
2
: Wutstruktur-Subskalenbetrachtung
4.2.4.2.1 Die Vernichtungswut zu t
2
4.2.4.2.2 Die Trennungswut zu t
2
4.2.4.2.3 Vor Wut die anderen kontrollieren zu t
2
4.2.4.2.4 Vor Wut die Kontrolle über sich selbst verlieren (explodieren) zu t
2
4.2.4.2.5 Vor Wut Liebe entziehen zu t
2
4.2.4.2.6 Vor Wut Gegenaggression zeigen zu t
2
4.2.4.2.7 Vor Wut hörig machen wollen zu t
2
4.2.5 Veränderung der generellen emotionalen Struktur/Befindlichkeit in Bezug auf die Überlebensregel zu t
2
4.2.5.1 Veränderung der generellen emotionalen Struktur/Befindlichkeit zu t
2
: Gefühlskategorie „Freude“
4.2.5.2 Veränderung der generellen emotionalen Struktur/Befindlichkeit zu t
2
: Gefühlskategorie „Trauer“
4.2.5.3 Veränderung der generellen emotionalen Struktur/Befindlichkeit zu t
2
: Gefühlskategorie „Angst“
4.2.5.4 Veränderung der generellen emotionalen Struktur/ Befindlichkeit zu t
2
: Gefühlskategorie „Wut“
4.2.6 Mittelwerte der Persönlichkeitsskalen VDS30 vorher und nachher
4.2.7 Entwicklungsstufen von Therapie- und Wartelistenkontrollgruppe vorher und nachher (VDS31)
4.2.8 Subjektives Familienbild von Therapie- und Wartelistenkontrollgruppe vorher und nachher (SFB)
4.2.9 Veränderung des VEV
4.3 Studie 2: Therapieprozess- und Therapieverlaufsanalysen und Erkenntnisse zu elterlichen Frustrationen über die Teilstichproben hinweg
4.3.1 Therapieprozess- und Therapieverlaufsanalysen
4.3.1.1 Patientenfeedback und Therapeutenrating der Sitzungen (QMP04 und QMT04)
4.3.1.2 Zielerreichungsskalierung
4.3.1.3 Zielannäherung QMP05
4.3.1.4 Beziehungsqualität QMT06
4.3.1.5 Therapieprozess (QMT07)
5.1 Diskussion der Ergebnisse der Strategischen-Jugendlichentherapie-Pilotstudie
5.2 Methodisch-statische Begrenzungen, Implikationen und Ausblick hinsichtlich der Pilotstudie zur Strategischen Jugendlichentherapie (SJT)
5.2.1 Aussagen zu den Hypothesen der Wirksamkeit der Therapie
5.2.2 Bedeutung der nicht signifikanten Ergebnisse
5.3 Ein Blick in die Zukunft
Abbildungsverzeichnis
Fragebögendownload
I. Einleitung und Problemstellung
Es besteht die Notwendigkeit eines differenzierten therapeutischen Verständnisses für die Phase der Adoleszenz, vor deren Hintergrund Symptomverständnis und damit einhergehende Interventionsstrategien bzw. -verfahren entwicklungsadäquat reflektiert und eingesetzt werden sollten. Hierfür steht die therapeutische Konzeption der dieser Evaluationsstudie zugrunde gelegten Strategischen Jugendlichentherapie (SJT), die sich aus der entwicklungsspezifischen, dem Jugendalter inhärenten Dynamik ableitet: Das Jugendalter wird in der Literatur als ein biologisch, kognitiv-emotional, kulturell bzw. handlungsbezogen definiertes Entwicklungsstadium aufgefasst, für das sich verschiedene Periodisierungsversuche finden lassen. Einige davon sollen nachfolgend zur Veranschaulichung herausgegriffen werden (s. auch Stange, 1993). Ewert (1983, s. auch Oerter, Dreher, 1995) unterscheidet wie folgt: Im Alter vom zehnten bis zum zwölften Lebensjahr spricht er von der Vorpubertät im Sinne einer Zeit „zwischen reifer Kindheit und dem Auftreten erster sekundärer Geschlechtsmerkmale“. In Anlehnung an Eichhorn (1966) sieht Ewert die Zeit zwischen dem zwölften und 14. Lebensjahr als Transzendenz im Sinne eines „Übergang(s) von der Kindheit in die Adoleszenz“, wo es zu deutlichen pubertären und damit verbundenen psychischen Veränderungen innerhalb eines sozialen Kontextes kommt. Die Transzendenz ist seiner Auffassung nach als Zeit der intensiven Auseinandersetzung mit jugendspezifischen Entwicklungsanforderungen in Verbindung mit einer erhöhten seelischen Vulnerabilität zu verstehen. Sie wird zwischen dem 14. und dem 18. Lebensjahr von der frühen Adoleszenz abgelöst. Der „Erwerb schulischer und beruflicher Qualifikationen als Voraussetzung für die Übernahme der Erwachsenenrolle“ wird von Ewert dabei als ein zentraler Bestandteil dieser Zeit betrachtet. Die darauf folgende Periode bis zu einem Alter von etwa 25 Jahren bezeichnet Ewert als späte Adoleszenz, die unter einer entwicklungspsychologischen Perspektive mit einem veränderten Selbstbezug einhergeht und von unterschiedlichsten, sich aus dem Lebenskontext ergebenden Anforderungen und qualitativen Merkmalen begleitet wird. Die Altersgruppe von über 21 Jahren bis zum 25. Lebensjahr sieht Ewert als die junger Erwachsener an.
Hurrelmann (1997) unternimmt in Anlehnung an Schäfers (1982) eine gröbere Unterteilung: Die 13- bis 18-Jährigen werden als die Jugendlichen im engeren Sinne betrachtet, 18- bis 21-Jährige sieht er als jugendliche Heranwachsende in einer nachpubertären Phase an und die 21- bis 25-Jährigen und Älteren werden als junge Erwachsene verstanden, die in ihrer Nachjugendphase vom Sozialstatus her und ihrem Verhalten nach noch als Jugendliche zu betrachten sind. Hierzu Oerter und Dreher (1995): „Im Alltagsdenken wird Jugend oft mit Erwachsenwerden assoziiert. Global betrachtet ist damit eine Übergangsperiode gemeint, die zwischen Kindheit und Erwachsenenalter liegt. Die Zuschreibung der Attribute ,nicht mehr Kind‘ und ,noch nicht Erwachsener‘ akzentuiert die Veränderungsdynamik der Zwischenposition, die beides umfasst: Verhaltensformen und Privilegien der Kindheit aufzugeben und Merkmale/Kompetenzen zu erwerben, die Aufgaben, Rollen und Status des Erwachsenenalters begründen.“ Dies verweist auf die Übergangszone, in die der Heranwachsende mit der Adoleszenz eintritt. Auch Schelsky (1957) spricht in seinem frühen Definitionsversuch des Jugendalters davon, dass das Jugendalter „im soziologischen Sinne (…) die Verhaltensphase des Menschen (ist), in der er nicht mehr die Rolle des Kindes spielt, dessen Leben sozial wesentlich innerhalb der Familie wurzelt oder von Institutionen gehalten wird (…) und in der er noch nicht die Rolle des Erwachsenen als vollgültigen Träger der sozialen Institutionen (…) übernommen hat“, was mit Lewin durch die Bezeichnung des Jugendlichen als „Marginalperson“ (Lewin, 1948) geprägt wurde. Die Definition von Oerter und Dreher legt ihren Schwerpunkt auf die mit dem Eintritt in das Jugendalter auftretenden Anforderungen bzw. Aufgaben und einem damit verbundenen nötigen Kompetenzerwerb. Schelsky demgegenüber zeigt aus soziologischer Perspektive schwerpunktmäßig die mit dem Jugendalter verbundene Problematik einer gesellschaftlichen Rollendefinition im Sinne einer Rand- bzw. Außenseiterposition auf. Ewert (1983) verweist auf Notwendigkeit einer Beachtung des gesellschaftlich-kulturellen und epochalen Hintergrundes für die Definition des Jugendbegriffes. Hierzu finden sich in der Literatur Begriffe wie „gestreckte Pubertät“, „verkürzte Pubertät“, „Moratorium“ und „Lernphase“ (s. Oerter, Dreher, 1995), die aufgrund ihrer unterschiedlichen zeitlichen Erstreckung ein verschiedenes Ausmaß an Entwicklungsund Entfaltungsmöglichkeiten bieten: Jugendlichen werden vor einem unterschiedlichen gesellschaftlichen bzw. schichtspezifischen Hintergrund verschieden lange Zeiträume des „Suchens und Experimentierens“ eingeräumt, um die Anforderungen und Möglichkeiten der Erwachsenenrolle übernehmen bzw. nutzen zu können. Nach Hurrelmann (1997) erfuhr die Jugendphase eine zeitliche Ausdehnung von anfänglich etwa vier bis fünf Jahren (Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts) hin zu zehn Jahren mit einer mindestens fünfjährigen nachgelagerten Phase, was der Autor dem Industrialisierungsprozess zuschreibt. Oerter und Dreher (Oerter, Montada, 1995) verweisen in diesem Zusammenhang auf die Multidimensionalität des Jugendbegriffes, der neben gesellschaftlich-kulturellen Prägungen insbesondere die „Jugend als Entwicklungsstadium im individuellen Lebenslauf“ hervorhebt. Hierzu sei einleitend Hurrelmann (1997) angeführt, der die Besonderheiten dieses Entwicklungsabschnittes folgendermaßen treffend beschreibt: „Im Unterschied zur Kindheit wird in der Jugendzeit eine Bewältigung nur dadurch möglich, dass sich Jugendliche von den primären Bezugspersonen, meist Mutter oder Vater, innerlich ablösen und eine eigenständige, autonome Organisation des Bewältigungsprozesses vornehmen. Waren in der Kindheitsphase noch Imitation und Identifikation mit den Eltern die vorherrschenden psychischen Mechanismen, um mit den Anforderungen zurechtzukommen, so treten sie jetzt deutlich in den Hintergrund. (…) In der Lebensphase Jugend unterscheiden sich die konstitutiven Entwicklungsaufgaben derart stark von der Kindheitsphase, dass es zum ersten Mal im Lebenslauf zu einer bewussten oder doch zumindest bewusstseinsfähigen Entwicklung eines Bildes vom eigenen Selbst und einer Ich-Empfindung kommt.“ In der Adoleszenz werden drei Quellen für die altersspezifischen Entwicklungsaufgaben aktiviert (s. Fend, 1990, 2001): Durch intraindividuelle physiologische und psychologische Veränderungen kommt es zu einer sich verändernden Auseinandersetzung mit sich selbst und der sozialen Umwelt als interindividueller Komponente. Intraindividuelle Veränderungen des Organismus und damit verbundene Veränderungen in der Interaktion mit verschiedenen sozialen Systemen, denen der Jugendliche angehört, sind ihrerseits in einen gegebenen gesellschaftlich-kulturellen Rahmen eingebettet, innerhalb dessen sich die Veränderungen abspielen. Kohnstamm (1999) verweist in diesem Zusammenhang auf Greenberger (Greenberger, Sorenson, 1974), die das Erwachsensein als „psychosoziale Reife“ in Verbindung mit dem Erworbenhaben persönlicher, zwischenmenschlicher und sozialer Kompetenzen betrachtet. Als persönliche Kompetenzen werden z.B. Selbstbeherrschung, Selbstvertrauen und Eigeninitiative genannt. Zwischenmenschliche Kompetenzen beinhalten Kommunikationsfähigkeiten, die Fähigkeit zum Aufbau von zwischenmenschlichen Beziehungen und Vertrauen in soziale Interaktionen. Soziale Kompetenzen beziehen sich auf Toleranz und Offenheit gegenüber anderen. Bereits Havighurst (1948; in Ewert, 1983; und in Remschmidt, 1992) postulierte für den Lebensabschnitt des Jugendalters acht klar umschriebene Entwicklungsaufgaben, die sich von der Phase der Kindheit bzw. des Erwachsenseins unterscheiden: die Akzeptanz der körperlichen Reifung, den Geschlechtsrollenerwerb, den Erwerb reifer sozialer Beziehungen, die emotionale Ablösung von den Eltern und von anderen Erwachsenen, die Vorbereitung auf die berufliche Karriere, die Vorbereitung auf Heirat und Familiengründung, die Übernahme sozialer Verantwortung und die Entwicklung von Werten und eines ethischen Bewusstseins. Oerter (in Hurrelmann, 1997) fügt dem u.a. die Entwicklung eines reflexiven Wissens über sich selbst und die Entwicklung einer Zukunftsperspektive hinzu. Kapfhammer (1993, 1995) benennt sechs verschiedene „Entwicklungslinien“, die im Sinne „idealtypischer Veränderungsmuster“ die Phase der Adoleszenz charakterisieren und ebenfalls Entwicklungsthemen des Jugendalters implizieren, die mit den bereits benannten Entwicklungsaufgaben Übereinstimmungen aufweisen. In Anlehnung an tiefenpsychologische Modelle verweist er zum einen auf eine „psychosexuelle Entwicklungslinie“ mit einer erneuten „Auseinandersetzung mit verdrängten präödipalen, vor allem aber ödipalen Konfliktthemen“, die eine stabile sexuelle Identität ermöglichen sollen. Zudem benennt er eine „selbstwertregulierende und narzisstische Entwicklungslinie“ und damit ein „fragiles Selbsterleben des Jugendlichen“ und in Anlehnung an Erikson (1974) eine „psychosoziale Entwicklungslinie“ in Verbindung mit der Suche nach einer persönlichen „Ich-Identität“. Die drei letztgenannten Entwicklungslinien beziehen sich auf interpersonale, kognitive und moralisch-ethische Aspekte der Entwicklung: Die kognitive Entwicklungslinie beinhaltet „eine zunehmende Kritikfähigkeit“, zweitere meint die Fertigkeit eines Individuums, „sich selbst in einer sozialen Interaktion mit anderen Personen zu begreifen, die unterschiedlichen sozialen Perspektiven zu koordinieren, ein durch eine Problemlage verursachtes interpersonales Ungleichgewicht durch Veränderung der eigenen oder der Belange des anderen assimilativ bzw. akkomodativ zu lösen“, wogegen es im Rahmen der moralisch-ethischen Entwicklungslinie darum geht, „einen Übergang von der heteronomen zur autonomen Moral“ zu vollziehen.
Es erschließt sich deutlich, dass die Phase des Jugendalters vor einem kulturellgesellschaftlichen Hintergrund in der Biografie eines jeden eine bedeutsame und psychologischem Verständnis nach herausfordernde Zeit darstellt, die für die weitere Persönlichkeitsentwicklung von maßgeblicher Bedeutung ist. Deren adaptiv-funktionales und maladaptiv-dysfunktionales Potenzial soll im weiteren Verlauf theoretisch wie folgt weiter herausgearbeitet werden: Remschmidt (1992) zeigt mit seiner Abwägung der Adoleszenz als Übergangsphase einerseits und als eigenständige Phase andererseits auf, dass Adoleszente sich durch ganz spezifische Bedürfnisse, Wertvorstellungen, Interessen und Belastungen auszeichnen, die nicht ausschließlich unter der Perspektive einer „einfachen“ Übergangsposition zwischen Kindheit und Erwachsenenalter zu verstehen sind. Er definiert die Adoleszenz treffend als eine „Lebensphase (…), die den Übergang von der Kindheit zum Erwachsenenalter markiert“, wobei „diese bewusst sehr weit gefasste Umschreibung zeigt, dass nur eine mehrdimensionale Betrachtung den vielfältigen Problemen der Adoleszenz gerecht werden kann. Denn dieser Übergang geht mit einer Reihe tiefgreifender körperlicher Veränderungen einher, er bringt zahlreiche psychische Wandlungen mit sich, führt manchmal zu heftigen Auseinandersetzungen mit der Gesellschaft und ihren Institutionen (…) und weist schließlich bei einheitlichen biologischen Gegebenheiten zahlreiche soziokulturelle Differenzen auf“. Die Abgrenzung zur Kindheit besteht in den beginnenden körperlichen Reifungsprozessen und dadurch abverlangten, vom Kindesalter qualitativ verschiedenen psychischen Verarbeitungsmechanismen, die auf komplexe und multiple Art miteinander verbunden sind, was im Zusammenhang mit dem Thema der Entwicklungsaufgaben einer detaillierten Betrachtung unterzogen wird. Unter psychologischer Perspektive rechtfertigt Hurrelmann (1997) eine Abgrenzung des Jugendalters vom Kindesalter bzw. vom Erwachsenenalter durch das Eintreten der Geschlechtsreife, die ihrerseits eine Zeit einleitet, die eine Integration qualitativ neuer Erfahrungen und Verarbeitungsmechanismen notwendig macht und von einem „abrupten Ungleichgewicht in der psycho-physischen Struktur der Persönlichkeit“ (Hurrelmann, 1997) begleitet ist. Die Psyche hinkt dem Körper hinterher. An dieser Stelle sei auf die Bedeutungen der Begriffe „Pubertät“ und „Adoleszenz“ hingewiesen: Die „Pubertät“ bezieht sich primär auf die mit dem Jugendalter auftretenden körperlichen Veränderungen, wogegen die „Adoleszenz“ die damit verbundenen emotionalen und sozialen Entwicklungs- bzw. Bewältigungsprozesse beinhaltet (Specht in Aschoff, 1996). Als gegenüber dem Erwachsenenalter verschieden sieht Hurrelmann (1997) für Jugendliche die Bewältigung derjenigen Entwicklungsthemen an, die idealtypisch mit Autonomie, Verantwortungsübernahme und mit einer gewissen Stabilisierung der Persönlichkeit assoziiert sind. Die Stellungnahmen und Argumentationen der eben angeführten Autoren verweisen über das Konzept der „Entwicklungsaufgabe“ hinaus auf die Berechtigung einer qualitativen Abgrenzung der Jugendphase mit ihrem richtungsweisenden Entwicklungspotenzial für die Persönlichkeitsentwicklung (s. auch Remschmidt, 1992). Ihre Prozesshaftigkeit muss als solche erkannt und gegebenenfalls im Rahmen einer präventiven bzw. therapeutischen Arbeit mit Jugendlichen nutzbar gemacht werden. Hierzu Hurrelmann (1997): „In psychologischer Perspektive ist die Jugendphase als eine eigenständige Lebensphase insofern anzusehen, als in ihr der Prozess der selbstständigen und bewussten Individuation einsetzt und zu einem zumindest vorläufigen ersten Abschluss kommt. Mit der Individuation, der Entwicklung einer besonderen und unverwechselbaren Persönlichkeitsstruktur, wird das Individuum in die Lage versetzt, sich durch selbstständiges, autonomes Verhalten in seinem sozialen Umfeld zu behaupten.“
Zusammengefasst kann postuliert werden, dass das Jugendalter eine deutlich abzugrenzende und differenziert zu verstehende Lebensphase mit spezifischem Konflikt- und Entwicklungspotenzial darstellt. Sie ist nicht als ein „schneller Übergang“ zu sehen, sondern obliegt spezifischen Transformationsprozessen und Herausforderungen, mit denen der Heranwachsende konfrontiert wird. Das Jugendalter muss als Phase verstanden werden, innerhalb derer es darum geht, durch Kompetenzerwerb eine gesellschaftliche Marginalposition zu überwinden und in das Erwachsenenalter einzutreten. Der Kompetenzerwerb geschieht seinerseits vor dem Hintergrund der bisherigen Biografie und trägt zur Manifestation der Persönlichkeitszüge bei. Der Jugendphase wohnt sinngemäß eine biografisch „eigenwillige“ Dynamik inne, die einer spezifischen Erforschung und individuellen Exploration, wenn Prävention und Therapie greifen sollen. Die angeführten jugendspezifischen Entwicklungsthemen werden, unabhängig von der theoretischen Ausrichtung, relativ einheitlich innerhalb der Jugendliteratur benannt (s. Klosinski in Schneider, 1998; Hurrelmann, 1990; Specht in Aschoff, 1996) und ihre Reflexion legitimiert die Definition einer eigenständigen Entwicklungsphase bzw. macht diese zum besseren Verständnis des Jugendlichen sogar nötig.
In der Literatur wird dabei die Entwicklungsphase der Adoleszenz in unterschiedlichem Ausmaß als obligatorisch krisenhaft betrachtet: Sogenannte „Katastrophentheorien“ (Ewert, 1983; Aschoff in Aschoff, 1996) bzw. „Sturm-und-Drang-Theorien“ (Remschmidt, 1992), wie klassischerweise das Entwicklungsmodell Halls (1904), der psychoanalytische Ansatz Anna Freuds (1958, s.u.) oder der Ansatz Eriksons (1974, s.u.), nehmen eine dem Jugendalter obligatorisch inhärente krisenhafte Dynamik (von unterschiedlicher Qualität) an. Dieser Gedanke wird innerhalb der Literatur durch verschiedene Autoren kritisiert. So widerlegte Mead (1970), wie bereits erwähnt, durch ihre kulturanthropologischen Studien diese krisentheoretischen Annahmen. Auch Schlegel (1973) zeigte den Zusammenhang zwischen kulturell-gesellschaftlichen bzw. psychologischen Stressoren in Verbindung mit multiplen Sozialisationsverläufen einerseits und Jugendkrisen andererseits auf. Coleman wies auf eine mehrheitlich adaptiv-funktionale Bewältigung dieser Phase durch die Betroffenen hin, woraus er die Fokaltheorie der Adoleszenz (Coleman, 1983) entwickelte, die soziologische und tiefenpsychologische Ansätze vereint und den Verlauf einer pathologischen und salutogenen Entwicklung im Jugendalter unterscheidet: „Sie besagt, dass das Individuum im Jugendalter zwar mit einer Anzahl bedeutsamer Probleme konfrontiert wird, doch kann der in der Regel gesunde, flexible und mit ausreichender Spannungskraft ausgestattete Jugendliche diese Probleme in einer Sequenz aufgreifen und nach und nach erfolgreich bearbeiten. Als Resultat ergibt sich überwiegend produktive Adaptation“ (Olbrich in Oerter, 1985).
Eine differenzierte Betrachtung pathologischer versus gesunder Entwicklungsverläufe betont einen individuumsspezifischen Umgang mit den Problemen, die sich in der Adoleszenz auftun. Zusammenfassend stimmen neuere Studien mehrheitlich dahingehend überein, dass sich das Jugendalter per se nicht gezwungenermaßen krisenhaft gestalten muss. So konnte z.B. Endepohls (1995) in einer Studie an 152 Elf- bis 18-Jährigen nachweisen, dass die Befragten, v.a. weiblichen Geschlechts, mit dieser Entwicklungsphase zufrieden sind und dass die Jugendlichen beider Geschlechter damit insbesondere eine Erweiterung des Handlungsspielraums assoziieren, die sie als positiv empfinden. Andere Studien wiesen auf geschlechtsspezifische Unterschiede bezüglich einer stärkeren emotionalen Belastung weiblicher Jugendlicher und einer relativen Zunahme spezifischer psychischer bzw. Verhaltensprobleme in der Adoleszenz hin (s. Übersicht von Petersen et al in Meeus, 1993). Allerdings wird andererseits kritisch eingewandt, dass methodische Divergenzen bezüglich der Erfassung der „Adoleszentenkrise“ und im Speziellen die Tatsache interindividuell sehr verschiedener Biografien nicht den Schluss zulassen, dass die Adoleszenz vorwiegend einen „normalen Verlauf“ nimmt (Stange, 1993). Unter Bezugnahme auf eine Aufstellung entwicklungsrelevanter Themen der Adoleszenz führt Specht (in Aschoff, 1996) Risikofaktoren an, die eine positive Bewältigung erschweren können. Die „Relativierung des Einflusses der Herkunftsfamilie“ kann bei einigen Jugendlichen mit einem widersprüchlichen oder sehr reduzierten Einfluss der Familie einhergehen, der letztlich den postulierten Ablösungsprozess für diese Gruppe der Adoleszenten als schwierig gestaltet. Die Orientierung an Gleichaltrigen birgt die Gefahr eines Zusammentreffens mit extremen bzw. delinquenten Gruppen in sich, deren negatives Potenzial den Jugendlichen in seiner Entwicklung beeinflusst. In Hinblick auf die „Gestaltung sexueller Beziehungen“ benennt Specht die Widersprüchlichkeit gesellschaftlich vertretener Orientierungsmuster, die die Ausbildung einer sexuellen Identität erschweren können. Die „Festigung neuer Körperidentitäten“ sieht er (Specht in Aschoff, 1996) durch die jeweiligen Modeerscheinungen mehr oder weniger gefährdet: „Moden haben Einfluss darauf, wie sicher oder unsicher man sich in seiner Haut durch Übereinstimmung mit anderen oder aber auch durch den Kontrast gegenüber anderen fühlt (…). Das Bemühen um Selbstvergewisserung kann durch die Macht, die von Moden ausgeht, zu einem Hindernis für Selbstbestimmung werden.“ Die „Entwicklung realistischer beruflicher Pläne“ erscheint aufgrund der momentanen Arbeitssituation zudem als schwierig. Ebenso schwer kann es für einen Jugendlichen sein, ein Wertesystem auszubilden, wenn man sich den gesellschaftlich forcierten Wertewandel und die widersprüchlich handelnde Erwachsenenwelt vor Augen führt. Faktoren, die letztlich eine krisenhafte Entwicklung fördern, stellen in diesem Zusammenhang nach Specht (in Aschoff, 1996) „konstitutionelle Bedingungen“, „Verletzbarkeit als Folge früher Beziehungsstörungen“, „Unsicherheiten und/oder Festlegungen durch einseitige Erfahrungen (Neurotische Entwicklungen)“ bzw. „aktuelle Beziehungskonstellationen in Familie, Schule, Gleichaltrigengruppe“ dar. Remschmidt (1992) unterscheidet in diesem Zusammenhang verschiedene Verlaufsformen psychischer bzw. psychiatrischer Störungen im Jugendalter: Bei einem zweigipfligen bzw. kontinuierlichen Verlauf besteht eine von der Kindheit an existierende psychische Störung entweder bis in die Adoleszenz hinein weiter oder wird in dieser Phase reaktualisiert. Andererseits können Störungen bis zur Adoleszenz abklingen bzw. mit der Adoleszenz ihren Abschluss finden (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, Enuresis, Enkopresis etc.), oder aber psychische Störungen treten mit der Adoleszenz vor dem Hintergrund einer unauffälligen Kindheit auf, was Meyer (1973) als „autochtone Reifungskrise“ bezeichnet. Nach Remschmidt (1992) ist die Adoleszentenkrise entweder der ersten oder der letzten Kategorie zuzuordnen. Remschmidt (1992; s. auch Resch, 1996) versteht die Adoleszentenkrise als Ausdruck maladaptiv-dysfunktionaler Bewältigungsmechanismen jugendspezifischer Entwicklungsaufgaben, die ihren Ausdruck in neurotischem und psychotischem Erleben bzw. Persönlichkeitsfehlentwicklungen finden können. Er definiert sie als folgendes Phänomen: „Bei der Adoleszentenkrise kommt es vor dem Hintergrund einer Reifungs- und Entwicklungsproblematik zu erheblichen intrapsychischen Problemen, die relativ häufig die Grenze zum Notfall überschreiten und dann als Notfall behandelt werden müssen. Die Adoleszentenkrisen sind für diese Altersstufe spezifische Krisen. Sie lassen sich auch auffassen als fehlgeschlagene Bewältigung der adoleszentenspezifischen Entwicklungsaufgaben. Der Jugendliche ist überfordert von der Vielzahl der zu bewältigenden Probleme und schafft es nicht, der neuen Situation angepasste Bewältigungsmechanismen zu entwickeln.“ Und weiter: „Der Terminus ,Adoleszentenkrise‘ ist eine ungenaue Bezeichnung für eine Reihe sehr unterschiedlicher Auffälligkeiten des Erlebens und Verhaltens in der Adoleszenz (…). Synonym mit ,Adoleszentenkrise‘ kann die Bezeichnung ,Normvarianten des Erlebens und Verhaltens in der Adoleszenz‘ verwendet werden. Denn vom Grundsatz her handelt es sich um Variationen der Entwicklung der Adoleszenz, die sich meist im Bereich des Erlebens (Selbstwertskrupel, Schuldgefühle, Insuffizienzgefühle, körperliche und seelische Selbstwertkonflikte) oder auch im Verhalten (Suizidversuche, Weglaufen, übertriebene Protesthaltung) ausdrücken.“
Klosinski (in Lempp, 1981; s. auch Klosinski in Schneider, 1998) zeigte in einer empirischen Untersuchung an 309 Probanden im Alter von zehn bis 20 Jahren die Relevanz des Alters, des Geschlechts und der Geschwisterkonstellation für die Beschaffenheit der Adoleszentenkrise auf. Bei männlichen Jugendlichen wurde die Pubertätskrise eher von externalisierender Symptomatologie (antisoziales Verhalten, Aggressivität, Diebstähle, kriminelle Tendenzen) begleitet, wogegen bei den Mädchen das v.a. in der Hochpubertät (zwischen 13 und 15 Jahren) bestehende Aggressionspotenzial eher in eine internalisierende Symptomatik (Suizidalität) mündet. Trotzdem internalisierendes Verhalten eher bei weiblichen Probanden anzutreffen war, konnte auch bei den männlichen Jugendlichen eine relative Steigerung an Suizidversuchen in der Hochpubertät festgestellt werden, was Klosinski (in Lempp, 1981) mit einer in dieser Phase bestehenden gesteigerten Ich-Labilität erklärt. Mit dem Heranwachsen werden Probleme mit den Eltern zu zentralen Themen der Adoleszentenkrise. Tendenziell scheinen zudem eher Einzelkinder oder Erstgeborene von einer Pubertätskrise betroffen zu sein.
Die in der Literatur oftmals geschlechtsspezifisch erhöhten Depressionswerte weiblicher Probanden in der Pubertät scheinen nach Joiner et al. (1999) mit anderen internalisierenden (Dys-)Funktionalitäten in einem Zusammenhang zu stehen. Die Ergebnisse ihrer Studie an einer Patientengruppe ergaben, dass sich Jugendliche in Hinblick auf die „reinen“ Depressions- bzw. Angstwerte nicht unterschieden, wogegen bei weiblichen Adoleszenten eher Komorbiditäten depressiver mit Angstsymptomen zu bestehen scheinen. Fend (2001) erklärt die wesentlich höhere Rate depressiver Verstimmungen bei weiblichen Jugendlichen u.a. mit mehr Schuldgefühlen und geringerer emotionaler Distanzierung bei Konflikten, mit gesellschaftlich widersprüchlichen Erwartungen, die v.a. an die weiblichen Jugendlichen herangetragen werden, mit einem negativen Körperselbstbild, mit einer reduzierteren Fähigkeit zur Bewältigung des Ablösungsprozesses und mit tendenziell mehr kritischen Lebensereignissen.
Im Sinne einer systemischen Betrachtungsweise kann eine Entwicklungs- bzw. Adoleszentenkrise als Ausdruck bestimmter Verhältnisse innerhalb eines sozialen Systems verstanden werden. „Eine der wichtigsten Prämissen der systemischen Sichtweise ist: Nicht die Pathologie (Abweichung) ist das Problem, sie ist die Lösung. Was das dahinterstehende Problem ist, gilt es herauszufinden“ (Hosemann in Aschoff, 1996). Hosemann verweist auf die spezifische Problematik, die die Adoleszenz für die Eltern mit sich bringen kann; Eltern und Kinder unterscheiden sich in Hinblick auf ihre Zukunftsperspektive, die spezifischen Entwicklungsaufgaben und bezüglich der Integration in das gesellschaftliche System, was eine besondere Dynamik in sich birgt: „Wenn die Kinder anfangen, die Welt zu erobern, sind die Eltern (oder ein Elternteil) meist auf dem Höhepunkt ihrer Karriere (…). Während sich für die jüngere Generation die Wege öffnen, muss sich die ältere damit abfinden, dass ihre Möglichkeiten weniger werden (…). Jede Generation hat zu jedem Zeitpunkt ihres Lebens gewisse Entwicklungsaufgaben. Sind die Adoleszenten damit beschäftigt, sich auf ein selbstständiges Leben vorzubereiten, Beziehungen, Partnerschaften aufzubauen, so müssen sich die Eltern (vor allem natürlich die Mütter) mit der Phase des ,leeren Nestes‘ auseinandersetzen (…). Der dritte wichtige Unterscheidungspunkt ist die Integration in das gesellschaftliche System: Der Übergang vom Kindheits- in den Erwachsenenstatus ist inzwischen aller Rituale beraubt worden, oder sie sind so verkürzt, dass sie in ihrer Bedeutung unwirksam geworden sind.“
Nach Remschmidt (1992) ist für 30–40% derer, die eine Adoleszentenkrise durchleben (was für etwa 20% der Jugendlichen zutrifft), von einem günstigen Ausgang auszugehen. Bei dem restlichen Prozentsatz „muss man mit einem Übergang in eine schizophrene Psychose, eine Persönlichkeitsstörung oder eine längerfristige neurotische Entwicklung rechnen“. Klosinski (1980; und in Schneider, 1998) verweist hierbei auf die phänomenologische Nähe der Adoleszentenkrise zu der Borderline-Persönlichkeitsstruktur, die eine Diagnose dieser Persönlichkeitsstörung in der Jugendphase infrage stellt. Auch Remschmidt (1992) benennt für die Adoleszenz Störungsbilder, die den phänomenologischen Symptomen einer Borderline-Persönlichkeitsstörung zugeordnet werden können: Störungen der Sexualentwicklung, Identitäts- und Autoritätskrisen, Entfremdungserlebnisse (Depersonalisation und Derealisation), körperliche Selbstwertkonflikte (Dysmorphophobien) und narzisstische Krisen, Suizidversuche und Dissozialität/Delinquenz/Verwahrlosung.
Hierzu Hurrelmann und Lösel (1990): „Health problems in adolescence differ from those in other life stages. For example, the most frequent causes of death in adolescence are not illnesses but traffic accidents and unintended injuries (…). Violence, murder, homicide and suicide make up a second leading group of causes of death. Alcohol and drug abuse, smoking, the acquired immune deficiency syndrome (AIDS) and other sexually-transmitted diseases, early pregnancy, appetite disorders, malnutrition, allergies and emotional and behavioral disorders are other widespread problems that clearly indicate that the image of ,healthy adolescence‘ is inaccurate.“
Klosinski (in Hartmann-Kottek-Schröder, 1988) zeigt in diesem Zusammenhang „in diathetischen Gegensatzpaaren“ erscheinende gesellschaftliche Bedingungen auf, die analog der individuellen Adoleszentenkrise für die Entwicklung Jugendlicher erschwerende Rahmenbedingungen darstellen: „Abhängigkeit versus Unabhängigkeit“, „Omnipotenz versus Impotenz“, „Passivität versus Aggressivität“, „Altruismus versus Narzissmus“, „Identität versus Identitätsdiffusion“ und „Rationalismus versus Irrationalismus“. Der Prozess der Individuation wird nach Klosinski (in Lempp, 1981) von einem gleichzeitig bestehenden Wunsch „nach Sicherheit und einem fest strukturierten Rahmen“ begleitet (s. auch Garrion & Garrison, 1975). Parallel dazu sieht er einen durch die wirtschaftliche Entwicklung unserer Gesellschaft entstandenen Abhängigkeits-Unabhängigkeitskonflikt: Gesellschaftlich möglich gewordene Erweiterungen des Handlungsspielraums vor dem Hintergrund gesicherter wirtschaftlicher Ressourcen geraten ins Schwanken. Innerhalb der gesellschaftlichen Wandlungsprozesse und Schnelllebigkeit geht der Einzelne verloren, was ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis erweckt, das zu dem Wunsch nach Aufrechterhaltung und Erweiterung gesellschaftlicher Freiheitsgrade in Widerspruch steht.
Der Macht-Ohnmachtskonflikt stellt sich nach Klosinski (in Lempp, 1981) bei den Jugendlichen derart dar, dass die Adoleszenten auf der einen Seite wegen ihrer Abhängigkeitswünsche die Gefühle der Impotenz entwickeln, andererseits im Sinne eines kompensatorischen Mechanismus zu Omnipotenzfantasien neigen: Zudem verweist Klosinski auf die Vermarktung von Sexualität, die bei Jugendlichen u.U. einen Leistungsdruck hervorruft, welcher zu Gefühlen der Impotenz führen kann.
Das Hin- und Herschwanken des in einer Entwicklungskrise befindlichen Jugendlichen zwischen Gefühlen der Allmacht und der absoluten Ohnmacht spiegelt sich in Klosinski in der technischen Entwicklung wider, die einerseits Horizonte eröffnet, auf der anderen Seite damit einhergehende Risiken und Katastrophen impliziert. Weiter führt Klosinski an: „Hinzu kommt, dass das Beängstigende an unserer Lage gekennzeichnet ist durch das wachsende Missverhältnis zwischen dem äußeren Aufstieg unserer westlichen Zivilisation, ihren überwältigenden materiellen und technischen Mitteln einerseits und dem Stillstand oder dem zu geringen Fortschritt der inneren, insbesondere der ethischen Kräfte andererseits.“ Die Entwicklungsaufgabe der „Wir-Bildung“ (Klosinski in Lempp, 1981) wird in einer Gesellschaft erschwert, „die den Einzelmenschen zum Maß aller Dinge gemacht hat“ und die durch „Konkurrenzdenken“, „Rivalisieren“ und „egozentrisches Verhalten“ geprägt ist. Die Identitätsausformung, die, wie Klosinski betont, in der Interaktion mit der sozialen Umwelt passiert, erscheint zudem im Rahmen eines gesellschaftlichen Kontextes erschwert, der durch Widersprüche, Verunsicherungen und Unvorhersehbarkeit geprägt ist.
Bei Jugendlichen beobachtbare Passivität bzw. Aggressivität bringt Klosinski (in Lempp, 1981) in einen Zusammenhang mit Reality-TV bzw. den Medien im Allgemeinen: „Durch die modernen Nachrichtentechniken und Massenmedien sind wir vermehrt und gezwungenermaßen passive Zuschauer der ,Weltbühne‘ geworden. Ereignisse wie Kriege und Katastrophen werden in sachlich-informativer Weise dargereicht, ohne dass oftmals ausreichend Zeit verbleibt, solche emotionalen Erschütterungen psychisch zu verarbeiten: Es folgt ein Werbespot oder ein Unterhaltungsprogramm.“ Als die letzte Polarität führt Klosinski Rationalismus versus Irrationalismus bzw. Areligiosität versus Religiosität an: „Ziel aller seelisch-geistigen Entwicklung in der Adoleszenz ist die totale Sinngebung und Sinnerfahrung im persönlichen Leben, und dieses Ziel strebt der Jugendliche umso mehr an, je mehr er der kindlichen Elternimagines verlustig ging und neue Objektrepräsentanzen in Form von Idolen oder ,Ersatzeltern‘ suchen muss. Mit seiner Suche nach dem endgültigen Sinn steht der Jugendliche einer Gesellschaft gegenüber, die durch ihre Anfälligkeit für Okkultes versucht, die Entzauberung und ,Entgötterung‘ der Welt, die letztlich Folgen des Rationalismus und der Rationalisierung sind, wieder auszugleichen“ (Klosinski in Lempp, 1981). Hierzu Stange (1993): „Unerbittlich heißt es jetzt: Verhalte Dich individualisiert, indem Du Dein Leben selbst entwirfst, keiner ist mehr verantwortlich außer Dir selbst.“ Die damit einhergehenden gegenläufigen Ansprüche bezüglich Kleidung und des Sprachjargons stehen diesen Anforderungen, worauf Stange auch verweist, entgegen und lassen Widersprüche entstehen. Der gesellschaftliche Kontext muss in seiner Beeinflussungskraft gegenüber salutogenen bzw. pathogenen Entwicklungen der Jugendlichen gesehen werden: „Today, however, social, economic and political conditions in many nations are making it difficult for this age group to develop the skills they need to take on these tasks in responsible ways“ (Gibson-Cline, Dikaiou in Gibson-Cline, 1996).
Was die spezifischen Herausforderungen und Aufgaben des Entwicklungsabschnittes „Adoleszenz“ für das intrapsychische System anbelangt, so wird vor dem Hintergrund entwicklungspsychologisch einschlägiger Autoren zusammenfassend Folgendes deutlich: Der Erwerb bzw. der Ausbau von Skills zur Emotionsregulation und Beziehungsgestaltung spielen eine zentrale Rolle, was die Bewältigung adoleszentenspezifischer Herausforderungen anbelangt. Das Jugendalter impliziert eine tiefgreifende Veränderung der Person-Umwelt-Interaktion und kann in Anlehnung an das Konstrukt der „Entwicklungsaufgabe“ (Oerter und Dreher, 1995; Remschmidt, 1992) in Zusammenhang mit der Etablierung adaptivfunktionaler bzw. maladaptiv-dysfunktionaler Bewältigungsmechanismen als eine einschneidende Episode für die Persönlichkeitsentwicklung verstanden werden, innerhalb derer dem Individuationsprozess eine besondere Bedeutung beigemessen wird: Vor dem Hintergrund intraindividueller physiologischer und psychischer Veränderungen tritt der Jugendliche in einen veränderten Kontakt mit der ihn umgebenden sozialen Umwelt; die zunehmende Fähigkeit zur Selbstreflexion macht Verantwortungsübernahme und Selbststeuerung mehr und mehr möglich bzw. nötig.
Steinberg (s. Montada, 2002) nimmt in seiner Hypothese der emotionalen Distanzierung entsprechend einer Verringerung der Bindung (attachment) dabei an, dass die Jugendlichen sich während der Phase der Ablösung obligatorisch emotional aus der Familienbande lösen, was angesichts emotionaler Überforderung für psychische Symptome der Angst und Depression vulnerabel macht. Demgegenüber besagt die Dämpfungshypothese (buffering hypothesis) nach Armsden und Greenberg (1987) in Anlehnung an die Attachmenttheorie, dass Jugendliche in der Phase der Adoleszenz nicht selbstredend in emotionale Distanz zu ihren Eltern gehen. Vielmehr sind diejenigen Adoleszenten, die im Rahmen erhöhter Stresssituationen, wie sie die Entwicklungsphase der Adoleszenz darstellen kann, Zuflucht bei den Eltern suchen, weniger anfällig für psychische Symptome. Empirische Ergebnisse belegen tendenziell die Dämpfungshypothese, was Steinbergs generalisierte Annahme emotionaler Distanzierung widerlegt (s. Oerter, Dreher, 1995).
Auch dem Konzept der Strategischen Jugendlichentherapie nach bedarf es vor dem Hintergrund eines differenzierten theoretischen Verständnisses für eine adaptiv-funktionale bzw. eine maladaptiv-dysfunktionale Persönlichkeitsentwicklung einer Differenzierung: Der Individuationsprozess ist nicht per se mit emotionaler Autarkie Jugendlicher von deren Eltern gleichzusetzen. Gelungene Ablösung muss vielmehr als eine Form des Individuationsprozesses verstanden werden, in dem es bei einer weiterhin bestehenden Bindung zwischen Eltern und Jugendlichen zu emotionalen Veränderungen kommt, innerhalb derer sich in Abhängigkeit von der Qualität der frühen Eltern-Kind-Beziehung spezifische handlungsleitende Konzepte als prägend und zentral erweisen (s. auch Aunola et al., 2000).
Vor dem Hintergrund eines Differenzierungsversuchs nimmt die Strategische Jugendlichentherapie dabei an, dass in der Phase der Adoleszenz nicht nur Autonomie-, sondern auch Zugehörigkeitsbedürfnisse von Bedeutung sind (Richter, 2006; Richter-Benedikt, 2009). Das affektiv-kognitive Entwicklungsmodell von Sulz (1992, 1994, 2001, 2005) bietet in diesem Zusammenhang einen Erklärungsansatz, wonach in Abhängigkeit von der individuellen Lerngeschichte und des damit verbundenen Entwicklungsniveaus des Einzelnen spezifische Bedürfnisse, Ängste, Wutformen und Persönlichkeitsmuster in den Vordergrund rücken. Selbige stellen zentrale Komponenten bzw. Arbeitshypothesen der Evaluationsstudie dar, wobei die Strategische Jugendlichentherapie neben der konkreten Symptomtherapie in der therapeutischen Arbeit eine generelle Förderung salutogener bzw. eine umfassende Abwendung pathogener Entwicklungstendenzen zum Ziel hat (s. auch Sulz & Müller, 2000; Sulz & Tins, 2000).
Adoleszentenspezifische Entwicklungsdynamik und Symptombildung bzw. sich daraus ergebende therapeutische Implikationen sollen anhand einer Stichprobe von Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren mittels eines dafür adaptierten Fragebogeninventars, dessen therapeutisches Konzept für Erwachsene (Sulz, 1992, 1999a, 1999b; Sulz et al., 1998, 1999, 2005, 2009) bereits existiert, methodisch abgebildet und evaluiert werden.
D.h. die empirischen Fragestellungen dieser Arbeit bestehen v.a. darin, Bedürfnisse, Angst, Wut, Persönlichkeitstendenzen und Entwicklungsdynamiken für den Lebensabschnitt der Adoleszenz differenziert und individuell zu erfassen, um vor dem Hintergrund spezifischer Interventionen eine therapeutische Förderung salutogener bzw. eine Abwendung pathogener Entwicklungstendenzen zu unternehmen bzw. präventive und therapeutische Implikationen abzuleiten. Zudem gilt es, Bedürfnisse, Ängste, Wut und Persönlichkeitstendenzen durch ein differenziertes Theorieverständnis mit dem Konstrukt der „Adoleszentenkrise“ in einen Zusammenhang zu bringen bzw. basierend auf der affektiv-kognitiven Entwicklungstheorie und dessen Überführung in einen entsprechenden therapeutischen Ansatz einen Erklärungsansatz für die Manifestation psychischer Symptome und Persönlichkeitstendenzen in der Jugendphase zu bieten.
II. Theoretischer Teil
2.1 Eine Theorie menschlicher Entwicklung
Was bedeutet „Entwicklung“ und was ist der Motor des „Entwicklungsprozesses“? Eine eindeutige Definition dessen vorzunehmen, was inhaltlich konkret unter „Entwicklung“ verstanden wird, ist per se nicht möglich, da innerhalb der Psychologie diesbezüglich verschiedene definitorische bzw. theoretisch-konzeptionelle Auffassungen bestehen. Eines wird aber deutlich (Flammer, 1996; Trautner, 1997): Entwicklung impliziert eine Dynamik, eine Veränderung vs. Stillstand. Ein dynamisches Verständnis von Entwicklung ist das der grundlegenden „Veränderung“. Hierbei ist der Entwicklungsaspekt in Abgrenzung vom Begriff des „Lernens“ auf einem Zeitkontinuum eher langfristig angesetzt und umfasst verschiedene Funktionsbereiche gleichzeitig. Allerdings spielen auch innerhalb der Entwicklung kurzfristige Lernprozesse eine Rolle, wenn sie weiterführende Konsequenzen nach sich ziehen, sodass eine Wechselwirkung zwischen Entwicklung und Lernen besteht und die beiden Prozesse sich gegenseitig nicht selbstredend ausschließen. Zum einen können Lernprozesse die Entwicklung anstoßen oder auch hemmen, zum anderen eröffnet Entwicklung die Möglichkeit zu neuen Lernprozessen. Entwicklung wird von einigen als „reifungsbedingte Veränderung“ aufgefasst, was einen organisch-biologisch programmierten Entwicklungsprozess impliziert. Andere verstehen Entwicklung als „Veränderung zum Besseren und Höheren“, womit eine wertende Komponente eingebracht wird, oder als „qualitative bzw. strukturelle Veränderung“, ohne dabei eine wertende Stellungnahme abzugeben. Ein Teil der Theoretiker beschäftigt sich in diesem Zusammenhang mit kulturübergreifenden, generalisierbaren Veränderungen und sieht Entwicklung demzufolge als „universelle Veränderung“ an. Eine andere, diesem Standpunkt entgegengesetzte Definitionsmöglichkeit ist die von Entwicklung als „Sozialisation“, womit die Adaptation der Person an die kulturellen, gesellschaftlichen Normen und Regeln gemeint ist (s. Trautner, 1997).
In Anlehnung an das vielfältige Verständnis von „Entwicklung“ existiert eine Vielzahl von Entwicklungstheorien, die den Entwicklungsprozess in seiner Dynamik und bezüglich seiner inhaltlichen Ziele unterschiedlich verstehen, was eng mit dem jeweils implizit angenommenen Welt- bzw. Menschenbild verbunden ist. In diesem Zusammenhang wurde von Reese und Overton (1979) durch Abstraktion von konkreten Inhalten eine weithin gültige Einteilung von Entwicklungstheorien in grundlegende Metamodelle unternommen. Sie unterscheiden die mechanistischen von den organismischen Modellen: Der Begriff „mechanistisch“ wurde dabei unter theoretischer Orientierung an die Newtonsche Maschine, die aus einzelnen, voneinander zu unterscheidenden Teilen zusammengesetzt ist und durch peripher wirkende Kräfte angetrieben wird, konzipiert. Psychische Phänomene wie Emotionen werden innerhalb dieses Ansatzes sinngemäß mit maschinell wirksamen physikalischen und chemischen Prozessen gleichgesetzt und als im menschlichen Organismus ablaufende neuronale Veränderungen bzw. elektrische Aktivität erklärt. Der Mensch beantwortet eingehende Umweltreize automatisch reaktiv, nimmt die Stimulationen von außen im Sinne des naiven Realismus also auf festgelegte Weise wahr und hat keinen aktiven Einfluss auf den informationsverarbeitenden Prozess. Entwicklung meint hier eine Veränderung beobachtbarer Verhaltensweisen über die Zeit hinweg, wobei sich durch die Verknüpfung einzelner Verhaltenselemente v.a. ein quantitativ komplexeres Verhalten aufbaut. Organismische Theorien betonen demgegenüber die Eigenaktivität des sich entwickelnden Menschen, der sich durch eben diese ihm zugeschriebene aktive Rolle zu dem macht, was er ist. In aktiver Auseinandersetzung mit der Umwelt setzt der Entwicklungsprozess durch aktive Wahrnehmung und Verarbeitung bzw. Konstruktion der Realität ein. Dabei kommt es zur qualitativen Veränderung psychischer Strukturen, die im Sinne epigenetischer Modelle auf der vorausgehenden Stufe aufbauen und ein verändertes Organisationsniveau implizieren.
Ein in der Literatur außerdem angeführtes Entwicklungsmodell ist das dialektische, das eine Veränderung des Menschen in einer sich verändernden Umwelt annimmt und dabei kulturelle Einflüsse betont, wobei nach diesem Gedanken die aufeinander aufbauenden Organisationsstufen miteinander interagieren und durch eben diese Interaktion der Entwicklungsprozess vorangetrieben wird (s. Montada, 1995; Trautner, 1997).
2.1.1 Entwicklung im Jugendalter: Anlage oder Umwelt?
Auch zu den Theorien des Jugendalters finden sich in der Literatur unterschiedliche Kategorisierungsversuche, die in ihrem historischen Verlauf einen Wandel von der Annahme personinhärenter Entwicklungsprogramme über das Postulat gesellschaftsdeterminierter Entwicklungsprozesse hin zu einem Verständnis von Entwicklung als Person-Umwelt-Interaktion nahmen (Fend, 2001). Zunächst gilt es, einen kurzen Überblick über wichtige theoretische Ansätze zur Entwicklungsdynamik im Jugendalter zu geben: Ewert (1983) differenziert zwischen „Katastrophentheorien der Adoleszenz“, die für das Jugendalter aufgrund intensiver psychischer, physischer und sozialer Veränderungen eine obligatorische Krise mit einem abrupten Übergang von einem Entwicklungsstadium zum nächsten annehmen, der „kulturanthropologischen Theorie des stetigen Übergangs von der Kindheit ins Jugendalter“, die, eingebettet in und geprägt durch das kulturelle Umfeld, eine Pubertätskrise nicht als zwingend betrachtet und schließlich dem Verständnis des „Individuum(s) als Gestalter seiner Entwicklung“. Letztere Kategorie betont das in der einzelnen Person verankerte Gestaltungs- und Entwicklungspotenzial. Oerter (1997 in Oerter, Montada) unterscheidet Anlagetheorien, Umwelttheorien und Interaktionstheorien der Adoleszenz, die unter Berücksichtigung von u.a. Ewerts Ausführungen im Rahmen dieser Arbeit als Grundlage für einen Kategorisierungsversuch herangezogen werden sollen und zum Ziel haben, vor einem historischen Hintergrund eine Übersicht über die in der Literatur diskutierten Vorstellungen zu diesem wichtigen Lebensabschnitt zu bieten.
2.1.1.1 Anlagetheorien der Adoleszenz
Einen wichtigen Vertreter des anlagetheoretischen Ansatzes stellt Stanley G. Hall (1904; s. auch Oerter, Dreher, 1995; Kohnstamm, 1999) dar, der in Anlehnung an Darwin und Haeckel ein evolutionstheoretisches Verständnis des Entwicklungsprozesses vertrat. Demnach bildet die Ontogenese die Phylogenese im Sinne einer Rekapitulationstheorie ab bzw. wiederholt sich in der Entwicklung jedes Einzelnen die Entwicklung der Menschheitsgeschichte: In den ersten sechs Lebensjahren wird die Entwicklung des Affenmenschen rekapituliert; die Spanne vom sechsten Lebensjahr bis zur Geschlechtsreife spiegelt die Entwicklung des Urmenschen wider und mit dem Erwachsenenalter wird letztlich in das Stadium des s.g. „modernen Menschen“ eingetreten. Nach Hall stellt die Adoleszenz diejenige Phase dar, „in der der Übergang vom Tierhaften des Urmenschen zur menschlichen Zivilisation stattfinden muss“ (Kohnstamm, 1999). Hall prägte durch seine Theorie die Idee der s.g. „Sturm- und Drangperiode“ (s. auch Remschmidt, 1992), wonach das Jugendalter durch eine emotionale Krise bzw. durch ein krisenhaftes Erleben und Verhalten führen muss, damit der Mensch sich weg vom Primitiven hin zum Kulturellen entwickeln und durch das Durchleben der Krise die dafür nötigen Voraussetzungen erwerben kann. Hall, der als Vorreiter einer wissenschaftlich begründeten Psychologie der Phase des Jugendalters gilt, regte zahlreiche andere Autoren, wie z.B. Kroh (s. Oerter, Dreher, 1995; Remschmidt, 1992), zu biogenetisch orientierten Modellvorstellungen an.
Zwei zentrale Kritikpunkte dieser biogenetischen Modelle stellen hierbei die empirische Widerlegung ihrer implizierten Entwicklungsphasen und die einseitige Beachtung des Somas bzw. die Unterschätzung kultureller Einflüsse dar (Remschmidt, 1992). Zudem muss diese Vorstellung von der Jugendzeit als zwingend krisenhaft, die in der Literatur in Anlehnung an Thomae (1969) auch unter der Bezeichnung des „Störreizmodells“ (s. auch Remschmidt, 1992; Oerter, Dreher, 1995) noch weithin Verbreitung findet, nach neuen Forschungsergebnissen fallen gelassen werden (Remschmidt, 1992; Kohnstamm, 1999). Spätere Ausführungen zum Thema der „Adoleszentenkrise“ werden hierzu weitere Aufschlüsse geben.
2.1.1.2 Umwelttheorien der Adoleszenz
Im Gegensatz zu den Anlagetheorien gehen die Umwelttheorien der Adoleszenz, die v.a. in den Sechzigerjahren ihren Aufschwung hatten (Fend, 2001), primär von der Prägung der Phase des Jugendalters durch äußere Faktoren aus. Die beiden großen theoretischen Ansätze, die Oerter und Dreher (1995) unter diesen Gliederungspunkt gruppieren, stellen der kulturanthropologische und der Ansatz der sozialen Lerntheorien dar.
Im Rahmen der kulturanthropologischen Ansätze wird die Frage aufgeworfen, ob die Adoleszenz eine zwingende Phase im Leben des Einzelnen ist, die einem mehr oder weniger rigiden Ablauf folgt, oder ob sich diese Phase in Abhängigkeit von unterschiedlichen kulturellen Hintergründen qualitativ bzw. quantitativ unterschiedlich gestaltet bzw. das Erleben und Verhalten des Einzelnen prägt.
Lerntheoretische Umweltmodelle erklären die spezifischen Phänomene des Jugendalters durch das Erleben und Verhalten formende Reiz-Reaktionszusammenhänge, wobei Oerter und Dreher (1995) zwei frühe Theorien des sozialen Lernens hervorheben: die Annahmen von Davis (1944), der eine „Theorie der sozialisierten Angst“ aufstellt und davon ausgeht, dass das Verhalten durch gesellschaftliche Regeln und Normen über die Emotion „Angst“ vermittelt wird. Der Einzelne macht in der Interaktion mit der Umwelt die Erfahrung, „dass erwünschtes Verhalten gebilligt und belohnt wird, während unerwünschtem Verhalten Missbilligung und Strafe folgen. Die Antizipation von Bestrafung ist mit unangenehmen Gefühlszuständen verbunden, die Davis als sozialisierte Angst‘ bezeichnet. Die Reduktion oder Vermeidung dieser Angst sieht er als Grund, sich in Übereinstimmung mit gesellschaftlichen Rollenerwartungen zu verhalten“ (Oerter, Dreher, 1995). Davis geht im Sinne soziologischer Ansätze davon aus, dass eine gesellschaftliche Definition der Rolle Jugendlicher für die Einzelnen nicht gesellschaftlich eindeutig definiert ist, sodass die Regulationsmöglichkeiten und die Reduktion sozialisierter Angst erschwert werden, was er seinerseits zur Erklärung der im Jugendalter auftretenden Gefühlslabilität heranzieht.
Eine weitere Theorie, die von Oerter und Dreher (Oerter, Montada, 1995) als lerntheoretischer Ansatz angeführt wird, ist die von McCandless (1970), der Lernen auf der Basis triebtheoretischer Annahmen erklärt: Nach McCandless kommt in der Jugend mit Betonung der Triebkomponente Sexualität in Interaktion mit der Umwelt zielgerichtetmotiviertes Verhalten auf, um im belohnenden Sinne Triebreduktion zu erlangen bzw. durch Bestrafung verhinderte Triebreduktion zu vermeiden.
Beide theoretischen Ansätze betonen die Bedeutsamkeit von Umwelteinflüssen für Verhaltensmodifikationen während der Adoleszenz: Nach Davis lassen unscharfe Erwartungen der Gesellschaft jugendspezifische Probleme entstehen, weshalb innerhalb dieses Ansatzes die krisenhafte Zeit der Jugend als obligatorisch betont wird. McCandless sieht die Krise nicht als obligatorisch an, schließt sie allerdings auch nicht aus: „Die Zeitdauer der Habitualisierung und des Aufbaus einer neuen Selbstdefinition kann für den Jugendlichen eine Periode unverminderter Triebspannung darstellen und von daher Stress und emotionale Belastung mit sich bringen“ (Oerter, Dreher, 1995). Auch die Theorie des „Strebens nach positiver Selbstbewertung“ von Susan Harter (1990) beinhaltet lerntheoretische Annahmen im Sinne des Verhaltensaufbaus durch Verstärkung, wonach das Selbstwertgefühl durch die Akzeptanz und somit durch das positive Feedback der Umwelt beeinflusst wird.
2.1.1.3 Interaktionstheorien der Adoleszenz
In der neueren Literatur wird „Entwicklung“ in der Periode der Adoleszenz tendenziell als kontinuierlicher, progressiver Prozess verstanden, dem regressive Anteile innewohnen können (Seiffge-Krenke in Hurrelman, Lösel, 1990; Seiffke-Krenke, 1994; Petersen et al. in Meeus, 1993) und der im Sinne einer Person-Umwelt-Interaktion geschieht. Interaktionstheoretische Ansätze der Adoleszenz können als Integration anlagetheoretischer und umwelttheoretischer Annahmen betrachtet werden, da sie sowohl dem Einzelnen, als auch den Umwelteinflüssen in Hinblick auf die Entwicklung der Persönlichkeit eine wichtige Bedeutung zukommen lassen. Ansätzen, die von einer Interaktion zwischen Individuum und Umwelt ausgehen, beschreiben Personen in unterschiedlichem Ausmaß als „Gestalter ihrer Entwicklung“ (Silbereisen in Schumann-Hengsteler, Trautner, 1997). Bei einer differenzierten Betrachtung interaktionstheoretischer Annahmen der Adoleszenz werden in diesem Zusammenhang nach Lerner und Spanier (Oerter, Dreher, 1995) „schwache“, „moderate“ und „starke“ Interaktionstheorien unterschieden, die den Komponenten Anlage und Umwelt jeweils unterschiedliche Gewichtungen zuschreiben.
2.1.1.3.1 Sigmund und Anna Freud
Ewert (1983; s. auch Freud, 1940) teilt den psychoanalytischen Ansatz der Kategorie der biogenetischen Theorien zu, da Entwicklungen entsprechend im Schwerpunkt durch festgeschriebene, phasenspezifische Abläufe vorangetrieben werden. Dennoch wirken auf der Grundlage vorprogrammierter personinterner Komponenten äußere Einflüsse, die nach Freud insbesondere in der frühen Eltern-Kind-Interaktion für das individuelle Durchlaufen einer festgelegten Stufenabfolge richtungsweisend sind. Die Formung der Persönlichkeit und des damit verbundenen Erlebens und Verhaltens untersteht dem Einfluss der Dynamik der drei Instanzen Es, Ich und Über-Ich. Hierbei verursachen aus der Eltern-Kind-Interaktion hervorgegangene innerpsychische Konflikte und Traumatisierungen (Dys-)Funktionalitäten bzw. bei einer ausreichend befriedigend gestalteten Eltern-Kind-Interaktion eine salutogene Entwicklung, die einem maladaptiv-dysfunktionalen Erleben und Verhalten weitgehend vorbeugt. Die frühe Interaktion determiniert also eine personinhärent festgelegte Stufenfolge, weshalb im Rahmen dieser theoretischen Abhandlung der psychoanalytische Ansatz der Adoleszenz und seine neo-analytischen Weiterentwicklungen im interaktionistischen Sinne verstanden werden.
Während Sigmund Freud die frühen Kinderjahre der Entwicklung für die Persönlichkeitsentfaltung als maßgeblich erachtet, versteht er die Pubertät als eine Zeit des Wiederauflebens frühkindlicher Konflikte auf der Basis neuer libidinöser Triebenergie (Elhardt, 1990): „Die starke Vermehrung der Triebstärke stellt das Ich vor schwierige Aufgaben. Vor allem in der Vorpubertät kommt es zu erneuter Mobilisierung der Partialtriebe, das Es spielt nochmals alle Register oraler, analer, aggressiver und phallischer Tendenzen durch, aber nun mit der verstärkten Wirksamkeit inzwischen gewachsener Funktionsmöglichkeiten (…). Das Über-Ich antwortet mit Strafreizen, sodass der Pubertierende selbst zwischen Trieblust und Schuld, Selbstüberschätzung und Minderwertigkeitsgefühl schwankt und in seiner Zerrissenheit oft unglücklich ist.“ In der Pubertät wird das Ich durch ein übermächtiges Es geschwächt, was für das Ich die Aufgabe impliziert, sich gegen das Es zu stärken: Im Sinne Freuds stellt die Ich-Stärkung somit das zentrale Thema des Jugendalters dar (s. auch Zauner, in Lempp, 1981; Kohnstamm, 1999).
Anna Freud (1958) widmete sich schwerpunktmäßig dem Studium der Adoleszenz, die sie im Sinne eines Sturm-und-Drang-Konzeptes als Phase betrachtete, welche auf der Basis der biologischen Reifung zu einem Ungleichgewichtszustand zwischen den drei intrapsychischen Instanzen führt: Das Es gewinnt gegenüber dem Ich an Dominanz, wobei das Ich versucht, diese erhöhte Triebstärke abzuwehren. In diesem Zusammenhang werden bereits vorhandene Abwehrmechanismen und damit bevorzugte Abwehrstrategien des Ich aktiviert. Für den Adoleszenten neue intrapsychische Strategien stellen dabei die Intellektualisierung und die Askese dar. Die Austragung des Konflikts, die im ungünstigen Fall mit einer Regression auf ein früheres Entwicklungsniveau verbunden ist, wird als obligatorisch betrachtet. Sofern die Konflikte nicht auftreten, ist nach Anna Freud von einer überstarken und pathogenen Triebabwehr auszugehen, die ebenfalls eine ungünstige Auswirkung auf die weitere Persönlichkeitsentwicklung hat. Adoleszenz ist hier zusammenfassend als obligatorisch krisenhaft zu verstehen.





























