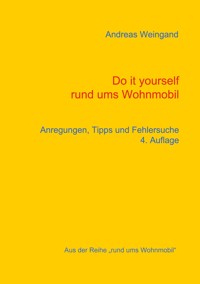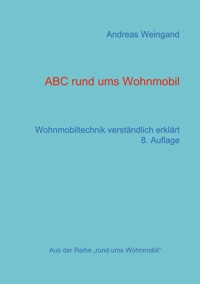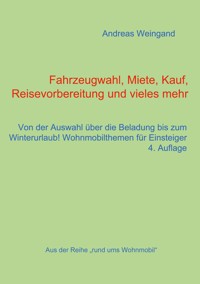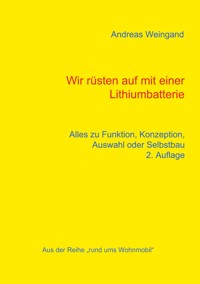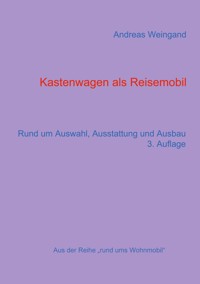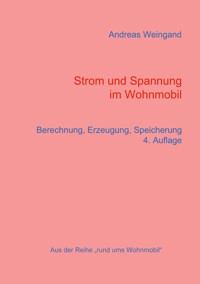
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Rund ums Wohnmobil
- Sprache: Deutsch
Immer mehr Wohnmobilfahrer möchten den Komfort von Kaffeeautomaten, Mikro-welle und anderen elektrischen Geräten genießen. Und was dem Mann seine Nespresso-Maschine ist, ist der Frau vielleicht zusätzlich ein leistungsstarker Haarfön. Auch ein gasunabhängiger, jedoch kräftig an der Batterie saugender, Kompressorkühlschrank kann den Komfort erheblich erhöhen. Leider braucht das alles viel elektrische Energie und die ist rar, wenn man auf Stellplätzen oder frei und autark stehen möchte. Es gibt jedoch Möglichkeiten, diese Energie zu erzeugen und auch im Wohnmobil zu speichern. Die Wege dazu möchte ich Ihnen mit diesem Buch nahe bringen. Strombedarfberechnungen, notwendige Dimensionierungen und konzeptionelle Unterschiede von Verschaltungen werden Ihnen dabei Hilfe leisten. Allerdings sollte man sich zuerst einmal über seine Reise- und Standgewohnheiten Gedanken machen und eine kleine Liste erstellen, was genau man eigentlich an Strom benötigt. Auf gut Deutsch, eine Bedarfsermittlung. Wenn man sich im Klaren ist, was es alles zu versorgen gibt und ob man nur im Sommer oder auch im Winter unterwegs sein möchte, können die technischen Möglichkeiten erheblich gezielter eingesetzt werden. Mit diesem Handbuch können Wohnmobilnutzer, Hobbybastler und Selbstausbauer ihr Hintergrundwissen und Verständnis für Auswahl und Kauf von Solaranlagen, Batterien, Ladetechnik und der ganze Elektrik darum herum vertiefen. Auch aktuelle Themen wie Lithiumbatterien, busgesteuerte Geräte, Steuerung per Smartphone und zukünftige Bedienungstechnologien werden angesprochen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Lesen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Zuerst möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie dieses Buch erworben haben.
Immer mehr Wohnmobilfahrer möchten den Komfort von Kaffeeautomaten, Mikrowelle und anderen elektrischen Geräten genießen. Und was dem Mann seine Nespresso-Maschine ist, ist der Frau vielleicht ein leistungsstarker Haarfön. Auch ein gasunabhängiger, jedoch kräftig an der Batterie saugender, Kompressorkühlschrank kann den Komfort erheblich erhöhen. Leider braucht das alles viel elektrische Energie und die ist rar, wenn man auf Stellplätzen oder frei und autark stehen möchte.
Es gibt jedoch Möglichkeiten, diese Energie zu erzeugen und auch im Wohnmobil zu speichern. Die Wege dazu möchte ich Ihnen mit diesem Buch nahe bringen. Strombedarfberechnungen, notwendige Dimensionierungen und konzeptionelle Unterschiede von Verschaltungen werde ich Ihnen hier aufzeigen. Damit können Wohnmobilnutzer, Hobbybastler und Selbstausbauer ihr Hintergrundwissen und Verständnis für Auswahl und Kauf von Solaranlagen, Batterien, Ladetechnik und der ganze Elektrik darum herum vertiefen. Auch neue Themen wie busgesteuerte Stromverteilung, Steuerung per Smartphone und zukünftige Technologien werden angesprochen.
Allerdings sollte man sich zuerst einmal über seine Reise- und Standgewohnheiten Gedanken machen und eine kleine Liste erstellen, was genau man eigentlich an Strom benötigt. Auf gut Deutsch, eine Bedarfsermittlung.
Wenn man sich im Klaren ist, was es alles zu versorgen gibt und ob man nur im Sommer oder auch im Winter unterwegs sein möchte, können die technischen Möglichkeiten erheblich gezielter eingesetzt werden.
In diesem Sinne, viel Spaß beim Lesen.
Andreas Weingand
Inhaltsverzeichnis
Zur Einstimmung ein kleiner Überblick über die Wohnmobil-Elektrik.
Energiebilanz, Berechnung und Simulation
Im Basisfahrzeug 24 V, im Aufbau 12V?
Die Stromerzeugung im Überblick
Aus dem Landstrom Netz mit 230V Ladegerät
Stromgeneratoren,
Lichtmaschine, MFR Regler, D+, intelligentes LiMa Mngt.
Stromerzeuger für 230 V, ggf. 12V
Windgenerator
Brennstoffzelle,
Solaranlage, Solargenerator, Photovoltaik
Batterien, Akkumulatoren, Stromspeicher
Blei Batterien (Pb)
Lithium (Ionen) Batterien, z.B. LiFeYPO4 (LYP) oder LFP
Die Power Station für Mini Camper oder Kastenwagen
Batteriewahl: nur Blei, nur Lithium, oder beide zusammen?
Batteriepflege von Bleibatterien
Batterieladung und Ladekurven
Batterie Ladezustand (SoC)
Batteriecomputer, Laderegler, Ladebooster
Control Panel, Bedienungsfeld
Überwachung Batteriespannung und Temperatur
Batteriecomputer (BC) und Shunt
Ladebooster, Batterie zu Batterie Laderegler (B2B)
Laderegler Solaranlage
Kombi Ladegeräte
Batteriepulser, -Refresher oder Regeneratoren
Stand By Charger, ArgoFet oder „ideale Diode“
Ladeverteiler
Batterie Balancer für Blei Batterien
Cell Logger
Batteriemanagementsystem BMS
Praktische Realisierung dieser Schutzfunktionen
Zell Balancing bei Lithium, OVP, UVP, Temperatur Mngt
Relais, Schutzschalter, Sicherungen, Wechselrichter
Trenn- / Koppelrelais für Batterien oder Kühlschrank
Trennschalter oder auch Natoknochen, programmierbare Sicherung „SmartFuse“
Fehlerstromschutzschalter (FI, RCD, LS oder RCBO) Spannungswächter
Überspannungsschutz, Blitzschutz
Sicherungen
Stromverteiler, Sicherungsverteiler, Sammelschienen
D+ Simulator, für ein spannungsgeführtes D+
Tiefentladungsschutz, UVP
USB Lader und Ladekabel
Ein Wechselrichter (WR),
Zusammenspiel FI Schutzschalter, Fehlerstrom, Erdung
Umwandlungsverluste, am Beispiel Pedelec Akkuladung,
Umsetzung im eigenen Wohnmobil
Konzept für kleinere Anforderungen, Benutzerprofil A & B
Konzept für größere Anforderungen, Benutzerprofil C & D
Bustechnologie, Anwendungen und Anbindung
Zuerst eine kleine Einführung in die Bus Technologie:
Bustechnologie zur Bedienung und Stromversorgung
Blick auf die aktuellen Infosysteme und Batterie Entwicklungen
Wichtige Dinge, die man wissen bzw beachten sollte:
Wann und wo brauche ich einen FI/LS Schutzschalter?
Normen & Vorschriften für alle Zubehör und Einbauteile:
Anhang 1, Abkürzungen, Glossar, Erläuterungen,
Anhang 2, Lieferantenadressen
Anhang 3, Anschlusswerte verschiedener Stromverbraucher
Zur Einstimmung ein kleiner Überblick über die Wohnmobil-Elektrik.
Jedes Fahrzeugchassis hat eine „Batterie“ zum Start und Betrieb des Fahrzeugs. Der Verständlichkeit halber verwende ich hier und im Rest des Buches diesen allgemein gebräuchlichen Ausdruck, richtig wäre allerdings der Begriff „Akkumulator“.
Läuft der Motor, wird die Startbatterie geladen und mit einem Steuersignal wird über ein Trenn/Koppelrelais oder einen Ladebooster die Aufbaubatterie zur Ladung parallel zu der Starterbatterie geschaltet.
Bei stehendem Motor werden Start- und Aufbaubatterie wieder getrennt, die Aufbaubatterie kann weiterhin über das eingebaute 230V-Ladegerät, ein Solarpanel, eine Brennstoffzelle oder einen Benzingenerator geladen werden.
Das Ladegerät und/oder die Aufbaubatterie versorgen dann über Sicherungen und Schalter die angeschlossenen 12V Verbraucher wie Licht, Wasserpumpe, Heizung, Kompressorkühlschrank oder Sat/TV. Die Bordspannung beträgt nominal 12V, in der Praxis sind es aber zwischen 12,5 V und 14,5 V!
Möchte man zusätzlich auch 230V Geräte, wie z.B. Kaffeemaschine oder Fön betreiben, muss man entweder eine 230V Zuleitung (Campingplatz) anschließen oder einen 12V zu 230V Wechselrichter benutzen.
Genügend Strom ist also eine Grundvoraussetzung für autarkes Stehen. Dieser Strom wird in der/den Aufbaubatterie(n) gespeichert. Entnommener Strom muss durch Ladung mittels Lichtmaschine, 230V Ladegerät oder Solarpanel ersetzt werden. Entscheidend für autarkes Stehen sind deshalb einerseits die Batteriekapazität (Ampere/Stunde) und andererseits Ladezeit und Ladestärke von Lichtmaschine, Solarpanel oder anderen Stromerzeugern. Diesen Überblick möchte ich nun vertiefen und mit der Ermittlung des Strombedarfs beginnen.
Ein kleiner Hinweis zu Batterie Ladezeiten: Diese sind immer von Tiefentladung (10% SoC) auf voll (100% SoC) gerechnet.
Im Basisfahrzeug 24 V, im Aufbau 12V?
Bevor ich in den weiteren Kapiteln in spannungsmäßige Details gehe möchte ich versuchen hier noch eine, meines Erachtens schon fast philosophische Frage vieler Ausbauer von Leicht-Lkw Basisfahrzeugen (z.B. IVECO) zu beleuchten. Eine generelle Antwort gibt es aber nicht.
Hat man ein LLkw oder ein Lkw-Chassis als Basisfahrzeug sorgt dort ab einer gewissen Größenklasse eine 24 V Lichtmaschine für Strom und Spannung. Die Startbatterie besteht dann aus zwei, in Reihe geschalteten, 12 V Batterien.
Und jetzt ist man auch schon beim ersten Kriterium für den Aufbau:
Möchte man auch im Aufbau eine 24 V Versorgung muss man auch hier 2x12 V Batterien in Reihe schalten. Das ist erstmal kein Problem. Möchte man allerdings die Batteriekapazität erweitern braucht man nochmals 2x12 V Batterien, die dann parallel geschaltet werden.
Das gleiche gilt mit kleinen Einschränkungen für die Solaranlage. Auch hier muss man, typabhängig, eventuell zwei Module in Reihe schalten um über den Regler eine Ladespannung von ca. 29 V zu erhalten. Auch hier benötigt man zur Erweiterung eventuell dann wieder zwei weitere Module.
Man kann nicht auf „plug & play“ Lithium-Batterien umstellen. Diese Systeme können aufgrund interner Schutzfunktionen (OVP/UVP Schutz, Fernabfrage) meist nicht in Reihe geschaltet werden.
Aber die Vorteile der gleichen 24 V Spannung in Chassis und Aufbau sind auch nicht von der Hand zu weisen:
Man kann Start- und Aufbaubatterie zum Laden zusammenschalten.
Die zu verlegenden Kabel sind wesentlich dünner, das wirkt sich vor allem bei Großverbrauchern aus.
Der Solarregler und das 230 V Ladegerät können die Startbatterien mit Erhaltungsladung versorgen.
Nachteilig ist, dass es nicht alle eventuell gewünschten Komponenten in einer 24 V Ausführung gibt. Hier müsste man dann mit vorgeschaltetem 24 V zu 12V DC/DC Wandlern arbeiten.
Die andere Alternative ist, den Aufbau mit 12V zu betreiben:
Aufgrund der Häufigkeit sind die 12V Versionen meist günstiger und schneller zu erhalten.
Solaranlagen mit nur einem Modul lassen sich einfacher und preisgünstiger realisieren.
Der Einbau oder Austausch auf „plug and play“ Lithium-Batterien ist einfacher.
Nachteilig ist,
dass man Start- und Aufbaubatterie zum Laden nicht mehr einfach zusammenschalten kann. Man benötigt zum Laden durch die LiMa einen 24 V zu 12V DC/DC Wandler bzw. Ladebooster.
Auch kann man die Startbatterien nur bedingt über Solar- oder 230V Lader erhaltungsladen, man muss dann je einen 12V zu 24 V DC/DC Wandler dazwischen schalten.
Die Leitungsverluste sind größer, die Kabel, vor allem für Großverbraucher müssen dicker sein. D. h. auch größere Presswerkzeuge für Kabelschuhe.
Aber als Lösung kann man auch eine weitere Möglichkeit ins Auge fassen, nämlich der Einbau einer zweiten Lichtmaschine. Der Aufbau wird einfach getrennt versorgt und in jedes LLkw 24 V Chassis kann man eine 12V Lichtmaschine zusätzlich einbauen. Das ist bei Iveco, MAN, und Sprinter bzw. Crafter kein Problem und ist wesentlich ausfallsicherer und preisgünstiger als Booster, Trennrelais und Step down Regler. Ich bin hier immer für Kis, nämlich Keep it simple!
Übrigens, in der Folge schreibe ich zwar immer von 12V, aber die Aussagen gelten genauso für 24 V Anlagen.
Eine Wasserpumpe hat z.B. eine Leistung von 80 Watt. Diese kann ich entweder auf eine Spannung von 12V auslegen, dann fließt ein Strom von 6,6 A oder ich benutze eine 24 V Version, dann fließt nur eine Strom von 3,3 A. Die Leistung ist in beiden Fällen die gleiche!
Die Stromerzeugung im Überblick
In den dreißiger Jahren haben die Schrebergartenbesitzer in der Nähe des Langwellen-Radiosenders König-Wusterhausen einfach ein paar Metern Empfangsdraht in den Baum gehängt, eine Glühlampe angeschlossen, den anderen Pol in die Erde gesteckt, und schon hatten sie Licht in der Laube. So einfach geht es heute mit der autarken Stromversorgung leider nicht mehr.
Die Energieversorgung für elektrische Verbraucher im Wohnmobil erfolgt heute auf mehrere Arten, über deren Vorteile und Nachteile man stundenlang diskutieren kann.
Zuerst einmal ein Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten:
Im Fahrbetrieb versorgt die Lichtmaschine des Basisfahrzeugs den Aufbau mit einer 12V Spannung und lädt sowohl die Starterbatterie als auch die Aufbaubatterie(n). Die Konzeption des Fahrzeug-Herstellens bei der Auslegung der Lichtmaschinenleistung dient aber nur der Versorgung der Kfz-Elektrik und der Ladung der relativ kleinen Starterbatterie. Hier lässt sich die Versorgung wie folgt optimieren:
Der serienmäßigen Lichtmaschinenladeregler wird mit einem nachgeschalteten Ladebooster (B2B-Regler) ergänzt und der Durchmesser der Ladekabel wird erhöht, um damit die Kabelverluste zu verkleinern.
Im Standbetrieb gibt es für die Versorgung mehrere Möglichkeiten:
Einen externen 230V Anschluss. Über die CEE Eingangsdose und einen FI/LS Schutzschalter wird das
230V Ladegerät
des Aufbaus angeschlossen, das über seinen 12V Ausgang die Aufbaubatterie lädt und die anderen Verbraucher versorgt. Manche Wohnmobile haben zur Lastaufteilung (Klimaanlage) einen zweiten CEE Anschluss der natürlich auch mit einem FI/LS Schutzschalter ausgestattet sein muss.
Eine
Solaranlage
, die Strom aus Sonnenlicht gewinnt und diesen in das 12V Netz des Aufbaus einspeist.
Ein
externer 230V Generator
, der über einen Verbrennungsmotor (Gas oder Benzin) angetrieben wird.Er erzeugt eine Spannung von ca. 230V~, die über den 230V CEE Anschluss eingespeist wird.
Die Bereitstellung einer 12V Versorgung durch eine
Brennstoffzelle
. Hier wird mit Hilfe eines Brennstoffs (Methanol) geräusch- und abgasfrei eine 12V Versorgung zur Ladung der Aufbaubatterien zur Verfügung gestellt.
Aus dem Yachtbereich gibt es auch
Windkraft
-Rotoranlagen zur Stromgewinnung. Deren Betrieb ist am Wohnmobil allerdings durch die entstehenden Rotorgeräusche und Vibrationen sehr problematisch.
Was man braucht oder für notwendig hält, ist eine sehr individuelle Entscheidung. Als kleine Hilfe zur Entscheidungsfindung kurz ein paar Punkte zum Einsatz von Lichtmaschine, B2B-Ladebooster, Solaranlage und externem Stromgenerator:
Wer viel fährt und wenig steht, ist mit einer Lichtmaschine/B2B Ladebooster Kombination gut beraten, denn schon nach relativ kurzer Fahrt sind die Aufbaubatterien voll geladen und man steht ja nicht lange.
Wer im Sommer in der Sonne steht, ist mit einer Solaranlage bestimmt besser bedient, sucht man aber den Schatten schaut es nicht ganz so positiv aus. Steht das Wohnmobil auch in der Winterpause im Freien, braucht man sich über Entladung der Start- und Aufbaubatterien keine Sorgen zu machen, solange das Solarmodul nicht anhaltend mit Schnee bedeckt ist.
Wer im Winter lange (mehr als zwei bis drei Tage) steht und nicht fährt, wird einen Stromgenerator bzw. eine Brennstoffzelle schätzen, da hier weder die LiMa / B2B Booster Kombination noch die Solaranlage viel zur positiven Energiebilanz beitragen.
Sowohl bei LiMa / B2B Ladebooster als auch bei der Solaranlage nutzt aber die zusätzliche Stromerzeugung gar nichts, wenn der erzeugte Strom nicht gespeichert werden kann und das bedeutet, man benötigt ausreichend Batteriekapazität. Die Erzeugung, die Speicherung und der Verbrauch sollten in einem ausgewogenen Verhältnis stehen.
Hier einmal eine klassische Elektroverteilung 12V/230V in einem größeren Wohnmobil.
Sie sehen links oben zwei CBE Batterielader, rechts daneben die 12V Verteilerbox DS mit Kfz-Flachsicherungen und noch weiter rechts einen zweipoligen FI/RCD-Schutzschalter für den 230V Stromkreis.
Im unteren Teil sehen Sie links den Solarregler, rechts daneben die CBE Relaisboxen für die Trenn/Koppelrelais für Startbatterie und Kühlschrank. Unter dem grauen Deckel sind die Anschlusskabel verlegt und rechts daneben im oberen Teil ein zusätzlicher Sicherungsverteiler. Die Funktion des Relais direkt darunter sowie das braune "fliegende" Relais sind mir unbekannt. Darunter ist die 230V Verteilerdose für Kühlschrank und andere 230V Verbraucher montiert. Auf der folgenden Seite noch ein Schaltbild mit verschiedenen Verschaltungsmöglichkeiten für Stromerzeugung, Speicherung und Verbraucher
Aus dem Landstrom Netz mit 230V Ladegerät
Die frühen Ladegeräte (vor Bj 1995) waren ungeregelte Lader (Trafo, Gleichrichter) mit W-Kennlinie und gaben einfach eine Spannung um die 13,5 V ab. Die heutigen Ladegeräte sind sogenannte primär getaktete Schaltnetzteile. Hier wird die 230V Netzspannung im Takt von 50-150 kHz in kleine Häppchen geschnitten und dann mit einem sehr viel kleineren Trafo (Potentialtrennung) auf ca. 20 V gebracht. Anschließend wird die Spannung gleichgerichtet und entweder in der I-Phase auf ca. 18 A strombegrenzt oder in der Uo-Phase auf 14,2 V (Ladeschlusspannung) bzw. in der U-Phase auf 13,8 V (Erhaltungsladung) spannungsstabilisiert abgegeben.
Ein so geregelter Lader ist die optimale Ladequelle, weil hier, im Gegensatz zu Lichtmaschine, 230V Generator oder Brennstoffzelle, die Ladung nach einer dem Batterietyp angepassten Ladekurve erfolgt. Wenn allerdings im Winter der Strombedarf sehr hoch ist kann es mit einem Standard 230 V Lader (15-18 A) schnell eng werden, denn mehr Verbraucher ziehen länger Strom und der 230V Lader kommt mit der Hauptladung gar nicht nach. In Folge wird die Batterie mehr entladen als geladen!
Da das 230V Ladegerät ein Standardeinbauteil ist, soll es hier zuerst beschrieben werden. Das Ladegerät für den Aufbau übernimmt die 12V Stromversorgung des Aufbaus sowie die Ladung (10 bis 50 A) der Aufbaubatterie nach I/UoU-Kennlinie aus dem 230V Netz. Das Ladegerät wird über einen FI/LS Schutzschalter an eine externe 230V Stromversorgung angeschlossen. Eine Feinsicherung im Eingang schützt die Ladeelektronik im 230V Bereich. Wählbare Ladekennlinien ermöglichen eine Anpassung auf den zu ladenden Batterietyp Nass, Gel, AGM1&2 und Li in Bezug auf Ladedauer und Ladeschlussspannung.
Bei den Produkten der Firmen Schaudt und Reich sind Ladegerät, Verbraucherverteiler, Sicherungen, Trennrelais und Tiefentladungsabschaltung in einem Gehäuse zusammengefasst. Sie werden dann EBL, EVS oder e-Box genannt.
Der Ausgang der Ladeelektronik geht dann zur Aufbaubatterie, eventuell zur Startbatterie und zum 12V Verteiler mit seinen Sicherungen, welche die einzelnen Verbraucherstränge absichern.
Mit welchen I/UoU-Kennlinien bzw. mit welcher Batterietypen Auswahl (Nass, Gel, AGM1&2, Li) die Ladegeräte ausgestattet sind und mit welchen Schwellspannungen sie arbeiten ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. (Siehe Batterieladung)
Ein Tiefentladungsschutz gibt bei Unterspannung Alarm und schaltet ggf. über ein Relais die Verbraucher spätestens bei einer auf <11 V gesunkenen Batteriespannung ab und erst bei >11 V wieder ein. Die Abschaltschwelle ist allerdings von Ladegerät zu Ladegerät leicht unterschiedlich.
Hier fangen auch die Modifikation bei der Umrüstung auf Ladebooster, Kompressorkühlschrank oder Lithium Batterien an.
Meist enthält der Elektroblocklader (EBL) oder die Verteilerbox auch das Trenn- und Koppelrelais für die Zusammenschaltung von Start- und Aufbaubatterie während der Fahrt. Für den 12V-Betrieb eines Absorberkühlschranks während der Fahrt ist noch ein weiteres Relais eingebaut. Diese Relais werden entweder mit D+ oder durch einen Spannungsanstieg an der Startbatterie angesteuert.
Das dafür notwendige D+ Signal bei Motorbetrieb steht bei neueren Chassis (ab Bj 2013) in unterschiedlicher Form zur Verfügung, als herkömmliches D+12V oder als D+ aktive at Ground (bei Motorbetrieb liegt D+ auf Masse), siehe Lichtmaschine.
Die Aufbau-, Lade- und Zusammenschalttechnik von Start- und Aufbaubatterie ist u.a. auch deshalb von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Die Hersteller von 230V Ladegeräten und Boostern haben deshalb zusätzlich ein chassisunabhängiges D+ entwickelt, nämlich ein
Spannungsgeführtes D+ Signal (D+ Simulation), eine
Kombination aus spannungsgeführtem Signal und Zünd+ oder
Eine „Motor läuft“ Simulation, eine Kombination von Zündung Plus und einem Rüttelsensor für Motorvibrationen.
Mit diesen künstlich erzeugten Steuersignalen ist keine, vom Chassis abhängige, D+ Steuerleitung notwendig. Allerdings sind diese „Simulationen“ immer abhängig von Situation und Konfiguration.
All diese Varianten machen das Funktionsverständnis der Aufbauelektrik leider nicht einfacher, man muss schon aufpassen oder noch besser nachmessen wenn man mit Solar oder einem Ladebooster nachrüstet.
Schaudt setzt z.B. auf ein D+12V gesteuertes elektromechanisches Trenn-/Koppelrelais, eingebaut im Ladegerät, um Start- und Aufbaubatterien im Fahrbetrieb gleichberechtigt zu verbinden. Bei neueren EBLs gibt es dafür einen kleinen Umschalter bei dem man den Eingang umschalten kann zwischen „D+ aktiv 12V“ und D+ aktiv Masse“. Bei anderen Modellen gibt es unterschiedliche Eingänge (Block 9 Pin 1 od. 4).
Bei der Ladung mit Landstrom wird die Aufbaubatterie mit maximalem Strom geladen, die Ladung der Startbatterie ist nur als Erhaltungsladung ausgelegt. Schaudt hat dafür einen Ausgang, der mit einer Diode und einem Kaltleiter bestückt ist und damit die Spannung und den Strom begrenzt.
Ob und wie bei 230V oder Solarladung die Startbatterie mitgeladen wird ist also unterschiedlich und hängt auch von der Anschlussbelegung bzw. Aufbauherstellerverkabelung ab. Bei Schaudt Ladern wird die Startbatterie nur bei 230V Ladung erhaltungsgeladen, aber leider nicht wenn das Solarpanel über das EBL angeschlossen wird. Hier sollte man den Solarregler direkt an der Aufbaubatterie anschließen, allerdings wird dann dieser Ladestrom nicht vom EBL Shunt und der CP Stromanzeige erfasst.
Auch bei den alten Ladegeräten, z.B. von Cramer, schaltet das Signal D+12V über das Trennrelais beide Batterien zusammen. Die korrekte Ladespannung kann /muss per Potentiometer auf der Rückseite auf den Batterietyp einstellen, sonst ist die Batterie schneller defekt als man denkt. Also Achtung beim Austausch!
Die Fa. CBE setzt auf eine diskret aufgebaute Ladetechnik. Ein Ladegerät und ein Verteilermodul mit Sicherungen und Trennrelais für Batterie und Kühlschrank. In neueren Anlagen sind Verteilermodul und Trennrelais zu einer Box namens „Trenngerät“ zusammen gefasst. In älteren Fahrzeugen sind die Trennrelais in einer separaten
„Boite Relais Securite“ Box, die auch eine 12V Hauptsicherung enthält.
Zur Steuerung des Trenn/Koppelrelais verwenden die Hersteller Calira, CBE, Nordelettronica und ArSilicii nicht immer die Steuerleitung D+12V, sondern überwachen auch die Spannung der Start- und Aufbaubatterien.
Liegt hier die Spannung der Startbatterie unter 13,6 V ist die Aufbaubatterie von der Lichtmaschine getrennt. Läuft der Motor steigt die Spannung an der Startbatterie auf über 13,8V. Das Ladegerät erzeugt damit ein „spannungsgesteuertes Ersatz D+“ (D+-Simulator) und steuert damit die Trenn- / Koppelrelais an. Jetzt werden Starter- und Aufbaubatterie verbunden und der Kühlschrank kann auf 12V betrieben werden. Allerdings werden beide Batterien auch erst wieder getrennt, wenn die Spannung der Aufbaubatterie auf unter 12,5 V gesunken ist und/oder die Zündung ausgeschaltet wird. Bei 230V Ladung werden beide Batterien also gleichberechtigt geladen bzw. entladen. Die Starterbatterie wird nur geladen, wenn auch die Aufbaubatterie geladen wird. Sind beide voll, wird auf Erhaltungsladung umgeschaltet und die Batterien wieder getrennt. Auch die Verteiler bzw. Trenn/Koppelrelais Boxen der Fa. TopTron arbeiten spannungsgesteuert.
Wenn man aber jetzt die Starterbatterie leer saugt (Radio an), bekommt das Ladegerät das nicht mit. Das überwacht nur die Aufbaubatterie und die ist ja noch voll.
Neue DS300 Verteilerboxen oder NE 3xx Lader führen auch das chassiseigene D+ aktive ground als Anschluss und kehren damit der problematischen „spannungsabhängigen Umschaltung“ den Rücken.
Achtung bei Lithiumbatterien: Manche CBE Geräte (z.B. DS516-3) haben am Ladebeginn, wenn es nötig ist, eine „Desulfationsphase“, oder vielleicht korrekter ausgedrückt eine „Zellausgleichsladung“. Hier steigt für ca. 2h die Ladespannung auf die 15,2V Gasungsgrenze. Das Gerät ist für Blei/Nass Batterien konzipiert und da ist dies von Zeit zu Zeit angebracht. Diese Phase lässt sich nicht weg konfigurieren und kann zu einer OVP Auslösung führen!
Auch bei den neueren 230V Lader der Fa. Nordelettronica