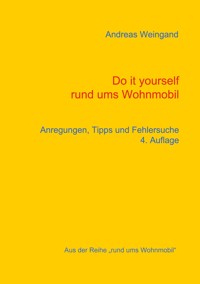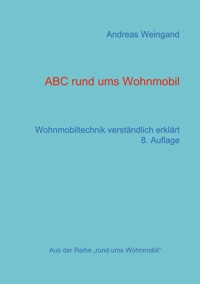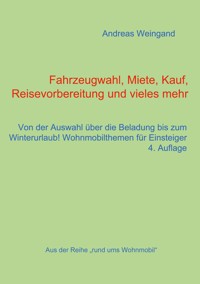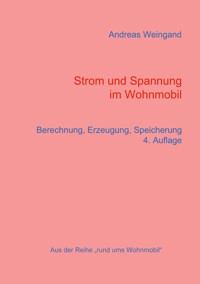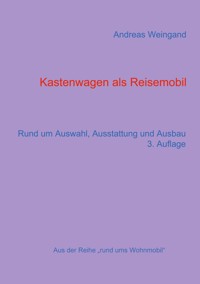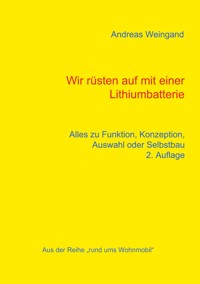
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Rund ums Wohnmobil
- Sprache: Deutsch
In einem Wohnmobilforum wurde vor mehr als zehn Jahren ein Lithium Batteriesystem als Ersatz für die schweren Bleibatterien vorgestellt und damit den speicherhungrigen Wohnmobilfahrern näher gebracht. Viele Wohnmobilfahrer folgten diesen Gedanken und Vorschlägen. Die Vorteile sind bestechend: 50% Gewichtsersparnis bei doppelter Nettokapazität und höherer Entnahmestrom ohne Spannungseinbrüche. Der geeignete Batteriespeicher um Kaffeemaschine, Fön, Induktionsherd besser zu versorgen und vielleicht auch noch die Pedelec-Akkus zu laden. In der ersten Generation waren es selbstgebaute Systeme mit den gelben Winston Zellen in einer Holzkiste, Balancermodule auf den Polen und ein Solid state Relay für einen UVP/OVP Schutz. Damit sammelte man Erfahrungen und mit der zweiten Generation zog der Markt mit sogenannten Drop in Ersatz für Bleiakku nach die man, zumindest laut Werbung, 1:1 gegen die alte Bleibatterie tauschen kann. In der dritten Generation kamen dann die blauen Becherzellen und Smart BMS mit integriertem Batteriecomputer und Smartphone App zum Einsatz. Aber sowohl für den Eigenbau als auch für die Drop in Systeme sollte man einige Dinge wissen. In diesem Kompendium für Lithiumbatterien in Wohnmobilen möchte ich Ihnen diese Technologie und Aufrüstung mit all ihren Vor- und Nachteilen erklären und Sie damit vielleicht auch zum Selbstbau oder Austausch ihrer Bleibatterie anregen. Wenn Ihnen die Chemie zu viel ist starten Sie Ihre Informationsreise einfach ab dem Vergleich Lithium zu Blei. Viel Spaß beim Lesen und gutes Gelingen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Ich möchte mich zuerst einmal bei Ihnen für den Erwerb dieses Buches bedanken. Und gleich auch zum versprochenen Thema übergehen.
In einem Wohnmobilforum wurde vor mehr als zehn Jahren ein Lithium Batteriesystem als Ersatz für die schweren Bleibatterien vorgestellt und damit den speicherhungrigen Wohnmobilfahrern näher gebracht. Viele Wohnmobilfahrer folgten diesen Gedanken und Vorschlägen.
Die Vorteile sind bestechend: 50% Gewichtsersparnis bei doppelter Nettokapazität und höherer Entnahmestrom ohne Spannungseinbrüche. Der geeignete Batteriespeicher um Kaffeemaschine, Fön, Induktionsherd besser zu versorgen und vielleicht auch noch die Pedelec-Akkus zu laden.
In der ersten Generation waren es selbstgebaute Systeme mit den gelben Winston Zellen in einer Holzkiste, Balancermodule auf den Polen und ein Solid state Relay für einen UVP/OVP Schutz.
Damit sammelte man Erfahrungen und mit der zweiten Generation zog der Markt mit sogenannten „Drop in Ersatz für Bleiakku“ nach die man, zumindest laut Werbung, 1:1 gegen die alte Bleibatterie tauschen kann. In der dritten Generation kamen dann die blauen Becherzellen und Smart BMS mit integriertem Batteriecomputer und Smartphone App zum Einsatz. Aber sowohl für den Eigenbau als auch für die „Drop in“ Systeme sollte man einige Dinge wissen.
In diesem Kompendium für Lithiumbatterien in Wohnmobilen möchte ich Ihnen diese Technologie und Aufrüstung mit all ihren Vor- und Nachteilen erklären und Sie damit vielleicht auch zum Selbstbau oder Austausch ihrer Bleibatterie anregen.
Wenn Ihnen die Chemie zu viel ist starten Sie Ihre Informationsreise einfach ab dem Kapitel „Konzeption und Auswahl“.
Viel Spaß beim Lesen.
Andreas Weingand
Inhaltsverzeichnis
Grundlagen der Lithiumtechnologie
Innenwiderstand, Quellenspannung, Wirkungsgrad:
Entladetiefe und Tiefentladungsgrenze einer Li-Batterie
Batterieladung, Ladekurven, Ladestand SoC,
Ladespannung aus verschiedenen Ladequellen
Batterie Ladezustand (SoC)
Energiebilanz, Berechnung und Simulation
Konzeption und Auswahl des Batteriesystems
Einbauplanung
Batt. Abmessungen, Polanordnung, Befestigung
Abhängigkeit von der Temperatur und Zellheizung
Vergleich Blei- zu Lithiumbatterie
Lithium Fertigsysteme (Drop in) zum Tausch
Smart BMS und Apps bei „Drop in“ Batterien
Lithium zusammen mit einer AGM als Hybridsystem
Konzeption, Realisierung eines Blei/Lithium Hybridsystems
Lithiumbatterie als Starterbatterie?
Lithiumbatterien im Bootseinsatz
Lithium Batterien als 12V oder 24V System?
Das Lithium Batterie Management System,
BMS Ersatzschaltbild für Balancing, UVP, OVP, ÜT und UT
Notwendige Schutzabschaltungen bei Lithiumbatterien
Praktische Realisierung dieser Schutzfunktionen
Zell Balancing Verfahren
Selbstbau eines Lithium Batteriesystems
Bausätze für den Eigenbau
Zellen und Balancer für den Eigenbau, Anordnung
Balancermodule, passive & aktive, Hochstromrelais
Schutzabschalter per Relais und Hochstromschalter
Elektronisches Smart BMS inklusive BC
Externe BMS Systeme für Eigenbau Batteriesysteme
Das smart BMS von DALY
Die Smart BMS von JBD Jiabaida, Xiaoxiang oder JK?
Gehäusebox und mechanische Umsetzung
Die erste Ladung, Initialladung der Zellen!
Funktionstest
Der Einbau des fertigen Akkus ins Fahrzeug
Selbstbau Batterien als Beispiele
Mein Umbau auf Lithium/AGM Hybridsystem
Erfahrungen im ganzjährigen Praxistest
Reparatur Balancing einer „Plug in“ Batterie
Abhängigkeiten zu der vorhandenen Elektrik
Abhängigkeiten zu der vorhandenen Elektrik
Mit der Aufrüstung involvierte Geräte
Schlusswort und Ausblick
Wichtige Dinge, die man beachten bzw. wissen sollte:
Anhang 1, Abkürzungen, Glossar, Erläuterungen
Anhang 2, Platz für eigene Notizen
Batterieladung, Ladekurven, Ladestand SoC,
Zuerst einmal ein paar erläuternde Worte für die Leser, die nicht so tief in der Elektrotechnik verwurzelt sind. In der Elektrotechnik gibt es Spannungsquellen (Lichtmaschine, 230V EBL, Solarregler) und Verbraucher (Licht, Kühlschrank oder auch die zu ladende Batterie), die aus diesen Quellen versorgt werden. Der Strom, der aus einer der Quellen in einen Verbraucher fließt, wird durch deren Innenwiderstände bestimmt. Da sowohl für die Beleuchtung als auch zum Laden der Batterie ein Strom aus dem Ladegerät fließt sind beide, aus Sicht des 230V Laders, Verbraucher.
Aber die Batterie ist nicht nur ein Ladestromverbraucher sondern eigentlich ein Ladestromsammler, und so kann auch diese Batterie später als Quelle dienen. Die Batterie sammelt die Ladung und deshalb steigt mit zunehmender Ladung (SoC) auch ihre Quellenspannung. Diese Quellenspannung setzt sich aber der Ladespannung entgegen. Mit zunehmender Ladung wird die batterieinterne Quellenspannung immer größer, die Differenz kleiner und der Ladestrom nimmt deshalb ab.
Dieses Spiel geht solange, bis die Batterie voll ist und Quellenspannung (Li 13,2V) und Ladespannung (14,4V) annähernd gleich sind.
Im Detail:
Egal durch was die Ladung erfolgt, die Batterie bestimmt mit ihrem Innenwiderstand und dem aktuellen Ladestand (SoC) den aufzunehmenden Strom.
Die Ladung einer Batterie ist damit kein linearer Prozess und darf nicht einfach als „ohmsche Last“ betrachtet werden.
In der Praxis heißt dies: „Je voller die Batterie ist, umso weniger Ladestrom fließt bzw. wird benötigt.“
Der höchstmögliche Ladestrom hängt dabei also nicht nur von der Leistungsfähigkeit der Ladequelle ab, sondern hauptsächlich von der Batterie bzw. deren Innenwiderstand und dem aktuellen Ladestand (SoC) bzw. der daraus resultierenden Quellenspannung.
Wichtig dabei ist, dass man dabei zwischen Ladespannung und Ladeschlussspannung unterscheidet. Die Ladespannung für Li-Batterien liegt so zwischen 12,2V und 14,4V und kann dauerhaft anliegen. Die Ladeschlussspannung bei einer Li-Batterie ist 14,6 V. Alles was darüber hinaus geht ist schädlich und sollte zu einer Schutzabschaltung führen.
Um den unterschiedlichen Ladespannungen und der notwendigen Ladezeit gerecht zu werden, gibt es auch verschiedene Ladekennlinien. Diese teilen sich auf in eine Bulk/CC stromgeführte Ladephase und eine Absorption/CV spannungsgeführte Ladephase mit einer jeweils unterschiedlichen Zeitdauer.
•
WU
durch die Lichtmaschine: abfallender Strom bei steigender Batteriespannung.
•
I/Uo/U
Ladung durch Standardladegeräte für Lade & Bereitschaftsbetrieb mit schneller aber trotzdem schonender Ladung
•
CC/CV
Für die Ladung einer „zyklische Lithium Versorgerbatterie“ eine I/U Ladung auch CC/CV Ladung (Constant Current/Constant
Bei Lithium ist die Zellausgleichsladung unnötig oder u.U. sogar schädlich. Auch eine lange Absorptionsphase wie bei Gel-Batterien sollte vermieden werden.
Die zwei folgenden Diagramme zeigen die unterschiedlichen Ladekurven am Beispiel einer I/Uo/Ue/U Ladung für Blei und einer CC/CV Ladung für Lithium.