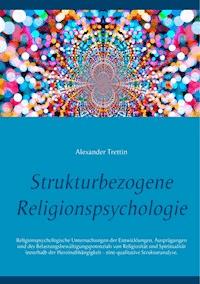
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Innerhalb der EU-Bevölkerung leiden immer mehr Menschen an Suchterkrankungen, welche jedoch nicht nur in herkömmlicher Art und Weise medizinisch behandelt, sondern zum Teil auch mit religiöser und spiritueller Unterstützung begleitet werden. Religiosität und Spiritualität gewinnen daher in diesem Bereich zunehmend an Bedeutung. Die vorliegende theoretische Grundlegung einer strukturbezogenen Religionspsychologie bietet einen interdisziplinären und fächerübergreifenden Rahmen, der dazu beitragen kann, weitere detaillierte qualitative und quantitative Forschungen, insbesondere zum Zwecke der Gesundheitsförderung im Bereich der Religionspsychologie und der Suchtforschung zu ermöglichen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danksagung
Der Abschluss dieses Forschungsprojektes hat sich aus verschiedenen Gründen mehrfach verschoben. An erster Stelle möchte ich deshalb meinem Doktorvater Prof. Dr. Dr. Peter Antes für seine Geduld, Fürsorge, vielfältigen Ermutigungen und überaus hilfreichen Anregungen meinen herzlichen Dank aussprechen. Ohne ihn wäre ich niemals ans Ziel gelangt. Darüber hinaus möchte ich mich bei meiner Zweitgutachterin Prof. Dr. Christine Morgenroth bedanken, die mir einen wichtigen neuen Blickwinkel in Bezug auf Bewusstseinsstrukturen ermöglicht hat. Mein Dank gilt ebenfalls Prof. Dr. Nils Hoppe, der mir in seiner besonnenen und freundlichen Art Ruhe gab, als ich sie am meisten benötigte.
Natürlich danke ich auch meiner lieben Ehefrau Susanne Trettin, die mir nicht nur den Rücken frei hielt, damit ich endlose und unzählbare Stunden an dieser Arbeit forschen konnte, sondern die mir auch bei etlichen Problemen als ‚geistiger Spiegel‘ und als ‚emotionale Stütze‘ zur Verfügung stand. Meinen beiden Töchtern Aimée und Magdalena sowie meiner Schwester Jessica danke ich dafür, dass sie mein Leben bereichern. Lasse und Hasan sind mittlerweile ebenfalls zu einem wichtigen Teil meiner Familie geworden. Danke auch dafür! Ohne meine Eltern Gabriele und Wilfried Trettin wäre ich wohl niemals auf die Idee gekommen, den ‚Prozess von Gesundheit und Krankheit‘ zu untersuchen. Meinen Schwiegereltern Waltraud und Klaus Wolter danke ich für ihre Herzlichkeit.
Aufrichtig danke ich ebenso meinen Forschungskollegen Dr. Michael Gottwald und Franck Adrian Holzkamp, die mich tatkräftig bei der Analysemethode der ‚Objektiven Hermeneutik‘ unterstützt haben. Herwig Fock danke ich für die umfassende Korrekturlesung. Burghard Schneider-Lombard und Bastian Salier danke ich für die Unterstützung bei der Veröffentlichung des vorliegenden Manuskriptes. Ohne den leider viel zu früh verstorbenen Achim D. Brandstaedter wäre ich wahrscheinlich schon an den formalen Voraussetzungen gescheitert. Danken möchte ich des Weiteren meinen Lehrern Prof. Dr. Bernhard Bauer, Thomas Forwe, Dr. Georg Franzen, Prof. Dr. Klaus-Jürgen Grün, Prof. Dr. Hans-Hermann Höhmann, Prof. Dr. Peter Nickl, Matthias Schönfeld, Dr. Gerhard Stamer, Dieter Zetzsche, sowie meinen Lehrerinnen Almut Tasgara-Tumat und Annelie Wolter.
Mein Dank richtet sich auch an meine ‚Band-Brüder‘ Roland Wachau, Valentin ‚Valle‘ Dörfel, Martin Froese und Dr. Nikolas ‚Pigge‘ Sellheim, die immer an mich geglaubt haben. Maik Lucht danke ich für die über 40 Jahre andauernde Freundschaft, die uns miteinander verbindet. Bedanken möchte ich mich bei allen anderen Menschen, die mein Leben bereichert haben! Leider reicht der Platz nicht aus, um alle benennen zu können. Bedanken möchte ich mich ebenfalls bei allen Beteiligten aus der ‚Selbsthilfegruppe Drogengefährdeter e.V.‘ und aus der Suchthilfeeinrichtung ‚Neues Land e.V.‘, ohne die dieses Forschungsprojekt nicht zu realisieren gewesen wäre.
Celle, 15.01.2018
Abstract
Schlagworte: Religionspsychologie, Suchtforschung, Strukturanalyse
Innerhalb der EU-Bevölkerung leiden immer mehr Menschen an ‚Suchterkrankungen‘, welche jedoch nicht nur in herkömmlicher Art und Weise medizinisch behandelt, sondern zum Teil auch mit religiöser und spiritueller Unterstützung begleitet werden. ‚Religiosität‘ und ‚Spiritualität‘ gewinnen daher in diesem Bereich zunehmend an Bedeutung. Die vorliegende theoretische Grundlegung einer ‚Strukturbezogenen Religionspsychologie‘ bietet demzufolge einen interdisziplinären und fächerübergreifenden Rahmen, der dazu beitragen kann, weitere detaillierte qualitative und quantitative Forschungen, insbesondere zum Zwecke der Heilung, Prävention, Rehabilitation und Gesundheitsförderung, im Bereich der ‚Religionspsychologie‘ und der ‚Suchtforschung‘ zu ermöglichen. Durch die vorliegende Studie konnten verschiedene alternative ‚Strukturelemente‘ lokalisiert werden, die wiederum die Neuentwicklung verschiedener ‚theoretischer Strukturmodelle‘ ermöglichten. Hierbei wurden ‚prozesshafte‘ und ‚strukturelle Sichtweisen‘ miteinander integriert. Schwerpunkt des empirischen Teils bildet das methodologisch-empirische Forschungsdesign, bei dem verschiedene Erhebungs- und Analysemethoden im Sinne des Methodenpluralismus zum Einsatz kommen. Hierzu gehören u.a. die ‚Narrationsanalyse‘ und die ‚Objektive Hermeneutik‘. Dabei wird auch erstmalig die ‚Strukturdiagnostik‘ in Form der ‚Operationalisierten psychodynamischen Diagnostik‘ als religionspsychologisches Instrumentarium eingesetzt.
Keywords: Psychology of Religion, addiction research, structural analysis
In the EU, more and more people suffer from an ‚addictive disorder‘ that gets treated not only by the conventional means but also under religious und spiritual guidance. In this context, ‚religiousness‘ and ‚,spirituality‘ gain relevance. The theoretical foundation of a ‚structure-related religious psychology‘ at hand offers an interdisciplinary framework which can contribute to detailed qualitative and quantitative reseach, especially aiming at healing, prevention, rehabilitation and health promotion in the area of ‚religious psychology‘ and ‚addiction research‘. The thesis at hand localizes various alternative ‚structure patterns‘ which in turn enable the new developement of various ‚theoretical structure models‘. ‚Processual‘ und ‚structural views‘ were integrated, too. Emphasis lies in the empirical part on the methodologic-empirical research design that applies several methods of collecting and analyzing data with a plurality of methods. Among others, this involves a ‚narrative analysis‘ and an ‚objective hermeneutic‘. For the first time the ‚structural diagnostics‘ as ‚operationalized psychodynamic diagnostics‘ is applied as a religious psychological instrument.
Inhaltsverzeichnis
Bestimmung der Begriffe ‚Religiosität‘ und ‚Spiritualität‘
1.1 Religiosität
1.2 Spiritualität
Dimensionen von Religiosität und Spiritualität
2.1 Dimensionen von Religiosität
2.2 Intrinsische/extrinsische Religiosität
2.3 Das multidimensionale Religiositätsmodell
2.4 Zentralität und Inhalt von Religiosität
2.5 Dimensionen von Spiritualität
2.6 Komplementarität von Religiosität und Spiritualität
Strukturbezogene psychologische Theorien zu religiösen und spirituellen Themen
3.1 Die Persönlichkeit des Menschen
3.2 Allgemeine Überlegungen zum Strukturbegriff
3.3 Persönlichkeitsbereiche
3.4 Struktur als psychodynamisches Konzept der Persönlichkeit bei Freud
3.5 Der psychoanalytische Strukturbegriff
3.5.1 Die qualitativen Strukturbegriffe
3.5.2 Der quantitative Strukturbegriff
3.6 Gerd Rudolfs Konzept des strukturellen Funktionsniveaus
3.7 Strukturelle Störungen
Religiosität und Spiritualität im Prozess von Gesundheit und Krankheit
4.1 Ausgewählte Theorien und Befunde zu Religiosität/Spiritualität und Gesundheit
4.2 Sucht, Süchtigkeit und Abhängigkeit
4.2.1 Suchtmodelle
4.2.2 Sucht als Krankheit
4.2.3 Die Verbindung neurobiologischer Erkenntnisse mit den klassisch-psychologischen Lerntheorien
4.2.4 Das multifaktorielle Ursachenmodell von Sucht
4.2.5 Das psychologische Modell
4.2.6 Motivation des Substanzkonsums
4.2.7 Das Wesen der Suchterkrankung in Bezug zur Religiosität und Spiritualität
4.2.8 Heroin
4.2.9 Verlauf der Heroinabhängigkeit
4.3 Coping
4.3.1 Religiöse/spirituelle Copingprozesse
Zusammenfassender Forschungsstand
Forschungsfragen und Forschungsziel
Erhebungsmethodik
1.1 Das narrative Interview
1.2 Das diagnostische Interview
1.2.1 Die operationalisierte psychodynamische Diagnostik (OPD)
1.2.2 Das OPD-Interview
1.2.3 Der Interviewleitfaden
1.2.4 Der modifizierte Erhebungsbogen (OPD-2)
Die Analysemethoden
2.1 Die Narrationsanalyse
2.2 Die objektive Hermeneutik
2.3 Die diagnostische Bilanz
Die Einrichtungen
1.1 Die Einrichtung „Neues Land“
1.2 Die Einrichtung „Warstr. e. V.“
Stichprobenbeschreibung
Einzelne Fallbeschreibungen
3.1 A. (Neues Land)
3.1.1 Prozessstrukturen
3.1.2 Lebenspraxis
3.1.3 Erläuterung der Einschätzungen (OPD)
3.2 Me. (Neues Land)
3.2.1 Prozessstrukturen
3.2.2 Lebenspraxis
3.2.3 Erläuterung der Einschätzungen (OPD)
3.3 D. (Neues Land)
3.3.1 Prozessstrukturen
3.3.2 Lebenspraxis
3.3.3 Erläuterung der Einschätzungen (OPD)
3.4 Sv. (Neues Land)
3.4.1 Prozessstrukturen
3.4.2 Lebenspraxis
3.4.3 Erläuterung der Einschätzungen (OPD)
3.5 M. (Warstr.)
3.5.1 Prozessstrukturen
3.5.2 Lebenspraxis
3.5.3 Erläuterung der Einschätzungen (OPD)
3.6 H. (Warstr.)
3.6.1 Prozessstrukturen
3.6.2 Lebenspraxis
3.6.3 Erläuterung der Einschätzungen (OPD)
3.7 Ma. (Warstr.)
3.7.1 Prozessstrukturen
3.7.2 Lebenspraxis
3.7.3 Erläuterung der Einschätzungen (OPD)
3.8 Sw. (Warstr.)
3.8.1 Prozessstrukturen
3.8.2 Lebenspraxis
3.8.3 Erläuterung der Einschätzungen (OPD)
Kontrastive Vergleiche
4.1 Prozessstrukturen
4.2 Tiefenstruktur des Handelns
4.3 Fallstruktur/Lebenspraxis
4.4 Strukturelemente der Persönlichkeit - Krankheitserleben (Achse I)
4.5 Elemente der ‚Psychischen Struktur‘ - Beziehungen (Achse II)
4.6 Strukturelemente der Persönlichkeit - Konflikte (Achse III)
4.7 Elemente der ‚Psychische Struktur‘ (Achse IV)
4.8 Elemente der Religiositäts-/Spiritualitätsstruktur
4.9 Elemente Suchtstruktur und Suchtspirale (Achse V)
4.10 Psychische/psychosomatische Störungen (Achse V)
4.11 Copingvariablen
Struktur (allgemein)
Gesamtstruktur
2.1 Psychischer Apparat (erweitertes Modell der Bewusstseinsebenen)
2.1.1 Konstruktion des Selbst (individuelle Perspektive)
2.1.2 Konstruktion des Selbst (soziale Perspektive)
2.2 Psychische Struktur
2.3 Persönlichkeitsstruktur
Substrukturen
3.1 Religiositäts-/Spiritualitätsstruktur
3.2 Suchtstruktur
3.3 Wirkungen und Beziehungen der Teil- und Substrukturen auf- und untereinander
3.4 Religiöses und spirituelles Coping
Literaturverzeichnis
Abbildungen im Anhang
Abb. 1a
Zugänge zur wissenschaftlichen Religionspsychologie (Inhalte)
Abb. 1b
Zugänge zur wissenschaftlichen Religionspsychologie (Personen und Literatur)
Abb. 2
Operationale Konstrukte des R-S-T und RM in der interdisziplinären Systematik des Modells der Religiosität
Abb. 3
Persönlichkeitsbereiche
Abb. 3a
Big Six
Abb. 3b
Handlungsmodell
Abb. 3c
Persönlichkeitsstörungen
Abb. 3d
Struktur: Das Selbst in Beziehung zu den Objekten
Abb. 3e
Beschreibung der Integrationsstufen des Funktionsniveaus (in der OPD-2)
Abb. 4
Deutschsprachige Fragebögen zum Themenkreis „Religiosität/Spiritualität und Gesundheit“
Abb. 5
Suchtstruktur
Abb. 6
Transkription
Abb. 6a
Ursprünglicher Erhebungsbogen (OPD-2)
Abb. 6b
Modifizierter Erhebungsbogen OPD-2 mit integriertem Interviewleitfaden
Abb. 7
Objektive Hermeneutik - Fragestellungen
Einleitung
Innerhalb der EU-Bevölkerung leiden immer mehr Menschen an einer Suchterkrankung. Jede Sucht hat ihre eigene Geschichte und meistens auch ihren „‘guten Grund‘ im Sinne der ‚Kompromissbildung‘: Sie kann eine längerfristig bestehende, sich verselbstständigende und krankmachende Abwehrleistung eines Individuums bedeuten gegen Anforderungen, die die individuelle Abwehr überfordert. Damit hat die Sucht so lange eine (über-)lebenswichtige Funktion, bis adäquate Abwehrmöglichkeiten für das betroffene Individuum bereitstehen“. (Elsner, 2005, S. 112) Jedoch werden einige der Suchterkrankten nicht nur in herkömmlicher Art und Weise medizinisch behandelt, sondern zum Teil auch mit religiöser und spiritueller Unterstützung begleitet. Da Religiosität und Spiritualität gerade in diesem Bereich an Relevanz gewinnen, wird in der vorliegenden Arbeit eine Population, die sich in einer derartigen Suchtsituation befindet, religionswissenschaftlich bzw. religionspsychologisch untersucht.
Am Anfang dieser Untersuchung stehen daher einige einleitende Fragen: Wie kann es z.B. möglich sein, dass langjährige Heroinabhängige ihren Substanzkonsum von einem Tag auf den nächsten, scheinbar nahtlos, anstatt mit Methadon, mit dem Glauben an Jesus/Gott substituierten? Ist das nur deshalb möglich, weil sich die Religiosität bzw. die Spiritualität und die Sucht so sehr gleichen? Oder entwickeln sich die Religiosität bzw. die Spiritualität und die Sucht parallel bzw. koinzident, sodass es ein Einfaches ist, das Eine mit dem Anderen auszutauschen? Vielleicht bietet die Religiosität bzw. die Spiritualität aber auch Bewältigungsstrategien, die besonders gut bei Suchterkrankungen greifen? Wenn ja, welche Wirkungen ergeben die Einbeziehung religiös-spiritueller Strategien sonst noch? Oder umgekehrt: Folgt „die Hinwendung zur Droge […] einem Bedürfnis, die eigene gewohnheitsmäßige Situation zu transzendieren“? (Zoja, 1986, S. 119) Kann die Droge auch zunehmend Ersatz für eine religiöse bzw. spirituelle Erfahrung sein? (vgl. Zoja, 1986, S. 127) Oder hat Fuchs (2006, S. 143) recht, wenn er Sucht als „zerstörerische Religion“ bezeichnet?
Um diesen Fragen auf den Grund gehen zu können, bedarf es sowohl einer geeigneten Definition der religionswissenschaftlichen Gegenstandsperspektive (siehe I.) als auch eines gegenstandsangemessenen Forschungsrahmens. Wie die Lektüre der religionspsychologischen Literatur (z.B. Utsch, 1998; Henning et al., 2003; Grom, 2007) zeigt, liegt für die Religionspsychologie kein einheitlicher und umfassender Theorieentwurf vor. Der Autor dieser Studie unternimmt nicht den Versuch diese Lücke zu schließen, sondern möchte mit der vorliegenden Arbeit stattdessen einen neuen Teilbereich, nämlich die ‚Strukturbezogene Religionspsychologie‘ samt ihrer ‚theoretischen Grundlegung‘ (siehe II.) in den Forschungsbereich einführen. Der Schwerpunkt liegt dabei sowohl auf strukturellen, als auch auf prozessualen Betrachtungsweisen. Darüber hinaus wird die ‚Strukturbezogene Religionspsychologie‘ an dieser Stelle „nicht um ihrer selbst willen betrieben, sondern will als Grundlage dienen für Diagnostik und Therapie in Kliniken oder Beratungsstellen zum Zweck der Heilung, Prävention, Rehabilitation oder generell der Gesundheitsförderung.“ (Heine, 2005, S. 20) Deshalb gilt das Interesse auch dem abweichenden Verhalten einer Person samt deren Psychopathologien.
Zur Vertiefung der Thematik wird zunächst eine umfassende Bestimmung der Begriffe ‚Religiosität‘ und ‚Spiritualität‘ (siehe II., 1.) vorgenommen, auf deren Basis dann die Dimensionen von Religiosität und Spiritualität (siehe II., 2.) herausgearbeitet werden. Da ‚Religiosität bzw. Spiritualität‘ so hochkomplexe Konzepte sind, „kann ihre Entwicklung auch in Analogie zu anderen umfassenden Entwicklungskomplexen gefasst werden“, z.B. zur Entwicklung der Persönlichkeit, Identität oder zur Entwicklung des Selbst. (Angel, 2006, S. 139) Auch Holm (1990, S. 11) beschreibt, dass „die theoretischen Aussagen über das Verhalten des Menschen inhaltlich abhängig sind von verschiedenen philosophischen Schulen und vom Menschenbild allgemein.“ So gelangt man von der ‚Psychologie der Persönlichkeit‘ zu einer ‚Psychologie von Religiosität bzw. Spiritualität als Teil der Persönlichkeit‘ samt deren jeweiligen Strukturen. (vgl. Kaiser, 2007) Für die vorliegende Arbeit werden daher Entwicklungs- und Persönlichkeitsmodelle skizziert, die Religiosität und Spiritualität angemessen psychologisch erfassen. Zellner (1995, S. 56) geht nämlich von einem religiösen Erbe aus, das über „Lehrsätze und religiöse Geschichten, über Kunst und Musik, über Riten und Gebete“ bewusst und unbewusst in unsere Persönlichkeit einfließt.
Die strukturbezogenen psychologischen Theorien zu religiösen und spirituellen Themen (siehe II., 3.) und die Untersuchungen zum Thema Religiosität und Spiritualität im Prozess von Gesundheit und Krankheit (siehe II., 4.) liefern die weiteren Rahmenbedingungen dieser Untersuchung. Neben den ausgewählten Befunden zur Religiosität/Spiritualität und Gesundheit (siehe II., 4.1), soll auch die Untersuchung von Suchterkrankung (vgl. Dollinger & Schmidt-Semisch, 2007), in der Ausprägung der Heroinabhängigkeit, zur Spezialisierung des Themas dienen. Um der religiösen und spirituellen Dimension des Abhängigkeitsphänomens gerecht zu werden, werden die Begriffe Sucht, Süchtigkeit und Abhängigkeit (siehe II., 4.2) spezifiziert, die aktuellen Suchtmodelle (siehe II., 4.2.1) referiert, das Wesen der Suchterkrankung in Bezug zur Religiosität und Spiritualität (siehe II., 4.2.7) erörtert, die Wirkung von Heroin (siehe II., 4.2.8) beschrieben, und der Verlauf der Heroinabhängigkeit (siehe II., 4.2.9) skizziert.
Darauf aufbauend wird in diesem Themenkreis das Coping, dessen Begriff ursprünglich aus der Stressforschung stammt, näher beleuchtet. (siehe II., 4.3) So formuliert z.B. Pargament (1990; zitiert nach Dörr, 2004, S. 262) in seiner religionspsychologischen Coping-Theorie, dass Religiosität „in die komplexe Struktur der Stressbewältigung integriert werden und auf jede Phase des Problemlöseprozesses signifikanten Einfluss haben“ kann. (siehe II., 4.3.1)
Letztlich ergeben sich daraus ein zusammenfassender Forschungsstand (siehe II., 5.) sowie die Forschungsfragen und das Forschungsziel (siehe II., 6.). Das religionspsychologisch angelegte Forschungsziel soll einen transdisziplinären Beitrag zur Überwindung von Verständnisbarrieren zwischen den genannten Fächerkulturen leisten und neue Perspektiven, Konzepte und Methoden anbahnen.
Kaiser (2007, S. 124) geht davon aus, dass es Aspekte der Religiosität und Spiritualität gibt, „welche sich aufgrund mangelnder Operationalisierbarkeit numerisch nicht messen, sondern nur beschreiben lassen“. Deshalb wird bei dieser Untersuchung ein methodologisch-empirisches Forschungsdesign (siehe III.) gewählt, bei dem verschiedene Erhebungs- und Analysemethoden im Sinne des Methodenpluralismus zum Einsatz kommen. Hierzu gehören u.a. die ‚Narrationsanalyse‘ (siehe III., 2.1) und die ‚Objektive Hermeneutik‘ (siehe III., 2.3). Dabei wird auch die Idee von Unterrainer (2010) aufgriffen, erstmalig die ‚Strukturdiagnostik‘ (Rudolf, 2006) in Form der ‚Operationalisierten psychodynamischen Diagnostik‘ (OPD; siehe III., 1.2.1) als religionspsychologisches Instrumentarium einzusetzen.
Für die Studie werden acht Suchterkrankte (siehe IV., 2.) aus zwei verschiedenen Einrichtungen (Warstraße e.V., Neues Land; siehe IV., 1.) zu ihrer Lebensgeschichte und dem darin enthaltenden Verlauf ihrer Heroinabhängigkeit sowie zu religiösspirituellen Themen befragt. Die daraus resultierenden Forschungsergebnisse (siehe IV.) beinhalten sowohl die einzelnen Fallbeschreibungen (siehe IV., 3.), als auch die kontrastiven Vergleiche (siehe IV., 4.). Die gesamte wissenschaftliche Grundlegung der einzelnen Kapitel erfolgt hauptsächlich in den Fußnoten, um den Fluss der Ausführungen nicht zu stören. Teile der wissenschaftlichen Grundlegung fließen, zusammen mit den ‚Forschungsergebnissen‘ (siehe IV.), in die ‚Theoretischen Strukturmodelle‘ (siehe V.) ein.
In einem letzten Schritt werden im Kapitel VI. (‚Fazit und Ausblick‘) mögliche Schlüsse aus den Forschungsergebnissen und Anregungen für weitere Forschungsarbeiten sowie weiterführende Fragen aufgezeigt.
Eine Erörterung des gesamten Forschungsbereiches enthält notwendigerweise auch Kritik gegenüber anderen Positionen. Dabei wird vom Autor die religiös-spirituelle Bedingtheit des Menschen akzeptiert, jedoch gleichzeitig der Umstand wahrgenommen, dass Religion bzw. Religiosität und Spiritualität von religiösen Institutionen, spirituellen Gemeinschaften und Einzelnen als Machtinstrument missbraucht werden können. Im folgenden richtet sich die Erforschung dieses Themenbereiches auf das deutsche Christentum, wobei dennoch auch Offenheit gegenüber Informationen aus anderen Religionen besteht. Das Christentum als Hauptreligion unserer Kultur ist in diesem Zusammenhang am direktesten zugänglich.
Die Erstellung einer systematisch-differenzierten Arbeit wird durch die Vielschichtigkeit, wechselseitige Verzahnung und Überschneidung von inhaltlichen, methodischen und formalen Segmenten erschwert. Die ‚Definition der religionswissenschaftlichen Gegenstandsperspektive‘ (siehe I.), die ‚theoretische Grundlegung einer strukturbezogenen Religionspsychologie‘ (siehe II.), das ‚Methodologischempirische Forschungsdesign‘ (siehe III.), die ‚Forschungsergebnisse‘ (siehe IV.) und die ‚Theoretischen Strukturmodelle‘ (siehe V.) bedingen sich wechselseitig. Deshalb enthält der Fließtext auch Anmerkungen und Querverweise auf andere Kapitel. Das Literaturverzeichnis enthält Nennungen von wichtigen Werken über die zitierten Schriften hinaus. Zur besseren Lesbarkeit wurde das grammatikalische Maskulinum für die männliche und weibliche Form verwendet.
I. Definition der religionswissenschaftlichen Gegenstandperspektive
Religionswissenschaft ist nach Hock (2006, S. 7) „die empirische, historische und systematische Erforschung von Religion und Religionen“. Heine (2005, S. 16) spezifiziert, dass wenn man von Religionen spricht, die unterschiedlichen Religionsgemeinschaften gemeint sind wie Judentum, Christentum, Islam oder Buddhismus. „Religion in der Einzahl signalisiert hingegen keinen Außenbezug auf eine bestimmte Gemeinschaft hin, sondern einen Innenbezug wie ‚Religion haben‘ bzw. ‚religiös motiviert‘ sein.“ (Heine, 2005, S. 16)
Der Begriff ‚Religion‘ lässt sich vom lateinischen Ausdruck ‚religio‘ (fromme Scheu, Gewissenhaftigkeit, Gottesfurcht) ableiten. Zinser (2010, S. 12) führt dazu aus, dass Cicero den Begriff wie folgt definiert: „religio id est cultus deorum (‚de natura deorum‘, II, 8). Damit ist ‚religio‘ durch zwei Elemente: die Götter und deren Verehrung bestimmt.“ Der Begriff ‚religio‘ wiederum lässt sich auf zwei mögliche Quellen zurückführen - ‚relegere‘ (sorgfältig beachten, die sorgfältige Verehrung) oder ‚religare‘ (zurückbinden, wiederanbinden). Hock (2006, S. 10) weist darauf hin, dass kürzlich eine dritte Variante vorgeschlagen worden ist, nämlich „rem ligare“, im Sinne von „die Betriebsamkeit ruhen lassen“.1
Zinser (2010, S. 35) schreibt, dass der Begriff der Religion völlig umstritten sei, da sich die Religionswissenschaft „bis heute nicht auf eine Definition verständigen konnte“. Es kommt zunächst darauf an, ob der Begriff der Religion substanzialistisch, also durch den kleinsten gemeinsamen Nenner der Religionen oder funktional, also durch die Frage, welche Funktion die Religion erfüllt, bestimmt wird. Beim Definieren von Religion treten somit die ersten systematischen Probleme auf. Vergrößert man den Umfang des Religionsbegriffs, umfasst er zwar umso mehr Fälle, wird aber auch entsprechend diffuser. Umgekehrt fasst ein genauer definierter Begriff auch weniger Phänomene, die man vielleicht doch als religiös bezeichnen wollte. Dann gibt es noch den Konflikt zwischen der deskriptiven und normativen Definition. Soll die Definition sagen, wie man Religion beschreiben kann, oder soll sie sagen, was Religion sein sollte? Zinser (2010, S. 67) folgert, dass alle Definitionen von Religion scheitern müssen, „da sie eine der Seiten der Religion jeweils zum Kriterium herausheben […]. Damit schließen sie zugleich andere Erscheinungsformen von Religion aus, werden praktisch normativ. Die Begründung für diese Norm entstammt offen oder verdeckt einer Religion oder theologischen Tradition.“
Zudem gibt es das Problem der Übersetzbarkeit. Außereuropäische Sprachen haben oft kein eigenes Wort, keinen Begriff für Religion. Zinser (2010, S. 13) vermerkt, dass es viele Völker gab, „die ihre kulturellen Schöpfungen nicht als Religion bezeichneten und auch kein sprachliches Äquivalent, das ohne Bedeutungsverschiebungen mit Religion übersetzt werden könnte, dafür hatten und haben.“ (vgl. Antes, 2006)
Die Religion kann auf horizontaler Ebene, also von uns aus oder auf vertikaler Ebene, also aus der höheren Sicht verstanden werden. (Van der Leeuw, 1925/1970, S. 778) Das erste entspricht dem verständlichen Erlebnis, das letztere der „nicht mehr verständlichen Offenbarung“. (Van der Leeuw, 1925/1970, S. 778) In beiden Fällen impliziert Religion, dass der Mensch im Leben Macht sucht, um sein Leben zu erhöhen. Entweder versucht er sich der Macht zu bedienen oder sie anzubeten. (vgl. Van der Leeuw, 1925/1970, S. 778) Die Offenbarung ist kein Phänomen und ist weder erfass- noch verstehbar, gerade weil in ihr etwas Fremdartiges wirkt. Rudolf Otto (1869 - 1937) schlug dafür die Wortschöpfung „das Numinose“ vor. (vgl. Van der Leeuw, 1925/1970, S. 780) Aber es gibt auch noch andere Begriffe, die sich dem Fremdartigen annähern wollen. So finden sich in den Religionen die Bezeichnung „das Ganz-Andere“, das Wort „heilig“, das lateinische „sanctus“ sowie der Ausdruck „tabu“. Nach Van der Leeuw (1925/1970, S. 780) „richtet sich die Religion immer auf das Heil (Steigerung des Lebens, Vertiefung; Anm. d. Verf.), nie auf das Leben selbst, wie es gegeben ist“.
Ein weiteres Problem ist der Konflikt zwischen Innenperspektive und Außenperspektive. Hier stellt sich die Frage, ob die Definition des Begriffes ‚Religion‘ besser aus dem jeweils eigenen Glauben heraus vorgenommen werden soll oder von einem distanzierten Betrachter von außen. Ratschow (1973, S. 354) fordert, „daß die Religionswissenschaft einen Forscher verlangt, der selbst um ‚Religion‘ weiß […]. Dies ist die wesentliche Voraussetzung, denn ohne daß der Religionswissenschaftler ein lebendiges Verhältnis zu ‚seinem‘ Gott hat, vermag diese Wissenschaft nicht zu geschehen.“ Stolz (2001, S. 39) plädiert im Gegensatz dazu dafür, dass man in der Religionswissenschaft „neben dem methodischen Zugang zum Phänomen der Religionen, der die eigene Verwurzelung in einer Religion zum methodischen Ausgangspunkt macht“, auch „von Anfang an eine größtmögliche methodische Distanz zum eigenen Standort“ einführt.
Religion wird auch häufig durch die „Beziehung der Menschen zu Gott, Göttern, Geistern, Transzendenz und anderen übermenschlichen Mächten“ bestimmt. (Zinser, 2010, S. 52) Aus religionswissenschaftlicher Sicht sind nach Zinser (2010, S. 37) jedoch alle Definitionen der Religion abzuweisen, „die in ihrer Bestimmung einen Bezug zu Gott, zu Überweltlichem, zu Übermenschlichem, zur Transzendenz, der wissenschaftlichen Erfahrung entzogenen Instanzen oder Ähnlichem enthalten“. Zinser (2010, S. 15) konkretisiert an anderer Stelle, dass „im Unterschied zu Gegenständen der Naturwissenschaften […] Religionen nicht unabhängig vom Menschen, sondern von ihm gemacht und gestaltet“ sind.
Damit schließt Zinser die Transzendenz2 als Gegenstand der Religionswissenschaft aus, weil sie die Empirie und Theorie überschreitet. Zinser (2010, S. 17) formuliert diesen Umstand wie folgt: „Da eine empirische Wissenschaft keine Mittel und Methoden hat, um Transzendentes, Nichtempirisches und Nichttheoretisches zu untersuchen, muß auch die Religionswissenschaft sich auf Geschichtliches und Gesellschaftliches beschränken. Aussagen über Transzendentes werden nicht gemacht, da diese wissenschaftlich in einem strengen Sinne nicht überprüfbar und wiederholbar sind.“
Religion kann zudem ihrem Wesen nach viele Antworten auf Lebensfragen geben und auch von der Sinnfrage3 aus bestimmt werden, da diese den Menschen „angesichts der unausweichlichen Endlichkeit seiner Existenz durch die Zeit hindurch begleitet“. (Neumann, 2010, S. 44) Die Verbindung zwischen Leben und Sinn wird dadurch sowohl als gegenseitige Verweisung wie als Spannungsverhältnis sichtbar. Nach Zinser (2010, S. 23) lässt sich „ein objektiver, absolut gültiger, von den Individuen unabhängiger Sinn des Lebens […] nicht erweisen“, was sich am Beispiel der Medizin erläutern lässt. „Die wissenschaftliche Medizin gibt natürliche Erklärungen der Genese von Krankheiten und bietet vielfach erfolgreiche Therapien an. Eine ‚Erklärung‘ im Zusammenhang des Lebens, etwa als Strafe der Götter für Fehlverhalten und Hybris, kann sie nicht geben. Damit wird Krankheit sinnlos, was das Leiden bei chronischen und hoffnungslosen Fällen subjektiv vergrößern kann. Der Religion wird dann vielfach die Aufgabe überantwortet, einen Sinn zu stiften […].“ (Zinser, 2010, S. 45) Zinser (2010, S. 40f.) wendet zudem ein:
„So verbreitet nun in den Religionen Antworten auf viele Lebensfragen sind, so darf man dies nicht als Definition oder Bestimmung von Religion ansehen. Vielmehr handelt es sich um eine Bestimmung der Aufgaben oder Funktionen von Religionen. Es ist auch nicht gesagt, daß alle Religionen diese Funktion in gleicher Weise übernommen haben. […] Philosophen suchen auch Antworten auf diese Fragen und verstehen ihre Aussagen ebenfalls nicht religiös. […] Wenn man diese Funktionen als Bestimmung von Religion ausgibt, werden alle Menschen für die Religion vereinnahmt, ob sie selber es wollen oder nicht. Es gibt dann nichts mehr, was nicht Religion ist.“
Zu den Funktionen von Religion gehören neben der Kompensationsthese und der Legitimation von Herrschaft und sozialer Ordnung auch „die Stiftung von sozialer Synthesis oder ihr Gegenteil, die Motivation von sozialem Protest“. (Zinser, 2010, S. 46) Die Kompensationsthese beschreibt den Gedanken, „dass viele Menschen im Diesseits ihre Wünsche und Bedürfnisse nicht befriedigen“ und sich deshalb im Jenseits „einen tröstenden Ersatz, sozusagen als Ausgleich für die Frustrationen und Ungerechtigkeiten im hiesigen Leben“ schaffen. (ebd.) Karl Marx (1844/1974, S. 378f.) schrieb nicht von ungefähr, dass die Religion das Opium des Volkes sei.
Jacques Waardenburg (1986, S. 34) bemüht sich um eine Vermittlung von funktionalem und substanzialistischem Religionsverständnis (vgl. Hock, 2006, S. 18), wobei er „Religion auf abstrakter Ebene vor allem als Orientierung, Religionen als eine Art Orientierungssysteme“ definiert.4 Zinser (2010, S. 66f.) beharrt darauf, dass der Begriff der Religion geschichtlich zu entfalten sei. Für ihn ist das als Religion anzusehen, „was von den Anhängern einer Religion und ihrer sozialen Umwelt als Religion betrachtet wird. Religionen sind gesellschaftliche und geschichtliche Bildungen und bestehen aus Vorstellungen und daraus folgenden Handlungen von Menschen. Religionen waren und sind eine soziale Wirklichkeit, wie andere kulturelle Phänomene.“ (Zinser, 2010, S. 67)
Als ‚Religion‘ kann laut Utsch & Klein (2011, S. 27)
„sowohl ein persönliches Deutungs- und Wertsystem inklusive damit verbundener religiöser Aktivitäten bezeichnet werden […] als auch ein soziales Gebilde, das Institutionen ausbildet, die dann zum Träger des jeweiligen Deutungssystems werden und seine Verbindlichkeit zu untermauern versuchen […]. Diese beiden Bedeutungsbereiche - sowohl das Phänomen des Religiös-Seins als auch die institutionalisierten Religionsgemeinschaften - sind also im modernen Religionsbegriff enthalten, so dass sich Facetten beider etymologischen Quellen im heutigen Verständnis von Religion wieder finden lassen. […] Die Ausweitung des Religionsbegriffs gestattet es nun, auch Phänomene fremder Kulturen […] Religion zu nennen, wiewohl in vielen außereuropäischen Sprachen ein synonymer Begriff nicht wirklich existiert.“
Zu einer religionswissenschaftlichen Standortbestimmung „gehört auch die Frage, was Gegenstand der Religionswissenschaft ist und sein kann und vor allem: was nicht […]“ (Zinser, 2010, S. 14) Waardenburg (1993, S. 98) verortet die Religionswissenschaft als „eine empirische Wissenschaft, welche Theorien, Methoden und Techniken der Human- und Sozialwissenschaften anwendet, mit dem Ziel, zu gesicherten Erkenntnissen religiöser Tatbestände und ganzer Religionen zu gelangen“.
Bei Ratschow (1973, S. 351) ist die Religionswissenschaft „eigenständig und eigengesetzlich. Sie ist in Methode und Ziel von all den genannten Wissenschaften abhängig, indem sie sich ihrer bedient. Aber sie hat ein ganz eigenes Gepräge, das in Aufgabe, Methode und Ziel ihrer Forschung gegeben ist.“
Religionswissenschaft ist in zwei Grundbereiche unterteilt, nämlich in ‚Historische Religionswissenschaft‘ und in ‚Systematische Religionswissenschaft‘. (vgl. Figl, 2003; Hock, 2006) Die ‚Historische Religionswissenschaft‘ beschreibt das Besondere in Gestalt von historischen Längsschnitten, wohingegen die ‚Systemische Religionswissenschaft‘ die Beschreibung des Allgemeinen, in Form von Querschnitten favorisiert, um das Typische herauszuarbeiten. (vgl. Hock, 2006, S. 7)
Nach Zinser (2010, S. 21ff.) ist Religionswissenschaft
„nicht Religion oder religiöse Unterweisung, sondern die Untersuchung und das gesammelte Wissen von und über Religion. Die Religionen mit allen ihren Erscheinungen sind Gegenstand, Objekt dieses Wissens. […] Glauben5 kann sie nicht vermitteln, sondern Wissen und Wissenschaft. […] In der Wissenschaft darf nicht geglaubt werden. […] Der religiöse Glaube dagegen verlangt im Unterschied dazu Unbedingtheit; er kann im Wesentlichen nicht in Zweifel gezogen und revidiert werden, dies gilt als Abfall vom Glauben, jedenfalls als Austritt aus der religiösen und moralischen Gemeinschaft, die durch die gemeinsamen Glaubensüberzeugungen konstituiert wird. […] Für die Religionswissenschaft bedeutet dies, daß sie nur auf Empirisches bezogene Aussagen machen darf, wenn sie sich nicht in Religion oder Ideologie verwandeln will.“
Zinser (2010, S. 23 ff.) führt dazu weiter aus, dass Religionswissenschaft „nicht Theologie, auch nicht eine überkonfessionelle Theologie oder gar eine alle Religionen umfassende und synthetisierende Theologie“ ist. Hock (2006, S. 9) schreibt passend dazu: „Obwohl die Religionswissenschaft als eigenständige akademische Disziplin mit der Theologie eine ganze Reihe von Berührungspunkten aufweist […] geht die Religionswissenschaft nicht in der Theologie auf.“
Während die Theologie eine Innensicht einnimmt und somit den Glauben an eine Offenbarung voraussetzt (vgl. Kaiser, 2007, S. 23), nimmt die Religionswissenschaft eine Außensicht ein und steht somit außerhalb von religiösen Systemen. Kaiser (2007, S. 23) berichtet: „Die Religionswissenschaft beschäftigt sich nicht mit dem Wahrheitsgehalt irgendwelcher Postulate der verschiedenen Religionen, sondern mit dem Phänomen Religion als empirische Realität. […] Neben dem (bloßen) phänomenologischen Aspekt werden psychologische und soziale Ursachen und Implikationen von Religion und Religiosität hinterfragt.“
Für Zinser (2010, S. 25 ff.) stützt sich der Religionswissenschaftler
„in seiner Arbeit auf Erfahrung und Theorie. Ihm steht keine Schrift, in der die Wahrheit ein für alle Male festgestellt ist, zur Verfügung und ebenso wenig die Autorität einer sozialen Gemeinschaft. Allein die Kraft seiner Argumente zählt. Kriterium seiner Arbeit ist zum einen die durch Erfahrung vermittelte Sachkenntnis der verhandelten Gegenstände und zum anderen die innere Reflexion seiner Überlegungen […]. Schließlich haben Theologie und Religionswissenschaft auch nicht den gleichen Gegenstand; zugespitzt kann man sagen: ein Theologe spricht über Gott, der Religionswissenschaftler über die Vorstellungen, die sich Menschen von ihrem Gott oder ihren Göttern machen und in Kulten und anderem bis hin zur Gestaltung ihres Lebens zur Darstellung bringen. […] Aber es wäre eine Illusionserzeugung, wenn man behauptete, daß Wissenschaft mit ihren Methoden Gott und Götter, das Absolute, einen objektiven Sinn würde erkennen oder setzen können.“
Knoblauch (2003, S. 41) spricht in diesem Zusammenhang von einem ‚methodologischen Agnostizismus‘, der wissenschaftliche „Aussagen über die Existenz höherer Mächte oder göttlicher Wesen weder bestätigen noch widerlegen kann“. […] Wissenschaftliche Untersuchungen müssen also die transzendenten Wahrheitsansprüche der Aussagen ihrer Untersuchungssubjekte einklammern.“
Religionswissenschaft ist auch keine Philosophie. Mit der Philosophie verbindet die Religionswissenschaft lediglich die gemeinsamen Bemühungen „um die Erarbeitung einer formalen Wissenschaftssprache auf der Grundlage klarer methodologischer Standards und Verfahrensweisen“. (Hock, 2006, S. 9) Die Religionsphilosophie gehört nicht zur Religionswissenschaft, da die Wahrheitsfrage innerhalb der Religionswissenschaft ausgeschlossen wird. Zinser (2010, S. 33) schreibt: „Wissenschaftliche Wahrheit gründet sich auf Erfahrung und Theorie, neue Erfahrungen können alte Theorien der Unwahrheit überführen. Wissenschaft hat also allenfalls einen vorläufigen, zeitlich und gesellschaftlich bedingten Wahrheitsanspruch, keinen absoluten.“ Waardenburg (1993, S. 101) führt noch ein weiteres Argument ins Feld: „Die Religionswissenschaft erforscht religiöse Normen, Werte und Wahrheiten, ohne aber selbst eine normative Disziplin zu werden und ohne sich von außen auferlegten Normen, mit Ausnahme der wissenschaftlichen, zu unterwerfen.“
Religionswissenschaft und Psychologie haben nach Hock (2006, S. 128) einen gemeinsamen Schnittpunkt: „Die Psychologie hat den ‚Faktor Religion‘ gleichermaßen in Rechnung zu stellen, wie umgekehrt die Berücksichtigung des Einflusses psychischer Dispositionen und Abläufe für die Religionswissenschaft von Bedeutung ist.“ Ratschow (1973, S. 355f.) schreibt, dass die moderne Religionswissenschaft im weitesten Sinne aus den Gedanken der Aufklärung6 hervorgegangen sei:
„Die Aufklärung selbst hat keine Religionswissenschaft hervorgebracht. Aber der Zerfall der Aufklärung ließ die Momente sichtbar werden, die eine Religionswissenschaft ermöglichten. […] Das erste Moment ist die Wahrnehmung des Einzelnen und Individuellen in den Religionen als dessen, was sie konstituiert und zu dem macht, was sie sind. […] Das zweite Moment, das mit dem Ende der Aufklärung sichtbar wird, ist die Korrelation des Irrationalen in der Religion und des ‚Gefühls‘ oder des ‚Gemüts‘ im Menschen.“
Erstaunlicherweise spielt „die Religionspsychologie innerhalb des Spektrums der religionswissenschaftlichen Disziplinen eine recht untergeordnete Rolle“. (Hock, 2006, S. 128) Hock (ebd.) kommt zum Schluss,
„dass über eine lange Zeit hin - und sicherlich bis in die Gegenwart hinein - zwischen Vertretern der Psychologie auf der einen Seite und der Religionsforschung auf der anderen Seite stets ein gewisses Misstrauen geherrscht hat und immer noch herrscht: Psychologen, in Glaubensfragen nicht selten indifferent oder gar religionskritisch, haben oft eine gewisse Skepsis gegenüber dem Vorhaben, etwas, das mit Religion zu tun hat, zum Gegenstand psychologischer Forschung zu machen. Umgekehrt sind Religionsforscher bisweilen misstrauisch gegenüber psychologischen Fragestellungen und Perspektiven, die sie als reduktionistisch oder als unsensibel gegenüber religiösen Dimensionen erachten.“
Ratschow (1973, S. 371) fordert: „Die Religionswissenschaft kann in ihrer Forschung auf die methodischen Einsichten der Psychologie nicht verzichten, denn sie hat das psychische Verhalten von Menschen zu untersuchen, die in ihrer Lebensfreude und Lebensnot zum Kult kommen, oder in deren alltägliches Dasein urplötzlich der Gott eintritt. Man bedarf zum Verständnis dieser Vorgänge psychologischer Fragestellungen.“ Murken (1998b, S. 40) führt aus, dass die Religionswissenschaft ihrerseits wiederum für die Religionspsychologie wichtig ist, „da ohne Verständnis der religiösen Tradition und Gemeinschaft auch das Individuum nicht verstanden werden kann“.
1 Zinser (2010, S. 16) vermerkt, dass die meisten Begriffe der Religionswissenschaft einem Wandel unterworfen sind, da diese Begriffe aus den Religionen übernommen werden. „Da die Gegenstände der Religionswissenschaft nur als gesellschaftlich-geschichtliche Erscheinungen in den Vorstellungen und den daraus resultierenden und mit ihm verbundenen Handlungen existieren, sind auch die Begriffe der Religionswissenschaft gesellschaftlich und geschichtlich produziert.“
2 Der Begriff ‚Transzendenz‘ wird klassischerweise folgendermaßen definiert: „Der Überstieg, das Überschreiten der Grenzen zwischen zwei Gebieten, das Hinausgehen über die Welt als Diesseits.“ (Kast, 2000, S. 33) Utsch (1998, S. 123ff.) unterscheidet dabei drei psychologische Bereiche der Transzendenz: (1) die Bewusstseinstranszendenz (jegliche Dinge der Gegenstandswelt sind durch die menschliche Wahrnehmung verzerrt, können aber mit Hilfe der phänomenologischen Methode erkannt werden), (2) die Selbsttranszendenz (beschreibt „die von Heidegger herausgestellte psychologische Konsequenz des ‚In-der-Welt-Seins‘“) und (3) die Personale Transzendenz (weist „auf die Möglichkeit des Überschreitens personaler Grenzen hin“). Demnach rückt allerdings vermehrt „der Mensch ins Zentrum. Man fragt nach dem Wesen des Menschen. Damit ist Transzendenz zu einem anthropologischen Begriff geworden, in dem ausgesagt wird, was der Mensch seinem Wesen nach ist.“ (Kast, 2000, S. 36f.) Dadurch werden das Selbst und die Transzendenz zur Grundbestimmung des Psychischen. Transzendieren hat dann „einerseits sehr viel damit zu tun, daß wir unser Ich aufgeben können und dennoch in voller Selbstgewißheit leben können. […] Transzendieren heißt andererseits aber auch, daß wir uns von einer emotionellen Besetztheit distanzieren können.“ (Kast, 2000, S. 45) Unter diesen Gesichtspunkten kann es sinnvoll sein, den modifizierten Begriff der ‚Transzendenz‘ oder besser gesagt, die Erfahrung des Transzendierens doch in die religionswissenschaftliche bzw. religionspsychologische Betrachtungsweise mit einzubeziehen.
3 Van Belzen (1997; zit. nach Utsch, 2005, S. 110) bemerkt hierzu, dass der Inhalt von Sinn für die Religionspsychologie kein Forschungsobjekt sei, „wohl aber die menschliche Beziehung dazu“. Dörr (2001, S. 21) schreibt dazu passend: „Schließt man die eher übergeordnete Frage nach dem Sinn menschlichen Lebens einmal aus, so macht die Psychologie aber ebenfalls Aussagen, was die sinnvolle und erfolgreiche Gestaltung des alltäglichen Lebens angeht und bemüht sich, Verhaltensweisen, Gefühle und Gedanken in den verschiedensten Situationen zu erklären.“
4 Dabei unterscheidet Waardenburg (1986, S. 35ff.) folgende Merkmale von Religion: (1) Religiös gedeutete Wirklichkeiten, (2) religiös gedeutete Erfahrung und (3) religiös gedeutete Normen.
5 Bei der Definition von Religion kann auch eine Verknüpfung von Glauben und Religion angenommen werden. Doch lassen sich nicht „alle Erscheinungen, in denen etwas geglaubt wird, z. B. an die Treue von Mann und Frau, als Religion bezeichnen. […] Man kann die Grundpositionen unserer Kultur: Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit als Glaubenspositionen auffassen, ohne daß diese gleich zur Religion werden. Auch der Wissenschaftsglaube kann nicht ohne weiteres als Religion anerkannt werden.“ (Zinser, 2010, S. 57)
6 Für Heine (2005, S. 20) erweist sich auch „die Religionspsychologie als ein Kind aus dem Geist der Aufklärungskultur. Dem entspricht auch ihr Gegenstand: Sie will Formen de facto erlebter und gelebter Religiosität und deren Auswirkungen erfassen.“
II. Theoretische Grundlegung einer strukturbezogenen Religionspsychologie
Die Disziplin innerhalb der wissenschaftlichen Landschaft, die sich in besonderem Maße mit dem Menschen und dessen Bedürfnis nach und dem Erleben von Religiosität und Spiritualität sowie mit deren verhaltenssteuernder Bedeutung befasst, ist also die Religionspsychologie, die an der Schnittstelle zwischen Religionswissenschaft, Psychologie, Theologie, Soziologie und Philosophie einzuordnen ist und eine wertvolle Ergänzung dieser Disziplinen darstellt. Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass die Methoden der angrenzenden Bereiche ebenfalls eine große Bedeutung für die Arbeit der Religionspsychologie besitzen. (vgl. Sundén, 1982, S. 178)
Historisch betrachtet liegen für Hock (2006, S. 130) „die Wurzeln der Religionspsychologie als empirisch fundierter Wissenschaft […] eindeutig in den USA: Angeregt durch statistische Untersuchungen von Francis Galton (1822 - 1911) über den Einfluss des Gebets auf Gesundheit und Karriere hatten zunächst Granville Stanley Hall (1846 - 1924), dann Edwin Diller Starbuck (1866 - 1947) und James Henry Leuba (1868 - 1946) den Grundstein der Religionspsychologie gelegt. Die Anfänge der Disziplin sind allerdings vornehmlich mit dem Namen von William James (1842 - 1910) verbunden.“ Dabei sollte festgehalten werden, dass „alle diese religionspsychologischen Modelle […] ihre Herkunft aus der jüdisch-christlichen Tradition nicht verleugnen“ können. (Dunde, 1993, S. 233) Innerhalb der deutschen Forschungslandschaft nimmt die Religionspsychologie vergleichsweise nur eine untergeordnete Rolle ein.7
Bisher wurden verschiedene Zugänge zu den spezifischen religiösen bzw. spirituellen Phänomenen an-, sowie diverse Definitionsversuche von Religionspsychologie vorgenommen. Holm (1990, S. 9) definiert die Religionspsychologie als eine Wissenschaft, welche das Verhältnis der religiösen Ausdrucksformen zu psychologischen Prozessen und Abläufen untersucht. Vergote (1970, S. 12; S. 15f.) schreibt, dass die Religionspsychologie in erster Linie „die Religion, so wie sie sich im Menschen manifestiert und strukturiert“, sowie die religiösen bzw. spirituellen Erfahrungen, Haltungen und Ausdrucksformen erforscht.8 Lämmermann (2006, S. 27) liefert mehrere Definitionen zum Begriff der Religionspsychologie. So heißt es z.B., dass die Religionspsychologie der Versuch ist, „mit psychologischen Methoden und auf der Grundlage psychologischer Theorien das Phänomen Religion und die religiösen Phänomene begreifbar zu machen, d.h. die Formen religiösen Lebens und Erlebens in Abhängigkeit von psychischen Strukturen des Menschen und ihrer Entwicklung verständlich zu machen“. Etwas weiter schreibt er: „Religionspsychologie untersucht ‚Erlebnisse, Akte und Strukturen‘ […]. Als Gegenstand der Religionspsychologie kann im breiteren Sinne die subjektive Religiosität von Menschen“ gelten. (ebd.)
Dunde (1993, S. 235) führt aus, dass die Religionspsychologie „nach den psychischen und sozialpsychologischen Ursachen von Religion, der Entwicklung religiöser Einstellungen im Lebenslauf, nach Funktionen und Auswirkungen religiöser Überzeugungen und Handlungen“ fragt. Hemminger (2003, S. 14) resümiert, dass „prinzipiell jede psychologische Fragestellung auf die Religiosität des Menschen anwendbar“ ist, „da Religion immer auch […] eine Betätigung von Menschen ist“, bei der die menschliche Psyche mitwirkt.
Die Themen der Religionspsychologie sind vielfältig und dennoch lassen sich nach Henning und Murken (2003, S. 91; erw. vom Verf.) vier Grundfragen ausmachen:
Die
Motivationsfrage
(Warum ist eine Person religiös/spirituell?);
Die
Frage nach der Wechselwirkung
(Welche Wechselwirkungen lassen sich zwischen der Religiosität/Spiritualität des Einzelnen und seiner religiösen/spirituellen Bezugsgruppe / Kultur beschreiben?; Welchen Einfluss haben Sozialisierung und Erziehung bei der Entwicklung von Religiosität/Spiritualität?);
Die
Frage nach der Art und Weise von Religiosität/Spiritualität
(Wie / in welcher Form ist sie religiös/spirituell?);
Die
Frage nach der psychologischen Einwirkung auf die Persönlichkeit
(z.B. Welche Konsequenzen hat die Religiosität/Spiritualität für Gedanken/Kognitionen, Gefühle/Emotionen und Verhalten?).
Zu einer theoretischen Grundlegung einer empirisch fundierten und strukturbezogenen Religionspsychologe gehört, analog zur Religionswissenschaft, ebenfalls die Frage, was Gegenstand der Religionspsychologie ist und welche Teilbereiche von ihr abgrenzt werden sollten. 9
Religionspsychologie ist keine Religionsphänomenologie, da die menschliche Psyche - neben dem Erlebnisraum, der erlebbaren, phänomenologischen Inhalte - auch einen nicht erlebbaren Raum mit einer psychologischen Struktur aufweist. (siehe II, 3.4)
Religionspsychologie ist keine Pastoralpsychologie. Die Pastoralpsychologie ist aus der systematischen und praktischen Theologie hervorgegangen. In der Pastoralpsychologie ist verstärkt der seelsorgerische sowie religionspädagogische Ansatz wirksam und es steht ein kirchliches Handlungsinteresse im Vordergrund.
Religionspsychologie ist keine Transpersonale Psychologie oder Parapsychologie, obwohl einige Überschneidungen im Gegenstandsbereich festzustellen sind. 10 Im Gegensatz zur Religionspsychologie ist die Transpersonale Psychologie bzw. die Parapsychologie jedoch nicht als Wissenschaft etabliert.
Zwischen der Religionspsychologie und der Religionssoziologie lassen sich keine scharfe Grenzen ziehen. Nur die Fragestellungen sind in den Disziplinen unterschiedlich: „Das Hauptinteresse der Religionspsychologie liegt auf dem Einzelnen, das der Religionssoziologie dagegen auf der ganzen Gruppe und ihrem Verhalten gegenüber anderen sozialen Faktoren wie Wirtschaft, Politik, sozialer Gruppenzugehörigkeit, Verstädterung, Säkularisierung usw.“ (Holm, 1990, S. 19)
1. Bestimmung der Begriffe ‚Religiosität‘ und ‚Spiritualität‘
Jede Definition engt ein, legt fest und grenzt damit unweigerlich aus. Bei den Begriffen Religiosität und Spiritualität könnte man einwenden, dass gerade diese offen gelassen werden sollten, da sie Phänomene beschreiben, welche nicht mit weltlichen Maßstäben beschrieben werden können. Aber auch eine Nicht-Definition (vgl. Bucher, 2007, S. 21) schließt letztendlich definitorische Elemente mit ein. Deshalb ist es unumgänglich, zumindest jeweils eine Annäherung an die Begriffe Religiosität und Spiritualität zu gewährleisten. Wie Werres (2012, S. 5) feststellt, belegen mittlerweile zahlreiche Studien (Argyle, 2000; Spilka et al., 2003), „dass die beiden Begriffe zwar aufeinander bezogen, aber nicht deckungsgleich sind“.
1.1 Religiosität
Der Begriff ‚Religiosität‘ ist „ein Konstrukt menschlichen Denkens und menschlicher Sprache und verweist auf ein hochkomplexes Phänomen“.11 (Angel, 2006, S. 8) Maiello (2007, S. 22) schreibt, dass sich die Religiosität für ein Individuum „auf die persönliche Relevanz von Religion“ bezieht. Für Zwingmann und Murken (2000, S. 257) steht jede Begriffsbestimmung von ‚Religiosität‘ „zwischen einer substantiellen, inhaltsbezogenen Perspektive, welche angibt, was das Religiöse12 ‚ist‘, und einer funktionalen, aufgabenbezogenen Perspektive, welche angibt, was das Religiöse ‚leistet‘“. Substantielle Definitionen13 beinhalten allerdings bestimmte Glaubensinhalte (Gott, Transzendenz), und funktionale Konzepte gründen sich auf existentielle menschliche Grundsituationen (Sinnsuche)14, welche eher dem Begriff der ‚Spiritualität‘ vorbehalten werden sollte. „Jede geprägte Form von Religiosität erfüllt daher […] aus einer funktionalen Betrachtung heraus den Anspruch auf Weltorientierung und implizierter Sinngebung für das Handeln des Individuums.“15 (Hemel, 2006, S. 99) Viele Wissenschaftler (Utsch, 1998; Moosbrugger, Zwingmann & Frank, 1996) bevorzugen daher eine Kombination aus substantiellen und funktionalen Ansätzen.
Bell D´Davis (2005, S. 109) schreibt, dass Religiosität oft verstanden wird „als die sich einer institutionalisierten Religionsgemeinschaft und deren Ordnung unterwerfende Haltung des Subjekts.“ Dabei bezieht sich die Religiosität „auf das unmittelbare und subjektive Erleben von Religion und ihren Vollzug“. (Werres, 2012, S. 12) Nach Utsch (2011, S. 27) betont der Terminus ‚Religiosität‘ daher die individuelle Seite und die psychologischen Aspekte der Religion und des Religiösen.16
Wie die Literaturrecherche gezeigt hat, gibt es diverse unterschiedliche Forschungsansätze in Bezug auf ‚Religiosität‘. Hemel (2006, S. 101ff.) entwirft z.B. eine „Typologie religiöser Lebensstile“ auf der Basis des „religiösen Bewusstseins“, bei der „die Ausdrucksformen wie Religiosität als Zugehörigkeit zu einem religiösen Milieu, Religiosität als Praxis gelebter Frömmigkeit, Religiosität als narzisstisch geprägte Identität eines religiösen Individuums und Religiosität als geschlossene religiöse Identität voneinander unterscheidet“. Für Lämmermann (2006, S. 62) sind der ‚Religiosität‘ zudem die „im Unterbewussten schlummernden religiösen Traditionsfragmente“ zuzurechnen.
Vergote (1970, S. 12) hat sein Hauptaugenmerk auf die religiösen Erscheinungen gerichtet. Dabei unterscheidet er zwischen „verschiedenen Dimensionen und Vektoren: den (religiösen) Meinungen, Glaubensvorstellungen, Werturteilen, Erfahrungen, Haltungen, Verhaltensformen und Riten […]“. Zudem betont Vergote (1970, S. 33) eine dynamische Konzeption der Religiosität und stellt die These auf, dass der Mensch nicht mit Geburt religiös sei, sondern erst religiös wird, nämlich durch seine Entwicklung und durch die Interaktion mit seiner Umwelt. An anderer Stelle (Vergote, 1970, S. 49) modifiziert er diese These im Anschluss an Scheler (1921, S. 550), in dem er schreibt, dass der Mensch nun doch „ursprünglich religiös auf Grund der unmittelbaren Erfahrung seiner Abhängigkeit“ sei.17
Kaiser (2007, S. 16f.) greift den Gedanken auf. Für ihn ist allerdings „dieses Moment der Abhängigkeit und der Gebundenheit an gegenständliche Strukturen […] das entscheidende Kriterium für religiöse Erfahrung.“ Die religiöse Erfahrung18 ist für ihn somit ein wichtiger Teil der Religiosität.
1.2 Spiritualität
‚Spiritualität‘ wird oft dem Begriff der ‚Religiosität‘ gegenübergestellt, und sie wird durch ein Nichtvorhandensein von Institutionalisierung identifiziert.19 Der lateinische Begriff ‚Spiritus‘ bedeutet (vgl. Unterrainer, 2010, S. 16): Lufthauch, Atem, Geist, Leben, Seele sowie Begeisterung. Buchner (2007, S. 22) führt dazu weiter aus: „Das zugrunde liegende Verb lautet ‚spiro‘ und bezeichnet nicht nur ‚wehen, hauchen‘, sondern auch ‚atmen, leben‘ sowie ‚erfüllt und beseelt sein‘.“ Der Begriff ‚spiritualis‘ bezeichnet indes das Wirken des Heiligen Geistes und ‚spiritualitas‘ die christliche Lebenspraxis. Spiritualität kann auch als ‚geistliches‘ oder ‚inneres Leben‘ bezeichnet werden. (vgl. Bucher, 2007, S. 22)
Buchner (2007, S. 26ff.) gibt in Folge einen Überblick über qualitative Studien zum Thema ‚Spiritualität‘. Dabei kommt er zum Ergebnis, dass Spiritualität verstanden werden kann, als
Verbundenheit und als Erfahrung von Einheit
,
20
Beziehung zu einem höheren Wesen
,
Verbundensein mit der Natur
(naturalistische Spiritualität),
Beziehung zu anderen
,
Selbsttranszendenz
,
Beziehung zum Selbst
(Selbstverwirklichung, Wachstum des eigenen Selbst),
Praxis, speziell Meditation
,
paranormale Erfahrung und Fähigkeiten
(Synchronizität, Visionen, Nah-Toderfahrungen).
Für Buchner (2007, S. 28) steht die Verbundenheit im Zentrum der Spiritualität, die verschiedene Bezugsgrößen mit einbeziehen kann. Dabei beinhaltet die vertikale Ausprägung „die Beziehung zu einem höheren Wesen“ und „die horizontale hingegen die Verbundenheit mit der sozialen Mitwelt, dem Selbst, der Natur, dem Kosmos.“ Das folgende Schaubild von Buchner (2007, S. 33) verdeutlicht das vorher Ausgeführte:
Utsch (2005, 194f.) liefert in seiner Übersichtsarbeit einige Definitionen von Spiritualität, welche zum Teil das Schaubild von Buchner bestätigen:
„Helminak (1987, 23)
‚intrinsisches Prinzip authentischer Selbsttranszendenz‘ […]
Pargament (1999, 12)
‚Suche nach Geheiligtem‘
Belzen (1997, 210)
‚individuelle Gestaltung der Bezogenheit auf Transzendenz‘
Wilber (2001, 32)
‚permanente Verwirklichung des Bewusstseins zum nondualen Geist‘
Wirtz/Zöbeli (2000, 299)
‚Öffnung der Ich-Grenzen zum überindividuellen Sein‘
Berger (2000, 228)
‚wachsende Durchdringung der Alltagswelt mit religiöser Erfahrung‘“
21
Büssing und Ostermann (2004; zitiert nach Büssing, 2006, S. 23) legen bei ihrer Definition einen zusätzlichen Schwerpunkt auf den ‚göttlichen Ursprung‘:
„Mit dem Begriff Spiritualität wird eine nach Sinn und Bedeutung suchende Lebenseinstellung bezeichnet, bei der sich der/die Suchende ihres ‚göttlichen‘ Ursprungs bewusst ist (wobei sowohl ein transzendentes als auch ein immanentes göttliches Sein gemeint sein kann, z.B. Gott, Allah, JHW, Tao, Brahman, Prajna, All-Eines u.a.) und eine Verbundenheit mit anderen, mit der Natur, mit dem Göttlichen usw. spürt. Aus diesem Bewusstsein heraus bemüht er/sie sich um die konkrete Verwirklichung der Lehren, Erfahrungen oder Einsichten im Sinne einer individuell gelebten Spiritualität, die durchaus auch nicht-konfessionell sein kann. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf die Lebensführung und die ethischen Vorstellungen.“
Auch Unterrainer (2010, S. 17) benutzt für seine überaus gelungene Studie eine Arbeitsdefinition von Spiritualität, die er von Cook (2004, S. 548) übernommen und ins Deutsche übersetzt hat, welche sehr dem Schaubild von Buchner nahekommt. Diese soll ebenfalls als Grundlage für diese Studie dienen:
„‚Spiritualität ist eine, möglicherweise spezifische schöpferische und universelle Dimension des menschlichen Befindens, die sowohl von der inneren subjektiven Wahrnehmung herkommt, als auch vermittelt wird durch Gemeinschaften, soziale Gruppen und Traditionen. Sie kann erfahren werden als Beziehung zum ‚inneren‘ Selbst und immanent/personal zu anderen und/oder transzendent/transpersonal durch die Beziehung zu einer Dimension bzw. etwas, das jenseits des Selbst liegt.‘“
2. Dimensionen von Religiosität und Spiritualität
Wie die oberen Ausführungen gezeigt haben, ist es ebenso schwer, eine objektive Definition für ‚Religiosität und Spiritualität’ abzuleiten, wie eine allgemeingültige Begriffsbestimmung für ‚Religion‘ zu finden. Daher werden innerhalb der Religionspsychologie häufig mehrdimensionale Modelle mit verschiedenen Dimensionen von Religiosität und Spiritualität, vorgeschlagen, um den Begriffen die nötige Tiefe zu geben.22 (vgl. Knoblauch, 2003, S. 47)
2.1 Dimensionen von Religiosität
Ein so komplexes Phänomen wie ‚Religiosität‘ kann also nur sinnvoll in einem multiperspektivischen Modell erfasst werden. Dabei sind vor allem drei Perspektiven von Interesse: (1) die inhaltliche Perspektive (mit der Frage nach religiösen Ausdrucksformen), (2) die Einstellungs- und Haltungsperspektive und (3) die funktionale Perspektive (z.B. Religiosität in Relation zu psychischer Gesundheit versus Krankheit). (vgl. Heine, 2005, S. 78) Utsch (1998, S. 107) liefert hierzu ein Arbeitsmodell der psychischen Dimensionen der Religiosität, welches in einer etwas erweiterten und modifizierten Form wiedergeben werden soll:
Anthropologische Dimension
Inhalte
Auswirkungen auf
Erleben
religiöse Erfahrung
Sinndeutungen, Biographie
Emotion
religiöse Gefühle, Empfindungen
Grundhaltung
Glauben
religiöse Bedeutung
Ideologie
Kognition
religiöses Denken/Wissen
Weltanschauung
Bewusstsein
religiöse Lebensstile
Ausdrucksformen (Zugehörigkeit zu einem religiösen Milieu, Praxis, narzisstische oder religiöse Identität)
Sozialisation
religiöse Erziehung und Entwicklung
Religiöse Deutungsmuster, Gewohnheiten, Habitus (siehe
II
.,
3.1
)
Motivation
religiöse Ziele/ Werte/Urteile/Haltungen
Einstellung
23
Verhalten
religiöse Rituale, Handeln
Lebenspraxis
Es gibt demnach nicht nur eine Form, sondern verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten von Religiosität. Religiosität kann als Erfahrung (siehe II., 1.1), Haltung, Empfindung, Wissen, Bewusstsein oder Motivation sowie unter den Gesichtspunkten der Erziehung und persönlichen Bedeutung Gegenstand von wissenschaftlichen Erforschungen sein.24 Aus den verschiedenen Ansätzen ragen insbesondere die Untersuchungen von Gordon W. Allport und Charles Y. Glock hervor.
2.2 Intrinsische/extrinsische Religiosität
Allport (1937/1979, 1950) fokussiert in seinem Modell „die motivationale Verankerung der Religiosität in der Persönlichkeit eines Menschen“ und postuliert erstmals zwei Formen religiöser Motivation, nämlich eine Unterscheidung von intrinsischer und extrinsischer Religiosität. Wie Huber (2003, S. 16) später zusammenfasst, basiere die intrinsische Religiosität „auf spezifisch religiösen Motiven, die gegenüber anderen, nicht religiösen Motiven funktionell autonom sind. Sie werde daher um ihrer selbst willen praktiziert, sie sei ein Selbstzweck. Demgegenüber basiere extrinsische Religiosität auf Motiven, die außerhalb der Religiosität liegen. Sie sei daher eher ein Mittel, um Zwecke zu erreichen, die außerhalb ihrer selbst liegen.“ Auf dieser Basis konstruieren Allport und Ross (1967) schließlich Skalen zur Messung von intrinsischer und extrinsischer religiöser Orientierungen.
Batson und Ventis (1982) fügten diesem Modell noch einen dritten Bereich hinzu, nämlich die „Religiosität als Suche“ (Quest). Wolfradt und Müller-Plath (2003, S. 169) schreiben hierzu: „Weitere Dimensionen wären religiöse Zweifel und existentielle Fragen, die durch Widersprüche und Tragödien des Lebens veranlasst werden (auch als ´Quest´ bekannt), Spiritualität und Transzendenz oder aber Formen alternativer Religiosität, wie Aberglauben und paranormale Überzeugungen.“ 25
2.3 Das multidimensionale Religiositätsmodell
Im Gegensatz zu den von Allport entwickelten Religiositätsskalen, die hauptsächlich bei religionspsychologischen Studien zum Einsatz kommen, wird das multidimensionale Religiositätsmodell von Glock eher bei religionssoziologischen Untersuchungen bevorzugt. (vgl. Huber, 2003, S. 16)
In dem Modell von Glock (1962, S. 98f.) werden fünf Dimensionen von Religiosität angenommen (vgl. Grom, 2007, S. 26f.; Unterrainer, 2010, S. 53; Huber, 2003, S. 92):
(1)
Wissen
(Intellekt, zentrale Aussagen des Glaubens);
(2)
Ideologie
(Glaubensdimension);
(3)
Ritual
(Gottesdienst, Praktiken, Gebet, Meditation);
(4)
Erfahrung
(Erleben religiöser Erfahrungen, Gotteserfahrungen);
(5)
Konsequenzen
(ethische Verpflichtungen, Belohnungen).
Die erste Dimension ist dem religiösen Wissen gewidmet. Die zweite Dimension „Ideologie“ beinhaltet Glaubensinhalte, welche sich in drei Kategorien unterteilen lassen (vgl. Jakobs, 2006, S. 125): (1) Behauptungen über die Existenz und Natur des göttlichen Wesens, (2) Ziel und Inhalt des göttlichen Wesens und (3) Erfüllung des göttlichen Willens. Die dritte Dimension bezieht sich auf die religiöse Praxis. Bei der vierten Dimension ist der Fokus sowohl auf das religiöse Erleben als auch auf die religiösen Empfindungen gerichtet. Die fünfte Dimension bezieht sich auf die Wirkungen eines religiösen Bekenntnisses.
2.4 Zentralität und Inhalt von Religiosität
Huber (2004, S. 80) gelingt es, die Ansätze von Allport und Glock weiterzuentwickeln und auf der Basis eines konstruktpsychologischen Ansatzes von George A. Kelly ein mehrdimensionales Strukturmodell der Religiosität zu erarbeiten.26 Dafür legt Huber (2011, S. 163) folgenden Religiositätsbegriff zu Grunde: „Ein Erleben und Verhalten ist immer dann ‚religiös‘, wenn in ihm ein Bezug zu einer transempirischen Ebene, die für das Subjekt den Charakter einer letztgültigen Instanz hat, hergestellt wird. Dieser Begriff ist bewusst sehr weit gefasst, dadurch beinhaltet er auch viele Phänomene, die teilweise unter dem Begriff Spiritualität diskutiert werden.“ Dabei ist es Huber (2011, S. 166) wichtig, „dass Religiosität nicht eindimensional ist, sondern in verschiedenen relativ autonomen Dimensionen zum Ausdruck kommt“.
Huber teilt die Glocksche Dimension ‚Ritual‘ in eine ‚öffentliche religiöse Praxis‘ sowie in eine ‚private religiöse Praxis‘ und fügt den restlichen Dimensionen „einen Index für die persönliche Bedeutung und Wichtigkeit (‚Zentralität‘) der jeweiligen Dimension“ hinzu. 27 (Utsch, 2005, S. 197) Die fünf Kerndimensionen der Religiosität konstituieren die allgemeinen Sozialformen des religiösen Erlebens und Verhaltens (Huber, 2011, S. 167). Die intellektuelle Dimension umfasst die religiöse Welt- und Selbstdeutung und „Antworten auf Grundfragen der menschlichen Existenz: Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich?“. (Huber, 2011, S. 168) Die Dimension der religiösen Ideologie soll anzeigen, wie stark der „Akt des Glaubens“ ausgeprägt ist. Die öffentliche religiöse Praxis gibt Auskunft darüber, ob der Transzendenzbezug in einer Gemeinschaft gesucht und vollzogen wird. Die private religiöse Praxis zeigt an, ob sich ein Individuum aktiv der Transzendenz, z. B. in Gebet und Meditation, zuwendet. Die religiöse Erfahrung stellt für Huber (2007) einen wesentlichen Faktor der Religiosität dar, da diese Dimension wesentlich auf die subjektiven Wahrnehmungsprozesse bezogen ist. „Die Frage nach der Ursache bzw. dem ‚objektiven‘ Korrelat dieser Wahrnehmung bleibt gemäß dem sozialwissenschaftlichen Prinzip vom Ausschluss der Transzendenz (Flournoy, 1903) ausgeklammert.“ (Huber, 2011, S. 172)
Auf dieser Basis präsentiert Huber (2004, S. 80) vier Kernpostulate zur Messung der Religiosität: „(1) Das Erleben und Verhalten eines Menschen wird durch persönliche Konstrukte und Konstruktsysteme gesteuert. (vgl. II., 3.1) (2) Die Stärke der erlebens- und verhaltenssteuernden Effekte eines religiösen Konstruktsystems hängt von seiner Zentralität in der Persönlichkeit eines Menschen ab. (3) Die Richtung der erlebens- und verhaltenssteuernden Effekte eines religiösen Konstruktsystems hängt von (alternativ konstruierbaren) Inhalten und Deutungsmustern ab, die in ihm wirksam sind. (4) Religiöses Erleben und Verhalten ist eine Funktion der Zentralität und der Inhalte religiöser Konstruktsysteme.“28 Der Zentralitätsfaktor umfasst dabei, unabhängig von den Inhalten des religiösen Glaubens, das Ausmaß von Religiosität (Effektstärke). (vgl. Unterrainer, 2010, S. 113)
Daraufhin postuliert Huber (2004, S. 89) vier Grundannahmen zur Zentralitätsskala:
„
Die fünf Dimensionen der Religiosität (Intellekt, Ideologie, öffentliche Praxis, private Praxis, Erfahrung; Anm. d. Verf.) bilden einen repräsentativen Querschnitt aller spezifisch religiösen Aktivierungsmöglichkeiten des religiösen Konstruktsystems ab.
Je öfter das religiöse Konstruktsystem aktiviert wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine zentrale Stellung in der Persönlichkeit eines Menschen einnimmt.
Mit der Zentralität des religiösen Konstruktsystems nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass dieses Konstruktsystem in der Konfiguration aller Konstruktsysteme einer Persönlichkeit funktionell autonom ist.
Mit der Wahrscheinlichkeit einer autonomen Funktionsweise des religiösen Konstruktsystems geht die Wahrscheinlichkeit einer intrinsischen religiösen Motivation einher.
“
Diese Grundannahmen werden von Huber (2004) zu einer Zentralitätsskala operationalisiert. Bisher hat er drei Versionen der Z-Skala mit zunächst 15 und in Folge dann mit 10 und schließlich 7 Indikatoren veröffentlicht. (Huber, 2004, 2007, 2008b) Bei den ersten Versionen wurden die fünf Kerndimensionen (Intellekt, Ideologie, öffentliche-, private Praxis, Erfahrung) mit jeweils zwei oder drei Items erfasst. Da aber diese beiden ersten Versionen der Z-Skala einen pantheistischen Zugang zum Religiösen vernachlässigt haben, entwirft Huber (2008b) eine dritte Z-Skala mit sieben Indikatoren, von denen aber nur fünf Items in die Berechnung des Skalenwerts eingehen. Die vierte (private Praxis) und fünfte Dimension (Erfahrung) enthalten nun sowohl eine theistische als auch eine pantheistische Fragestellung. Allerdings fließt nur das Item mit dem höheren Wert in die Berechnung des Zentralitätsscores. Die vorliegende Studie bedient sich der dritten Version der Zentralitätsskala mit 7 Indikatoren (Z-7). Huber (2008b, S. 7) fasst wie folgt zusammen:
Dimension
Item
1. Intellekt:
Wie oft denken Sie über religiöse Themen nach?
2. Ideologie:
Wie stark glauben Sie daran, dass es Gott oder etwas Göttliches gibt?
3. Öffentliche Praxis:
Wie häufig nehmen Sie an Gottesdiensten/ Synagogengottesdiensten /Gemeinschaftsgebeten / Tempelritualen / spirituellen Ritualen oder religiösen Handlungen teil?
4. Private Praxis:
Wie häufig beten Sie? Wie häufig meditieren Sie?
5. Erfahrung:
Wie oft erleben Sie Situationen, in denen Sie das Gefühl haben, dass Gott oder etwas Göttliches in Ihr Leben eingreift? Wie oft erleben Sie Situationen, in denen Sie das Gefühl haben, mit allem eins zu sein?
Punkte
Idealtyp
Konstruktsystem/ Verhaltenssteuernde Wirkung
Beschreibung
25-20
hoch religiös
autonom/hoch
religiöse Inhalte üben einen starken Einfluss auf andere psychische Systeme aus;
19-11
religiös
heteronom/mittelhoch
ein persönliches religiöses Konstruktsystem befindet sich in einer untergeordneten Position in der kognitiven Architektur der Persönlichkeit; dieses übt nur einen schwachen Einfluss auf andere psychische Systeme aus;
10-5
nicht religiös
untergeordnet/niedrig
Religiöse Inhalte, Praktiken und Erfahrungen kommen kaum vor und spielen in der Persönlichkeit sowie in den Erlebens- und Handlungsfeldern keine Rolle;
Je höher der Gesamtwert auf der Zentralitätsskala ist, desto mehr nimmt das religiöse Konstruktsystem eine zentrale Stellung in der Persönlichkeit ein. Huber (2003, S. 338) schreibt, dass diese Information auch für therapeutische Zwecke hilfreich sein kann. Denn „je zentraler das religiöse Konstruktsystem bei einem Klienten ist, desto stärker beeinflusst es sein Erleben und Verhalten. Insbesondere bei funktionell autonomen religiösen Konstruktsystemen kann die Religiosität - je nach Problemlage - entweder eine wichtige personale Ressource oder ein wesentlicher Bestandteil des zu bearbeitenden Problems darstellen.“ Huber (2008a) hat daher den „Religiositäts-Struktur-Test“ (RST)29 entwickelt, der auch für die klinische Diagnostik im Bereich der Religiosität und Gesundheit anwendbar ist. Hier wird - analog zu Glock - die Dimension ‚Konsequenzen der Religiosität im Alltag‘ eingeführt. Die Konsequenzen der Religiosität im Alltag umfassen „einen sehr breiten und heterogenen Phänomenbereich. Insbesondere gehört dazu auch ein religiös begründetes Erleben und Verhalten in Bezug auf Gesundheitsfragen sowie auf Krankheit und Lebenskrisen.“ (Huber, 2011, S. 179). Dadurch kann auch der Bereich des religiösen Copings (siehe II., 4.2) miterfasst werden.
2.5 Dimensionen von Spiritualität
Studenten der Universitäten Fribourg und Salzburg haben bei einer Studie (Bucher, 2007, S. 23f.) acht Dimensionen von Spiritualität ermittelt: (1) Übernatürliches und Transzendentes, (2) Esoterik - Okkultismus, (3) Spirituelle Praktiken, (4) Gefühle, speziell von Harmonie, (5) Glaube, (6) Philosophische Komponenten: Sinnfrage, (7) (Über-)sinnliche Erfahrungen, (8) Individuation. Laut Buchner (2007, S. 24) ist Spiritualität „individuell, stärker emotional und erfahrungsorientiert als kognitiv und lehrhaft.“
Buchner (2007, S. 47) liefert in seiner Übersichtsarbeit einen Überblick über quantitative Studien zum Thema ‚Spiritualität‘. Folgende Dimensionen sowie Konzepte zur Messung und Erfassung von Spiritualität können dabei von Buchner herauskristallisiert werden:
Spirituelle Transzendenz
Piedmont (1999; zit. nach Buchner, 2007, S. 48) beschreibt folgende Dimensionen: „(1) Universalität, (2) Verbundenheit, (3) Gebetserhöhung“;
Spirituelles Wohlbefinden
Paloutzian & Ellision (1982; zit. nach Buchner, 2007, S. 48) finden die Dimensionen: „(1) Existenzielles Wohlbefinden, (2) Religiöses Wohlbefinden“;
Gomez & Fischer (2003; zit. nach Buchner, 2007, S. 48) untersuchen die Dimensionen: „(1) Persönlicher Bereich, (2) Gemeinschaftlicher Bereich, (3) Umgebung, (4) Transzendenz“;
Daaleman & Freym (2004; zit. nach Buchner, 2007, S. 48) beschränken sich auf die Dimensionen: „(1) Selbstwirksamkeit, (2) Lebensschema“;
Religiös-Spirituelles (Wohl)Befinden
Unterrainer (2010b, S. 61) konstruiert eine Skala mit folgenden Dimensionen: „Hoffnung immanent, Vergeben, Erfahrung von Bedeutung und Sinn, Hoffnung transzendent, allgemeine Religiosität, Allverbundenheit“;
Humanistisch-phänomenologische Spiritualität
Elkins et al. (1988 zit.; nach Buchner, 2007, S. 48) stützen ihre Untersuchung auf die Dimensionen: „(1) Transzendenz, (2) Sinn und Zweckhaftigkeit, (3) Lebensmission, (4) Heiligkeit des Lebens, (5) Materielle Werte, (6) Altruismus, (7) Idealismus, (8) Bewusstsein für Tragik, (9) ‚Früchte‘ der Spiritualität“;
MacDonald (2000, S. 156ff.) fand in seiner Studie „fünf robuste Dimensionen von Spiritualität“: „Kognitive Orientierung gegenüber Spiritualität“ (Lebenssinn), „Erfahrung/phänomenologische Dimension“ (mystische und transpersonale Erfahrung, Transzendenz), „Existenzielles Wohlbefinden“, „Glaube an Übersinnliches“ und „intrinsische Religiosität“ (Glaube an Gott, religiös-kirchliche Praxis) (vgl. auch Büssing, 2006, S. 11; Bucher, 2007, S. 49; Unterrainer, 2010b, S. 50).
Johnson, Kristeller und Sheets (2004, zit. nach Buchner, 2007, S. 50) haben folgende empirische Konzeptualisierung von Spiritualität vorgelegt: „Spirituelles Wohlbefinden“, „Religiöse Bindung“, „Suche nach Sinn“, „Religiöser Stress“ (Strafe Gottes), „Zweifelnde Suche“ (quest).30
2.6 Komplementarität von Religiosität und Spiritualität
Einige Psychologen (Bell D´Davis, 2005, S. 109; Olinsky & Ronnestadt, 2005) beschreiben die Phänomene der Religiosität und Spiritualität als stark kontrastierende Gegensätze. Nach ausgiebiger Literaturrecherche des Autors zeichnet sich allerdings auch ein Bild ab, bei dem von einer Komplementarität (sich ergänzende, ausgleichende und überlappende Gegensätze) der Phänomene ausgegangen werden kann. So schreibt Unterrainer (2010, S. 17), „dass eine strikte Trennung von ‚Spiritualität‘ zu ‚Religion‘ und ‚Religiosität‘ nicht gelingen kann bzw. auch nicht wirklich attraktiv erscheint“. Auch Buchner (2007, S. 54) begreift Spiritualität und Religiosität nicht als krasses Gegensatzpaar, wenn er schreibt: „Eine Schnittmenge von Spiritualität und Religiosität ergibt sich, wenn sich Spiritualität auf dezidiert Religiöses oder Heiliges bezieht bzw. wenn Religiosität spirituelle Erlebnisqualitäten aufweist: Gefühle von Gottesnähe, Verbundenheit, Friede. Intrinsische Religiosität, um ihrer selbst willen oder für Gott vollzogen, ist spirituelle Erfahrung. Mitten im Alltag das Heilige zu suchen und zu bewahren - darin sehen zahlreiche Psychologen ein zentrales Anliegen von Spiritualität.“
Daraus ergibt sich nach Buchner (2007, S. 54; erw. vom Verf.) folgende differenzierte Sichtweise:
„
Religiosität als Spiritualität“
(intrinsisch; wird um ihrer selbst willen praktiziert),
„
Religiosität ohne Spiritualität“
(extrinsisch; eher Mittel zum Zweck),
„
Spiritualität ohne Religiosität“
(z. B. Ausübung von meditativen Praktiken, ohne den Bezug zu einer Religion; existentielle Sinnsuche, ohne seine eigene Existenz in Frage zu stellen und ohne einen auslösenden Zweifel dafür zu haben),
Religiosität und Spiritualität als zweifelnde Suche
(Quest; religiöser Zweifel; existentielle Fragen, die durch Tragödien oder Widersprüche, ausgelöst werden; Misstrauen gegen religiöse Institutionen; Aberglaube; paranormale Überzeugungen) sollte nach Meinung des Autors als Ergänzung mit hinzugenommen werden. (vgl. Batson & Ventis, 1982; Johnson, Kristeller und Sheets, 2004; siehe II., 2.1)
„
Nicht-religiös/nicht-spirituell“
.
Buchner (2007, S. 55) fasst diese Überlegungen folgendermaßen zusammen:
„So ist bei ‚Religiosität‘ zu prüfen, ob sie intrinsisch, um ihrer selbst willen ausgeübt wird oder extrinsisch, mit wenig oder keinem inneren Engagement, und ohne geistige, spirituelle Erlebnisqualitäten. Aber auch bei Spiritualität gilt es zu klären, ob ihre Elemente den großen religiösen Traditionen entstammen und auf das Heilige oder die Transzendenz bezogen sind oder ob ihre Elemente ausschließlich profan sind.“
Nun werfen allerdings Pargament (1999), Utsch (2005, 2011), Klein (2011) und Buchner (2007) noch die Frage auf, welches Phänomen als das grundlegendere anzusehen ist. Pargament (1999) und Klein (2011) beschreiben ‚Religiosität‘ als Oberbegriff, also grundlegendes Phänomen. Klein (2011, S. 39) kritisiert vor allem den Umstand, dass die als eine Suche nach existenzieller Bedeutung verstandene Spiritualität, „nicht mehr von solch grundlegenden Konzepten wie Weltanschauung, Weltbild/Weltsicht oder Lebenssinn“ zu unterscheiden sind.





























