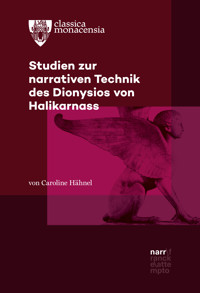
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Classica Monacensia
- Sprache: Deutsch
Die Studie bietet eine umfassende Analyse der lange Zeit unterschätzten und nur wenig untersuchten Darstellungsweise in den Antiquitates Romanae des Dionysios von Halikarnass. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf den Büchern zur Königszeit, in denen drei wesentliche erzählerische Merkmale besonders hervortreten: die Schaffung von enargeia, das heißt von Anschaulichkeit, die Verwendung von Reden und die Gestaltung von Frauenfiguren, welchen für die römische Frühgeschichte eine wichtige Rolle zugeschrieben wurde. Diese drei Charakteristika stehen in enger Wechselwirkung mit dem Ziel der kulturellen Vermittlung zwischen Griechen und Römern, das Dionysios sich mit seinem Geschichtswerk gesetzt hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 664
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Caroline Hähnel
Studien zur narrativen Technik des Dionysios von Halikarnass
Umschlagabbildung: Marmorsphinx als Basis. Neapel, Museo Nazionale, Inv. 6882. Guida Ruesch 1789. H: 91 cm INR 67. 23. 57. Su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
DOI: https://doi.org/10.24053/9783381120925
© 2024 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISSN 0941-4274
ISBN 978-3-381-12091-8 (Print)
ISBN 978-3-381-12093-2 (ePub)
Inhalt
Danksagung
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um die geringfügig überarbeitete und mit Indizes versehene Fassung meiner Dissertation, welche im Wintersemester 2022/23 an der Ludwig-Maximilians-Universität München eingereicht wurde.
Ihre Entstehung verdankt sich gewissermaßen einer Leerstelle. Als ich mich mit der Frage beschäftigte, in welcher Weise römische und griechische Autoren des ersten Jahrhunderts vor Christus von der Gründung Roms erzählen, begegnete mir immer wieder Dionysios von Halikarnass, doch als ich mehr über die Erzähltechnik dieses so produktiven Autors erfahren wollte, stellte ich fest, dass die Forschung das Thema über lange Zeit eher mit spärlichem Interesse bedacht hatte.
Damit war meine Neugierde geweckt, zumal Dionysios mit seinem Geschichtswerk ein nicht minder ehrgeiziges Ziel verfolgte als sein römischer Zeitgenosse LiviusLivius, nämlich den Griechen in augusteischer Zeit Aufstieg und Wesen der neuen Weltmacht Rom zu erklären und ihnen ein historisch begründetes Deutungsmuster für die politischen Gegebenheiten der Gegenwart an die Hand zu geben.
Dafür, dass meine Gedanken zur Erzählkunst dieses Historikers nun in der vorliegenden Form einem breiteren Publikum zugänglich sind, möchte ich mehreren Personen danken:
So hat mein Doktorvater Professor Dr. Martin Hose das Werden dieser Studie mit stetem Engagement und Wohlwollen begleitet. Seiner profunden Kenntnis der geistigen Welt des ersten vorchristlichen Jahrhunderts verdanke ich zahlreiche wertvolle Hinweise. Zusammen mit seiner Mitherausgeberin Professor Dr. Claudia Wiener sorgte er für eine zügige Aufnahme meiner Arbeit in die Reihe „Classica Monacensia“.
Mein Dank gilt ebenso Professor Dr. Dennis Pausch für die Übernahme des Zweitgutachtens und für das Interesse, das er meinen Überlegungen zur Erzähltechnik des Dionysios von Halikarnass bereits in einem sehr frühen Stadium entgegenbrachte, sowie Professor Dr. Therese Fuhrer als weiterem Mitglied der Prüfungskommission.
Brigitte Weber war stets eine inspirierende Gesprächspartnerin und verständnisvolle Freundin. Ohne sie gäbe es dieses Buch nicht.
Den größten Dank jedoch schulde ich meiner Familie, insbesondere meinem Mann Felix Mundt und meinen Eltern, für nie versiegende Geduld und stetigen Ansporn.
Perleberg, im August 2024
1Einleitung
In der stark auf Fragen der Identität und Schaffung von Memoria ausgerichteten römischen Kultur1 wurden die Ursprünge und die Frühgeschichte der Stadt Rom in der Literatur immer wieder thematisiert. Erzählungen von Stadtgründungen und Gründern spielten bereits in der griechischen Polisgesellschaft, aber auch bis weit in die hellenistische Zeit hinein eine tragende Rolle bei der Konstruktion von Identitäten, sei es individueller, sei es kollektiver Identität.2 Als literarische Medien dienen hierfür gleichermaßen poetische Texte wie Prosaerzählungen. Zwar sind die griechischen Gründungsepen bis auf wenige Fragmente verloren, doch lassen selbst diese erahnen, welch große Rolle die Frühgeschichte und ihre Mythen in der hellenistischen Literatur der beiden letzten vorchristlichen Jahrhunderte spielten. Der Einfluss, den diese Produktionen auf römische Dichter wie Ennius und Vergil ausgeübt haben, ist in immerhin groben Zügen erfassbar.3
In augusteischer Zeit gewinnt der Diskurs über die Anfänge Roms in sämtlichen Medien der kollektiven Erinnerung an Intensität.4 Wenngleich der princeps inter pares AugustusAugustus seine Vormachtstellung geschickt hinter republikanischer Nomenklatur zu kaschieren wusste und den Übergang zur Alleinherrschaft als Restauration der res publica libera deklarierte, sahen sich die Literaten dieser Zeit dennoch mit den Fragen konfrontiert, ob nicht der Staat sich in eine Monarchie transformiere und wie dies sich zu Roms Anfängen verhalte.5 In den historiographischen und poetischen Texten jener Epoche verbinden sich mit dem Rückgriff auf die römische Frühzeit verschiedene Zielstellungen, wie etwa die Konstruktion von Legitimität für den augusteischen Prinzipat und eine möglichst bruchlose, Stabilität suggerierende Transformation der kollektiven Identität der Römer in einer sich wandelnden Verfassung. Das aitiologische Moment kann dabei als gemeinsamer Nenner dieser Texte im Umgang mit der Frühzeit angesehen werden.6 Wie die Forschung der letzten Jahre zeigen konnte, beschäftigten diese Themen nicht nur römische Autoren. Neben der lateinischen entstand eine reiche griechischsprachige Literatur.7 Unter Augustus fanden zahlreiche griechische Intellektuelle den Weg nach Rom, das inzwischen nicht nur auf politischer, sondern auch auf der kulturellen Ebene eine Vorrangstellung vor den traditionsreichen Zentren der griechischen Welt wie Athen und Alexandria eingenommen hatte und Bedingungen für literarisches Schaffen bot, die vielen Denkern ideal erscheinen mochten.
Unter den in Rom entstandenen griechischen Texten nehmen die Antiquitates Romanae des Dionysios von Halikarnass heute eine Sonderstellung ein, da sie die einzige zu großen Teilen erhaltene Darstellung der römischen Geschichte aus der Sicht eines in augusteischer Zeit schreibenden Griechen sind. Daher mag es erstaunlich scheinen, dass sie in der Forschung vergleichsweise wenig Beachtung fanden und die rhetorischen Schriften des Dionysios stets stärker im Fokus der Aufmerksamkeit standen. Zurückzuführen ist dies auf die negative Beurteilung, die Dionysios in der älteren Forschung meist zuteil wurde; man warf ihm vor, kein ernst zu nehmender Historiker und, dies vor allem, in der Darstellungsweise zu sehr von Maßgaben der Rhetorik beeinflusst zu sein. Gegenüber dem vernichtenden Verdikt so einflussreicher Altertumswissenschaftler wie Eduard Schwartz, Maximilien Egger und Eduard Norden vermochten sich positivere Stimmen nicht durchzusetzen. Dionysios trug fortan das Stigma, als Historiker, von dem man nach den Maßstäben des 19. Jahrhunderts eine sachlich-objektive Darstellung erwartete, zu viel rhetorischen Schmuck verwendet zu haben. Es kam erschwerend hinzu, dass er als Verfasser zahlreicher theoretischer Schriften zu Rhetorik und Geschichtsschreibung in besonderem Maße um die Bedeutung der Darstellungsweise für die Wirkung auf den Rezipienten wusste, weshalb man ihm gern vorwarf, als Historiker lediglich auf das Erwecken von Affekten des Lesers abzuzielen. Die Forschung beließ es in der Folge bei diesem Negativurteil, eine weitergehende Analyse erfolgte nicht. Wurden die Antiquitates Romanae herangezogen, so in der Regel zu quellenkritischen Fragestellungen. Eine angemessene Würdigung des literarischen Aspekts des Werkes steht bislang noch aus.
Die lange Zeit überwiegende Fokussierung auf den Text als Mittel zur Rekonstruktion der römischen Frühzeit teilt Dionysios zwar mit seinem lateinischen Gegenpart, dem Geschichtswerk des LiviusLivius, jedoch hat im Falle des Livius die Forschung seit Beginn des 20. Jahrhunderts zunehmend dessen Bedeutung als Erzähler erkannt und hervorgehoben. Zu nennen sind hier vor allem die Arbeiten von Erich Burck8 und Patrick G. Walsh9 sowie James T. Luce10 und jüngst Dennis Pausch,11 die die Darstellungstechnik des Livius als kunstvoll eingesetztes Mittel analysieren, dem Rezipienten seine, Liviusʼ, Version der römischen Frühgeschichte nahezubringen. Eine vergleichbar umfassende Untersuchung der Antiquitates des Dionysios ist nach wie vor ein Desiderat, wenngleich sich in der jüngsten Forschung Ansätze zeigen, einzelne Episoden mit Blick auf ihre erzählerische Gestaltung zu interpretieren.12
Vor diesem Hintergrund möchte die vorliegende Studie die Aufmerksamkeit auf den literarischen Aspekt der Antiquitates Romanae richten, zumal die antike Historiographie eine Trennung zwischen „wissenschaftlicher“ und „literarischer“ Geschichtsschreibung nicht kannte:13 Dionysios ist wie LiviusLivius, HerodotHerodot, ThukydidesThukydides und andere kein bloßer Vermittler historischer Fakten (insoweit man von solchen sprechen kann), sondern ein Erzähler, der bei der Vermittlung seines Stoffes ein bestimmtes Argumentationsziel verfolgt,14 wobei dieses Argumentationsziel entscheidende Unterstützung durch die Art und Weise erhält, wie der Stoff erzählt wird. Die antike Geschichtsschreibung präsentiert ihre Materie bewusst unter Einsatz spezifischer literarischer Darstellungsformen, die jeweils unterschiedliche oder komplementäre Wirkungen auf den Rezipienten ausüben und häufig auf dessen stärkere Involvierung in das erzählte Geschehen abzielen. So setzt Livius gezielt literarische Techniken und Darstellungsformen wie etwa Reden, Fokalisierungen, Perspektivenwechsel und Anachronismen ein, um mit dem Leser in Interaktion zu treten.15 Es gilt zu untersuchen, inwieweit sich eine solche Vorgehensweise auch im Geschichtswerk des Dionysios von Halikarnass aufzeigen lässt. Bekanntlich verfolgte er mit der Abfassung der Antiquitates Romanae das Ziel, einem griechischsprachigen Publikum den ersten ausführlichen Bericht über die Geschichte und den Aufstieg der Römer und eine Erklärung zu bieten, wie es dazu kommen konnte, dass diese sich innerhalb nur weniger Jahrhunderte zur beherrschenden Macht im Mittelmeerraum entwickelten.16 Die Antiquitates Romanae beinhalten das Programm, der griechischsprachigen Welt unter AugustusAugustus die römische Fremdherrschaft erträglicher zu machen.17 Dazu gehört die These, dass von einer Fremdherrschaft im Grunde gar keine Rede sein könne, da die Römer einerseits von ihrem ethnischen Ursprung her griechisch seien und andererseits in ethisch-moralischer Hinsicht ebenfalls als Griechen gälten.18 Dieses Anliegen der kulturellen Vermittlung nähert den Text den Historien des PolybiosPolybios an; im Gegensatz zu diesen setzen die Antiquitates allerdings in hohem Maße auf die Verwendung bestimmter erzählerischer Mittel, um diese Vermittlung erfolgreich zu vollziehen.19
Es dürfte zu einem tieferen Verständnis des Historiographen Dionysios beitragen, die Beziehung zwischen seinem Argumentationsziel und den dafür eingesetzten literarischen Strategien zu analysieren und ihn auf diese Weise auch wieder stärker als Erzähler in das Bewusstsein der Forschung zu rücken. Dabei kann es nicht darum gehen, in Fortsetzung der älteren Forschungsmeinung den Nachweis zu erbringen, dass Dionysios in seinem Geschichtswerk zu viele rhetorische Stilmittel eingesetzt und dadurch womöglich die Geschichte verfremdet habe: Vielmehr möchte ich eine vorurteilsfreie literarische Analyse des Werkes vorlegen.20 Hierfür ist danach zu fragen, inwieweit sich bei Dionysios wiederkehrende Elemente der Darstellungstechnik aufzeigen lassen, die er sich seinem Anliegen entsprechend zunutze macht und die ihn als Erzähler zu charakterisieren geeignet sind.21
Da die Schilderung der römischen Gründungs- und Frühgeschichte bis zum Beginn der Republik, die Bücher 1 bis 4,22 zur Verhandlung der für Dionysios zentralen Identitätsfrage der Römer besonders bedeutsam ist,23 erweist sie sich für eine Untersuchung seiner Erzählweise mit Blick auf Leserlenkung und Aussageabsicht als besonders geeignet, zumal die Darstellung der Königszeit nicht nur bei ihm, sondern auch bei seinem lateinischen Gegenpart LiviusLivius zusammenhängend erhalten ist und dies einen stellenweisen Vergleich mit diesem begünstigt. Hierbei soll nicht in wertender Manier eine Beurteilung der schriftstellerischen Leistung des einen oder anderen der beiden Autoren vorgenommen werden, vielmehr eignet sich das Geschichtswerk des Livius als Kontrastfolie, um die Eigenart des Erzählers Dionysios schärfer zu umreißen.
Die Arbeit konzentriert sich auf drei Aspekte, die nicht nur als wesentliche Charakteristika der Erzählweise in diesen Büchern anzusehen sind, sondern darüber hinaus eine zentrale Rolle für die Geschichtsdeutung des Dionysios spielen und eng mit dem Unternehmen des Kulturtransfers verbunden sind, das er sich zum Ziel gesetzt hat. Es handelt sich um
die Verwendung narrativer Techniken zur Erzeugung von enargeia,
den Einsatz von Reden,
die Gestaltung weiblicher Figuren, denen für die Deutung der römischen Geschichte bei Dionysios eine wichtige Rolle zukommt.
In den Antiquitates Romanae finden sich nur wenige methodische Überlegungen von der Art, wie andere Historiker sie entweder in eigens dafür eingefügten Methodenkapiteln (wie ThukydidesThukydides) oder als wiederkehrende Kommentare in die Darstellung integriert haben. Zwar beinhalten die einleitenden Kapitel der Antiquitates derartige Reflexionen, doch handelt es sich hierbei nahezu ausschließlich um die üblichen Topoi, die in den praefationes antiker Geschichtswerke abgearbeitet zu werden pflegen.24 Daher sind wir für Informationen, die die Auffassung des Dionysios von Geschichtsschreibung betreffen, weitgehend auf die Auswertung dessen angewiesen, was er in seinen literaturkritischen Schriften zu diesem Thema zu sagen hat. Eine zusammenhängende Theorie fehlt freilich auch hier: Bei den relevanten Äußerungen handelt es sich um verstreute Aussagen, die zumeist im Rahmen der Kritik eines bestimmten Historikers gemacht werden, wie im Falle des Vergleichs zwischen HerodotHerodot und Thukydides.25 Dessen ungeachtet kommt eine Untersuchung der Erzähltechnik des Dionysios nicht umhin, die Scripta rhetorica zu berücksichtigen, da dessen theoretisches und praktisches literarisches Schaffen eng miteinander verwoben sind.
Daher werden im Hinblick auf die Generierung von enargeia und die damit einhergehende Involvierung des Rezipienten zunächst die theoretischen Überlegungen, die Dionysios in seinen Scripta rhetorica zu diesem Thema vornimmt, in Bezug zu anderen antiken Theorien der enargeia gesetzt. Vor diesem Hintergrund wird sodann die praktische Umsetzung anhand ausgewählter Passagen aus den Königszeitbüchern beleuchtet. Ebenso soll die Verwendung von Reden in den Antiquitates Romanae sowohl in der Praxis analysiert als auch in den weiteren Kontext der Funktionen von Rede in der griechisch-römischen Historiographie und der theoretischen Äußerungen des Dionysios eingeordnet werden. Was die Darstellung von Frauenfiguren anbelangt, so ist eine solche Vorgehensweise aufgrund des Fehlens eines antiken Diskurses über deren Rolle in der Geschichtsschreibung nicht möglich. Vielmehr erfolgt die Untersuchung unter Einbeziehung der Fragestellung, inwieweit Dionysios Aspekte weiblicher Lebenswirklichkeit in die Gestaltung seiner Frauenfiguren einfließen lässt, und stellt zudem die Darstellung des LiviusLivius vergleichend gegenüber. Dieses Kapitel bildet insofern den Hauptpunkt der Untersuchung, als in den Portraits von Frauen wie TulliaTullia oder LucretiaLucretia die bereits zuvor beleuchteten Mittel der enargeia und der Rede gebündelt auftreten und der Text hier gleichsam alle Register seiner Kunst zieht. Es erschien somit folgerichtig, das Kapitel an das Ende des Hauptteils zu stellen. Für die einzelnen Kapitel wurden grundsätzlich Textabschnitte ausgewählt, in denen das jeweilige erzählerische Mittel in besonders augenfälliger Weise hervortritt. Zwar bauen die drei Hauptabschnitte aufeinander auf und können somit linear gelesen werden, doch stellen sie zugleich in sich geschlossene Abschnitte dar und ermöglichen durch jeweils erneut vorgenommene Kontextualisierungen der besprochenen Textpassagen auch eine separate Lektüre.
Wie zu zeigen sein wird, stehen die drei genannten Komponenten der Erzählweise des Dionysios in engster Interaktion mit der Intention des Geschichtswerkes und leisten einen entscheidenden Beitrag zur Kommunikation zwischen Autor und Leser. Daher kann eine auf den literarischen Aspekt der Antiquitates Romanae ausgerichtete Untersuchung wie die vorliegende nicht nur Licht werfen auf die spezifische Erzählweise des Dionysios, sondern dient auch der Erhellung seines Anliegens eines kulturellen Transfers zwischen Griechenland und Rom.
Ich hoffe daher, durch die skizzierte Untersuchung der Antiquitates Romanae des Dionysios von Halikarnass einen Beitrag zu dessen Wahrnehmung als Erzähler zu leisten und den Blick zu öffnen für eine andere Sichtweise auf sein allzu oft unterschätztes Unterfangen, die Geschichte der Römer neu zu deuten.
Zur weiteren Verdeutlichung dieses Zieles soll im Folgenden zunächst ein Blick auf die bisherige Forschung zu Dionysios im Allgemeinen und seinem Geschichtswerk im Besonderen geworfen werden (Kapitel 2). Daran schließt sich eine Einordnung des Dionysios in den soziokulturellen Kontext seiner Zeit an, da die Antiquitates Romanae mit diesem in enger Wechselwirkung stehen (Kapitel 3): Sie stellen wie andere antike Geschichtswerke, etwa des ThukydidesThukydides und des PolybiosPolybios, aber auch des LiviusLivius und des TacitusTacitus, um nur wenige Beispiele zu nennen, eine Reaktion auf eine spezifische historische Situation dar und versuchen, die sie umgebende Gegenwart ihrerseits zu gestalten. Die drei Hauptkapitel (4–6) sind den genannten Charakteristika der Erzählweise des Dionysios gewidmet. Auf sie folgt eine knappe Zusammenfassung der Ergebnisse, die meine Untersuchung hervorgebracht hat (Kapitel 7).
2Zur Forschungsgeschichte
Bei der Beschäftigung mit Dionysios fällt zunächst auf, welch geringe Aufmerksamkeit ihm von Seiten der philologischen Forschung über die Jahrhunderte zuteilgeworden ist, zumal wenn man die Anzahl der Studien mit denen zu anderen griechischen Historikern wie etwa HerodotHerodot und ThukydidesThukydides vergleicht. Zudem wurde überwiegend eine scharfe Trennung vorgenommen zwischen dem Historiker Dionysios und dem Literaturtheoretiker Dionysios, obgleich die Antiquitates Romanae und die Scripta rhetorica aufs Engste miteinander verknüpft sind und eine separate Interpretation somit stets unvollständig bleibt.1 Doch nicht nur das Geschichtswerk stand im Schatten von Autoren, die man als bedeutender empfand, auch die Auseinandersetzung mit seinen literaturkritisch-rhetorischen Schriften war lange Zeit wenig umfassend und kann sich in keiner Weise mit der Erschließung beispielweise der ciceronischen Schriften zur Rhetorik messen, was umso erstaunlicher anmutet, als wir Dionysios das umfangreichste Corpus zu stilistisch-rhetorischen Fragestellungen aus der gesamten griechisch-römischen Antike verdanken.2 Zudem bietet sein Werk einen einzigartigen Zugang zum Verständnis des in der augusteischen Zeit vorherrschenden Klassizismus-Diskurses, an dem sich sowohl griechische Intellektuelle in Rom als auch römische Denker beteiligten. Diese Einsicht hat sich in den vergangenen Jahrzehnten allmählich durchzusetzen vermocht,3 nachdem Dionysios zumeist unterschätzt und verkannt wurde, in seinen Abhandlungen zur Literatur und Rhetorik als unorigineller Kompilator und in seinem Geschichtswerk als langatmiger Erzähler galt, dem mehr an rhetorischer Effekthascherei als an Wahrheit und Aussage gelegen habe.
Im 19. und bis hinein ins frühe 20. Jahrhundert war sein Name innerhalb der Altertumswissenschaften vergleichsweise geläufig, seine Schriften dienten mitunter als Gegenstand philologischer Inaugural-Dissertationen, welche sich bisweilen mit Spezialfragen befassten,4 bisweilen auch lediglich eine Aufarbeitung und Darlegung aller eruierbarer Fakten über Leben und Werk darstellten.5
Eine wichtige Grundlage für die spätere Dionysios-Forschung schufen Ludwig Radermacher und Hermann Usener mit der mehrbändigen Teubner-Edition der Scripta rhetorica, die von 1899 bis 1929 publiziert wurde und deren Praefatio erstmalig eine ausführliche Darstellung der handschriftlichen Überlieferung beinhaltet. Ihnen vorangegangen war bereits Karl Jacoby mit seiner Teubneriana der Antiquitates Romanae, deren Bände zwischen 1885 und 1905 erschienen.
Gleichwohl war der Anteil an wissenschaftlicher Auseinandersetzung, der auf seine Texte entfiel, im Vergleich mit anderen Autoren eher gering und sein Ansehen nicht größer, wie in den 1830er Jahren ein Candidat aus Frankfurt am Main bezeugt: „Optimo jure miretur aliquis, quid sit quod, quum omnes fere alii, quos Romana Graecave tulit antiquitas scriptores, nostro tempore diligentissimos doctissimosque interpretes et quasi tutores nacti sint, unus Dionysius Halicarnassensis quinquaginta abhinc aut etiam plures annos fere prorsus contemtus jaceat atque abjectus.“6 Hauptuntersuchungsgegenstand waren bereits zum damaligen Zeitpunkt die literaturkritisch-rhetorischen Schriften, die Antiquitates Romanae betrachtete man überwiegend als bloßes Anhängsel dieser Texte, etwas, das Dionysios eben „auch noch“ geschrieben habe, das aber nicht weiter ernst zu nehmen sei und hinter den Scripta rhetorica an Bedeutung weit zurückstehe.7
Waren somit bis zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert noch vereinzelte Studien zu Dionysios erschienen, so begann die Auseinandersetzung ab dem frühen 20. Jahrhundert drastisch zu erlahmen und, so sie überhaupt stattfand, in polemischer und zum Teil sehr emotionaler Weise geführt zu werden. Hierfür ist der Grund hauptsächlich in dem vernichtenden Artikel aus der Feder Eduard Schwartzʼ für die Pauly-Wissowa’sche Realencyclopädie der classischen Alterthumswissenschaften zu suchen, welcher im Jahre 1903 publiziert wurde und dessen negatives Urteil über den Historiker für die Dionysios-Rezeption der folgenden Jahrzehnte verderblich wurde.8 Dionysios wird darin in allen denkbaren Aspekten abgekanzelt;9 Hauptkritikpunkt der Antiquitates ist ihre als allzu groß empfundene Nähe zur Rhetorik.10 Für den deutschen Gelehrten stellen sie nichts dar als die unwürdige Fingerübung eines emotionslosen Dilettanten an einem an und für sich erhabenen Gegenstand: „Die überaus klägliche Ausführung des Gedankens einer griechisch-römischen οἰκουμένη, der von PolybiosPolybios und PoseidoniosPoseidonios imposant in die Geschichtsschreibung eingeführt war, verrät, dass D. ausgewittert hatte, wohin der Classicismus der neuen Monarchie lief, und ohne Selbständigkeit den Tendenzen folgte, die zu seiner Zeit Gemeingut waren; die tragischen Schmerzen, die jenen echten Hellenen das Begreifen des römischen Primats gekostet hatte, sind dieser kleinen Seele fremd.“11 Der Klassizismus des Dionysios steht für eine Geschichtsschreibung, die lediglich dazu dient, den Rezipienten mit rhetorischen Effekten zu beeindrucken; wirklich große Geschichtsschreibung, so Schwartzʼ Sichtweise, kann nur in Zeiten bedeutender politischer Ereignisse entstehen, wie etwa das Beispiel des ThukydidesThukydides zeige.12
Nahezu zeitgleich mit Schwartzʼ RE-Artikel erschien die Abhandlung des französischen Gräzisten Maximilien Egger. Dieser unternahm darin den Versuch, das literaturkritisch-rhetorische Corpus des Dionysios in seiner Zeit und seinem kulturellen Milieu zu verorten und in Einzelanalysen die intellektuelle Leistung des Dionysios herauszuarbeiten. Egger wollte eine Gesamteinschätzung der Werke nach ihrer (von ihm definierten) Qualität und Bedeutung geben und spart hierbei nicht mit Kritik, ja die Vorgehensweise ist vielmehr die gleiche wie in den Scripta rhetorica des Dionysios selbst, etwa in De Thucydide. Eggers gesamte Abhandlung zeigt sich durchzogen von (oft ab-)wertenden Urteilen über die angeblich positiven und negativen Merkmale der untersuchten Texte, wie besonders im neunten Kapitel mit der Titulierung „Denys artiste et écrivain dans ses œuvres littéraires“13 deutlich wird, dessen Unterkapitel, „Ses défauts“ überschrieben, eine Aufzählung sämtlicher, hauptsächlich kompositionstechnischer und stilistischer, „Fehlgriffe“ des Dionysios bietet. Bereits das Vorwort zu Eggers Studie beginnt mit dem berühmten Zitat von Émile Faguet: „Nous avons perdu Ménandre et nous jouissons de Denys d’Halicarnasse. Car, ne cherchons pas à nous dissimuler cette infortune: nous possédons Denys d’Halicarnasse”,14 dessen Ansicht Egger zu Beginn seiner Beschäftigung mit Dionysios durchaus geteilt habe. Auch er unterscheidet zwischen dem literaturkritischen und dem historiographischen Schaffen des Dionysios. Im Zentrum seiner Untersuchung stehen denn auch die Scripta rhetorica: „C’est elle [sc. der literaturkritisch-rhetorische Teil des Gesamtwerkes] qui mérite le plus d’attention, car elle est la plus originale.“15 Als Literaturkritiker verdiene Dionysios immerhin – trotz so mancher Unzulänglichkeiten16 – durchaus Beachtung; jedoch das Geschichtswerk, von Egger kurz gestreift, sei ein von Anbeginn verfehltes Unterfangen, an dem er sich schlicht überhoben und seine intellektuellen Kapazitäten überschätzt habe. Bezeichnenderweise wird, ähnlich wie bei Schwartz, in erster Linie der erzählende Charakter der Antiquitates kritisiert und ihr mangelnder Quellenwert hervorgehoben: „Reste l’historien. Il est difficile de ne pas l’estimer très inférieur au critique littéraire, car aucun n’a poussé plus loin la mise en pratique de cette idée fausse, commune à presque toute l’antiquité, qu’un livre d’histoire est une œuvre d’art destinée à plaire plus qu’à instruire.“17 Die Antiquitates seien im Grunde eine Zumutung für jeden Rezipienten: „Enfin, l’élégance et la prolixité de son style sont si monotones, sa rhétorique, cette rhétorique où Michelet voyait « l’avant-goût de l’imbécillité byzantine », est si encombrante et si vide que l’Histoire primitive de Rome, malgré les bonnes intentions et le labeur immense dont elle témoigne, reste à peu près illisible même pour les lecteurs les plus intrépides.“18
Derart abwertende Einschätzungen der griechisch-römischen Geschichtsschreibung gehen zurück auf die positivistischen Voraussetzungen der im 19. Jahrhundert vorherrschenden Annahme, was ein historisches Werk zu wollen und zu leisten habe. In der philologischen Forschung bestand überwiegend noch kein geschärftes Bewusstsein dafür, dass die antike Historiographie weitgehend anderen Prämissen folgt als die moderne, für ihren „ambivalente[n] Status zwischen Wissenschaft und Literatur“.19 Hiermit war der Weg vorgezeichnet, den die Dionysios-Forschung in den nachfolgenden Jahrzehnten nehmen sollte.20 Zwar fanden die literaturkritisch-rhetorischen Schriften eine etwas geneigtere Beurteilung, da zumindest ihre Bedeutung als herausragende Quelle für den Attizismus des ersten Jahrhunderts v. Chr. anerkannt wurde. Im Hinblick auf die Antiquitates Romanae allerdings, von Dionysios selbst wohl als sein Hauptwerk konzipiert und empfunden,21 übernahm man kurzerhand das Pauschalurteil so namhafter Gelehrter wie Schwartz und Egger, demgegenüber sich vereinzelte Versuche einer positiveren Beurteilung nicht behaupten konnten.22 Die Hauptangriffspunkte waren, wie gezeigt, der historische Quellenwert und – dies in erster Linie – die Darstellungsweise des Dionysios. Die Antiquitates galten als Musterbeispiel einer seelen- und aussagelosen Geschichtsschreibung, welche ihren Stoff im Gewand leerer und unselbständiger Rhetorik präsentiere und den Leser keineswegs zu fesseln vermöge, sondern lediglich langweile und ermüde. So war das Geschichtswerk innerhalb der Altertumswissenschaften zumeist lediglich für die Althistoriker von rein inhaltlichem Interesse, die die Antiquitates Romanae denn auch hin und wieder als Quelle heranziehen.23
Erst über drei Jahrzehnte nach Eggers Studie erschien – bezeichnenderweise im angelsächsischen Raum – eine weitere umfassende Monographie über die Scripta rhetorica des Dionysios, vorgelegt von Stanley Frederick Bonner.24 Das Ziel der Arbeit bestand wie im Falle Eggers in einer Aufarbeitung sämtlicher literaturkritisch-rhetorischer Schriften, jedoch versuchte Bonner, zu einem ausgewogenen Urteil zu gelangen, indem er zwar einerseits so manche Eigenheit des Dionysios durchaus zur Kenntnis nahm, andererseits allerdings den unbestreitbaren Wert und die Komplexität des klassizistischen Programms erkannte, die die Scripta rhetorica unter den Augen des Lesers entfalten.25 Die Schriften werden wie im Falle des Corpus Platonicum in eine frühe, mittlere und späte Phase untergliedert26 und im Hinblick auf die in ihnen entwickelte kritische Methode eingehend analysiert, wobei besonderes Augenmerk auf der Bedeutung des Mimesis-Konzepts für den Klassizismus des Dionysios liegt.
Der eigentliche Wendepunkt in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Schriften des Dionysios ist mit den Arbeiten Emilio Gabbas anzusetzen, der in den 1960er Jahren das Terrain für eine sachlich orientierte Herangehensweise vorzubereiten begann und sich zudem nicht der Scheidung von literaturkritisch-rhetorischem und historiographischem Werk anschloss, sondern gerade die Untrennbarkeit dieser beiden Facetten des Schaffens des Dionysios herausstellte. Neben zahlreichen Aufsätzen27 ist es insbesondere seine im Jahr 1991 erschienene Monographie über die Antiquitates Romanae, welcher die Dionysios-Forschung – sie im Allgemeinen und die Beschäftigung mit dessen Geschichtswerk im Besonderen – ihre Neuorientierung zu verdanken hat.28 Darin beleuchtet Gabba die Antiquitates aus verschiedenen Perspektiven; er untersucht ihre Bedeutung, zumal in politischer Hinsicht, für die Zeit und das Umfeld, in dem sie entstanden sind, als Gegengewicht zu einer offenbar in der griechischen Welt verbreiteten anti-römischen Haltung. Die These von Rom als eigentlich griechischer Polis, die den Kern der Antiquitates darstellt, wird von Gabba keineswegs als opportunistische Anbiederung des Dionysios an die neue Weltmacht Rom interpretiert, sondern vielmehr als Ausdruck einer gemeinsamen kulturellen Identität.29 Darüber hinaus wird das von Dionysios vertretene Konzept des Attizismus herausgearbeitet und in Bezug gesetzt zu dem in der frühen Kaiserzeit in sämtlichen Medien dominierenden Klassizismus. Gabba zieht ferner Verbindungslinien zwischen Dionysios und den römischen Antiquaren, wie er überhaupt dessen historische Methode gezielt analysiert und zeitlich einordnet und somit einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis von Entstehung und Wirkungsabsicht der Antiquitates leistet.
Der vergleichsweise geringe Bekanntheitsgrad der Antiquitates Romanae und ihre Vernachlässigung durch die wissenschaftliche Forschung mag zum Teil auch – zumindest was den deutschen Sprachraum anbelangt – auf den Umstand zurückzuführen sein, dass lange Zeit keine deutsche Übersetzung verfügbar war, welche modernen Anforderungen genügte.30 Zwar existierten zwei Übersetzungen ins Deutsche, jedoch veraltet, stammen sie doch aus dem 18. bzw. 19. Jahrhundert31 und waren noch in den 1990er Jahren für denjenigen, der sich mit Dionysios beschäftigen wollte, in der Praxis nur schwer konsultierbar, da in kaum einer philologischen Bibliothek im Bestand.32
Allerdings sind inzwischen zwei neue Übersetzungen hinzugekommen.33 Dies ist als Ausdruck der mittlerweile veränderten Sichtweise auf Dionysios zu werten. So kann man in den letzten drei bis vier Jahrzehnten von einer regelrechten Dionysios-Renaissance sprechen; die Zahl der Publikationen ist inzwischen erheblich angestiegen. Dies trifft vor allem für die Scripta rhetorica zu, aber auch grundsätzlich für die Antiquitates Romanae. Gleichwohl scheint die Unterscheidung zwischen literaturkritisch-rhetorischem und historiographischem Werk nach wie vor die Regel zu sein und ist auch die neuere Literatur zu Dionysios überwiegend durch die Auseinandersetzung mit den rhetorischen Schriften charakterisiert.
Obgleich bereits die frühen Arbeiten Gabbas einen neuen Weg zur Beurteilung des Dionysios von Halikarnass beschritten, ist die wirklich intensive Wiederbelebung der Dionysios-Erforschung und der Richtungswechsel hin zu einer weniger vorurteilsbehafteten Einschätzung in die 1990er Jahre zu datieren. So legte Thomas Hidber 1996 nicht nur einen mustergültigen Kommentar zur praefatio von De oratoribus veteribus vor, sondern zudem eine ausgezeichnete Einführung in Leben und Werk des Dionysios und eine gründliche Untersuchung von dessen klassizistischer Weltanschauung.34 Die Analyse der praefatio war seit Langem ein Desiderat und leistet einen grundlegenden Beitrag zum Verständnis des gesamten Schaffens des Dionysios, denn „[d]ie besondere Bedeutung dieses kurzen Textes liegt darin, dass er das einzige formulierte Programm des griechischen attizistischen Klassizismus der augusteischen Zeit darstellt“.35 Besonders die einführenden Kapitel von Hidbers Edition enthalten eine ausführliche Aufarbeitung dessen, was wir über den Klassizismus des Dionysios und seines Umfeldes wissen können, insbesondere über das Konzept der φιλόσοφος ῥητορική nach IsokratesIsokrates und die von Dionysios propagierte und praktizierte Mimesis der als „klassisch“ definierten Autoren. Auch wird, wenngleich es sich vordergründig um die Edition einer der literaturkritischen Schriften handelt, die Brücke geschlagen zu den Antiquitates Romanae und deren Bedeutung innerhalb des klassizistischen Bildungsprogramms herausgestellt. Speziell dem klassizistischen Programm des Dionysios hatte bereits wenige Jahre zuvor Koen Goudriaan eine großangelegte Studie gewidmet.36
Im Bereich der Beschäftigung mit den literaturkritisch-rhetorischen Schriften des Dionysios ist zudem besonders Casper C. de Jonge zu nennen, der in den vergangenen rund 15 Jahren mehrere Studien dazu vorgelegt hat, unter denen insbesondere seine umfassende Monographie über die Scripta rhetorica hervorzuheben ist.37 Der darin verfolgte Forschungsansatz scheint auf den ersten Blick den Studien Eggers und Bonners zu gleichen, indem de Jonge die Scripta rhetorica auf die in ihnen dargelegten Erörterungen zur sprachlich-stilistischen und Literaturtheorie hin untersucht und diese in ihren historischen Kontext einordnet. Allerdings liegt sein Schwerpunkt, anders als in den genannten vorangegangenen Arbeiten, auf den von Dionysios behandelten linguistischen Fragestellungen, mehr als auf dessen Literaturkritik. So widmet er sich sämtlichen bei Dionysios begegnenden Problemen von Sprache, von dem Verhältnis zwischen Bezeichnungen und Dingen und den grammatischen Bestandteilen von Reden hin zu den stilistischen Unterschieden zwischen Poesie und Prosa, von Syntax und Metathesis bis zu den Verbindungspunkten zwischen rhetorischer und philosophischer, metrischer, poetischer und musikalischer Theorie. Dabei gelingt es ihm zu zeigen, dass der Literatur- und Rhetorikspezialist Dionysios nicht, wie von der wissenschaftlichen Forschung behauptet wurde, lediglich dadurch für die Nachwelt von Wert sei, dass man aus seinen Schriften die Ideen früherer Sprach- und Literaturtheoretiker rekonstruieren könne, wohingegen eine eigene Leistung kaum erkennbar sei.38 Zwar lässt sich durch eine gründliche Analyse der einzelnen Texte nachweisen, dass Dionysios zahlreiche zu seiner Zeit kursierende Theorien von Sprache und Literaturkritik gekannt und in seinen Abhandlungen verarbeitet hat, jedoch wäre es verfehlt, ihn deshalb als schlichten Vielleser und Kompilator fremder Ideen zu betrachten. Durch eine sorgfältige Verortung in ihrem intellektuellen und historischen Kontext vermag de Jonge dieses Vorurteil gegenüber den Scripta rhetorica überzeugend zu widerlegen und die Eigenleistung des Dionysios herauszustellen: Dieser verstand es durchaus, in Auseinandersetzung mit den verschiedenen sprachlich-stilistischen und literarischen Theorien seiner Vorgänger ein eigenes Konzept zu entwickeln, sein sogenanntes klassizistisches Programm.39 Seine Abhandlung De compositione verborum, die von de Jonge genauestens untersucht wird, legte erstmals die historische Entwicklung der Wortarten dar und leistete damit für die Antike Pionierarbeit.
Nicolas Wiater wiederum legte nur wenig später ebenfalls eine Monographie40 über den Klassizismus des Dionysios vor. Sein Ziel ist es, diesen nicht als lediglich sprachlich-literarisches, sondern vielmehr als soziokulturelles Phänomen zu betrachten: „Why did it make sense to Greek and Roman intellectuals in Augustan Rome to attempt to speak and write like LysiasLysias, Isocrates, or DemosthenesDemosthenes?“41 Zentrale Begriffe des dionysianischen Klassizismus-Konzeptes wie Mimesis, φιλόσοφος ῥητορική und πολιτικοὶ λόγοι werden von Wiater einer eingehenden Untersuchung unterzogen und auf ihre Rolle innerhalb dieses Konzeptes hin beleuchtet. Hierfür nimmt er nicht allein das literaturkritische Corpus in den Blick, sondern berücksichtigt ebenso die Antiquitates Romanae insofern, als ihm das „historical programme“ des Dionysios im Verhältnis zu dessen Klassizismus wichtig erscheint. Von besonderem Interesse ist für ihn die Frage, ob letzterer eine Erklärung dafür liefere, warum Dionysios gerade die Anfänge der römischen Geschichte als Gegenstand historischer Reflexion auswählte.42 Nur innerhalb des klassizistischen Weltbildes ist diese Entscheidung Wiater zufolge verständlich:43 So haben die Römer es vermocht, die einst mächtige φιλόσοφος ῥητορική wieder in ihre alten Rechte einzusetzen, indem sie diese mit politischer Macht vereinen. Augusteische Gegenwart und klassische Vergangenheit werden hier von Dionysios in eine wechselseitige Abhängigkeitsbeziehung gesetzt, da die Machtstellung der Römer im 1. Jahrhundert v. Chr. durch deren Verkörperung früherer griechischer Werte ihre Legitimation erhält; die Epoche der griechischen Klassik wiederum erlangt auf diese Weise eine Bedeutung für die Gegenwart, welche die jeder anderen Epoche überragt.44
Die bisher genannten Studien beziehen in mehr oder weniger hohem Umfang auch das Geschichtswerk des Dionysios in ihre Fragestellungen ein, die literaturtheoretischen Abhandlungen stehen dort jedoch im Vordergrund des Forschungsinteresses. Die Antiquitates Romanae werden zumeist als Bestandteil des dionysianischen Klassizismus interpretiert, als Quelle zum Verständnis dessen, was in den Scripta rhetorica in literaturtheoretischer Form ausgeführt wird. Zwar ist darin ein wichtiger Fortschritt zu sehen, indem sich in der Forschung allmählich ein Bewusstsein für die Zusammengehörigkeit beider Corpora etabliert, allerdings scheint das Geschichtswerk insgesamt nach wie vor eine der Literaturkritik unter- bzw. nachgeordnete Rolle zu spielen und als Werk von eigenem Wert noch nicht angemessen wahrgenommen zu werden.45 Die Antiquitates als literarischer Text sind im Verhältnis zu den literaturkritischen Schriften noch wenig studiert, eine grundlegende narratologische Analyse fehlt bislang zur Gänze. Zu lange galt Dionysios als langatmiger und wenig origineller Schriftsteller, nicht als ernst zu nehmender Historiker.46
In den 1930er Jahren unternahm Erich Burck einen Vorstoß in Richtung einer narratologischen Auseinandersetzung mit dem Geschichtswerk des Dionysios, indem er seine Analyse des LiviusLivius auf eine kontinuierliche Gegenüberstellung mit den Antiquitates bettete.47 Obgleich er letztere, entsprechend dem Ziel seiner Untersuchung, primär als Folie gebraucht, um die Eigenarten der livianischen Darstellungsweise klarer aufzeigen zu können,48 und obgleich auch er es an wertenden Urteilen zuungunsten des Dionysios nicht fehlen lässt,49 so leistet seine Analyse dennoch einen wichtigen Beitrag für die Wahrnehmung des Dionysios als Erzähler. Sie widmet sich zentralen Gestaltungselementen wie der Strukturierung des Stoffes, dem Einsatz von enargeia und dem Erregen der Emotionen des Lesers und benennt einige Charakteristika der Antiquitates wie etwa die Ausführlichkeit der Darstellung und die insbesondere das innere Empfinden hervorhebende Charakterisierung von Einzelfiguren.50 Erschöpfend geht Burck hierbei freilich nicht vor, da es ihm vorrangig auf Livius ankommt.
Die unlängst erschienene vergleichende Analyse der Antiquitates mit dem Geschichtswerk des LiviusLivius von Philip Haas51 klammert Fragen der Erzähltechnik weitestgehend aus und unternimmt es stattdessen, die Motivik beider Autoren in ihrer Beziehung zum augusteischen Diskurs zu beleuchten. So stellt nicht nur eine Untersuchung der Darstellungsweise des Dionysios, sondern auch der narratologische Vergleich zu Livius noch immer ein Desiderat dar. Freilich liegt dies nicht zum Mindesten in der Schwierigkeit der relativen Chronologie begründet, da in der Forschung bis heute umstritten ist, ob Livius vor oder nach Dionysios schrieb bzw. publizierte und inwieweit einer den anderen als Quelle für sein eigenes Werk verwendet haben könnte. Allerdings wären derartige Bedenken nicht zwingend angebracht, da es sich bei einer Studie, welche die Erzählweise beider Autoren in den Blick nimmt, ja um eine rein textimmanente Untersuchung handeln würde, die weitestgehend unabhängig von außerliterarischen Umständen die Art und Weise analysierte, wie Livius und Dionysios denselben Stoff je nach Wirkungsabsicht unterschiedlich darstellen. Die Frage, „wer zuerst da war“, ist dafür nicht zwingend relevant und könnte ausgeklammert werden.
Nicht speziell mit narratologischen Fragestellungen, aber mit Strategien zur Leserlenkung im weiteren Sinne befasst sich die Studie Anouk Delcourts,52 die als umfassendste Monographie über den Historiker Dionysios seit derjenigen Gabbas anzuführen ist und die erstmals gezielt die historiographische Vorgehensweise in den Blick nimmt, mittels derer die Antiquitates dem Leser die These von der griechischen Polis Rom nahezubringen suchen. Im Zentrum steht das Geschichtsbild der Antiquitates, das die unauflösliche Verflechtung von Römischem und Griechischem kohärent präsentiert. Neben der obligatorischen Situierung im kulturellen Kontext der augusteischen Zeit ist es zunächst die Bedeutung Griechenlands für dieses Geschichtsbild, die Delcourt herausarbeitet; insbesondere die Rolle Arkadiens, Athens und Spartas wird eingehend untersucht. Das (freilich idealisierte) Griechische spielt eine wesentliche Rolle insofern, als die römische Geschichte von Anbeginn davon durchdrungen und geprägt ist, die Stadt Rom ethnisch und kulturell für Dionysios eine griechische Polis darstellt. Das Bestreben des Dionysios ist es, nach Möglichkeit sämtliche Einrichtungen und Traditionen der Römer auf griechische Vorbilder zurückzuführen, um so eine eigentlich griechische Identität für seine Wahlheimat zu konstruieren. Namentlich in vier Bereichen ist dies besonders augenfällig: in ethnischer Zugehörigkeit, Sprache, Kultur und Institutionen. Man kann hier mitnichten von einer neuen Idee, von einer originalen Schöpfung des Dionysios sprechen, denn die Vorstellung von Rom als griechischer Polis begegnet bereits mehrere Jahrhunderte vor seiner Zeit, etwa bei Herakleides Pontikos.53 Jedoch propagiert kein anderer Text diese These mit derartigem Nachdruck wie die Antiquitates Romanae, die die römische Geschichte unermüdlich in hellenische Traditionen integrieren und ihren griechischen Rezipienten gewissermaßen eine Apologie für die Weltherrschaft des imperium Romanum liefern möchten. Allerdings ist dies ein wechselseitiger Prozess: Das griechische Element, die griechische Tradition, wird eingesetzt, um Dionysiosʼ Vorstellung der römischen Frühzeit zu konstruieren, andererseits dient die römische Geschichte wiederum dazu, die eigentliche Überlegenheit der griechischen Kultur hervorzuheben und durch Ausdehnung und Dauer des römischen Reiches ihren Fortbestand zu garantieren. Besondere Beachtung schenkt Delcourt in ihrer Analyse der Darstellung der Königszeit, vor allem der Figur des RomulusRomulus, welcher in den Antiquitates nicht allein als Stadtgründer auftritt, sondern darüber hinaus gleich zu Beginn all ihre Einrichtungen und Gebräuche (nach griechischem Modell) begründet und damit für die spätere Entwicklung maßgeblich verantwortlich zeichnet. Der Niedergang der Königsherrschaft, ihre Entartung in Richtung der Tyrannis, und die negativen Konnotationen des Terminus rex werden von Dionysios erst mit dem sechsten römischen König Servius TulliusServius Tullius in Verbindung gebracht und nicht wie sonst in der Tradition, etwa in der Darstellung des LiviusLivius, bereits bei Tarquinius Priscus angesetzt.54
Dionysios von Halikarnass hat in der philologischen Forschung somit in den letzten Jahrzehnten eine erhebliche Aufwertung erfahren: Sowohl die Sprach- und Stilkritik als auch das Geschichtswerk stehen in weitaus höherem Ansehen, als dies noch vor rund 90 Jahren der Fall war. Abwertende Polemik kennzeichnet nicht mehr den Ton der wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Die historische Arbeitsweise und die Quellen des Dionysios für die Antiquitates Romanae sind inzwischen umfassend erschlossen, es liegen mehrere jüngere Studien zu seinen literaturkritischen Schriften als solchen und zu seinem klassizistischen Bildungsideal vor. Umso mehr sticht hervor, welch geringe Aufmerksamkeit bislang dem literarischen Aspekt der Antiquitates zuteilgeworden ist. In dieser Hinsicht versucht die vorliegende Arbeit eine Lücke zu schließen.
3Zum soziokulturellen Hintergrund der Antiquitates Romanae des Dionysios von Halikarnass
Im Folgenden möchte ich einige grundlegende Bemerkungen machen, die der Verortung des Dionysios und seines rhetorisch-literaturkritischen wie historiographischen Schaffens im kulturellen Kontext seiner Zeit dienen sollen, da in den weiteren Kapiteln meiner Untersuchung wiederholt bestimmte Aspekte dieses Kontextes eine Rolle spielen.
3.1Leben, Werk und Zeit
Der soziokulturelle Hintergrund des Lebens und Wirkens des Dionysios ist inzwischen ausgezeichnet erforscht.1 Zwar können im Einzelnen nur wenige gesicherte Aussagen über seinen Lebensweg gemacht werden,2 eine grobe Struktur lässt sich jedoch anhand der autobiographischen Äußerungen in den Antiquitates Romanae durchaus rekonstruieren.3 Als Geburtsdatum ist etwa 60 v. Chr. anzunehmen,4 der Geburtsort Halikarnass wird von Dionysios selbst genannt.5 Nach Rom kam er im Jahre 30 oder 29 v. Chr., dort erschien auch rund 20 Jahre später das erste Buch seines Geschichtswerkes.6 Zutreffend dürfte Hidbers Annahme sein, Dionysios habe zumindest bis zum Abschluss der Publikation der Antiquitates noch in Rom gelebt; über seinen weiteren Aufenthaltsort ist nichts bekannt, wenngleich manche byzantinische Quellen von angeblichen Nachkommen des Historikers in Halikarnass zu berichten wissen.7
Bei seiner Ankunft in Rom traf Dionysios ein reges griechisches Kulturleben an. Mit der Schlacht bei Actium fand bekanntlich ein rund 200 Jahre währender Prozess sein vorläufiges Ende: Der griechische Osten war nunmehr, ungeachtet der wiederholten Deklarierung als Befreiung der Hellenen vom Joch eines MithridatesMithridates oder AntiochusAntiochus, endgültig ins Römische Reich integriert. Die griechischen Staaten hatten, wie das Beispiel der Heimatstadt des Dionysios zeigt, zum Teil erheblich unter den Auswirkungen der allzu häufig auf ihrem Boden ausgetragenen Bürgerkriege gelitten.8 Rom entwickelte sich in der Folgezeit zum bedeutendsten Anziehungspunkt für Denker aus dem griechisch geprägten Teil des Reiches und hatte nunmehr auch auf kultureller Ebene die Vormachtstellung der alten Geistesmetropolen Athen, Pergamon und Alexandria übernommen.9 Berührungspunkte auf geistiger Ebene hatte es zwischen Griechen und Römern freilich schon früher gegeben. Bereits seit dem 3. Jahrhundert v. Chr. unternahmen junge Angehörige der römischen Elite „Bildungsreisen“ in den griechischen Osten, insbesondere um dort Philosophie und Rhetorik zu studieren. Der Rhetorikunterricht, den CiceroCicero bei dem griechischen Redner MolonMolon nahm, ist nur das bekannteste Beispiel.10 Waren bereits während der römischen Eroberungsphase griechische Intellektuelle wie etwa PolybiosPolybios überwiegend unfreiwillig als politische Geiseln oder Kriegsgefangene nach Rom gelangt,11 so strömten nach Beendigung der Bürgerkriege zahlreiche Denker aus dem Osten nun aus freien Stücken in die neue Hauptstadt der Welt und entfalteten dort eine breitgefächerte literarische Tätigkeit.12 Der Historiker und Geograph Strabon gelangte etwa zur selben Zeit wie Dionysios nach Rom;13 der Historiker Nikolaos von DamaskusNikolaos von Damaskus, Verfasser einer Biographie des AugustusAugustus, hielt sich wiederholt in diplomatischer Mission dort auf.14 Ebenfalls als Autor einer Augustus-Biographie bekannt ist Timagenes von AlexandrienTimagenes von Alexandrien, der im Jahre 55 v. Chr. als Kriegsgefangener nach Rom gelangt war.15 Caecilius von KaleakteCaecilius von Kaleakte wird von der Forschung meist neben Dionysios als der „andere“ bedeutende griechische Rhetoriker im augusteischen Rom und als enger Freund genannt.16 Er firmiert als Verfasser eines Werkes mit dem Titel Περὶ ὕψους sowie rhetorischer Schriften und einer Abhandlung, wie man Geschichte schreiben solle.17 Im augusteischen Rom lebte und wirkte eine Vielzahl griechischer Denker, was angesichts der in der philologischen Forschung üblichen Verengung auf die als repräsentativ geltenden „Augusteer“ wie VergilVergil, HorazHoraz und OvidOvid bisweilen in Vergessenheit gerät.18
Ob die in Rom wirkenden griechischen Schriftsteller einen festen Intellektuellen-Zirkel bildeten, ist fraglich. De Jonge spricht von einem „Netzwerk“ von Intellektuellen, die einen regen Austausch von Ideen pflegten.19 Die Forschung konnte zumindest den näheren Umkreis des Dionysios anhand der Widmungsträger seiner rhetorischen Schriften identifizieren, zu denen offenbar sowohl Griechen als auch Römer zählten.20 Dionysios bewegte sich somit nicht in einem vom römischen Kulturbetrieb abgetrennten und rein griechisch geprägten Elfenbeinturm. Grundsätzlich scheint die Mehrzahl der griechischen Denker, die sich im ersten vorchristlichen Jahrhundert in Rom aufhielten, eine pro-römische Einstellung gehabt und die neue Hauptstadt der Welt als einen dem griechischen Polis-System ähnlichen Stadtstaat betrachtet zu haben.21 Als römischer Vermittler scheint in diesem Kreis Q. Aelius TuberoTubero, Q. Aelius von besonderer Bedeutung gewesen zu sein, der als eine Art Patron für Dionysios fungierte – Delcourt nennt ihn „l’ami et protecteur de Denys“22 – und, aus einflussreicher Familie stammend und in hohem Maße literarisch interessiert, selbst als Verfasser eines Geschichtswerkes hervortrat, das mindestens von den Anfängen Roms bis zu den Bürgerkriegen reichte und sowohl von Dionysius als auch von LiviusLivius benutzt wurde.23 Inwieweit Dionysios in Kontakt mit den lateinischen Dichtern seiner Zeit wie OvidOvid, VergilVergil, HorazHoraz u.a. kam, lässt sich nicht mit Gewissheit feststellen, da er die heute als „typisch augusteisch“ geltenden Autoren in seinen Werken nicht erwähnt.24 Erstaunlicherweise findet sich auch in seinem gesamten erhaltenen Œuvre einschließlich der rhetorischen Schriften kein einziger direkter Hinweis auf CiceroCicero.25 Nach eigener Aussage erlernte Dionysios in Rom die lateinische Sprache und hatte somit unmittelbaren Zugang zu den Quellen für sein Geschichtswerk, ob es sich nun im Einzelnen um schriftlich Festgehaltenes wie historiographische Texte oder allgemein um Dokumente in Archiven oder um mündliche Überlieferung handelte.26 Er nennt auch immer wieder namentlich Quellen, die er für die Antiquitates herangezogen habe.27 Wie verhält es sich allerdings in dieser Hinsicht mit dem großen lateinischen Gegenstück, dem Geschichtswerk des LiviusLivius? Ob und inwieweit dieser Dionysius als Quelle gedient haben mag, ist nicht zu eruieren, da er in den Antiquitates mit keinem Wort erwähnt wird.28 Somit gestaltet sich auch die relative Chronologie beider Geschichtswerke problematisch.
Von den ursprünglich 20 Büchern der Antiquitates Romanae sind die ersten zehn vollständig und das elfte größtenteils erhalten, die Bücher 12 bis 20 lediglich durch Fragmente kenntlich, deren Einordnung schwierig ist.29
Neben den Antiquitates Romanae ist von Dionysios ein umfangreiches Corpus an Schriften literaturkritisch-rhetorischen Inhalts überliefert, das größte erhaltene aus der griechisch-römischen Antike. Es umfasst Abhandlungen und Briefe an Personen aus dem intellektuellen Umkreis des Dionysios und beschäftigt sich vorrangig mit sprachlich-stilkritischen Fragestellungen.30 Bedauerlicherweise nur fragmentarisch tradiert ist die Abhandlung De imitatione.31 Historiographie und Literaturkritik sind im Schaffen des Dionysios nicht voneinander zu trennen, wiewohl die philologische Forschung ihn zumeist entweder als Historiker oder als Literaturkritiker untersucht, was freilich auch aus arbeitsökonomischen Gründen naheliegt, da eine erschöpfende Gesamtüberschau über das Werk von einem Einzelnen wohl kaum zu leisten ist. Allerdings ist die Kenntnis der literaturkritischen Schriften für ein adäquates Verständnis der Antiquitates unabdingbar; die Frage, wie man Geschichte schreiben solle, und die Analyse historiographischer Texte anderer Autoren nehmen in ihnen großen Raum ein. Die Opuscula rhetorica bereiten gewissermaßen in der Theorie vor, was sodann in den Antiquitates in praxi ausgeführt ist.32
3.2Das klassizistische Konzept des Dionysios
Albrecht Dihle bezeichnet den Klassizismus als „dominant factor of the imperial civilization, both on the Greek and Roman side“.1 Umso wertvoller ist daher die Auseinandersetzung mit den Schriften des Dionysios von Halikarnass, da sie uns die erste umfassend ausgearbeitete klassizistische Theorie der griechisch-römischen Antike präsentieren. Die Frage, inwieweit Dionysios tatsächlich der erste oder der einzige Intellektuelle war, der überhaupt ein derartiges Unterfangen in Angriff nahm, muss natürlich mit Blick auf die Quellenlage letztlich unbeantwortet bleiben. Wie bereits erwähnt, war er Teil einer klassizistisch orientierten Anzahl griechischer Denker in Rom, jedoch ist einzig von ihm ein derart umfangreiches Schriftencorpus überliefert, das es uns erlaubt, das Wesen dieses Klassizismus näher zu beleuchten.
Über das intellektuelle Umfeld des Dionysios in Rom ist in den letzten Jahren umfangreich publiziert worden, besonders der von (und um) Dionysios praktizierte Klassizismus, sein „klassizistisches Programm“,2 ist Gegenstand mehrerer neuerer Monographien. Grundlegend für das Verständnis des Klassizismus-Konzeptes, welches uns sowohl in den literaturkritisch-rhetorischen Schriften als auch in seinem Geschichtswerk entgegentritt, ist die Studie Hidbers.3 So bedient sich Dionysios des Dekadenzmodells des sogenannten klassizistischen Dreischritts, indem er im Athen des vierten vorchristlichen Jahrhunderts das Ideal der Literatur und insbesondere der Rhetorik verortet, das in hellenistischer Zeit4 dem Verfall preisgegeben gewesen sei, jedoch zu Dionysiosʼ eigener Zeit wieder zu alter Geltungsmacht zurückgefunden habe.5 Dieses Modell geht nicht erst auf Dionysios und sein direktes Umfeld zurück. Von ähnlichen klassizistischen Ansätzen wissen wir bereits aus dem Hellenismus, jedoch schien es damals noch an einer ausgebildeten klassizistischen Theorie wie derjenigen des Dionysios zu fehlen.6 Auch andere Literaten wie etwa CiceroCicero sahen in der Zeit um bzw. nach AlexanderAlexander d. Gr. einen Wendepunkt.7 Allerdings scheint es erst im intellektuellen Klima unter AugustusAugustus zu einer systematischen Ausarbeitung, zur Entwicklung eines regelrechten Programms aus vereinzelt anzutreffenden früheren klassizistischen Tendenzen gekommen zu sein.8 Inwieweit der römische Attizismus mit der Entstehung des Klassizismus um Dionysios zusammenhängt, ist in der Forschung umstritten.9 Die für den rhetorischen Diskurs des ersten vorchristlichen Jahrhunderts zentralen Begriffe des Attizismus und Asianismus tauchen in Rom um die Mitte eben dieses Jahrhunderts bei CiceroCicero erstmals als Schlagworte für zwei unterschiedliche Arten rhetorischer Prosa auf und verweisen auf eine unter römischen Intellektuellen zum damaligen Zeitpunkt geführte Debatte.10 Thomas Gelzer verortet das Aufkommen des Attizismus dementsprechend im Rom der 50er Jahre und definiert diesen als eine Orientierung für die Römer, wie sie sich mittels der aktiven Nachahmung von als klassisch angesehenen Vorbildern ebenfalls zu „Attikern“ entwickeln könnten.11
Mit Blick auf die Antiquitates Romanae des Dionysios ist bemerkenswert, dass die Orientierung an diesen Vorbildern von Angehörigen der römischen Oberschicht als dem eigenen Selbstverständnis angemessen eingestuft und von Politikern wie CiceroCicero keineswegs als Widerspruch zur kulturellen Identität der Römer empfunden wurde. Das Zusammendenken der griechischen und der römischen Kultur in den Antiquitates Romanae, die darin vertretene These von der griechischen Abstammung der Römer und deren Rolle als Träger griechischer Wert- und Moralvorstellungen entstanden somit in einem intellektuellen Umfeld, dem solches Denken vertraut war.
Der von Dionysios von Halikarnass vertretene Klassizismus umfasst zwei Ebenen, eine sprachliche sowie eine ethisch-moralische. Auf den ersten Blick rückt er damit in die Nähe der Orientierung an der Vergangenheit, wie sie die Römer selbst vornahmen, indem sie immer wieder aufs Neue das Herkommen und den mos maiorum zur Verhaltensrichtlinie bestimmten; bekanntestes Beispiel ist das Geschichtswerk des LiviusLivius.12 Allerdings unterscheidet sich der Klassizismus seiner Definition nach insofern vom mos maiorum, als dieser sich auf die gesamte Vergangenheit der Römer beziehen kann, während jener sich beschränkt auf eine bestimmte Epoche, welche als vorbildlich angesehen wird, namentlich das 4. Jahrhundert v. Chr.13
Das klassizistische Konzept des Dionysios lässt sich am besten nachvollziehen in seiner Abhandlung De oratoribus veteribus. Hier sind die attizistischen Tendenzen, die in der griechisch-römischen Welt bis dato vereinzelt kursierten, erstmalig zu einem ganzheitlichen System verarbeitet.14 Insbesondere aus der umfangreichen Vorrede, die Hidber als das „klassizistische Manifest des Dionysios“ bezeichnete, wird deutlich, welche Vorstellungen dieser mit einem konsequent praktizierten Attizismus verbindet und was er sich von selbigem erhofft.15 Genau genommen stellt der Klassizismus, wie Dionysios ihn gesehen wissen will, nicht lediglich ein sprachlich-literarisches Phänomen dar, das aus der schriftlichen Nachahmung bestimmter Vorlagen wie DemosthenesDemosthenes und ThukydidesThukydides besteht; vielmehr handelt es sich dabei um ein umfassendes Bildungsprogramm, in dessen Zentrum als Vorbild – neben anderen kanonischen Autoren, besonders Rednern – der griechische Rhetor IsokratesIsokrates und dessen Bildungsideal einer φιλόσοφος ῥητορική steht. So soll das intensive Studium der Klassiker der Vermittlung von Bildung, sprachlicher Artikulation und – vor allem – ethischen Werten dienen und auf diese Weise zu moralischem Handeln im Privaten und insbesondere im öffentlichen Leben anleiten, hierin dem Ideal des ciceronischen Staatsmannes nicht unähnlich.16 Dieses Bildungsideal umfasst sowohl die Sprach- als auch die Handlungsebene (λόγοι und βίος),17 es beabsichtigt somit den Menschen in seiner Gesamtheit zu erfassen.
Allerdings ist einzuwenden, dass sich die von Dionysios als kanonisch18 propagierten Autoren zum Teil nicht unwesentlich voneinander unterscheiden und mitnichten allesamt Attiker sind – so ist für ihn der vorbildliche griechische Historiker schlechthin keineswegs ThukydidesThukydides, wie unter dem Schlagwort „Klassizismus“ eigentlich zu erwarten gewesen wäre, sondern der ganz und gar „unklassische“ HerodotHerodot. Auch die von Dionysios verfemte asianische Literatur lässt sich inhaltlich nicht ohne Weiteres auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Folglich ist nicht eindeutig zu eruieren, wie Dionysios sein Ideal des Klassischen im Einzelnen definiert wissen möchte.19
3.3Das Programm der Antiquitates Romanae und ihr Publikum
Besondere Aufmerksamkeit innerhalb des klassizistischen Programms des Dionysios verdient das Konzept der Mimesis, die auf zwei Ebenen eine Rolle spielt. Zum einen bezeichnet Mimesis in den stilkritischen Schriften die empfohlene Methode der Literaturproduktion.1 Hierbei handelt es sich um die sprachlich-stilistische Nachahmung der als vorbildlich angesehenen Autoren, die dazu dient, die Artikulationsfähigkeit in ihrer praktischen Anwendung sowohl im Schriftlichen, etwa bei der Abfassung eines eigenen Geschichtswerkes, als auch bei der Tätigkeit im öffentlich-politischen Bereich zu optimieren.
In den Antiquitates ist es die Nachahmung im Bereich der moralisch richtigen Lebensführung, zu der der Text den Rezipienten anleiten will. Die Darstellung der römischen Geschichte des Dionysios ist inhaltlich und in ihrer Absicht exempla-Geschichtsschreibung und steht hierin dem Geschichtswerk des LiviusLivius nahe: Anhand von Beispielen vorbildlichen Verhaltens aus der römischen Vergangenheit soll der Leser eine Richtschnur für sein eigenes Handeln erhalten. Man hat die Antiquitates in diesem Zusammenhang denn auch als Katalog nachahmenswerter Handlungen bezeichnet.2
An dieser Stelle wird das in der Forschung kontrovers diskutierte Problem des Adressatenkreises der Antiquitates besonders relevant: Gilt die implizite Aufforderung, diese positiven Verhaltensmuster nachzuahmen, für alle denkbaren Leser oder zielt sie primär entweder auf ein griechisches oder ein römisches Publikum? Die folgende Passage scheint auf die zeitgenössischen Römer als Nachkommen ihrer berühmten Vorfahren bezogen (οἱ ἀπ᾽ ἐκείνων τῶν ἰσοθέων ἀνδρῶν νῦν τε ὄντες καὶ ὕστερον ἐσόμενοι):
διὰ ταύτας μὲν δὴ τὰς αἰτίας ἔδοξέ μοι μὴ παρελθεῖν καλὴν ἱστορίαν ἐγκαταλειφθεῖσαν ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων ἀμνημόνευτον, ἐξ ἧς ἀκριβῶς γραφείσης συμβήσεται τὰ κράτιστα καὶ δικαιότατα τῶν ἔργων· τοῖς μὲν ἐκπεπληρωκόσι τὴν ἑαυτῶν μοῖραν ἀνδράσιν ἀγαθοῖς δόξης αἰωνίου τυχεῖν καὶ πρὸς τῶν ἐπιγιγνομένων ἐπαινεῖσθαι, ἅ ποιεῖ τὴν θνητὴν φύσιν ὁμοιοῦσθαι τῇ θείᾳ καὶ μὴ συναποθνήσκειν [αὐτῆς] τὰ ἔργα τοῖς σώμασι· τοῖς δὲ ἀπ᾽ ἐκείνων τῶν ἰσοθέων ἀνδρῶν νῦν τε οὖσι καὶ ὕστερον ἐσομένοις μὴ τὸν ἥδιστόν τε καὶ ῥᾷστον αἱρεῖσθαι τῶν βίων, ἀλλὰ τὸν εὐγενέστατον καὶ φιλοτιμότατον, ἐνθυμουμένους ὅτι τοὺς εἰληφότας καλὰς τὰς πρώτας ἐκ τοῦ γένους ἀφορμὰς μέγα ἐφ᾽ ἑαυτοῖς προσήκει φρονεῖν καὶ μηδὲν ἀνάξιον ἐπιτηδεύειν τῶν προγόνων·3
Aus diesen Gründen schien es mir angeraten, eine edle Geschichte, die von den Vorfahren unbeachtet gelassen worden ist, nicht unerinnert zu übergehen, aus der sich, wenn sie genau aufgeschrieben ist, die besten und gerechtesten Werke ergeben werden: Die guten Männer, die die ihnen zugemessene Lebenszeit bereits ausgeschöpft haben, werden immerwährenden Ruhm und Lob bei den Nachgeborenen erlangen, was die Natur der Sterblichen der Natur der Götter ähnlich werden und ihre Werke nicht zugleich mit dem Körper sterben lässt. Die aber von jenen gottgleichen Männern abstammen, sowohl heute als auch in der Zukunft, werden nicht das süßeste und leichteste Leben wählen, sondern das vornehmste und ehrliebendste, da sie bedenken, dass es denjenigen, die ihre Abstammung auf so edle Anfänge zurückführen, zukommt, hoch von sich zu denken und nicht zu beginnen, was der Vorfahren unwürdig ist.
Liest man diesen Abschnitt vor dem Hintergrund anderer Stellen in den Antiquitates, die sich kritisch über das Verhalten von Römern in jüngerer Zeit äußern, so ist ihm eine Aufforderung an die Römer des ersten Jahrhunderts zu entnehmen, ihr Handeln wieder stärker an den moralischen Standards auszurichten, die die Römer der Frühzeit gesetzt hätten.4 Es ist allerdings eine Frage der Interpretation, ob es sich hierbei um eine Anleitung zu eigenem Handeln in der politischen Öffentlichkeit handelt. Denkbar wäre, dass Dionysios weniger ambitiöse Ziele verfolgte und in erster Linie auf die grundsätzliche moralische Charakterbildung seiner Rezipienten einzuwirken suchte, eine spätere praktische Anwendung dieser Bildung in politischem Rahmen jedoch miteinkalkulierte oder zumindest nicht ausschloss. Anouk Delcourt hat in diesen Worten das Konzept einer engen Bindung an die Vergangenheit gesehen, die durch die Erzählung hergestellt wird: „[…] il s’instaure entre l’individu et son passé une relation intime et privilégiée, car l’imitation permet l’émulation. Les grands hommes fournissent à leurs descendants des modèles de comportement qui déterminent l’action de ceux-ci.”5
Während der oben zitierte Abschnitt auf einen vorrangig römischen Adressatenkreis hindeutet, suggerieren andere Passagen der Antiquitates ein griechisches Zielpublikum. Über die Frage, an Leser welcher der beiden Kulturen sich die Antiquitates Romanae wenden, besteht daher in der philologischen Forschung keine Einigkeit.6 Zwar stehen die Gründe, die Dionysios zur Abfassung seines Geschichtswerkes bewogen haben, mit einiger Gewissheit fest, da er sie selbst in der Vorrede7 nennt: Er möchte seine Leser davon überzeugen, dass die Römer keineswegs durch eine (ungerechte) Laune des Zufalls zur Weltherrschaft gelangt sind, sondern dies verdientermaßen aufgrund ihrer Tugenden und Wertvorstellungen so gekommen ist, und dass die Römer ihrem Ursprung nach Griechen sind. Jedoch kann diese Aussage in Hinsicht auf das Zielpublikum auf unterschiedliche Art und Weise gedeutet werden. So beinhaltet die Darstellung der römischen Frühzeit durch Dionysios für ein römisches Publikum einen Mehrwert insofern, als die These der Gräzität der Römer zur Aufwertung ihrer Identität nutzbar gemacht werden konnte und ihnen die Möglichkeit bot, sich in einen Kreis altehrwürdiger Kulturvölker aufgenommen zu sehen8 und etwaige Minderwertigkeitsgefühle speziell gegenüber den als älter und kulturell überlegen empfundenen Griechen zu überwinden. Gleichzeitig lässt die folgende Erklärung auf ein griechisches Adressatenpublikum schließen:
Ὅτι δ᾽ οὐκ ἄνευ λογισμοῦ καὶ προνοίας ἔμφρονος ἐπὶ τὰ παλαιὰ τῶν ἱστορουμένων περὶ αὐτῆς ἐτραπόμην, ἀλλ᾽ ἔχων εὐλογίστους ἀποδοῦναι τῆς προαιρέσεως αἰτίας, ὀλίγα βούλομαι προειπεῖν […]. ἔτι γὰρ ἀγνοεῖται παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ὀλίγου δεῖν πᾶσιν ἡ παλαιὰ τῆς Ῥωμαίων πόλεως ἱστορία, καὶ δόξαι τινὲς οὐκ ἀληθεῖς, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἐπιτυχόντων ἀκουσμάτων τὴν ἀρχὴν λαβοῦσαι τοὺς πολλοὺς ἐξηπατήκασιν, ὡς ἀνεστίους μέν τινας καὶ πλάνητας καὶ βαρβάρους καὶ οὐδὲ τούτους ἐλευθέρους οἰκιστὰς εὐχομένης, οὐ δι᾽ εὐσέβειαν δὲ καὶ δικαιοσύνην καὶ τὴν ἄλλην ἀρετὴν ἐπὶ τὴν ἁπάντων ἡγεμονίαν σὺν χρόνῳ παρελθούσης, ἀλλὰ δι᾽ αὐτοματισμόν τινα καὶ τύχην ἄδικον εἰκῆ δωρουμένην τὰ μέγιστα τῶν ἀγαθῶν τοῖς ἀνεπιτηδειοτάτοις· καὶ οἵ γε κακοηθέστεροι κατηγορεῖν εἰώθασι τῆς τύχης κατὰ τὸ φανερὸν ὡς βαρβάρων τοῖς πονηροτάτοις τὰ τῶν Ἑλλήνων ποριζομένης ἀγαθά.9
Ich will wenige Worte darüber vorausschicken, dass ich mich nicht ohne Überlegung und gründliche Voraussicht der Frühzeit der römischen Geschichte zugewandt habe, sondern dass ich wohlüberlegte Gründe für meine Wahl anzuführen habe. […] Denn die Frühgeschichte der Stadt Rom ist fast allen Griechen noch unbekannt, und die meisten werden von gewissen Meinungen getäuscht, die nicht wahr sind, sondern aus zufällig Gehörtem ihren Ursprung nehmen. So rühme sich die Stadt irgendwelcher Heimatlosen, Wanderer und Barbaren, die nicht einmal frei gewesen seien, als ihrer Gründer, und sei nicht durch Götterverehrung, Gerechtigkeit und die andere Tugend mit der Zeit zur Herrschaft über alle anderen gelangt, sondern durch irgendeinen Zufall und ein ungerechtes Schicksal, das planlos die größten Güter denjenigen schenke, die diese am wenigsten verdienten: Und die allzu Böswilligen pflegen das Schicksal offen anzuklagen, dass es den Niedrigsten unter den Barbaren die Güter der Griechen zur Verfügung stelle.
Auf den ersten Blick wendet sich Dionysios nun wiederum an griechische Leser: Er nennt als Motivation für seine Arbeit, er wolle der Unkenntnis der Griechen über die römische Geschichte abhelfen, damit diese nicht länger böswilligen Vorurteilen über die niedrige Abkunft und das unverdiente Glück der Römer Glauben schenken.10 Zudem schrieb er sein Geschichtswerk in griechischer Sprache. Dazu ist freilich zu sagen, dass es eine Verkennung des intellektuellen Umfeldes der Antiquitates bedeuten würde, die Sprache als Indiz für ein rein griechisches Lesepublikum ins Feld zu führen. Dass Dionysios seine Schriften sämtlich auf Griechisch abfasste, mag den banalen Grund haben, dass er, obwohl er mindestens 20 Jahre lang in Rom gelebt und nach eigenen Angaben das Lateinische erlernt hatte, in seiner Muttersprache nach wie vor über die sicherere und gewandtere Artikulationsfähigkeit verfügte.11 Er konnte davon ausgehen, dass die Mehrheit der römischen Oberschicht der griechischen Sprache so weit mächtig war, dass sie sein Werk ohne Schwierigkeiten zu rezipieren vermochte. Die römische Elite war zur Zeit des AugustusAugustus längst zweisprachig.12 Stärkeres Gewicht besitzt hingegen die Angabe, griechische Leser über die römische Geschichte informieren zu wollen. Hiermit ist eindeutig ein griechisches Publikum angesprochen.13
Das gezeigte Nebeneinander von Hinweisen auf römische und solchen auf griechische Adressaten lässt sich erklären, wenn man von der (ohnehin anachronistischen) Kategorie des Nationalen absieht. Der Umstand, dass der Verfasser sich offenbar beiden Kulturkreisen, dem griechischen wie dem römischen, zugehörig fühlte,14 kann als Hinweis darauf gelten, dass es ihm um einen spezifischen Wertekanon ging, den er bei seinen Adressaten voraussetzte.15 Dionysios, aus dem griechisch geprägten Kleinasien stammend und nach Rom übergesiedelt, schreibt im vollen Bewusstsein seiner griechischen Bildung und in griechischer Sprache ein Geschichtswerk, das die Römer zu Hellenen macht, sie seinem eigenen Herkommen gewissermaßen anverwandelt. Andrew Wallace-Hadrill hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass Identität bzw. Identitäten in der Antike nicht unbedingt statisch waren, sondern vielmehr komplex verhandelte Phänomene darstellten.16 Das Griechische stand vor allem anderen für eine kulturelle Identität und keine politische, da es niemals einen „Staat“ Griechenland oder ein „griechisches Reich“ gegeben hatte, nicht einmal zu Alexanders Zeiten; das Römische dagegen war wohl ebenfalls keine nationale Kategorie, sondern primär eine juristische, wie ein Blick auf das römische Bürgerrechtssystem nahelegt.17
Meines Erachtens ist davon auszugehen, dass sich die Antiquitates Romanae sowohl an griechische als auch an römische Leser wenden, die einen bestimmten Wertekanon klassizistischer Prägung teilen.18





























