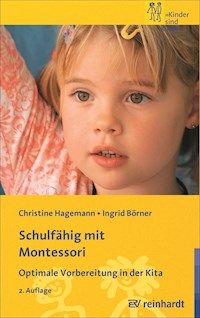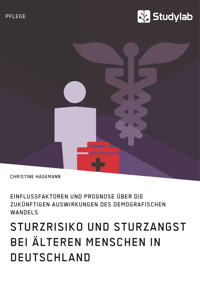
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Studylab
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Stürze sind eines der größten gesundheitlichen Probleme älterer Menschen. Die Auswirkungen von Stürzen reichen von geringfügigen Verletzungen über schwere Frakturen bis hin zum Tod. Der Sturz selbst und die Angst davor haben hierbei gegenseitig den größten Einfluss aufeinander und können einen Teufelskreis bilden. Da Stürze stark mit dem Alter zusammenhängen, ist durch die zunehmende Alterung der Gesellschaft in Zukunft mit einer starken Zunahme der Stürze und Sturzfolgen zu rechnen. Die Autorin Christine Hagemann beschäftigt sich in diesem Buch mit Möglichkeiten und Methoden, wie die Sturzrisiken bei alten Menschen gezielt verringert werden können. Durch die Aufstellung einer Prognose für die Zukunft, kommt sie zu dem Ergebnis, dass ein starkes Engagement der Gesundheitspolitik gefordert ist, damit die Zunahme von Sturzverletzungen mitsamt ihrer Risiken verhindert werden kann. Aus dem Inhalt: Sturz; Sturzangst; Ältere Menschen; Senioren; Gesundheitspolitik; Präventionsprogramm.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2018 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
2 Hintergrund
2.1 Definition von Stürzen
2.2 Sturzursachen
2.2.1 Intrinsische Risikofaktoren
2.2.2 Extrinsische Risikofaktoren
2.3 Epidemiologie von Stürzen
2.4 Sturzverletzungen
2.4.1 Frakturen
2.4.2 Immobilisierung und ihre Folgen
2.5 Demografischer Wandel in Deutschland
3 Zielsetzung/Fragestellungen
4 Methodik
4.1 Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe
4.1.1 Beschreibung der Datenquelle
4.1.2 Methodik der Datenerhebung und Datenaufbereitung
4.1.3 Beschreibung der angewendeten Analyseverfahren zur Untersuchung der Einflussfaktoren auf Stürze und Sturzangst
4.2 Krankenhausdiagnosestatistik
4.2.1 Beschreibung der Datenquelle
4.2.2 Methodik der Datenerhebung
4.3 Bevölkerungsprognosen
4.3.1 Methodik von Bevölkerungsprognosen
4.3.2 Die 12. koordinierte Bevölkerungsprognose des Statistischen Bundesamtes für Deutschland
4.4 Berechnung der sturzrelevanten Frakturen für die nächsten 20 Jahre
5 Ergebnisse
5.1 Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe
5.1.1 Beschreibung der Studienpopulation
5.1.2 Ergebnisse der logistischen Regressionsverfahren
5.1.3 Zwischenfazit
5.2 Frakturen in Deutschland heute und in der Zukunft
5.2.1 Frakturen bei Männern und Frauen in Deutschland von 2000 bis 2008
5.2.2 Prognose der einzelnen Frakturarten für die Jahre 2020 und 2030 nach Altersgruppen und Geschlecht
6 Prävention von Sturzereignissen
7 Diskussion
7.1 Ergebnisdiskussion der Auswertung des Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe
7.2 Ergebnisdiskussion der Vorausberechnung der Frakturen in Deutschland bis 2030
7.3 Stärken und Schwächen der Arbeit, Anregungen für weitere Forschungsvorhaben
8 Abschlussfazit
Anhang
Syntax der Auswertung des SHARE-Datensatzes
Bevölkerungszahlen für Deutschland in den Jahren 2020 und 2030 nach Prognose des Statistischen Bundesamtes, 12. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung (2010)
Literatur
Zusammenfassung
Hintergrund: Stürze sind eines der größten gesundheitlichen Probleme älterer Menschen, da sie eine Vielzahl von Verletzungen und weiteren Komplikationen hervorrufen können. Dabei gibt es Risikofaktoren auf intrinsischer und extrinsischer Ebene, die das Sturzrisiko erhöhen können. Es wird angenommen, dass rund 30% der über 65-Jährigen zu Hause lebenden Menschen jedes Jahr stürzen, bei über 90-Jährigen stürzt sogar etwa die Hälfte mindestens einmal pro Jahr. Die schwerste Sturzfolge ist die Femurfraktur, die im Jahr 2008 zu 137.502 Krankenhausbehandlungen bei über 60-Jährigen geführt hat. Da Stürze stark mit dem Alter korrelieren, ist durch die zukünftige Entwicklung der Altersstruktur mit einer deutlichen Vergrößerung der Bevölkerung in den höheren Altersgruppen mit einer Zunahme der Stürze und Sturzfolgen zu rechnen.
Methoden: Zunächst werden die Daten von SHARE in Bezug auf die Einflussfaktoren auf Stürze und Sturzangst untersucht. Hierfür werden die signifikanten Determinanten auf beide Outcomes jeweils durch simple und multiple logistische Regressionsverfahren ermittelt und dargestellt. Im zweiten Hauptteil der Arbeit geht es um die demografisch bedingte Entwicklung der sturzassoziierten Frakturen in Deutschland bei über 55-Jährigen. Die 12. koordinierte Bevölkerungsprognose und die Krankenhausdiagnosestatistik des Statistischen Bundesamtes bilden die Grundlage für die Erstellung von Prognosen über die zukünftigen Fallzahlen bei Frakturen für Männer und Frauen nach 5-Jahres-Altersgruppen. Dabei wurden zwei Szenarien mit unterschiedlichen Annahmen zur Lebenserwartung für alle sturzassoziierten Frakturarten[1] erstellt und verglichen.
Ergebnisse: Den stärksten Einfluss auf Stürze in den letzten sechs Monaten vor dem Interview hat Sturzangst (OR=8,5). Diese führt zu unsicheren Bewegungen und Einschränkungen der Mobilität, was wiederum das Sturzrisiko weiter erhöht. Aber auch Inkontinenz und Schwindel erhöhen das Sturzrisiko drastisch (OR≈2,4). Der größte Einflussfaktor auf Sturzangst ist wiederum ein erfolgter Sturz (OR=7,8). Ebenfalls großen Einfluss auf Sturzangst haben Müdigkeit/ Erschöpfung, Ohnmacht/Schwindel, Geschlecht und sturzassoziierte Bewegungseinschränkungen.
Die meisten Frakturarten werden durch die demografische Alterung stark zunehmen, insbesondere, wenn die Lebenserwartung stark steigt. Insgesamt kann in Zukunft von einer Steigerung der untersuchten Frakturen um 148.000 bis 174.000 Fälle pro Jahr ausgegangen werden. Dabei nehmen die Fallzahlen bei Frauen stärker zu als bei Männern, die wiederum einen stärkeren relativen Zuwachs aufweisen.
Schlussfolgerungen:
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Einteilung von Stürzen
Abbildung 2: Verteilung der physischen Verletzungen nach einem Sturz.
Abbildung 3: Altersaufbau in Deutschland 2005 und 2030 *)
Abbildung 4: Fallzahlen der sturzassoziierten Frakturen bei Männern und Frauen über 55 Jahre im Jahr 2008
Abbildung 5: Entwicklung der Frakturen der Lendenwirbelsäule und des Beckens bei Frauen von 2000 bis 2008
Abbildung 6: Entwicklung der Frakturen des Oberarmes bei Frauen von 2000 bis 2008
Abbildung 7: Entwicklung der Frakturen des Unterarmes bei Frauen von 2000 bis 2008
Abbildung 8: Entwicklung der Frakturen des Handgelenks bei Frauen von 2000 bis 2008
Abbildung 9: Entwicklung der Frakturen des Femurs bei Frauen von 2000 bis 2008
Abbildung 10: Entwicklung der Frakturen des Unterschenkels und Sprunggelenkes bei Frauen von 2000 bis 2008
Abbildung 11: Entwicklung der Frakturen der Lendenwirbelsäule und des Beckens bei Männern von 2000 bis 2008
Abbildung 12: Entwicklung der Frakturen des Oberarmes bei Männern von 2000 bis 2008
Abbildung 13: Entwicklung der Frakturen des Unterarmes bei Männern von 2000 bis 2008
Abbildung 14: Entwicklung der Frakturen des Handgelenkes bei Männern von 2000 bis 2008
Abbildung 15: Entwicklung der Frakturen des Femurs bei Männern von 2000 bis 2008
Abbildung 16: Entwicklung der Frakturen des Unterschenkels und Sprunggelenkes bei Männern von 2000 bis 2008
Abbildung 17: Darstellung der Frakturarten bei Männern und Frauen ab 55 Jahren je 100.000 Einwohner, 2008
Abbildung 18: Prognostizierte Fallzahlen bei Lendenwirbel- und Beckenfrakturen für die Jahre 2020 und 2030 bei Frauen, Basisjahr 2008, Variante 1W1
Abbildung 19: Prognostizierte Fallzahlen bei Oberarmfrakturen für die Jahre 2020 und 2030 bei Frauen, Basisjahr 2008, Variante 1W1
Abbildung 20: Prognostizierte Fallzahlen bei Unterarmfrakturen für die Jahre 2020 und 2030 bei Frauen, Basisjahr 2008, Variante 1W1
Abbildung 21: Prognostizierte Fallzahlen bei Handgelenksfrakturen für die Jahre 2020 und 2030 bei Frauen, Basisjahr 2008, Variante 1W1
Abbildung 22: Prognostizierte Fallzahlen bei Femurfrakturen für die Jahre 2020 und 2030 bei Frauen, Basisjahr 2008, Variante 1W1
Abbildung 23: Prognostizierte Fallzahlen bei Unterschenkel- und Sprunggelenksfrakturen für die Jahre 2020 und 2030 bei Frauen, Basisjahr 2008, Variante 1W1
Abbildung 24: Prognostizierte Fallzahlen bei Lendenwirbel- und Beckenfrakturen für die Jahre 2020 und 2030 bei Männern, Basisjahr 2008, Variante 1W1
Abbildung 25: Prognostizierte Fallzahlen bei Oberarmfrakturen für die Jahre 2020 und 2030 bei Männern, Basisjahr 2008, Variante 1W1
Abbildung 26: Prognostizierte Fallzahlen bei Unterarmfrakturen für die Jahre 2020 und 2030 bei Männern, Basisjahr 2008, Variante 1W1
Abbildung 27: Prognostizierte Fallzahlen bei Handgelenksfrakturen für die Jahre 2020 und 2030 bei Männern, Basisjahr 2008, Variante 1W1
Abbildung 28: Prognostizierte Fallzahlen bei Femurfrakturen für die Jahre 2020 und 2030 bei Männern, Basisjahr 2008, Variante 1W1
Abbildung 29: Prognostizierte Fallzahlen bei Unterschenkel- und Sprunggelenksfrakturen für die Jahre 2020 und 2030 bei Männern, Basisjahr 2008, Variante 1W1
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Risikofaktoren für Stürze
Tabelle 2: : Sturzbedingte Frakturen
Tabelle 3: Lokalisation von Frakturen bei über 60-Jährigen in Deutschland im Jahr 2008, beide Geschlechter.
Tabelle 4: Körperliche und psychische Folgen von Immobilität
Tabelle 5: Darstellung der unabhängigen Variablen
Tabelle 6: Verteilung der Sturzereignisse in der Stichprobe nach bestimmten Merkmalen
Tabelle 7: Verteilung der sturzassoziierten Erkrankungen in Bezug auf die Sturzereignisse
Tabelle 8: Verteilung von Sturzangst in der Stichprobe nach bestimmten Merkmalen
Tabelle 9: Ergebnisse der simplen logistischen Regression bei Stürzen
Tabelle 10: Multiple logistische Regression bei Stürzen
Tabelle 11: Alters- und geschlechtsspezifische Prävalenzraten bei Stürzen
Tabelle 12: Ergebnisse der simplen logistischen Regression bei Sturzangst
Tabelle 13: Multiple logistische Regression bei Sturzangst
5.1.2.4 Alters- und geschlechtsspezifische Prävalenzrate von Sturzangst
Tabelle 14: Alters- und geschlechtsspezifische Prävalenzraten bei Sturzangst
Tabelle 15: Prognose der Fallzahlen von Frakturen bei Frauen nach unterschiedlichen Annahmen zur Bevölkerungsprognose
Tabelle 16: Prognose der Fallzahlen von Frakturen bei Männern nach unterschiedlichen Annahmen zur Bevölkerungsprognose
Tabelle 17: Relative Veränderung der Fallzahlen bei Frakturen von 2008 bis 2030 basierend auf den beiden Varianten der Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes 2009, beide Geschlechter
Tabelle 18: Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes bis 2030
1 Einleitung
Bereits heute sind Stürze eine große gesundheitliche Belastung für ältere Menschen. Die Auswirkungen von Stürzen reichen hierbei über geringfügige Verletzungen und schwere Frakturen bis hin zum Tod. Mit zunehmendem Alter lässt oft die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung der Balance nach, hinzu kommen weitere individuelle Faktoren, die ein Sturzereignis begünstigen. Neben einem hohen Alter gibt es eine Reihe weiterer Einflüsse, die das Sturzrisiko erhöhen. Stürze sind meist multifaktoriell bedingt und nur selten einem einzigen Risikofaktor zuzuschreiben. In Kapitel 2: Hintergrund geht es zunächst ausführlich um Sturzgeschehen, Sturzursachen und die Epidemiologie von Stürzen in Deutschland. Eine Übersicht über Sturzverletzungen und deren Häufigkeiten gibt Kapitel 2.4: Sturzverletzungen. Stürze sind stark mit hohem Alter assoziiert, weshalb auf Grund des Wachstums dieses Bevölkerungsanteils (Stichwort demografische Alterung, vgl. Kapitel 2.5: Demografischer Wandel in Deutschland) mit einer Zunahme der Stürze und damit verbunden auch der sturzassoziierten Verletzungen und Frakturen zu rechnen ist.
Während die Sturzgeschehen in Einrichtungen wie Krankenhäusern, Alten- oder Pflegeheimen meist recht gut dokumentiert sind – wenn auch nicht mit einheitlichen Definitionen von Stürzen – ist bei Menschen, die zu Hause wohnen, die Datenlage eher rar (Tideiksaar 2000). Stürze ohne Verletzungen werden oft verharmlost oder tabuisiert aus Angst, die Eigenständigkeit einzubüßen. Dabei können auch Stürze, die ohne schwere Verletzungen enden, Hinweis sein auf bereits vorhandene Risikofaktoren, die möglicherweise zu multiplen Stürzen führen können (Downton 1995).
Um Stürze und Sturzrisiken in der Allgemeinbevölkerung geht es daher im ersten Ergebnisteil dieser Arbeit (Kapitel 5.1: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe). Hier werden aus einer europäischen Panelbefragung von Menschen über 55 Jahren in Europa die Sturzgeschehen und der Faktor Sturzangst für Deutschland ausgewertet. Die detaillierte Beschreibung der Datenquelle, der Variablen und der angewendeten statistischen Verfahren ist im Kapitel 4.1: Methodik –Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) dargestellt. Sturzangst als größter Einflussfaktor auf Stürze kommt deutlich häufiger vor als ein Sturzereignis, und die Angst davor, hinzufallen kann sowohl nach einem erlebten Sturzereignis oder unabhängig davon auftreten. Ziel ist es, zum einen die Auswirkungen der verschiedenen Sturzrisiken wie Medikamenteneinnahme auf die Sturzgefahr zu untersuchen und zum anderen altersspezifische Prävalenzen von Stürzen und Sturzangst zu ermitteln.
Frakturen, insbesondere Femurfrakturen, gehören zu den schweren Sturzfolgen, die eine medizinische Behandlung mit sich bringen. In etwa 2 bis 3% führt ein Sturz zu einer Femurfraktur (Tideiksaar 2000). Je nach Schwere des Bruchs können ein längerer Krankenhausaufenthalt und Rehabilitationsmaßnahmen zur Wiederherstellung von Mobilität und Selbstständigkeit von Nöten sein. Schwere Frakturen können weitere Komplikationen wie Pneumonien zur Folge haben, meist durch die Immobilisierung des Patienten. Bereits heute erleiden viele ältere Menschen eine Fraktur: insgesamt sind im Jahr 2008 in Deutschland 420.708 Menschen über 65 Jahren auf Grund einer Fraktur im Krankenhaus behandelt worden. Die größte Einzeldiagnose sind dabei Femurfrakturen mit 132.551 Fällen bei beiden Geschlechtern (102.418 Fälle bei Frauen, 30.133 bei Männern, (Statistisches Bundesamt 2010a). 336.421 behandelte Frakturen, also etwa 80% aller Frakturen, lassen sich in die Kategorie „sturzassoziiert“ einordnen, d.h. dass diese Brüche zu einem bestimmten Anteil durch Stürze hervorgerufen sind (vgl. Kapitel 2.4.1: Frakturen).
Um den zukünftigen Bedarf medizinischer Versorgung planen zu können, aber auch um die weiter zunehmende Brisanz des Themas zu verdeutlichen, wird in dieser Arbeit eine Prognose der in Zukunft zu erwartenden sturzassoziierten Frakturen erstellt. Dabei wird auf Grundlage der Bevölkerungsvorausberechnungen des Statistischen Bundesamtes die Auswirkung der Veränderung in der Altersstruktur auf die Anzahl der Fälle je 100.000 Einwohner projiziert (siehe Kapitel 4.4: Berechnung der sturzrelevanten Frakturen für die nächsten 20 Jahre).
Prävention von Stürzen ist das Thema des nächsten Kapitels. Besonders in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und Altenheimen sind Stürze oft dokumentiert und es werden Maßnahmen zur Sturzprävention eingesetzt (Tideiksaar 2000). Langfristige und vor allem flächendeckende Programme zur Sturzprävention bei zu Hause lebenden älteren Menschen stehen hingegen noch aus; bisher existieren einige Modellversuche hierzu (vgl. Kapitel 6: Prävention von Sturzereignissen und in der Literatur bspw. (Stalenhoef et al. 2000; Siegrist 2001; Runge, Rehfeld 2001). Dabei könnten durch geeignete Präventions- und Interventionsprogramme zum einen Stürze durch ein Erkennen und – wenn möglich – Beseitigen von Sturzrisiken verhindert werden, oder zum anderen schweren Verletzungen beispielsweise durch das Tragen von Hüftprotektoren vorgebeugt werden.
Im letzten Teil werden die gewonnenen Ergebnisse an Hand der Literatur diskutiert und zusammengefasst. Hier geht es um die Auswertungen der Einflussfaktoren aus dem SHARE-Datensatz und um die Prognosen der sturzassoziierten Frakturen und um die Stärken und Schwächen der vorliegenden Arbeit. Zu guter Letzt geht es um mögliche weiterführende Forschungsfragen, die in weiteren Arbeiten erforscht werden könnten. Stürze und Sturzfaktoren bestehen aus vielen Dimensionen, von denen im Rahmen dieser Arbeit nur ein kleiner Ausschnitt betrachtet werden kann.
2 Hintergrund
Einführend in die Thematik werden zunächst die Hintergründe von Stürzen an Hand der Literatur betrachtet. Dabei geht es zunächst um die Frage, was ist ein Sturz überhaupt, und was macht ihn so problematisch für ältere Menschen? Die unterschiedlichen Risikofaktoren, die zusammen zu einer erhöhten Sturzgefahr führen können, werden im nächsten Abschnitt detailliert behandelt. Anschließend geht es um die Epidemiologie von Sturzereignissen in Deutschland. Hierbei werden verschiedene Studien genannt, die die Häufigkeit von Stürzen in unterschiedlichen Settings untersucht haben. Die für die Betroffenen schlimmsten Sturzfolgen sind (schwere) Verletzungen. An erster Stelle stehen hier Frakturen, die im schlimmsten Fall auch zum Tod führen können, öfters jedoch langwierige medizinische und rehabilitative Behandlungen zur Folge haben. Stürze und schwere Sturzverletzungen sind mit einem hohen Alter assoziiert, so dass sich eine Zunahme der älteren Bevölkerung auch auf die Zahl der Sturzverletzungen auswirken wird. Um die Grundlagen der Veränderungen in der Altersstruktur geht es im Kapitel 2.5: Demografischer Wandel in Deutschland.
2.1 Definition von Stürzen
Stürze sind eines der größten gesundheitlichen Probleme älterer Menschen. Die Bandbreite der Sturzfolgen ist groß: Stürze können geringe Verletzungen oder schwere Frakturen hervorrufen oder schlimmstenfalls bis zum Tod führen. Stürze sind Ursache der meisten Todesfälle bei Menschen ab dem 65. Lebensjahr: jährlich sterben in Deutschland rund 10.000 Menschen an den Folgen eines Sturzes. Dabei können sowohl Verletzungen, die bei dem Sturz zugezogen werden als auch Folgen von Stürzen und der damit verbundenen Immobilisierung[2] zum Tode führen. Geschätzt wird, dass jeder fünfte Sturz bei Menschen in der Altersgruppe der über 85-Jährigen zum Tod führt (Tideiksaar 2000).
Die Kellog International Work Group on the Prevention of Falls by the Elderly (1987) definiert Sturzereignisse folgendermaßen:
„Ein Sturz ist ein Ereignis, in dessen Folge eine Person unbeabsichtigt auf dem Boden oder auf einer tieferen Ebene zu liegen kommt“ nach: Kellog International Work Group on the Prevention of Falls by the Elderly (1987) in: Elsbernd et al. 2005, S. 12.