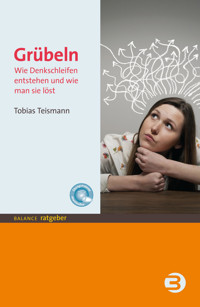16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Pro Jahr sterben in Deutschland etwa 10.000 Menschen an einem Suizid. Ein Großteil der Suizide wird dabei im Kontext psychischer Erkrankungen vollzogen. Die aktualisierte Auflage des Bandes stellt epidemiologische, theoretische und diagnostische Informationen zum Verstehen und Erkennen suizidaler Entwicklungen und Krisen überblicksartig dar. Der Schwerpunkt des Bandes liegt auf den diagnostischen und therapeutischen Strategien zum Umgang mit akuter Suizidalität, die praxisbezogen beschrieben werden. Leserinnen und Leser erhalten konkrete Hinweise zur Risikoabschätzung, zur Beziehungsgestaltung, zu Strategien der motivationalen und kognitiven Arbeit mit suizidalen Intentionen sowie auch zur Förderung von Selbstkontrolle. Notwendige Anpassungen des therapeutischen Settings an die Belange der suizidalen Patientinnen und Patienten werden genauso beschrieben wie Strategien im Umgang mit wiederkehrender Suizidalität. Abschließend wird auf die Effektivität pharmakologischer und psychotherapeutischer Strategien der Suizidprävention eingegangen und es werden rechtliche Aspekte im Umgang mit suizidalen Patientinnen und Patienten erläutert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Tobias Teismann
Wolfram Dorrmann
Suizidalität
2., aktualisierte Auflage
Fortschritte der Psychotherapie
Band 54
Suizidalität
PD Dr. Tobias Teismann, Dr. Wolfram Dorrmann
Herausgeber der Reihe:
Prof. Dr. Martin Hautzinger, Prof. Dr. Tania Lincoln, Prof. Dr. Jürgen Margraf, Prof. Dr. Winfried Rief, Prof. Dr. Brunna Tuschen-Caffier
Begründer der Reihe:
Dietmar Schulte, Klaus Grawe, Kurt Hahlweg, Dieter Vaitl
PD Dr. Tobias Teismann, geb. 1975. 1996–2002 Studium der Psychologie in Mainz und Bochum. 2003–2006 Weiterbildender Studiengang für Klinische Psychologie und Psychotherapie (Schwerpunkt Verhaltenstherapie) an der Ruhr-Universität Bochum (RUB). 2004–2012 Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der AE Klinische Psychologie und Psychotherapie an der RUB. 2009 Promotion. Tätigkeit als Psychotherapeut, Dozent und Supervisor. Seit 2012 Geschäftsführender Leiter des Zentrums für Psychotherapie (ZPT) an der RUB. 2017 Habilitation.
Dr. Wolfram Dorrmann, geb. 1954. 1975–1987 Studium der Psychologie in Bamberg. 1982–1996 Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter im Bereich Klinische Psychologie und Verhaltensmodifikation an der Universität Bamberg. 1987 Promotion. Seit 1999 Leiter des staatlich anerkannten Ausbildungsinstituts für Verhaltenstherapie, Verhaltensmedizin und Sexuologie (IVS) in Nürnberg. Seit 1987 als Psychologischer Psychotherapeut und Kinder‑ und Jugendlichenpsychotherapeut niedergelassen zunächst in Bamberg und heute in Fürth.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Satz: Sabine Rosenfeldt, Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
Format: EPUB
2., aktualisierte Auflage 2021
© 2014 und 2021 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-3037-9; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-3037-0)
ISBN 978-3-8017-3037-6
https://doi.org/10.1026/03037-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung:
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Beschreibung
1.1 Definitionen
1.2 Epidemiologie und Risikofaktoren
1.2.1 Prävalenz von Suiziden, Suizidversuchen und Suizidgedanken
1.2.2 Risikofaktoren
1.3 Verlauf und Prognose
1.4 Komorbidität
1.5 Diagnostische Verfahren und Dokumentationshilfen
1.5.1 Selbst- und Fremdbeurteilungsbögen
1.5.2 Interviewverfahren
2 Störungstheorien und -modelle
2.1 Kognitives Modell suizidaler Handlungen
2.2 Interpersonale Theorie suizidalen Verhaltens
2.3 Integratives motivational-volitionales Modell suizidalen Verhaltens
2.4 Genetische Faktoren
2.5 Gestörte Neurotransmission
3 Diagnostik und Indikation
3.1 Allgemeine Hinweise zur Risikoabschätzung
3.2 Einschätzung von Risikofaktoren
3.3 Einschätzung von protektiven Faktoren
3.4 Bestimmung des Suizidrisikos
3.5 Indikation
4 Behandlung
4.1 Strategien der Krisenintervention bei akuter Suizidalität
4.2 Therapeutische Beziehung
4.3 Zeit gewinnen – Reflexion anregen
4.3.1 Neugier wecken
4.3.2 Entscheidung für das Leben fördern
4.3.3 Bearbeitung ungünstiger Annahmen, Überzeugungen und Vorstellungen
4.4 Förderung der Selbstkontrolle
4.4.1 Zugang zu letalen Mitteln begrenzen
4.4.2 Notfallplan/Sicherheitsplan
4.4.3 Non-Suizid-Vertrag
4.5 Konfrontation
4.6 Einbeziehen von Angehörigen
4.7 Entscheidung über das Setting
4.7.1 Ambulante Weiterbehandlung
4.7.2 Stationäre Weiterbehandlung
4.8 Aufarbeitung suizidförderlicher Faktoren
4.8.1 Analyse suizidaler Verhaltensketten
4.8.2 Zentrale Therapiebausteine
4.8.3 Rückfallpräventionsübung
4.9 Pharmakotherapie
4.10 Effektivität und Prognose
4.11 Rechtliche Aspekte
5 Weiterführende Literatur
6 Literatur
7 Kompetenzziele und Lernkontrollfragen
8 Anhang
Fragen zur Analyse suizidaler Verhaltensketten
Karten
Prozessmodell für die Krisenintervention bei suizidalen Patienten
Fragen zur Exploration eines Suizidversuchs
Non-Suizid-Vertrag
Notfallplan
|1|Einleitung
Für jemanden, dessen Finger von einer zuschlagenden Tür getroffen ist, gibt es nichts in der Welt außer Finger und Schmerz. Ebenso für den Suizidanten: Der Schmerz macht die ganze Welt aus.
(Omer & Elitzur, 2003)
In Deutschland sterben pro Jahr in etwa 10.000 Menschen an einem Suizid. Betroffen sind insbesondere Personen, die an einer psychischen Erkrankung leiden. Entsprechend verwundert es nicht, dass vor allem Mitarbeiter im Sozial- und Gesundheitswesen – hauptsächlich Psychiater und Psychotherapeuten – mit suizidalen Personen in Kontakt kommen. In Befragungsstudien geben zwischen 20 bis 30 % der Psychologen und 50 bis 60 % der Psychiater an, den Suizid eines ihrer Patienten erlebt zu haben. Die therapeutische Auseinandersetzung mit Suizidgedanken, Suizidplänen und Suizidversuchen ist naturgemäß um ein Vielfaches häufiger und bestimmt je nach klinischem Arbeitsfeld die tägliche Arbeit in mehr oder weniger starkem Ausmaß. Ängste im Umgang mit suizidalen Patienten sind dabei gleichermaßen normal wie vielfältig: Neben Ängsten vor juristischen Konsequenzen eines Patientensuizids und Ängsten vor persönlichen Fehleinschätzungen äußern viele Therapeuten die Befürchtung, in Anbetracht suizidaler Wünsche keine ausreichenden Interventionsmöglichkeiten zur Verfügung zu haben. Weitere Ängste beziehen sich darauf, nicht die dem Thema angemessene Sprache zu finden, der Verantwortung nicht gerecht zu werden oder mit den intensiven Gefühlen des Klienten nicht zurecht zu kommen. Prononciert sind solche Befürchtungen vor allem bei Therapeuten, die nur selten Kontakt zu suizidalen Personen haben (Dorrmann, 1996). Nicht zuletzt dürften schließlich auch Vorbehalte und Unsicherheiten in Bezug auf die Legitimation suizidpräventiver Maßnahmen eine lähmende Wirkung auf den Umgang mit suizidgefährdeten Menschen haben.
In diesem Zusammenhang kontrastieren Eink und Haltenhof (2009) zwei gleichermaßen ungünstige Haltungen zur Frage, ob Suizide verhindert werden sollen und können: die Ohnmachtsfalle und die Allmachtsfalle. Unter dem Begriff der Ohnmachtsfalle subsumieren sie Einstellungen, die dadurch geprägt sind, dass der professionelle Helfer sich als unwichtig und machtlos erlebt, weil er Suizidhandlungen als Resultat einsamer Entscheidungen versteht, auf die von außen kaum Einfluss genommen werden kann. Diese Einschätzung entspricht weder der klinischen Erfahrung noch den Ergebnis|2|sen einer Vielzahl von Untersuchungen zu suizidpräventiven Maßnahmen, in denen sich zeigte, dass es zum Teil bereits nach kurzen Kontakten zu einer Reduktion suizidalen Erlebens kommt und dass die allerwenigsten Personen, die einen Suizid versucht haben, zu einem späteren Zeitpunkt an einem solchen versterben. Die Allmachtsfalle ist durch die entgegengesetzte Annahme, Suizidhandlungen seien bei guter professioneller Kompetenz immer zu verhindern, charakterisiert. Bedenklich an dieser Annahme ist insbesondere der Umkehrschluss, der nahelegt, dass suizidale Handlungen stets in der Verantwortung des behandelnden Therapeuten liegen. Auch diese Einschätzung ist sicher falsch – suizidale Entschlüsse sind oftmals einsame Entscheidungen, die nicht selten verschwiegen werden und damit selbst für die „beste“ therapeutische Intervention unzugänglich bleiben. Die Verantwortung für den suizidalen Akt liegt damit im Kern immer beim Betroffenen und nicht bei dessen Angehörigen, professionellen Helfern oder anderen beteiligten Personen.
Um der Ohnmachts- und der Allmachtsfalle zu entkommen bzw. Ängste und Hemmungen im Umgang mit suizidalen Personen abzubauen, ist es notwendig, die eigene Haltung suizidalem Verhalten gegenüber zu klären und sich mit diagnostischen und therapeutischen Methoden im Umgang mit Selbsttötungsabsichten vertraut zu machen. Zu diesem Zweck möchte das vorliegende Buch einerseits über empirische und theoretische Arbeiten zu suizidalem Verhalten informieren und andererseits diagnostische und therapeutische Strategien zum kurz- und langfristigen Umgang mit suizidalem Erleben und Verhalten praxisorientiert an die Hand geben. Im Einzelnen wird zunächst eine Begriffsbestimmung vorgenommen, bevor epidemiologische Daten überblicksartig dargestellt und Hinweise zur Diagnostik und Dokumentation suizidalen Verhaltens und Erlebens gegeben werden. Es folgt eine Übersicht über verschiedene theoretische Modelle suizidalen Verhaltens, bevor im dritten und vierten Kapitel ausführlich auf Strategien zur Risikoabschätzung, zur Krisenintervention und zur längerfristigen Aufarbeitung suizidaler Krisen eingegangen wird. Im Rahmen der gesamten Darstellung wird davon ausgegangen, dass der Leser mit klassischen kognitiv-verhaltenstherapeutischen Behandlungsstrategien vertraut ist. Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird auf die unterschiedliche geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet. Die gewählte männliche Form ist in diesem Sinne geschlechtsneutral zu verstehen.
Bochum und Fürth, Oktober 2020
Tobias Teismann
und Wolfram Dorrmann
|3|1 Beschreibung
1.1 Definitionen
Eine einheitliche, international gebräuchliche Nomenklatur und Klassifikation suizidbezogener Gedanken und Verhaltensweisen existiert bislang nicht. Weitgehende Einigkeit besteht gleichwohl darüber, dass dann von einem Suizid zu sprechen ist, wenn es aufgrund eines von der Person selbst ausgeführtem, schädigendem Verhalten zum Tod kommt und das Verhalten mit einem gewissen Maß an Absicht zu sterben assoziiert war (Silverman et al., 2007). Drei Bestimmungsstücke werden somit als zentral für die Feststellung eines Suizids erachtet: (a) die Person ist tot, (b) das Verhalten der Person selber führte zum Tod und (c) die Person hatte (in gewissem Ausmaß) die Absicht, ihren eigenen Tod herbeizuführen. Insbesondere die dritte Komponente ist nicht unumstritten und vielfach nur schwer zu bestimmen – gleichwohl erlaubt nur das Wissen um die Intention zwischen suizidalen Verhaltensweisen und nicht suizidalen selbstverletzenden Verhaltensweisen zu unterscheiden (vgl. Tabelle 1).
Entsprechend braucht es den Nachweis eines gewissen Maßes von Intentionalität auch, um von einem Suizidversuch zu sprechen. Wenzel, Brown und Beck (2009) definieren einen Suizidversuch als selbst ausgeführtes, potenziell schädigendes Verhalten, das nicht zum Tod führte, aber mit einem gewissen Maß an Absicht zu sterben assoziiert war. Zwei Bestimmungsstücke sind wiederum zentral: (a) die Person hatte (in gewissem Ausmaß) die Absicht ihren eigenen Tod herbeizuführen und (b) es wurde ein Verhalten gezeigt, dass das Potenzial zur Selbstschädigung hatte. Die Bestimmung des Ausmaßes an Intentionalität erfolgt entweder durch Selbstauskunft des Betroffenen oder durch die Berücksichtigung der Umstände des Suizidversuchs bzw. Suizids. Beide Arten Intentionalität zu erfassen sind naturgemäß stark fehleranfällig: Selbstberichtete Intentionalität kann durch den Kontext, in dem sie erfragt wird, und durch potenzielle Konsequenzen der Offenbarung von suizidaler bzw. nicht suizidaler Intention beeinflusst werden. Die Umstände eines selbstverletzenden Verhaltens können wiederum so arrangiert werden, dass es nach einem Suizidversuch aussieht, ohne tatsächlich einer zu sein; wie auch der umgekehrte Fall, in dem ein tatsächlicher Suizidversuch den Anschein eines Unfalls vermittelt, denkbar ist. Vor dem Hintergrund, dass viele Personen nur ein unzureichendes Wissen um das Gefährdungspotenzial verschiedener Suizidmethoden haben, bietet die potenzielle Letalität einer verwendeten |4|Methode keinen sicheren Indikator für das Ausmaß der Suizidabsicht. Entsprechend finden sich statistisch bedeutsame Zusammenhänge zwischen Suizidabsicht und Letalität der gewählten Methode nur bei Personen, die akkurate Vorstellungen über die von einer Methode ausgehende Gefährdung haben – nicht aber bei den Personen, denen dieses Wissen fehlt (Brown et al., 2004). Im Rahmen ihres Versuchs, eine einheitliche Nomenklatur für suizidbezogene Gedanken und Verhaltensmuster zu etablieren, haben Silverman et al. (2007) folgerichtig die Option unbestimmter Intentionalität vorgesehen. Eine Darstellung der von Silverman et al. (2007) vorgeschlagenen Terminologie findet sich in Tabelle 1. Einzelne Kategorien werden anhand der folgenden Fallbeispiele veranschaulicht.
Fallbeispiele
Beispiel 1: Selbstzugefügter unintentionaler Tod
Eine 35-jährige Frau springt in Panik vom Balkon eines mehrstöckigen brennenden Hauses, nachdem sie festgestellt hat, dass ihr der Weg zum Treppenhaus durch die Flammen versperrt war. Noch an der Unfallstelle verstirbt die Frau an inneren Verletzungen. Der Ehemann beschreibt sie als eine lebenslustige, sozial gut eingebundene und glückliche Person. Hinweise auf suizidale Wünsche und Impulse können im Rahmen einer psychologischen Autopsie nicht eruiert werden.
Beispiel 2: Selbstzugefügter Tod unklarer Intention
Ein 9-jähriger Junge wird von seiner Mutter im Kinderzimmer tot aufgefunden. Der Junge hat einen Ledergürtel um den Hals, welcher an einem Fenstergriff befestigt ist. Nach Aussage der Mutter habe es kurz zuvor einen heftigen Streit über die Fertigstellung der Schulaufgaben zwischen dem Jungen und ihr gegeben. Insgesamt hatte der an ADHS erkrankte Junge ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern, war sozial eingebunden und kam in der Schule gut mit. Suizidale Äußerungen im Vorfeld waren nicht bekannt.
Beispiel 3: Suizid
Ein 64-jähriger Manager wird tot in einem Waldstück aufgefunden. Eine große Zahl von leeren Tablettenverpackungen am Fundort, das Ergebnis der Obduktion und der kriminalpolizeilichen Ermittlung verweisen auf einen Vergiftungstod ohne Fremdeinwirkung. In einem Abschiedsbrief gibt der Verstorbene an, aufgrund eines unverzeihlichen beruflichen Fehlers „keinen anderen Ausweg zu sehen, um sich und seine Familie vor Schmach und Entehrung zu retten“.
Wie aus Tabelle 1 ersichtlich, stellt Silverman et al. (2007) zufolge die Abwesenheit bzw. das Vorhandensein physischer Schädigungen – neben der Inten|5|tionalität – ein Differenzierungsmerkmal suizidbezogener Verhaltensweisen dar. Eine Aussage über die Ernsthaftigkeit eines Suizidversuchs lässt sich aus dem Ausmaß physischer Schädigung gleichwohl nicht ableiten. So ist ein Suizidversuch, bei dem eine Person in suizidaler Absicht eine Schusswaffe auf sich selber richtet, der Schuss sich aufgrund einer Ladehemmung aber nicht löst, sicherlich nicht weniger ernsthaft als ein Suizidversuch, bei dem es durch selbstzugefügte Stichwunden im Brust- und Bauchbereich zu massiven Verletzungen, nicht aber zum Tod gekommen ist. Dem Kriterium kommt somit eher eine deskriptive als eine klinisch-therapeutische Bedeutung zu.
Tabelle 1: Nomenklatur suizidbezogener Verhaltensweisen (vgl. Silverman et al., 2007)
Physische Schädigung
Intention
Nein
unbestimmt
Ja
keine
Selbstverletzung I
unbestimmtes suizidähnliches Verhalten I
Suizidversuch I
Nicht tödliche
Selbstverletzung II
unbestimmtes suizidähnliches Verhalten II
Suizidversuch II
tödliche
selbstzugefügter, unintentionaler Tod
selbstzugefügter Tod unklarer Intention
Suizid