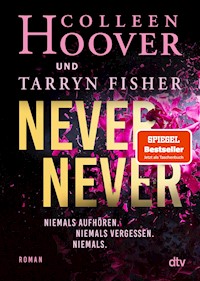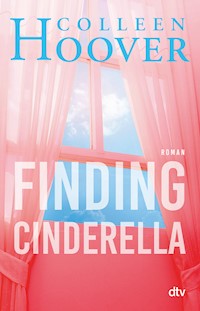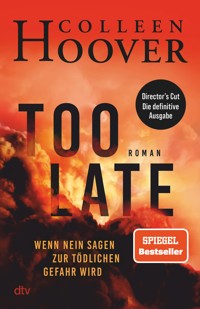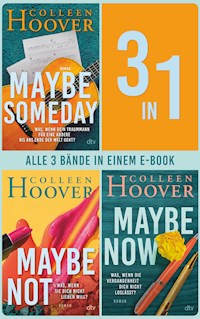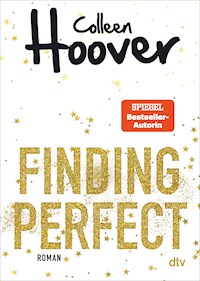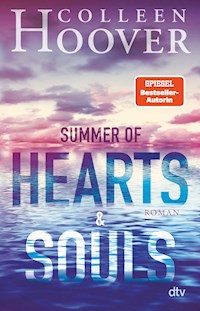
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Herzen haben keine Knochen, sie können nicht brechen – oder etwa doch? Suchtfaktor grenzenlos. Emotionen unendlich: der neue Liebesroman von Colleen Hoover. Eine intensive Lovestory mit authentischen Figuren, starken Themen, viel Sommerflair und einem grandiosen Setting Von der Trailersiedlung in die Welt der Rich Kids: Nach dem Tod ihrer Mutter bleibt der achtzehnjährigen Beyah nichts anderes übrig, als zu ihrem Vater zu ziehen. Dem Vater, den sie kaum kennt und der mit seiner neuen wohlhabenden Familie auf einer Halbinsel vor der texanischen Küste lebt. Wider Erwarten birgt die Welt der Schönen und Reichen mehr Überraschungen, als Beyah je gedacht hätte. Besonders Sunny Boy Samson scheint Abgründe in sich zu tragen, die ihr gar nicht so unbekannt vorkommen … »Colleen Hoover überzeugt jedes Mal aufs Neue.« Publishers Weekly »Colleen Hoover schreibt die Art von Büchern, über die noch lange gesprochen wird.« USA Today
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Herzen haben keine Knochen, sie können nicht brechen – oder doch?
Von der Trailersiedlung in die Welt der Rich Kids: Nach dem Tod ihrer Mutter bleibt der achtzehnjährigen Beyah nichts anderes übrig, als zu ihrem Vater zu ziehen. Dem Vater, den sie kaum kennt und der mit seiner neuen wohlhabenden Familie auf einer Halbinsel vor der texanischen Küste lebt. Wider Erwarten birgt die Welt der Schönen und Reichen mehr Überraschungen, als Beyah je gedacht hätte. Zum Beispiel Sarah, ihre neue Stiefschwester, die so gar nicht dem Klischee der Rich Kids entspricht. Oder aber ihr Nachbar Samson: Je näher sie ihm kommt, desto mehr ahnt sie, dass hinter der Fassade des Sonny Boys ein ganz Anderer steckt – und dass das Geheimnis, das ihn umgibt, sie beide in die Tiefe reißen könnte …
Von Colleen Hoover sind bei dtv lieferbar:
Weil ich Layken liebe | Weil ich Will liebe | Weil wir uns lieben
Hope Forever | Looking for Hope | Finding Cinderella
Love and Confess
Zurück ins Leben geliebt – Ugly Love
Nächstes Jahr am selben Tag – November 9
Nur noch ein einziges Mal – It ends with ust
Never Never (zusammen mit Tarryn Fisher)
Maybe Someday | Maybe not | Maybe Now
Die tausend Teile meines Herzens
Was perfekt war
Verity
All das Ungesagte zwischen uns
Finding Perfect
Layla
Für immer ein Teil von dir
Summer of Hearts and Souls
It starts with us – Nur noch einmal und für immer
Too Late – Wenn Nein sagen zur tödlichen Gefahr wird
Nur noch wenige Tage – Saint & The Dress. Zwei Stories
Colleen Hoover
SUMMER OF HEARTS & SOULS
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Katarina Ganslandt
Kelly Garcia,
dieses Buch ist für dich und deinen Mann und euer
ganz eigenes »Und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende …«
1
Sommer 2015
Bei uns im Wohnzimmer hängt ein Bild von Mutter Teresa an der Stelle, wo der Fernseher hängen würde, wenn wir uns einen Flachbildfernseher leisten könnten oder auch nur ein Haus mit richtigen Wänden, an die man so einen Fernseher hängen könnte.
Trailer-Home-Wände sind nicht wie normale Hauswände. Sie bröckeln wie Kreide, wenn man nur ein bisschen an ihnen kratzt.
Ich hab Janean mal gefragt, warum sie ein Bild von Mutter Teresa an unsere Wohnzimmerwand gehängt hat.
»Die Schlampe war eine Betrügerin.«
Ihre Worte. Nicht meine.
Ich glaube, wenn man ein schlechter Mensch ist, gehört es irgendwie zur Überlebenstaktik, in anderen Menschen auch immer nur das Schlechte zu sehen. In der Hoffnung, von der eigenen dunklen Seite ablenken zu können, konzentriert man sich auf die dunklen Seiten der anderen. Meine Mutter Janean hat das ihr Leben lang so gemacht und in allen Menschen immer nur Schlechtes gesucht. Selbst in ihrer eigenen Tochter. Selbst in Mutter Teresa.
Janean liegt immer noch so auf der Couch, wie sie dort lag, als ich vor acht Stunden gegangen bin, um meine Schicht bei McDonald’s anzutreten. Sie schaut auf das Bild von Mutter Teresa, ohne es anzuschauen. Als wären ihre Augen ausgeschaltet.
Als würden sie nichts mehr wahrnehmen.
Meine Mutter ist süchtig. Ich war ungefähr neun, als ich das richtig begriffen habe – wobei sich ihre Süchte damals noch auf Männer, Alkohol und Spielautomaten beschränkt haben.
Im Laufe der Jahre zeigte sich ihre Abhängigkeit immer deutlicher und wurde immer tödlicher. Vor etwa fünf Jahren, um meinen vierzehnten Geburtstag herum, habe ich dann zum ersten Mal gesehen, wie sie sich Crystal Meth in die Venen gejagt hat. Wenn man sich den Dreck regelmäßig spritzt, senkt das die Lebenserwartung drastisch. Ich hab am Computer in der Schulbibliothek mal Wie lange überlebt man mit Meth? gegoogelt.
Durchschnittlich sechs bis sieben Jahre, kam als Antwort.
In den letzten Jahren ist es schon ein paarmal vorgekommen, dass ich meine Mutter in einem Zustand gefunden habe, in dem sie nicht ansprechbar war. Aber heute fühlt es sich anders an. Endgültiger.
»Janean?« Meine Stimme klingt überraschend ruhig. Müsste sie sich nicht zittrig anhören oder erstickt? Irgendwie schäme ich mich dafür, dass ich keine Regung zeige.
Ich bleibe in der offenen Haustür stehen, lasse meine Tasche fallen und schaue in Janeans Gesicht. Es regnet mir auf den Rücken, trotzdem komme ich nicht auf die Idee, reinzugehen und die Tür zuzumachen. Ich stehe nur da, den Blick auf meine Mutter gerichtet, deren Blick wiederum auf Mutter Teresa gerichtet ist.
Ihr linker Arm liegt auf ihrem Bauch, der rechte hängt über den Rand der Couch, die Fingerkuppen berühren den ausgetretenen Teppichboden. Ihr Gesicht ist ein bisschen aufgedunsen, was sie jünger wirken lässt. Nicht jünger, als sie ist – sie ist erst neununddreißig –, aber jünger, als die Sucht sie eigentlich aussehen lässt. Ihre Wangen sind weniger eingefallen, und die Falten, die sich seit einiger Zeit um ihre Lippen herum eingegraben haben, wirken wie mit Botox aufgespritzt.
»Janean?«
Stille.
Ihr Mund steht ein Stück offen und enthüllt ihre gelben Zahnstümpfe. Meine Mutter sieht aus, als hätte sie gerade noch irgendwas gesagt, als das Leben aus ihrem Körper entwichen ist.
Ich habe mir diesen Augenblick oft ausgemalt. Wenn der Hass auf jemanden groß genug ist, fragt man sich in schlaflosen Nächten ganz automatisch auch mal, wie es wohl wäre, wenn derjenige sterben würde.
Aber ich hatte mir ihren Tod anders vorgestellt. Dramatischer.
Ich beobachte sie ein paar Sekunden lang, ob sie nicht vielleicht doch nur in einer Art Dämmerzustand ist. Dann gehe ich zwei Schritte auf sie zu und erstarre, als mein Blick auf ihren Arm fällt. Unterhalb ihrer Ellenbeuge steckt noch die Nadel in ihrer Haut.
Bei diesem Anblick bricht die Realität plötzlich wie eine schmierige Welle über mich herein und mir wird schlecht. Ich drehe mich um, stürze nach draußen und beuge mich über das morsche Treppengeländer, wobei ich darauf achte, mich nicht mit meinem ganzen Gewicht darauf zu stützen, damit es nicht zusammenbricht.
Dass ich kotzen muss, erleichtert mich. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, weil der Tod meiner Mutter erst mal so gar keine Reaktion in mir hervorgerufen hat. Vielleicht bin ich nicht so aufgelöst, wie es eine Tochter sein sollte, aber immerhin empfinde ich etwas.
Ich wische mir mit dem Saum meines McDonald’s-Shirts über den Mund und setze mich auf die Stufen, obwohl aus dem Nachthimmel der Regen weiter erbarmungslos auf mich herabprasselt.
Meine Haare und meine Klamotten sind klatschnass. Genau wie mein Gesicht. Aber in der Nässe, die mir über die Wangen läuft, sind keine Tränen.
Nur Regentropfen.
Nasse Wimpern, vertrocknetes Herz.
Ich presse mir beide Hände aufs Gesicht und frage mich, ob meine Teilnahmslosigkeit etwas damit zu tun hat, wie ich aufgewachsen bin, oder ob ich schon so zur Welt gekommen bin.
Was ist schlimmer für ein Kind – so sehr geliebt und behütet zu werden, dass es zu spät ist, die nötigen Skills zum Überleben zu lernen, wenn es erkennt, wie brutal die Welt ist? Oder so aufzuwachsen wie ich – in Verhältnissen, die so kaputt sind, dass Überleben das Einzige ist, was man lernt?
Als ich noch zu klein war, um selbst Geld zu verdienen und mir Essen zu kaufen, lag ich nachts oft mit Magenkrämpfen wach. Janean hatte mir erzählt, das Knurren in meinem Bauch käme von einer gefräßigen Katze, die in mir lebte und wütend werden würde, wenn sie nicht genug zu fressen bekäme. Jedes Mal, wenn mein Magen geknurrt hat, habe ich mir vorgestellt, wie die Katze verzweifelt in mir nach Fressen sucht und nichts findet. Ich hatte panische Angst, sie würde mich von innen auffressen, wenn ich sie nicht füttere, und habe deswegen manchmal Dinge in mich reingestopft, die gar kein echtes Essen waren, um sie zu besänftigen.
Einmal hat Janean mich so lange allein gelassen, dass ich irgendwann alte Bananen- und Eierschalen aus dem Müll gegessen habe. Ich habe sogar mal versucht, etwas von der Schaumstofffüllung aus den Couchkissen zu essen, aber das Zeug war zu trocken, ich hab es nicht geschafft, es runterzuschlucken.
Ich glaube nicht, dass Janean mich jemals länger als ein oder zwei Tage allein gelassen hat, aber wenn man ein Kind ist, kommt einem das wie eine Ewigkeit vor.
Ich erinnere mich an Nächte, in denen sie sturzbesoffen ins Haus gestolpert ist und auf die Couch fiel, wo sie stundenlang komatös ihren Rausch ausschlief. Ich hab mich dann zu ihren Füßen zusammengerollt, um auf sie aufzupassen.
Wenn ich am nächsten Tag aufgewacht bin, stand sie manchmal am Herd und hat uns Essen gemacht. Nicht immer richtiges Frühstück, oft waren es nur Erbsen aus der Dose oder Instant-Hühnersuppe mit Nudeln.
Als ich sechs war, fing ich an, Janean ganz genau zuzuschauen und mir alle Handgriffe zu merken, um mir selbst etwas kochen zu können, wenn sie das nächste Mal verschwand.
Wie viele Sechsjährige sich wohl beibringen müssen, einen Gasherd zu bedienen, weil sie Angst haben, von einer ausgehungerten Katze in ihrem Bauch aufgefressen zu werden, falls sie es nicht schaffen, sie rechtzeitig zu füttern?
Wahrscheinlich ist es einfach eine Frage von Glück oder Pech. Die meisten Eltern hinterlassen nach ihrem Tod eine schmerzhafte Lücke. Die übrigen werden durch den Tod zu besseren Eltern, als sie es im Leben je waren.
Sterben war das Netteste, was meine Mutter je für mich getan hat.
∼
Buzz hat gesagt, ich soll mich hinten in seinen Streifenwagen setzen, um nicht im Regen zu stehen, während sie ihre Leiche aus dem Haus holen. Ich habe wie betäubt zugeschaut, als sie die mit einem weißen Leintuch abgedeckte Bahre rausgetragen und in den Wagen der Gerichtsmedizin geschoben haben. Ein Notarzt ist gar nicht erst gerufen worden. Der hätte ja auch nichts mehr tun können. Wenn in unserer Stadt jemand unter fünfzig stirbt, ist das in den meisten Fällen auf irgendeine Art von Sucht zurückzuführen. Welche Droge den Leuten den Rest gibt, ist egal. Am Ende sind sie alle tödlich.
Ich drücke meine Wange an die Scheibe und spähe zum Himmel. Sterne sind heute nicht zu sehen. Nicht mal der Mond. Bloß Blitze, die immer wieder durchs Dunkel zucken und schwarz zusammengeballte Wolken aufleuchten lassen.
Das passt.
Buzz öffnet die Wagentür und beugt sich zu mir herunter. Der Regen hat sich mittlerweile zu einem Nieseln abgeschwächt und sein Gesicht sieht aus wie mit Schweißperlen überzogen.
»Soll ich dich irgendwohin fahren?«, fragt er.
Ich schüttle den Kopf.
»Willst du jemanden anrufen? Du kannst gern mein Handy benutzen.«
Ich schüttle wieder den Kopf. »Schon okay. Darf ich jetzt wieder rein?«
Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich wieder in das Haus zurückwill, in dem meine Mutter eben ihren letzten Atemzug getan hat, aber eine Alternative fällt mir im Moment nicht ein.
Buzz richtet sich wieder auf, macht einen Schritt zur Seite und klappt seinen Regenschirm für mich auf, obwohl der Regen nachgelassen hat und ich sowieso schon vollkommen nass bin. Er läuft hinter mir her und hält den Schirm über mich, während ich zum Haus gehe.
Ich kenne Buzz nicht besonders gut. Dafür kenne ich seinen Sohn – Dakota – besser, als mir lieb ist.
Ob Buzz weiß, was er da großgezogen hat? Buzz wirkt wie ein anständiger Kerl. Er hat mir und meiner Mutter nie Stress gemacht. Manchmal hält er auf seiner Streifenfahrt durch den Trailerpark an, wenn er an mir vorbeikommt. Er fragt dann immer, wie es mir geht, und ich habe jedes Mal das Gefühl, er erwartet halb, dass ich ihn anflehe, mich hier rauszuholen. Aber das mache ich nicht. Leute wie ich sind darin geübt, anderen sehr überzeugend vorzuspielen, dass alles okay ist. Ich lächle ihn immer an und behaupte, dass es mir gut geht, worauf er seufzt, als wäre er erleichtert, dass ich ihm keinen Grund gebe, das Jugendamt zu informieren.
Als ich wieder im Wohnzimmer stehe, bleibt mein Blick automatisch an der Couch hängen. Sie sieht anders aus. So als wäre jemand darauf gestorben.
»Kommst du heute Nacht klar?«, fragt Buzz.
Ich drehe mich zu ihm um. Er steht mit dem aufgespannten Schirm vor der Tür und sieht mich an, als würde er versuchen, Mitleid zu haben, obwohl er im Geist wahrscheinlich schon mit dem Papierkram beschäftigt ist, den er wegen der Sache jetzt gleich erledigen muss.
»Ja, ich bin okay.«
»Du kannst morgen Vormittag zum Beerdigungsinstitut, um alles Notwendige zu besprechen. Ab zehn ist jemand dort, haben sie gesagt.«
Ich nicke, aber statt sich zu verabschieden, tritt er unbehaglich von einem Fuß auf den anderen, klappt dann seinen Regenschirm vor der Tür zusammen und kommt einen Schritt ins Haus. »Nur damit du es weißt …« Seine Miene ist so angestrengt, dass seine Stirn Falten bis in die Glatze wirft. »Falls du nicht zum Beerdigungsinstitut gehst … Also … Die Bestattungskosten werden vom Staat übernommen, wenn sich keine Angehörigen melden. Dann gibt es zwar keine Trauerfeier, dafür kriegst du aber auch keine Rechnung.« Er sieht aus, als würde er sich schämen, mir diesen Vorschlag zu machen. Sein Blick huscht zu dem Bild von Mutter Teresa, dann starrt er auf seine Schuhe, als hätte sie ihn getadelt.
»Ja, danke.« Ich kann mir sowieso nicht vorstellen, dass jemand zur Trauerfeier gekommen wäre.
Das ist traurig, aber wahr. Meine Mutter war so einiges – aber vor allem war sie sehr allein. Natürlich hat sie in den Kneipen, in denen sie seit fast zwanzig Jahren jeden Tag abhing, Leute gekannt, aber das waren keine Freunde. Bloß andere einsame Menschen, die sich dort getroffen haben, um wenigstens gemeinsam einsam zu sein.
Wegen der Drogen, die unsere Stadt langsam kaputt machen, sind von denen aber auch immer weniger übrig. Abgesehen davon sind das keine Leute, die sich auf Beerdigungen blicken lassen. Die meisten werden wegen unbezahlter Bußgelder und anderer kleiner Vergehen polizeilich gesucht und meiden offizielle Zusammenkünfte aus Angst, dass die Cops die Gelegenheit nutzen, eine Razzia zu machen.
»Möchtest du vielleicht deinen Vater anrufen?«, fragt Buzz.
Ich überlege einen Moment. Es ist klar, dass ich das früher oder später tun muss. Allerdings würde ich es gern noch ein bisschen rauszögern.
»Hör zu, Bea …«
»Bay-ah«, korrigiere ich ihn, obwohl ich selbst nicht weiß, warum ich das mache. Er hat meinen Namen schon immer falsch ausgesprochen, aber bis jetzt war mir das egal, weshalb ich nie etwas gesagt habe.
»Beyah«, wiederholt er, diesmal mit der richtigen Betonung. »Ich will mich nicht in deine Angelegenheiten mischen, aber … du musst raus aus dieser Stadt. Du weißt selbst, was hier aus Leuten wie …« Er gerät ins Stocken. Wahrscheinlich will er mich nicht verletzen.
Ich beende den Satz für ihn. »Leuten wie mir, meinen Sie?«
Er sieht noch verlegener aus, obwohl ich weiß, dass er es nicht persönlich meint. Er spricht von Leuten mit Müttern, wie ich sie hatte. Leuten ohne Geld und ohne jede Chance, jemals hier wegzukommen. Leuten, die Tag und Nacht in Fressbuden schuften müssen, bis sie sich selbst nicht mehr spüren. Irgendwann bietet ihnen der Burgerbrater oder ein anderer Kollege eine Nase voll Stoff an, mit dem ihnen der Rest der Schicht wie eine wilde Party vorkommt, und bevor sie richtig kapieren, was los ist, können sie keine einzige Sekunde ihrer erbärmlichen Existenz mehr ohne diesen Kick ertragen. Ihn zu bekommen, wird ihnen sogar wichtiger, als sich um ihr eigenes Kind zu kümmern, bis sie dann anfangen, sich den Stoff direkt in den Blutkreislauf zu schießen, und irgendwann aus Versehen sterben – den letzten Blick auf Mutter Teresa gerichtet, obwohl sie doch eigentlich nur dieser ganzen Hässlichkeit entfliehen wollten.
Buzz ist anzumerken, wie unwohl er sich fühlt. Mir wäre es auch lieber, er würde jetzt gehen. Er tut mir gerade fast mehr leid als ich mir selbst, dabei bin ich doch diejenige, die ihre Mutter tot auf der Couch gefunden hat.
»Ich habe deinen Vater zwar nie kennengelernt, aber ich habe mitbekommen, dass er die Miete für euren Trailer gezahlt hat. Das reicht, um zu wissen, dass es besser für dich wäre, zu ihm zu ziehen, als in dieser Stadt zu bleiben. Wenn du eine Möglichkeit hast rauszukommen, musst du sie beim Schopf packen. Das Leben, das du hier lebst … ist nicht gut genug für dich.«
Wahrscheinlich ist das das Netteste, was jemals jemand zu mir gesagt hat. Und derjenige, der es sagt, ist ausgerechnet Dakotas Dad.
Buzz sieht mich einen Moment lang an, als würde er noch was hinzufügen wollen. Vielleicht will er auch, dass ich etwas sage. Aber wir schweigen beide und schließlich nickt er und geht. Endlich.
Nachdem die Tür hinter ihm zugefallen ist, drehe ich mich um und starre wieder auf die Couch. Ich starre so lang darauf, bis mir alles vor den Augen verschwimmt. Echt krass, wie sich das ganze Leben innerhalb der paar Stunden zwischen morgens aufwachen und abends ins Bett gehen komplett verändern kann.
So ungern ich es zugebe – Buzz hat recht. Ich kann nicht hierbleiben. Das hatte ich zwar auch nie vor, aber bis heute dachte ich, ich hätte wenigstens noch bis zum Sommer Zeit, meinen Abgang vorzubereiten.
Seit Jahren tue ich, was ich kann, um aus dieser Stadt rauszukommen, und mein Masterplan sieht vor, dass ich Anfang August einen Bus nach Pennsylvania besteige.
Ich habe mir ein Volleyball-Sportstipendium für die Penn State University erspielt. Ab August bin ich raus aus diesem Leben. Und das habe ich weder meiner Mutter noch meinem Vater zu verdanken. Sondern allein mir. Ich hab es mir aus eigener Kraft erarbeitet.
Das ist mein Triumph.
Ich ganz allein sorge dafür, dass aus mir der Mensch wird, der ich sein möchte.
Sollte ich irgendwann mal ein gutes Leben führen, wird Janean dazu nicht den allerkleinsten Beitrag geleistet haben. Von dem Sportstipendium hat sie nie erfahren. Ich habe niemandem davon erzählt und auch meine Trainerin gebeten, es geheim zu halten. Es gab keinen Artikel in der Lokalzeitung und keinen Hinweis unter meinem Foto im Highschool-Jahrbuch.
Meinem Vater habe ich auch nichts gesagt. Keine Ahnung, ob er überhaupt jemals mitbekommen hat, dass ich Volleyball spiele. Meine Trainer haben immer dafür gesorgt, dass ich alles hatte, was ich brauchte: Equipment, Schuhe, Trainingsklamotten. Ich war so gut, dass meine finanzielle Situation kein Hindernis für die Aufnahme ins Team war.
Ich musste meine Eltern nie um irgendwas bitten, um Volleyball spielen zu können.
Meine Eltern. Es fühlt sich falsch an, sie so zu nennen. Ich verdanke ihnen meine Existenz, aber das ist so ungefähr das Einzige, was ich je von ihnen bekommen habe.
Ich bin das Ergebnis eines One-Night-Stands. Mein Vater wohnt in Spokane, einem kleinen Ort im Bundesstaat Washington, und war geschäftlich in Kentucky unterwegs, wo er meiner Mutter begegnet ist. Dass er mit ihr ein Kind gezeugt hatte, bekam er erst mit, als ihm der Unterhaltsbescheid zugestellt wurde. Damals war ich schon seit drei Monaten auf der Welt.
Bis zu meinem vierten Geburtstag ist er einmal pro Jahr zu Besuch gekommen. Später hat er stattdessen dann immer ein Flugticket gezahlt und mich zu sich nach Washington kommen lassen.
Dieser Mann weiß nichts über mein Leben hier. Er weiß nicht, dass meine Mutter methsüchtig war. Er weiß nicht mehr über mich als das, was ich ihm erzählt habe – und das ist sehr wenig.
Ich gebe nur ungern Informationen über mein Leben preis. Geheimnisse sind das Einzige, was ich besitze.
Meinem Vater habe ich aus den gleichen Gründen nichts von dem Stipendium erzählt wie meiner Mutter. Er soll nicht stolz auf eine Tochter sein dürfen, die etwas erreicht hat. Auf das Kind, um das er sich praktisch nie gekümmert hat. Dieser Mann bildet sich ein, die Tatsache, dass er mich kaum kennt, mit einem monatlichen Unterhaltsscheck und gelegentlichen Anrufen bei mir auf der Arbeit kaschieren zu können. Dadurch, dass er zwei Wochen pro Jahr bereit ist, Vater zu spielen.
Dass wir so weit auseinander wohnen, macht es ihm einfach, seine Abwesenheit in meinem Leben vor sich selbst zu rechtfertigen. Ich habe in allen Sommerferien immer zwei Wochen bei ihm verbracht, aber die letzten drei Jahre habe ich ihn nicht mehr gesehen.
Seit ich mit sechzehn angefangen habe, in der Schulauswahl Volleyball zu spielen, nimmt der Sport bei mir einen so großen Raum ein, dass ich keine Lust mehr hatte, nach Washington zu fliegen. Seit drei Jahren denke ich mir jeden Sommer Ausreden aus, warum ich nicht zu ihm kommen kann.
Er tut so, als wäre er wahnsinnig enttäuscht.
Ich tue so, als würde es mir leidtun, dass ich so furchtbar viel zu tun habe.
Sorry, Brian – deine monatlichen Unterhaltszahlungen zeigen zwar, dass du eine gewisse Verantwortung übernimmst, aber sie machen dich noch lange nicht zu einem Vater.
Lautes Klopfen an der Tür lässt mich zusammenzucken. Als ich herumfahre, sehe ich unseren Vermieter durchs Fenster. Normalerweise würde ich Gary Shelby um diese Uhrzeit nicht mehr aufmachen, aber er weiß, dass ich noch wach bin. Weil ich kein Handy habe, musste ich vorhin von seinem Telefon aus die Polizei anrufen. Außerdem kann er mir sagen, was ich mit der Couch machen soll. Ich würde sie gern entsorgen.
Es regnet immer noch. Als ich die Tür öffne, schiebt er sich schnell an mir vorbei ins Haus und drückt mir einen Umschlag in die Hand.
»Was ist das?«, frage ich.
»Die Kündigung.«
Wäre er nicht Gary Shelby, wäre ich jetzt überrascht.
»Sie ist gerade eben erst gestorben. Hätten Sie nicht noch eine Woche warten können?«
»Sie ist drei Monate mit der Miete im Rückstand und ich vermiete meine Häuser nicht an Teenager. Entweder suchst du dir jemanden, der über einundzwanzig ist und den Vertrag übernimmt, oder du musst ausziehen.«
»Mein Vater zahlt die Miete. Wie können wir da drei Monate im Rückstand sein?«
»Deine Mutter hat gesagt, dass er vor drei Monaten aufgehört hat, Geld zu schicken. Mr Renaldo sucht schon seit Längerem ein größeres Haus für sich und seine Familie, deswegen habe ich beschlossen, ihm …«
»Sie sind ein Arschloch, Gary Shelby.«
Gary zuckt nur mit den Schultern. »Ich habe nichts zu verschenken. Deine Mutter hatte schon die zweite Mahnung bekommen. Dir fällt sicher jemand ein, der dich bei sich aufnimmt. Mit sechzehn darfst du hier sowieso nicht alleine wohnen.«
»Ich bin letzte Woche neunzehn geworden.«
»Macht keinen Unterschied. Meine Mieter müssen mindestens einundzwanzig sein. Steht so im Vertrag. Das und dass die Miete pünktlich gezahlt werden muss.«
Ich bin mir sicher, dass er mich nicht einfach so rausschmeißen darf und ich gerichtlich dagegen vorgehen könnte, aber ich sehe keinen Sinn darin. Ich will sowieso nicht hierbleiben.
»Wie viel Zeit geben Sie mir?«
»Bis Ende der Woche.«
Bis Ende der Woche? Ich besitze noch exakt siebenundzwanzig Dollar und habe absolut keine Ahnung, wo ich unterkommen soll.
»Können Sie mich nicht noch zwei Monate hier wohnen lassen? Ab August gehe ich aufs College.«
»Wenn ihr nicht schon drei Monate im Rückstand wärt, würde ich es mir vielleicht überlegen. Aber das wären noch mal zwei Monate, die zu den drei dazukommen, und ich kann es mir nicht leisten, irgendjemanden fast ein halbes Jahr kostenlos hier wohnen zu lassen.«
»Sie sind so ein Arschloch«, murmle ich.
»Ja. Hast du schon mal gesagt.«
Ich gehe die kurze Liste der Leute durch, die mich für zwei Monate aufnehmen könnten, aber Natalie ist einen Tag nach unserem Schulabschluss sofort ins College gefahren, wo sie einen Sommerkurs macht, um vor dem Studium schon mal Credits zu sammeln. Meine wenigen anderen Bekannten haben entweder die Schule abgebrochen und sind auf dem besten Weg, die nächste Janean zu werden, oder haben Eltern, von denen ich auch ohne zu fragen weiß, dass sie mir nie erlauben würden, bei ihnen zu wohnen.
Becca käme vielleicht infrage, aber ihr Stiefvater ist ein total ekliger Typ. Da würde ich eher noch bei Gary Shelby einziehen.
Bleibt nur eine letzte Möglichkeit.
»Ich muss noch mal Ihr Telefon benutzen.«
»Es ist schon spät«, sagt er. »Das kann bis morgen warten.«
Ich dränge mich an ihm vorbei nach draußen und gehe die Treppe runter. »Dann hätten Sie bis morgen warten sollen, um mir zu sagen, dass ich obdachlos bin, Gary!«
Ich laufe durch den Regen zu seinem Haus. Gary ist der Einzige im Trailerpark, der noch einen Festnetzanschluss hat, und weil die meisten Leute, die hier wohnen, zu arm sind, um sich ein Handy leisten zu können, benutzen alle Garys Telefon. Jedenfalls wenn sie nicht mit der Miete im Rückstand sind und ihm aus dem Weg gehen.
Es ist fast ein Jahr her, seit ich meinen Vater das letzte Mal angerufen habe, aber ich kann seine Handynummer auswendig. Sie hat sich in den letzten acht Jahren nicht geändert. Er ruft mich ungefähr einmal im Monat während meiner Schicht bei McDonald’s an, aber ich lasse ihm meistens von Kollegen ausrichten, dass ich zu tun habe und nicht ans Telefon kann. Worüber sollte ich auch mit einem Mann reden, den ich kaum kenne? Lieber spreche ich gar nicht mit ihm, als ihm die immer gleichen lahmen Lügen aufzutischen: Mom geht es gut. – In der Schule läuft es gut. – Auf der Arbeit läuft es gut. – Alles ist gut.
Einen Augenblick lang muss ich gegen meinen überdimensionalen Stolz ankämpfen, dann tippe ich schnell seine Nummer ein. Ich erwarte die Mailbox, aber zu meiner Überraschung meldet sich mein Vater schon nach dem zweiten Klingeln.
»Ja? Brian Grim hier.« Seine Stimme ist heiser. Ich habe ihn wohl geweckt.
Ich räuspere mich. »Äh. Hey, Dad.«
»Beyah?« Jetzt, wo er weiß, dass ich es bin, klingt er um einiges wacher und sehr viel besorgter. »Was ist passiert? Ist alles okay bei dir?«
Mir liegt auf der Zungezu sagen: Janean ist gestorben, aber ich bringe es nicht heraus. Er hat meine Mutter ja kaum gekannt. Es ist unendlich lang her, seit er das letzte Mal in Kentucky war und die beiden sich gesehen haben – damals war sie noch ziemlich hübsch und sah nicht wie ein blasses, klappriges Skelett aus.
»Alles okay, ja«, behaupte ich.
Es wäre auch irgendwie komisch, ihm am Telefon zu sagen, dass sie tot ist. Damit warte ich lieber, bis wir uns sehen.
»Warum ruft du so spät an? Ist irgendwas los?«
»Ich hatte Spätschicht und musste erst mal jemanden finden, von dessen Telefon aus ich anrufen kann.«
»Aber wozu habe ich dir denn das Handy geschickt?«
Er hat mir ein Handy geschickt? Ich frage nicht mal nach. Bestimmt hat meine Mutter es vertickt, um dafür ein Tütchen von dem Stoff zu kaufen, der jetzt in ihren Adern gefriert.
»Ich hab eine Bitte«, sage ich. »Wir haben uns schon lang nicht mehr gesehen, und ich wollte dich fragen … ob ich noch mal zu dir kommen könnte, bevor das College anfängt.«
»Na klar«, antwortet er, ohne zu zögern. »Sag mir, wann du kommen willst, und ich besorge dir das Flugticket.«
Als ich den Kopf hebe, sehe ich, dass Gary im Raum steht und mir auf die Brüste starrt. Ich drehe mich weg. »Wie wäre es mit … morgen?«
Einen Moment lang herrscht Schweigen, dann raschelt etwas. Es hört sich an, als würde er aus dem Bett steigen. »Morgen? Ist sicher alles okay, Beyah?«
Ich lasse den Kopf in den Nacken fallen und schließe die Augen. »Ja«, lüge ich. »Janean ist nur gerade … Ich brauche einen Tapetenwechsel. Und ich vermisse dich.«
Ich vermisse ihn nicht. Ich kenne ihn kaum. Aber ich bin bereit, alles zu behaupten, wenn ich dafür ein Ticket bekomme, das mich schnellstmöglich von hier wegbringt.
Am anderen Ende der Leitung höre ich es jetzt klappern, als würde er etwas in seinen Computer tippen. Er murmelt die Namen von Fluggesellschaften und Abflugzeiten vor sich hin, dann sagt er: »Morgen früh geht ein Flug mit United nach Houston. Du müsstest allerdings in fünf Stunden am Flughafen sein. Wie viele Tage willst du bleiben?«
»Houston? Warum denn Houston?«
»Ich wohne doch jetzt in Texas. Schon seit eineinhalb Jahren.«
Solche Dinge sollte eine Tochter über ihren Vater wahrscheinlich wissen. Wenigstens hat er immer noch die alte Handynummer.
»Oh. Ja, stimmt. Hatte ich vergessen.« Ich massiere mir den Nacken. »Kannst du vielleicht erst mal nur einen einfachen Flug buchen? Ich weiß noch nicht, wie lange ich bleiben will. Vielleicht ein paar Wochen.«
»Alles klar. Dann buche ich jetzt. Wenn du morgen früh am Flughafen zum Schalter von United gehst, drucken sie dir deinen Boarding Pass aus. Ich hole dich dann in Houston ab.«
»Danke.« Ich lege auf, bevor er noch etwas sagen kann. Als ich mich umdrehe, deutet Gary mit dem Daumen über die Schulter zur Tür.
»Ich kann dich zum Flughafen fahren, wenn du willst«, meint er. »Natürlich nicht umsonst.« Er grinst so widerlich, dass mir übel wird. Wenn Gary Shelby einer Frau einen Gefallen tut, will er dafür nicht mit Geld bezahlt werden.
Aber wenn ich mich schon bei jemandem dafür bedanken muss, dass er mich zum Flughafen fährt, mache ich das lieber bei Dakota als bei Gary Shelby. An Dakota bin ich gewöhnt. Sosehr ich ihn verachte, muss man ihm eins lassen. Er ist wenigstens zuverlässig.
Also greife ich noch mal zum Telefon und wähle Dakotas Nummer. Mein Vater hat gesagt, dass ich in fünf Stunden am Flughafen sein muss – besser, ich versuche Dakota zu erreichen, solange er noch wach ist. Später geht er vielleicht nicht mehr ans Handy.
Ich bin erleichtert, als er sich meldet. »Ja?« Er klingt verschlafen.
»Hey. Du müsstest mir einen Gefallen tun.«
Dakota ist einen Moment lang still, dann sagt er: »Ernsthaft, Beyah? Mitten in der Nacht?«
Er fragt nicht mal, was ich brauche oder ob bei mir alles okay ist. Er ist einfach nur sofort genervt. Ich hätte das, was da zwischen uns läuft – wie auch immer man es nennen will, in dem Moment beenden sollen, in dem es angefangen hat.
Ich räuspere mich. »Ich muss zum Flughafen.«
Er stöhnt, als fände er mich lästig. Was nicht der Fall ist. Vielleicht bin ich für ihn nicht viel mehr als ein Konsumartikel, aber ich weiß auch, dass er von diesem Konsumartikel nicht genug kriegen kann.
Sein Bett quietscht, als würde er sich aufsetzen. »Ich hab kein Geld.«
»Ich rufe nicht deswegen … Darum geht es nicht. Ich muss bloß zum Flughafen. Bitte.«
Dakota stöhnt noch mal, dann sagt er: »Gib mir eine halbe Stunde.« Er legt auf.
Ich gehe wortlos an Gary vorbei und lasse beim Rausgehen die Fliegengittertür extra laut zuknallen.
Im Laufe meines Lebens habe ich gelernt, Männern nicht zu trauen. Die meisten, mit denen ich zu tun hatte, waren so wie Gary Shelby. Buzz ist zwar in Ordnung, aber ich kann nicht darüber hinwegsehen, dass er einen Sohn wie Dakota großgezogen hat. Und Dakota ist wie Gary Shelby, nur in hübscher und jünger.
Ich habe gehört, dass es auch so was wie gute Männer geben soll, aber das halte ich für ein Gerücht. Dakota habe ich mal für einen von den guten gehalten. War ein Irrtum. Die meisten sind wie er. Von außen sehen sie harmlos aus, aber unter den diversen Haut- und Gewebeschichten sind sie alle verdorben.
Als ich wieder zurück im Haus bin, gehe ich in mein Zimmer, sehe mich um und überlege, ob es überhaupt irgendwas gibt, das ich mitnehmen will. Ich habe nicht viel, was sich einzupacken lohnt, deswegen ziehe ich nur ein paar Sachen aus dem Schrank und hole meine Zahn- und meine Haarbürste aus dem Bad. Die Klamotten stopfe ich in einen Müllsack, bevor ich sie in den Rucksack packe, damit sie nicht nass werden, falls ich lange im Regen stehen muss.
Bevor ich rausgehe, um auf Dakota zu warten, nehme ich auch noch das Bild von Mutter Teresa von der Wand. Ich versuche erst, es in den Rucksack zu zwängen, aber es ist zu groß. Also hole ich noch einen Müllsack, verstaue das Bild darin und schleppe dann mich selbst und mein Gepäck nach draußen.
2
Eine tote Mutter, eine Zwischenlandung in Orlando und einen mehrstündigen unwetterbedingten Aufenthalt später bin ich da.
In Texas.
Sobald ich aus der Maschine in den schlauchartigen Durchgang zum Flughafengebäude komme, spüre ich, wie die Spätnachmittagshitze meine Haut schmelzen und brutzeln lässt, als wäre ich aus Butter.
Ohne jeden Funken Leben oder Hoffnung in mir setze ich mechanisch einen Fuß vor den anderen und folge den Schildern zur Gepäckausgabe, um einen Mann zu treffen, aus dessen DNA ich zwar zur Hälfte bestehe, der mir aber trotzdem wie ein Fremder vorkommt.
Ich habe keine schlechten Erfahrungen mit meinem Vater gemacht, an die ich mich erinnern könnte. Im Gegenteil – eigentlich gehören die Sommerferien bei ihm zu den wenigen guten Kindheitserinnerungen, die ich habe.
Meine negativen Gefühle ihm gegenüber haben eher mit den Erfahrungen zu tun, die ich nicht mit ihm gemacht habe. Je älter ich wurde, desto klarer habe ich erkannt, wie wenig Mühe er sich gegeben hat, zu einem Teil meines Lebens zu werden. Manchmal frage ich mich, was ich jetzt für ein Mensch wäre, wenn ich mehr Zeit mit ihm als mit Janean verbracht hätte.
Wäre ich genauso misstrauisch und skeptisch, wenn ich mehr gute als schlechte Zeiten erlebt hätte?
Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Manchmal denke ich, dass die Persönlichkeit eines Menschen mehr durch erlittene Verletzungen geprägt wird als durch positive Erfahrungen.
Freundlichkeit gräbt sich längst nicht so tief ins Gedächtnis ein wie Traumata, die unauslöschliche Scharten in die Seele schlagen. Sie lassen sich nicht einfach so wegwischen, und ich glaube, dass man mir auf den ersten Blick ansehen kann, wie beschädigt ich bin.
Vielleicht hätte ich mich ja anders entwickelt, wenn sich bei mir Negatives und Positives zumindest die Waage gehalten hätte, aber so war es leider nicht. Die guten Erfahrungen könnte ich an zwei Händen aufzählen. Die Verletzungen nicht mal dann, wenn ich die Hände sämtlicher hier in diesem Flughafengebäude versammelten Leute dafür benutzen dürfte.
Es hat eine Weile gedauert, bis ich die Mauer hochgezogen hatte, die mich und mein Herz vor Menschen wie meiner Mutter schützt. Vor Typen wie Dakota.
Aber jetzt bin ich das Mädchen aus Stahl. Komm ruhig her, Welt. Du kannst der Undurchdringlichen nichts anhaben.
Als ich um die Ecke biege und meinen Vater durch die Scheibe sehe, die den Sicherheitsbereich von der Wartehalle trennt, bleibe ich stehen. Mein Blick fällt auf seine Beine.
Vor zwei Wochen hatten wir Abschlussfeier an der Highschool, und obwohl ich natürlich niemals damit gerechnet habe, dass er kommt, hatte ich die ganz leise Hoffnung, er würde es vielleicht doch tun. Tja. Eine Woche vorher hat er bei McDonald’s eine Nachricht für mich hinterlassen, er hätte sich leider das Bein gebrochen und könnte deswegen nicht nach Kentucky reisen.
Von hier aus sehen seine beiden Beine vollkommen unversehrt aus.
Ich bin in diesem Moment wahnsinnig froh, dass ich meine Schutzmauer habe, weil mich seine Lüge sonst wahrscheinlich schwer getroffen hätte.
Wie er da so vor dem Gepäckband auf und ab geht, ist nicht das geringste Humpeln zu erkennen. Auch ohne Ärztin zu sein, bin ich mir ziemlich sicher, dass ein gebrochenes Bein länger als zwei Wochen braucht, um zu verheilen. Und selbst wenn es innerhalb dieser kurzen Zeit verheilt wäre, würde mein Vater bestimmt noch ein bisschen hinken.
Ich bereue es schon jetzt, hergekommen zu sein, dabei haben wir noch nicht mal ein Wort miteinander gewechselt.
Seit dem, was passiert ist, sind noch keine vierundzwanzig Stunden vergangen – zu wenig Zeit, um es wirklich zu begreifen. Meine Mutter ist tot, ich werde nie wieder einen Fuß nach Kentucky setzen und muss die nächsten Monate bei einem Mann wohnen, mit dem ich seit meiner Geburt insgesamt weniger als zweihundert Tage verbracht habe.
Aber auch das werde ich durchstehen.
So wie ich immer alles durchgestanden habe.
Als ich durch die Automatiktür in die Halle komme, schaut mein Vater in meine Richtung und entdeckt mich. Er hört auf, hin und her zu gehen, und bleibt, die Hände in die Taschen gerammt, einen Moment stehen. Irgendwie wirkt er nervös und das verschafft mir Genugtuung. Er soll ruhig wissen, dass er als Vater versagt hat.
Das werde ich ihn in den nächsten Wochen auch spüren lassen. Der Mann soll sich bloß nicht einbilden, er könnte alles Versäumte wiedergutmachen, indem er auf einmal den überfürsorglichen Superdaddy spielt. Ehrlich gesagt wäre es mir das Liebste, wenn wir bis August wie in einer Zweck-WG zusammenwohnen und nicht mehr als nötig miteinander kommunizieren würden.
Nach kurzem Zögern gehen wir aufeinander zu. Er hat den ersten Schritt gemacht; ich gehe bewusst langsamer, um den letzten zu machen. Weil ich mit meinem Rucksack, meiner Umhängetasche und dem Müllsack mit Mutter Teresa alle Hände voll habe, muss die Umarmung ausfallen, was mir sehr recht ist. Übertriebene Wiedersehensshows sind mir sowieso suspekt.
Statt uns zu umarmen, nicken wir uns nur unbehaglich zu. Es ist ganz offensichtlich, dass wir Fremde sind, die nichts gemeinsam haben außer einem grimmig klingenden Nachnamen und unseren Genen.
»Wow.« Er betrachtet mich kopfschüttelnd. »Du siehst so erwachsen aus. Und wunderschön. Und so groß … und …«
Ich ringe mir ein Lächeln ab. »Du siehst … älter aus.«
Seine schwarzen Haare sind mit grauen Strähnen durchzogen und sein Gesicht wirkt voller. Er sah immer schon gut aus – wobei wahrscheinlich die meisten kleinen Mädchen finden, dass ihre Väter gut aussehen. Aber jetzt erkenne ich, dass er tatsächlich objektiv ein attraktiver Mann ist.
Trotzdem bleibt er als Vater ein Vollversager.
Da ist noch etwas, das anders an ihm wirkt, aber nichts mit dem Älterwerden zu tun hat. Ich kann nicht sagen, was es ist, und weiß nicht, ob ich es mag.
Er deutet aufs Band. »Wie viel Gepäck hast du mit?«
»Drei Koffer.«
Die Lüge kommt mir ganz automatisch über die Lippen. Manchmal bin ich selbst beeindruckt von der Leichtigkeit, mit der ich lügen kann. Auch das ist eine Fähigkeit, die ich im Zusammenleben mit Janean gelernt habe. »Drei große rote Koffer. Ich hab gleich alles mitgenommen, was ich dann auch fürs College brauche.«
Ein Summer ertönt und das Gepäckband setzt sich in Bewegung. Mein Vater geht zu der Stelle, wo die Koffer und Taschen aus dem Schacht ausgespuckt werden. Ich schiebe die Riemen meines Rucksacks – der alles enthält, was ich besitze – höher auf die Schulter.
Ich habe noch nicht mal einen einzigen Koffer, geschweige denn drei rote. Aber wenn ich ihn glauben lasse, mein Gepäck wäre verloren gegangen, bietet er mir vielleicht an, die nicht existierenden Sachen zu ersetzen.
Natürlich ist es mies, ihn anzulügen, aber er hat sich offensichtlich auch nicht das Bein gebrochen, also sind wir quitt.
Wer lügt, wird belogen.
Es herrscht eine unangenehme Stille zwischen uns, während wir auf Gepäck warten, von dem ich weiß, dass es niemals kommen wird.
Nach einer Weile behaupte ich, ich müsste mich mal frisch machen, und fliehe auf die Toilette. Vor dem Flug habe ich meine McDonald’s-Klamotten gegen ein verblichenes Sommerkleid aus meinem Rucksack getauscht. Nachdem ich den ganzen Tag auf Flughäfen und in engen Flugzeugsitzen gesessen bin, ist es hoffnungslos zerknittert.
Beim Händewaschen betrachte ich mich im Spiegel. Die langweilig braunen Haare habe ich von meiner Mutter geerbt, die grünen Augen und den Mund von meinem Vater, auch wenn ich ihm sonst kaum ähnlich sehe. Aber meine Mutter hatte dünne, fast unsichtbare Lippen, also hat mein Vater mir abgesehen vom Nachnamen wenigstens etwas Gutes mitgegeben.
Auch wenn ich gewisse äußerliche Merkmale von den beiden in mir wiedererkenne, hatte ich nie das Gefühl, zu ihnen zu gehören. Es ist, als hätte ich mich als Kind selbst adoptiert und wäre seitdem allein für mich verantwortlich gewesen. Der Besuch bei meinem Vater fühlt sich deswegen auch exakt so an: wie ein Besuch. Ich habe nicht das Gefühl, nach Hause zu kommen. Ich habe nicht mal das Gefühl, ein Zuhause zurückgelassen zu haben.
Zuhause ist für mich so was wie ein mythischer Ort, nach dem ich schon mein ganzes Leben lang suche.
Als ich wieder in die Ankunftshalle komme, sind die anderen Passagiere alle schon gegangen und mein Vater steht an einem Schalter und füllt ein Formular aus, um mein angebliches Gepäck als verloren zu melden.
»Im System ist nirgends verzeichnet, dass Gepäckstücke eingecheckt wurden«, sagt der Angestellte der Fluggesellschaft zu ihm. »Kleben die Codes denn hinten auf dem Ticket?«
Auf den fragenden Blick meines Vaters antworte ich mit einem unschuldigen Schulterzucken. »Ich war ziemlich spät dran, deswegen hat Mom meine Sachen eingecheckt, als ich schon mit dem Ticket zum Gate unterwegs war.«
Ich drehe mich weg und tue so, als würde ich mich brennend für ein Werbeposter an der Wand interessieren. Der Mann am Schalter sagt, dass wir informiert werden, sobald das Gepäck aufgetaucht ist.
»Beyah?« Mein Vater zeigt zum Ausgang. »Zum Parkplatz geht es da lang.«
∼
Wir sind jetzt über zwanzig Kilometer gefahren, laut Navi sind es aber immer noch etwa hundert Kilometer bis zu seiner Adresse. Im Wagen riecht es nach seinem Aftershave und nach salzigem Ozean.
»Wenn wir zu Hause sind, ruhst du dich aus. Später kann Sara dann mit dir zur Mall fahren, damit du dir dort erst mal das Nötigste besorgst.«
»Wer ist Sara?«
Mein Vater schaut zu mir rüber, als würde er sich fragen, ob ich einen Witz mache.
»Sara. Alanas Tochter.«
»Alana?«
Er presst die Lippen aufeinander und richtet den Blick wieder auf die Straße. »Meine Frau? Ich habe dir letzten Sommer die Einladung zu unserer Hochzeit geschickt. Du hast zurückgeschrieben, dass du dir nicht freinehmen kannst.«
Oh. Die Alana. Stimmt. Ich weiß nichts über diese Frau außer ihrem Namen, der auf der gedruckten Einladung stand.
»Ich wusste nicht, dass sie eine Tochter hat.«
»Na ja. Wir beide haben ja auch schon länger nicht mehr miteinander gesprochen.« Das klingt ein bisschen wie ein Vorwurf.
Ich kann nur hoffen, dass ich seinen Tonfall falsch deute, weil ich nämlich nicht wüsste, mit welchem Recht er mir irgendwelche Vorwürfe machen könnte. Ich bin nichts als das Ergebnis eines One-Night-Stands, bei dem er es für eine gute Idee hielt, auf Verhütungsmittel zu verzichten.
»Ich schätze, wir beide haben uns eine Menge zu erzählen«, sagt er.
Oh ja, so kann man es ausdrücken.
»Hat Sara noch Geschwister?«, frage ich. Hoffentlich nicht. Die Information, dass ich die nächsten Wochen nicht nur mit meinem Vater, sondern mit zwei zusätzlichen Menschen verbringen muss, schockt mich schon genug. Noch so einen Schlag halte ich nicht aus.
»Sie ist Einzelkind. Ein bisschen älter als du, studiert im ersten Jahr und verbringt den ganzen Sommer zu Hause. Du wirst sie mögen.«
Mal abwarten. Ich hab Cinderella gelesen.
Er streckt die Hand nach der Klimaanlage aus. »Ist dir zu heiß? Zu kalt?«
»Alles okay.«
Lieber wäre es mir, er würde das Radio anmachen. Ich fühle mich noch nicht in der Lage, einfach entspannt mit ihm zu reden.
»Wie geht es deiner Mutter?«
Ich erstarre. »Sie ist …« Ich stocke. Wie soll ich es ihm sagen? Ich habe zu lange gewartet. Es würde extrem merkwürdig rüberkommen, wenn ich es ihm jetzt erzähle. Er würde sich Sorgen machen und sich fragen, warum ich es ihm nicht gleich gestern am Telefon oder eben am Flughafen gesagt habe. Und dann würde auch noch meine Lüge auffliegen. Ich habe am Schalter ja behauptet, meine Mutter hätte mich zum Flughafen gebracht.
»Der geht’s seit Langem mal wieder ziemlich gut.« Ich taste unter meinem Sitz nach dem Griff, um ihn zurückzustellen. Stattdessen finde ich mehrere Knöpfe, die ich abwechselnd drücke, bis sich die Rückenlehne endlich nach hinten neigt. »Weckst du mich, wenn wir angekommen sind?«
Mein Vater nickt, und ich fühle mich mies, aber ich will jetzt einfach nur die Augen zumachen, versuchen zu schlafen und Fragen aus dem Weg gehen, von denen ich nicht weiß, wie ich sie beantworten soll.
3
Ein heftiger Ruck geht durch meinen Körper. Meine Augen fliegen auf und ich bin mit einem Schlag hellwach.
»Entschuldige«, sagt mein Vater. »Es holpert immer ein bisschen, wenn man die Rampe zur Fähre rauffährt.«
Ich sehe zu ihm rüber und bin im ersten Moment verwirrt, aber dann kommt alles wieder zurück.
Meine Mutter ist gestern Abend gestorben.
Mein Vater weiß noch nichts davon.
Ich habe eine Stiefschwester und eine Stiefmutter.
Ich sehe mich um, aber um uns herum stehen lauter Autos, die nach allen Richtungen die Sicht versperren. »Warum sind wir auf einer Fähre?«
»Laut Navi ist auf dem Highway 87 schon seit zwei Stunden Stau. Wahrscheinlich ein Unfall. Mit der Fähre kommen wir schneller auf die Bolivar Peninsula.«
»Wohin?«
»Das ist eine Halbinsel vor Galveston. Alana hat dort ihr Sommerhaus. Du wirst begeistert sein.«
»Ihr Sommerhaus?« Ich ziehe eine Braue hoch. »Du hast eine Frau geheiratet, die Häuser für verschiedene Jahreszeiten hat?«
Mein Vater lacht, dabei war die Frage ernst gemeint.
Als ich das letzte Mal bei ihm war, hat er in einem billigen Zwei-Zimmer-Apartment gewohnt. Ich habe damals im Wohnzimmer auf der Couch geschlafen. Und jetzt hat er eine Frau, die Häuser – Plural – besitzt?
Und auf einmal begreife ich, warum er so verändert wirkt. Es ist nicht das Alter. Es ist das Geld.
Mein Vater war nie wohlhabend. Noch nicht mal annähernd. Er hat zwar genug verdient, um den Unterhalt für mich zu zahlen und sein Leben zu finanzieren, aber er hat gespart, wo er nur konnte. Plastikbecher hat er zum Beispiel immer mehrmals benutzt und sich die Haare selbst geschnitten.
Aber wenn ich ihn mir jetzt so ansehe, erkenne ich deutlich die kleinen Veränderungen, die dafür sprechen, dass Geld mittlerweile kein Problem mehr ist. Ein guter Haarschnitt. Markenklamotten. Ein Wagen, der elektrische Knöpfe hat statt Hebel.
Mein Blick fällt auf das Lenkrad, in dessen Mitte eine kleine silberne Raubkatze im Sprung abgebildet ist.
Mein Vater fährt einen Jaguar.
Ich spüre, wie sich mein Gesicht zu einer Grimasse verzieht, und schaue schnell nach rechts aus dem Fenster, damit er den Abscheu nicht sieht. »Bist du jetzt reich?«
Wieder lacht er leise. Ich hasse Leute, die so selbstzufrieden in sich hineinlachen. Das klingt so dermaßen herablassend. »Ich bin beruflich mittlerweile zwar ein bisschen weiter als noch vor ein paar Jahren, trotzdem verdiene ich nicht so viel, dass ich mir ein Sommerhaus leisten könnte. Aber Alana hat nach ihrer Scheidung Vermögensanteile von ihrem Ex-Mann bekommen und ist außerdem Zahnärztin.«
Eine Zahnärztin.
Es wird immer schlimmer.
Ich bin mit einer drogensüchtigen Mutter in einem Trailerpark aufgewachsen, und jetzt werde ich den Sommer in einem Strandhaus verbringen, das meiner Stiefmutter gehört, die Zahnärztin ist, was bedeutet, dass diese Sara mit allergrößter Wahrscheinlichkeit eine total verwöhnte Bonzenzicke ist – also das komplette Gegenteil von mir.
Ich hätte in Kentucky bleiben sollen.
Ich kann sowieso nicht gut mit Menschen, aber mit Menschen, die Geld haben, kann ich noch viel weniger.
Ich muss dringend raus aus diesem Wagen. Ich muss einen Moment allein sein.
Per Knopfdruck stelle ich meinen Sitz wieder gerade und sehe mich um, ob irgendwelche anderen Leute aus ihren Wagen aussteigen. Ich war noch nie am Meer und auch nicht auf einer Fähre. Mein Vater hat, solange ich denken kann, in Spokane gewohnt. Kentucky und Washington sind die einzigen Bundesstaaten, in denen ich jemals gewesen bin.
»Darf man aussteigen?«
»Klar«, sagt er. »Du hast ungefähr fünfzehn Minuten, bis wir anlegen.«
»Kommst du mit?«
Er schüttelt den Kopf und greift nach seinem Handy. »Ich muss noch ein paar Anrufe erledigen.«
Ich öffne die Wagentür, steige aus und schaue mich um. Am Heck der Fähre sehe ich Eltern mit Kindern, die den umherfliegenden Möwen Brot hinwerfen. Ein paar Leute stehen am Bug und auch auf dem Aussichtsdeck über mir sind Menschen zu sehen. Ich schlängle mich zwischen den Autos hindurch aus dem Blickfeld meines Vaters zur anderen Seite der Fähre, wo niemand ist.
Und dann umfasse ich mit beiden Händen das Geländer und schaue zum ersten Mal in meinem Leben aufs Meer hinaus.
Wenn Klarheit ein Duft wäre, würde er so riechen.
Ich bin mir sicher, dass ich noch nie purere Luft eingeatmet habe als jetzt gerade. Mit geschlossenen Augen nehme ich so viel davon in mich auf, wie ich nur kann. Ihr Salzgehalt hat etwas Reinigendes, als sie sich mit dem abgestandenen Rest Kentucky-Luft mischt, der immer noch in meiner Lunge hängt.
Der Wind peitscht mir die Haare ums Gesicht, weshalb ich sie mit beiden Händen zusammenfasse und mir mit dem Gummiband, das ich ums Handgelenk trage, einen Zopf mache.
Ich schaue nach Westen. Die Sonne geht gleich unter und der gesamte Himmel ist mit einem Wirbel aus Pink- und Orange- und Rottönen überzogen. Ich habe in meinem Leben schon viele Sonnenuntergänge gesehen, aber noch nie so einen – nicht mit einer Sonne, die wie eine riesige am Horizont lodernde Flamme aussieht, von der mich nicht mehr trennt als Wasser und ein schmaler Streifen Land.
Ich habe noch nie einen Sonnenuntergang gesehen, der mich so tief berührt hat. Er ist so schön, dass es mir die Tränen in die Augen treibt.
Was sagt es über mich aus, dass ich um meine Mutter noch keine einzige Träne vergossen habe, aber bei einem Naturschauspiel, das sich alle vierundzwanzig Stunden wiederholt, weinen muss?
Und trotzdem kann ich nicht anders. Es kommt mir vor, als hätte die Erde mit Wolken und Farben ein Gedicht in den Himmel gemalt, um sich bei allen zu bedanken, denen etwas an ihr liegt.
Ich hole noch einmal tief Luft und nehme mir vor, diesen Geruch, das Kreischen der Möwen und alles, was ich jetzt gerade fühle, niemals zu vergessen. Ich habe nämlich Angst, dass die Wirkung solcher Momente womöglich verblasst, je öfter ich sie erlebe. Können Menschen, die von ihrem Haus aus aufs Meer blicken, diesen Anblick eigentlich immer noch genauso schätzen wie ich, die ich von der Veranda meines Zuhauses aus immer nur auf die Rückwand des Hauses unseres Arschlochvermieters geschaut habe?
Ich beobachte, was die Leute um mich herum machen. Es gibt ein paar, die sich auch den Sonnenuntergang ansehen, aber die meisten sind in ihren Wagen sitzen geblieben.
Werde ich im Laufe dieses Sommers abstumpfen und die Schönheit des Sonnenuntergangs als Selbstverständlichkeit betrachten?
»Delfine!«, höre ich jemanden rufen, und obwohl ich wahnsinnig gern einen echten Delfin sehen würde, gehe ich in die entgegengesetzte Richtung der Leute, die sofort wie von einer Lichtquelle angezogene Insekten zum Bug laufen.
Am Heck der Fähre steht jetzt niemand mehr und ich bin hier auch weiter von den Autos entfernt.
Plötzlich bemerke ich zu meinen Füßen eine halb leere Tüte Toastbrot. Das ist der Rest des Brots, mit dem die Kinder die Möwen gefüttert haben. Sie ist wohl einem von ihnen aus der Hand gefallen, weil sie es so eilig hatten, zu den Delfinen zu kommen.
Bei seinem Anblick knurrt unwillkürlich mein Magen. Außer einem Tütchen mit Mini-Salzbrezeln im Flugzeug habe ich seit der Mittagspause gestern nichts mehr gegessen – und auch da nur eine kleine Portion Pommes.
Ich vergewissere mich mit einem schnellen Blick, dass wirklich niemand neben mir steht, bücke mich dann verstohlen nach der Tüte, greife hinein und ziehe eine Scheibe Toast heraus.
An die Reling gelehnt, zupfe ich kleine Stücke davon ab, die ich zwischen den Fingern zu einer Kugel knete und mir in den Mund stecke.
So habe ich Brot immer schon gegessen. Langsam.
Es stimmt nämlich nicht – zumindest in meinem Fall –, dass Leute, die arm sind, alles Essbare, das sie in die Finger kriegen, gierig in sich reinstopfen. Ich habe mein Essen immer zelebriert, weil ich nie wusste, wann ich wieder etwas bekommen würde. Wenn ich als Kind noch eine letzte Scheibe Toast hatte, habe ich dafür gesorgt, dass sie bis zum Abend reicht.
Gut möglich, dass die neue Frau von meinem Vater auch noch kochen kann und die ganze Familie abends am Tisch sitzt und zusammen isst. Ziemlich gewöhnungsbedürftige Vorstellung.
Aber in den nächsten Wochen wird es wahrscheinlich eine ganze Menge Dinge geben, an die ich mich erst mal gewöhnen muss.
Das wird echt seltsam.