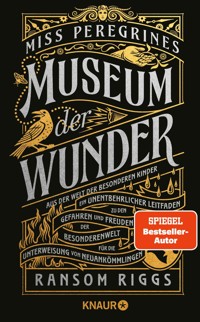12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Los Angeles: ganz magisch und voller Abenteuer! Los Angeles: ganz magisch und voller Abenteuer! Nach dem Tod seiner Mutter kämpft der 17-jährige Leopold Berry damit, den hohen Ansprüchen seines Vaters gerecht zu werden. Immer wieder passieren ihm merkwürdige Dinge, und als ihm Visionen der TV-Serie »Sunderworld« erscheinen, weiht er schließlich seinen Freund Emmet ein. Gemeinsam finden sie heraus, dass Sunderworld viel mehr ist als eine alte Fantasyserie aus den Neunzigerjahren: Die magische Welt ist real und in großer Gefahr! Wurde Leopold auserwählt, Sunderworld zu retten? Nur zu gern würde er beweisen, dass mehr in ihm steckt, als sein Vater denkt. Doch seine Rettungsmission für die magische Parallelwelt geht schrecklich schief. Leopolds Misserfolge sind beachtlicher – und viel erfolgreicher –, als er je zu träumen gewagt hätte. Der neue Fantasyroman von Bestsellerautor Ransom Riggs, dem Meister des Sonderbaren: actionreich, ungewöhnlich, fantastisch!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy:
www.Piper-Fantasy.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Sunderworld – Die beachtlichen Misserfolge des Leopold Berry« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Simon Weinert
© Ransom Riggs 2024
Published by Arrangement with Ransom Riggs
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»The Extraordinary Disappointments of Leopold Berry«, Dutton Books, New York 2024
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Piper Verlag GmbH, München 2025
Redaktion: Catherine Beck
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Guter Punkt, München, nach einem Entwurf von Paul Kepple / Headcase Design
Coverillustration: © 2024 Matt Griffin
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Abbildung
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Dreißig
Einunddreißig
Zweiunddreißig
Dreiunddreißig
Vierunddreißig
Fünfunddreißig
Sechsunddreißig
Siebenunddreißig
Achtunddreißig
Neununddreißig
Vierzig
Einundvierzig
Zweiundvierzig
Dreiundvierzig
Vierundvierzig
Fünfundvierzig
Sechsundvierzig
Siebenundvierzig
Achtundvierzig
Neunundvierzig
Fünfzig
Einundfünfzig
Zweiundfünfzig
Dreiundfünfzig
Vierundfünfzig
Fünfundfünfzig
Sechsundfünfzig
Siebenundfünfzig
Achtundfünfzig
Neunundfünfzig
Sechzig
Einundsechzig
Zweiundsechzig
Dreiundsechzig
Epilog
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Widmung
Für Tahereh
Abbildung
Eins
Leopold Berry wollte den Waschbären im Baum vor dem Fenster ignorieren, aber wie so viele Dinge im Leben schien ihm auch das unmöglich zu sein. Der Waschbär hockte auf einem Ast, genau auf einer Höhe mit dem Kopf des Mannes, dem Leopold zuhören sollte – des Mannes, der Leopold eben eine Frage gestellt hatte, die er nicht wirklich gehört hatte. Es kam ihm fast so vor, als würde ihn der Waschbär mit voller Absicht ablenken. Zweimal war das Vieh beinahe vom Baum gefallen, nur um sich mit viel Krallen und Rudern wieder auf den Ast zu ziehen. Und eben erst war sein Schwanz in Flammen aufgegangen.
Das Natürlichste wäre gewesen, seinen Vater und den Fragesteller auf das brennende Tier aufmerksam zu machen, gleichsam als Erklärung dafür, dass er die letzten paar Minuten so abgelenkt gewesen war. Das konnte er freilich nicht, denn eigentlich stand der Schwanz des Waschbären gar nicht in Flammen. Der Waschbär war eigentlich gar nicht da.
Derlei passierte Leopold manchmal.
Mit zwölf hatte ihm sein Therapeut erklärt, dass er eine zu blühende Fantasie habe – dass er immer dann, wenn er seinem Leben am dringendsten entkommen wolle, seltsame und unmögliche Dinge sehen würde. Früher hatte er oft unter diesen dissoziativen Episoden gelitten, aber dann waren sie jahrelang ausgeblieben. Vor einer Woche allerdings hatte Leopold gesehen, wie eine einzelne kleine Regenwolke einen gestressten Obsthändler auf einem Gehweg in Hollywood verfolgte. Und in der Woche davor, als er im Stau stand, hatte er durch die Windschutzscheibe seines Wagens einen Mann gesehen, der sich einen Zahn aus dem Mund brach und ihn in eine Parkuhr steckte, woraufhin sich ein Riss im Gehsteig auftat. Nach einem verstohlenen Blick nach hinten war der Mann in den Spalt geklettert und verschwunden, kurz bevor sich der Riss wieder geschlossen hatte. Aber das waren kurze Episoden gewesen, und Leopold hatte sich jedes Mal versichert, dass er sich keine Sorgen zu machen brauche. Wer ließ seiner Fantasie nicht schon mal freien Lauf, wenn er im Stau stand?
Jetzt aber der Waschbär.
Diese Episode dauerte länger als diejenigen mit dem Zahnmann und dem Obsthändler, und das beunruhigte ihn, zumal sie gerade äußerst ungelegen kam. Verzweifelt wünschte er sich, dass der Waschbär, der eigentlich sowieso nicht da war, verschwinden würde.
Mit einem verdrießlichen Wedeln des in Flammen stehenden Schwanzes tat dieser das nun auch.
Schon vor dem Waschbären war die Besprechung nicht gut gelaufen. Leopold wollte den Fragesteller, einen onkelhaften älteren Herrn mit Golfkleidern, der anfangs viel gelächelt hatte, nun aber den Eindruck machte, als wollte auch er lieber woanders sein, nicht absichtlich verärgern. Noch wollte er Richter auf die Palme bringen, seinen Vater mit der Tonnenbrust, der neben Leopold saß und vor Wut stumm vor sich hin kochte. Leopold gab wirklich sein Bestes, wenn auch nur, um Richter zu beschwichtigen, aber er konnte sich nicht konzentrieren. Der graue Anzug, den man ihm aufgenötigt hatte, schlackerte an einigen Stellen, während er an anderen spannte. Er war überzeugt, dass seine eigentlich so bleiche Haut rot angelaufen war. Viele der abgedroschenen Antworten, die er auf seines Vaters Anregung hin auswendig gelernt hatte, fielen ihm nicht mehr ein, und diejenigen, die ihm einfielen, klangen gezwungen. Und nun hatte er zugelassen, dass sechs Sekunden in quälendem Schweigen verstrichen waren, weil er auf einen nicht existierenden Waschbären vor dem Fenster gestarrt hatte.
Leopold richtete den Blick wieder auf den Mann hinter dem Schreibtisch.
»Entschuldigung, wie war noch mal die Frage?«
Hartes Leder knarrte, als Leopolds Vater die Finger in die Armlehnen krallte. »Larry ist nur etwas müde«, presste er zwischen wasserstoffweißen Zähnen hervor. »Der arme Junge war wegen des Treffens so aufgeregt, dass er heute Nacht kaum geschlafen hat.«
Larry war der Spitzname, den Leopold als Kind bekommen hatte und nie wieder losgeworden war. Larry Berry: Das klang wie eine Pointe. Der einzige Mensch, der ihn bei seinem richtigen Namen, Leopold, gerufen hatte, war seine Mutter gewesen, aber da der Name immer fremd klang, wenn andere ihn aussprachen, hatte er sich längst mit Larry zufriedengegeben, auch wenn er jedes Mal zusammenzuckte, wenn er ihn hörte.
Der Mann sah auf seine Armbanduhr. An der Wand hing stolz eine E-Gitarre mit den Autogrammen irgendeiner Band. »Kein Grund, nervös zu sein, Larry. Wir unterhalten uns doch nur.« Er grinste auf eine Weise, die Leopold beruhigen sollte. »Ich habe gefragt, was Ihre größte Stärke ist? Was meinen Sie, worin Sie am besten sind?«
Leopold räusperte sich. Er spürte den bohrenden Blick seines Vaters.
»Na ja, ähm, ich würde mal sagen …«
Er versuchte, sich eine der eingeübten Antworten ins Gedächtnis zu rufen, irgendetwas mit Führungsqualitäten und Problemlösung.
»… ich weiß es nicht so richtig?«
»Wenn du mich fragst, Mick«, mischte sich sein Vater ein, »ist Larrys Problem, dass er zu viele Stärken hat. Das macht es schwer für ihn, sich zu entscheiden, worauf er seine Energie fokussieren soll. Ein Fluch, der auf der Familie Berry lastet!« Er lachte wie eine stotternde Maschine.
Der Angesprochene kicherte höflich. »Dann mache ich es einfacher. Wie wäre es, wenn Sie mir Ihre drei größten Qualitäten nennen würden.«
Leopold fiel überhaupt nichts mehr ein. Er sah etwas zwischen den Zweigen vor dem Fenster flackern, zwang sich aber, es zu ignorieren. Seine Handflächen begannen zu jucken.
»Larry«, zischte sein Vater. »Musst nicht so bescheiden sein.«
»Bin ich nicht.« Leopold rutschte auf seinem Stuhl herum. »Aber ich … kann nichts am besten.«
Sein Vater gab einen erstickten Laut von sich.
»Na, na, ich bin sicher, dass das nicht wahr ist«, sagte der Mann mit den Fragen.
Aber Leopold erschien es wahr. Das Wahrste, was er seit Langem laut ausgesprochen hatte. Worin er außergewöhnlich gut war, waren Kleinigkeiten, die sein Vater kategorisch als wertlos betrachtete: sein altes Auto instand zu halten, an kleinen Elektrogeräten herumzubasteln und Filme zu drehen, die in der Welt einer bestimmten Fantasyfernsehserie spielten, die man abgesetzt hatte, bevor er zur Welt gekommen war. Er schämte sich dieser nichtigen Fähigkeiten, weshalb er sie nie erwähnte.
Der Mann zwinkerte. »Keine Sorge. Ich bin gut darin, verborgene Talente zu entdecken.«
»Das hoffe ich sehr«, grummelte Larrys Vater.
Nach Richter Berrys Ansicht gab es zwei Sorten Menschen auf der Welt: Gewinner und Verlierer. Dies hatte er in seinem ersten Buch Wie ein Gewinner denken dargelegt, auf dessen Veröffentlichung er seine Karriere als Erfolgsberater aufgebaut hatte, eine Tätigkeit, die perfekt zu ihm passte, denn sie bestand hauptsächlich darin, Leute anzuschreien. Solange er dabei lächelte, ließen sich erschreckend viele ausgeglichene Menschen von Richter Berry im Namen der persönlichen Weiterentwicklung schelten, Vorhaltungen machen und herabsetzen. Ganze Säle voll, und alle zahlten auch noch dafür.
Richter war sehr stolz auf sich und seine Stiefsöhne Hal und Drake. Hal, Captain der Wrestlingmannschaft der Highschool, und Drake, der im zweiten Jahr an der Handelsschule der USC studierte, entwickelten sich zu Abräumern im breitschultrigen Stil ihres Stiefvaters. Richter sorgte sich jedoch bereits seit Jahren, dass sein leiblicher Sohn, ein hagerer, verträumter, unkonzentrierter Junge ohne erkennbares Talent für oder Interesse an irgendetwas Praktischem, zu einem Menschen heranwachsen würde, der kein Gewinner war.
Aber Richter gab niemals auf.
Einen Versager in der Familie vermochte er nicht zu dulden. Das passte schlicht nicht zu seiner Marke. Er hatte seinem Sohn lauter einwandfreie Vorschläge für seinen künftigen Beruf gemacht: Larry konnte Jura studieren und Anwalt werden (vorzugsweise in einer Firma); er konnte Betriebswirtschaft studieren und eine Führungsposition einnehmen (in einem der fünfhundert weltgrößten Unternehmen, sonst hätte es freilich keinen Sinn); er konnte Finanzwesen studieren und bei Kapitalbeteiligungsgesellschaften einsteigen oder im Wertpapiergeschäft (idealerweise bei Goldman; der Junge war jedoch hoffnungslos mit Zahlen, weshalb das die unwahrscheinlichste der drei Optionen war). Larry brauchte nichts weiter zu tun, als sich etwas auszusuchen, und wie durch Zauberei hätte er den unschätzbaren Segen und die Unterstützung seines Vaters. Richter, der sich als Sohn eines Schweinezüchters in einem armseligen Kaff im Mittleren Westen hochgearbeitet hatte, hätte mit siebzehn Jahren alles für eine solche Gelegenheit getan. Der Junge war jedoch wie eine Katze: sonderbar, faul und fast unmöglich zu erziehen. Seine Mutter hatte ihm viel zu viel durchgehen lassen, weshalb Richter nun zum Ausgleich streng sein musste. Larry hatte immer wieder gezeigt, dass er selbst niemals streng zu sich sein würde, dass er vielmehr, sollte er die Möglichkeit dazu haben, sein restliches Leben mit dem Kopf in den Wolken zubringen und nichts zustande bringen würde. Als Larry nach unzähligen Vorträgen und Tiraden immer noch keine Option gewählt hatte, hatte Richter die (sehr teuren) Dienste des besten privaten Studienberaters in Los Angeles in Anspruch genommen. Dieser Mann brachte Schüler mit einer C-Note und ohne familiäre Beziehungen auf wundersame Weise nach Harvard und Verbrecher ohne jede Familie nach Stanford. Es war erstaunlich, dass sie überhaupt einen Gesprächstermin bekommen hatten. Nun aber vergeigte sein Sohn diese einzigartige Gelegenheit, vermutlich nur ihm zum Trotz.
»Und der Eignungstest?«, erkundigte sich Richter.
Das kugelsichere Lächeln des Studienberaters zerfiel. »Ich fürchte, der half auch nicht.«
Der Waschbär war zurück auf dem Ast, streckte ein Bein zum Himmel und leckte sich allen Ernstes die Geschlechtsteile.
»Larrys Ergebnisse waren ein wenig … uneindeutig. Seine Noten geben keinen Hinweis in die eine oder andere Richtung, wobei das nicht sonderlich ungewöhnlich ist. Im Test hat Larry bei allen Messwerten den Durchschnitt getroffen.« Er wirkte beinahe beeindruckt. »Das habe ich noch nie gesehen.«
»Sie wollen damit sagen«, schnaufte Leopolds Vater, »dass er völlig durchschnittlich ist?«
Der Berater zögerte. »Ich glaube, dass derartige Ergebnisse die Grenzen des Tests aufzeigen, nicht diejenigen Ihres Sohns. Und genau deshalb möchten wir unsere potenzielle Kundschaft gern persönlich kennenlernen.« Das potenziell schien in der Luft zu schweben. »Ich kann Ihnen helfen, Larry. Aber Sie müssen ehrlich zu mir sein.«
Hör auf, Larry zu mir zu sagen, dachte Leopold.
Der Berater formte mit beiden Händen ein Dreieck unterm Kinn. »Lassen wir Unis und Berufe einmal ganz außer Acht. Die wichtigste Frage lautet: Was magst du? Wofür brennst du?«
Leopold wollte instinktiv eine vorgefasste Antwort geben, aber die Aufmerksamkeit im Auge seines Gegenübers überrumpelte ihn. Er schien tatsächlich zuzuhören. Leopold wusste nicht, wann das ein Erwachsener das letzte Mal getan hatte. Deshalb drängte es ihn, etwas zu tun, das er in Anwesenheit seines Vaters fast nie tat: etwas zu sagen, das der Wahrheit nahekam.
»Na ja, ich glaube, ich könnte ganz gut Filme schneiden«, wagte Leopold sich vor. Für Regie führen fehlte ihm der Mut, und Schneiden klang nach einem erreichbaren und dennoch seriösen Berufsziel.
Sein Gegenüber beugte sich nickend vor.
»Ich dachte halt schon so an … die Filmhochschule.«
Sein Vater wischte mit der Hand herum. »Vier Jahre herumlungern.«
»Das könnte in der Tat perfekt sein«, erklärte der Berater. »Damit kann ich arbeiten.«
In Leopolds Brust keimte ein schwacher Hoffnungsschimmer. Vielleicht würde sich sein Leben ändern, eine Tür würde sich auftun, von der er bisher nichts gewusst hatte. Und dann sagte der Mann: »Du solltest mal über Recht in der Unterhaltungsbranche nachdenken. Einige der bestbezahlten Anwälte, die ich kennen, arbeiten für Filmstudios.« Und während er das beeindruckende Haus beschrieb, das einer dieser Anwälte in Malibu besaß, dröhnte es in Leopolds Kopf, und vor dem Fenster sah er etwas, das er nicht mehr ignorieren konnte: Der Waschbär, der nun ganz von Flammen eingeschlossen war und von Ast zu Ast sprang, hatte den Baum in Brand gesteckt. Rasch breitete sich das Feuer in der Baumkrone aus, und ein Schwarm Vögel, der ebenfalls Feuer gefangen hatte, flog auf und schwirrte in alle Richtungen davon.
Leopold wurde ganz steif und unterdrückte eine plötzliche Panik. Nicht weil der Baum brannte – er wusste, dass er nicht wirklich brannte –, sondern weil er es jetzt nicht mehr leugnen konnte.
Es geschieht wieder, dachte er.
Er sah nach Sunder.
Zwei
»Drogen. Er hat mich doch tatsächlich gefragt, ob du auf Drogen bist.«
Mehr sagte Richter Berry nicht zu seinem Sohn während des langen Marschs zurück zum Parkhaus, denn nach diesen Worten verfiel er in grimmiges Schweigen, das nur von seinem wütenden Schnauben unterbrochen wurde, einem angestrengten Pfeifen, das aus seiner Nase drang, während er leeren Blicks vor sich hin starrte und sich zu beruhigen versuchte, um überhaupt erst losschreien zu können.
Richter schwieg auch während der endlosen Fahrt im Aufzug in die stickigen unterirdischen Teile des Parkhauses. Er schwieg während des besoffenen Elefantenballetts, das sie veranstalten mussten, um aus dem vollgestopften Parkhaus herauszukommen – ein Vorgang, der wegen der unpraktischen Länge von Leopolds Volvo-Kombi und des Fehlens einer Einparkhilfe, einer rückwärtigen Kamera oder irgendeiner anderen modernen Erleichterung besonders schwierig war. Er schwieg, während Leopold sich mit dem ausgefransten Anschnallgurt abmühte. Dass Richter nicht einmal eine Bemerkung zu dem Volvo gemacht hatte, dem Familienschandfleck, in dem er nur fuhr, wenn sein Porsche – wie heute – in der Werkstatt war, bedeutete, dass er demnächst so richtig explodieren würde.
Den Zahlschalter erreichten sie ohne Zwischenfall, nur um festzustellen, dass sie drei fünfundsiebzig schuldig waren, obwohl Leopold das Parkticket entwertet hatte, man im Parkhaus nur bar bezahlen konnte und Leopold nichts als den Abriss eines alten Kinotickets und seinen Führerschein im Geldbeutel hatte. Er hütete sich, seinen Vater um Geld zu bitten, denn sonst würde es zu allem, was er sich ohnehin schon würde anhören müssen, als Zugabe noch die Predigt geben: Du bist nie vorbereitet. Panisch suchte er den Becherhalter, das Fach in der Tür und den unbenutzten Aschenbecher ab und hatte am Ende drei fünfzig zusammen, also immer noch einen Quarter zu wenig. Während hinter ihm schon gehupt wurde, entschuldigte Leopold sich bei der alten Dame hinterm Schalter, schnallte sich los und steckte den Arm in den Spalt des stoffbezogenen Sitzes. Dabei schnitt er sich den Finger, bekam Schmiermittel der Anschnallbuchse ans Handgelenk und fand zwei klebrige Zehncentmünzen. Das Kleingeld und die zusammengeknüllten Banknoten streckte er der Frau in hohlen Händen entgegen.
Diese nahm sie mit einem schwermütigen Seufzen entgegen und begann mit der Zählung. Sie sah aus wie eine junge Großmutter, gerade alt genug, dass Leopold sich fragte, was in ihrem Leben schiefgegangen war, dass sie einen solchen Job hatte und gezwungen war, den ganzen Tag im lichtlosen Untergrund eines Bürogebäudes in Beverly Hills Wechselgeld herauszugeben. Sie trug eine zerknitterte grüne Weste mit der gestickten Aufschrift Underground Parking Corp über dem Namensschild. Auf diesem stand Rochelle.
Wieder hupte es im dröhnenden Zwielicht. Leopold floss der Schweiß in den Kragen. Rochelle beendete ihre gemächliche Zählung und sah ihn dann ausdruckslos an. »Da fehlt noch ein Fünfer.«
»Ich weiß. Es tut mir wirklich leid. Mehr habe ich nicht.« Leopold hoffte, sie würde mit den Schultern zucken und ihn durchwinken, aber sie starrte ihn nur an.
Er versuchte es noch einmal. »Könnte ich ihn später vorbeibringen?«
Richter seufzte, beugte sich grob über Leopold und reckte der Frau eine Hundert-Dollar-Note entgegen. Die Standpauke, weil er angeblich nie vorbereitet war, war nun also unabwendbar. Die Kassiererin schürzte die Lippen und zeigte auf ein Schild, auf dem stand: Keine Scheine über $ 20. Richter Berry zog seine Hand gebieterisch langsam zurück, bevor er das Geld sorgfältig in sein Krokodillederportemonnaie steckte. Er zahlte am liebsten bar und hatte aus Prinzip keine kleineren Scheine als Hunderter bei sich. Dieses Prinzip führte er in Kapitel vier von Wie ein Gewinner denken aus.
»Sie können innerhalb von fünf Tagen per Post zahlen«, erklärte die Kassiererin mit monotoner Stimme. »Sonst geht der Fall an ein Inkassobüro. Ich gebe Ihnen die Adresse.«
Selbst im Dunkeln spürte Leopold, dass sein Vater hochrot anlief.
Die Kassiererin fuhr auf ihrem Drehstuhl herum, um nach einem Zettel zu greifen, da bemerkte Leopold, dass zwei Flügel aus dem Rückenteil ihrer Weste herauswuchsen. Sie waren mattgrau, ungefähr so groß wie ein Rucksack und lagen eingeklappt an ihren Schulterblättern, die Federn ein wenig zerknautscht vom langen Sitzen.
Leopold blinzelte, denn es juckte ihm im Gesicht.
Er schien ein wenig Zeit zu verpassen. Eben noch starrte er die Flügel an und fragte sich, wie sie ihre Kleider darüber bekommen hatte, und dann schreckte er schon wegen eines neuerlichen Hupens zusammen, und die Kassiererin hatte sich wieder zu ihm umgedreht. Sie sah ihn eigenartig an, während sie mit einem Zettel vor ihm herumwedelte.
Er streckte die Hand aus, um ihn zu nehmen, schaute dabei aber starr auf ihre Weste. Er war davon überzeugt, dass sich die Worte, die über ihrem Namensschild eingestickt waren, verändert hatten. Durch den Zusatz nur eines Buchstabens stand da nun: Sunderground Parking Corp.
Er flüsterte das Wort, seine Lippen formten es ohne seinen Willen.
Sunder.
Die Frau packte ihn am ausgestreckten Handgelenk. Ihre Hand war eisig, und sie hatte unglaubliche Kraft in den arthritischen Fingern, die sich wie Krallen in seine Haut gruben. Sie beugte sich zu ihm und flüsterte mit rauer und leicht drohender Stimme:
»So zu starren, ist unhöflich.«
Die Ahnung eines Lächelns glitt über ihre Lippen und verschwand gleich wieder.
Sie ließ ihn los. Er sackte auf seinen Sitz zurück. Die Schranke ging unter neuerlichem Hupen hoch.
»Fahr schon!«, blaffte Richter, der gerade von seinem Telefon aufsah, in das er etwas getippt hatte. »Wie kann man so unfähig sein?«
Leopold gab sachte Gas und beobachtete, wie die Reflexion der Frau im Rückspiegel kleiner wurde, bis das Sonnenlicht seine Windschutzscheibe traf und sie nicht mehr zu sehen war. Während Richter sich laut fragte, ob sein Sohn wirklich Drogen nahm, wartete Leopold auf eine Lücke im Verkehr und hielt das Lenkrad besonders fest, damit sein Vater nicht bemerkte, dass seine Hände zitterten.
Drei
Zum Glück schien Richter den bizarren Wortwechsel zwischen Leopold und der Parkhauskassiererin nicht bemerkt zu haben, noch hatte er die Flügel gesehen – natürlich, weil sie nicht da waren.
Aus Erfahrung wusste Leopold, dass sich seine Episoden in Dreiergruppen zu ereignen pflegten. Der Waschbär war die erste gewesen, die Sache in der Garage die zweite. Gemäß dem üblichen Auslöser – und dem Umstand, dass er so viel lieber irgendwo anders sein wollte, als mit seinem Vater im zunehmend dichten Verkehr im Auto eingesperrt zu sein – musste er wohl bald mit einer dritten Episode rechnen.
Das durfte er nicht zulassen.
Nicht, solange er am Steuer eines fahrenden Autos saß, und vor allem nicht, solange er Richter als Beifahrer hatte. Seinem Vater zu erzählen, was gerade mit ihm geschah, war undenkbar, weshalb Leopold sich auf die Straße konzentrierte und so tat, als wäre Richter nicht da. Er nickte nur hin und wieder, um Aufmerksamkeit zu simulieren. Vielleicht würde er es auf diese Weise nach Hause schaffen, ohne weitere in Flammen gehüllte Tiere und Parkhausengel zu sehen. Vielleicht würde er auf diese Weise keinen dreißig Sekunden langen Blackout erleiden und das Auto zu Schrott fahren.
»Verdammt, Larry, ich sagte doch, du sollst die Fountain Avenue nehmen!«
Richters plötzliches Bellen riss Leopold aus seinen Gedanken zurück auf den äußerst rechten Fahrstreifen des La Cienega Boulevards, wo er eben die entscheidende Abfahrt verpasst hatte. Dies löste die Predigt mit dem Titel »Nimm immer die Fountain« aus, die er mit leichtem Nicken und Entschuldigungen über sich ergehen ließ.
Schon früh hatte er gelernt, dass man mit seinem Vater nicht diskutieren konnte. Das machte die Predigten nur länger und ließ die emotionale Temperatur auf der Richterskala nach oben klettern. Man musste sie einfach über sich ergehen lassen, bis er irgendwann keine Kraft mehr hatte. Die Predigten mochten ruhige Vorträge sein oder wütende Standpauken, aber sie fielen immer in eine von mehreren Kategorien, die so vorhersehbar waren, dass Leopold ihnen Namen gegeben hatte. Nachdem sie das Parkhaus verlassen und sich im Verkehr verheddert hatten, hatte Richter mit der leidenschaftlichen Darbietung einer alten Lieblingspredigt losgelegt: »Noch nie in meinem Leben habe ich mich so geschämt«. Dann schwenkte er um auf: »Dir fehlt jeglicher Ehrgeiz«, schaltete sodann einen Gang herunter auf: »Schämst du dich denn nicht?«, und gelangte mit einer virtuosen Volte zu einer eigenartig selbstmitleidigen Version von »Bin selbst schuld, weil ich dich so verwöhnt habe« – das alles zwischendurch immer wieder garniert mit Höhepunkten aus der Predigt »Larry ist ein beschissener Autofahrer«, ein Klassiker, den Leopold schon auswendig aufsagen konnte.
An einer roten Ampel merkte er, dass der Volvo Sperenzien machte und auszugehen drohte. Leopold schaltete in den Leerlauf und gab Gas, damit dies nicht mitten auf der Straße passierte, denn damit hätte er ein lautstarkes »Ich sollte diesen beschissenen Haufen Altmetall verkaufen« ausgelöst – und diese Predigt hasste Leopold von allen am meisten.
Der Volvo – Bessie – war Leopolds liebster Besitz. Bessie war dottergelb, voller Rostflecken und hatte seiner Mutter gehört. Richter drohte regelmäßig, sie zu verkaufen, weil sie unzuverlässig und hässlich war und nicht zur Marke Berry passte. Dass er aus seinen Drohungen nie Ernst machte, war ein seltener Beweis für die Güte, die in seinem Vater steckte, und gleichsam das Eingeständnis, dass auch er Leopolds Mutter vermisste, auch wenn er es nie sagte. Das war, so mutmaßte Leopold, der einzige Grund, weshalb Richter zuließ, dass der Volvo noch in der Einfahrt stand.
Leopold warf einen Blick auf den Meilenzähler.
7261 Meilen.
Nach ihrem Tod hatte er ihn nie wieder auf null gestellt. Leopold brachte es nicht über sich, auf den Knopf zu drücken, denn er zählte eher die Meilen statt der Jahre seit ihrem Tod. Fünfeinhalb Jahre klang unendlich, unüberbrückbar lange. 7261 Meilen klangen irgendwie näher. Das war nicht mehr als ein Langstreckenflug.
Manchmal fuhr Leopold mit dem Fahrrad oder nahm den Bus, weil er es nicht ertrug, die Zahl anwachsen zu sehen. Manchmal, wenn er es im Haus seines Vaters nicht mehr aushielt, aber nicht wusste, wohin er sollte, stahl er sich hinaus und saß stundenlang im Auto, las etwas oder hörte Musik. Wenn es zu Hause ganz unerträglich war, schlich er nachts hinaus und schlief auf dem Rücksitz.
Grün.
Er schaltete in den ersten Gang, und der Volvo fuhr ruckelnd an. Irgendwann hatte sich die Predigt in eine Nacherzählung von Leopolds jüngsten Fehlschlägen gewandelt, die Richter an den Fingern abzählte. Aus der Baseballmannschaft rausgeschmissen. Bei der Praktikumsbewerbung abgelehnt. Als Ferienjob hast du bloß diese erbärmliche Stelle im Café gefunden. Und jetzt das …
Der stete Trommelschlag aus Versager, Versager, Versager drohte ihn zu ersticken.
Er zwang sich, an nichts zu denken. Beobachtete stattdessen, wie der Meilenzähler um eins hochrückte, und dachte an seine Mutter – und dann an Sunder.
Das eine löste oft das andere aus.
Vier
Kurz nach seinem zwölften Geburtstag im Dezember, der in Los Angeles ungewöhnlich heiß gewesen war, war Leopolds Mutter gestorben. An einer seltenen, aggressiven Krebsart und sehr schnell. Bevor der Krebs sie hinweggerafft hatte, hatte Monica Berry trotz ihres Zustands unbedingt noch den Geburtstag ihres Sohns feiern wollen, und in der bitteren Zeit nach ihrem Tod hatte Leopold das Bild eines vergessenen Luftballons verfolgt, der in einer Ecke des Krankenhauszimmers langsam geschrumpft war.
Im darauffolgenden Sommer, im Zwielicht eines sonnenlosen Junis, hatten seine Episoden angefangen.
Irgendwann hatte er sie »nach Sunder sehen« getauft.
Sunder war das fiktive Reich einer Fantasyfernsehserie aus den Neunzigerjahren namens Max’s Adventures in Sunderworld, die ein Jahrzehnt vor Leopolds Geburt ausgestrahlt worden war und dann nie wieder. In den verschwommenen Wochen nach der Beerdigung seiner Mutter, inmitten des hektischen Umzugs aus dem Bungalow in Venice in Richters Haus in Brentwood, hatte er die sieben VHS-Kassetten der ersten und einzigen Staffel in einem für den Müll bestimmten Karton gefunden. Er hatte die Kassetten davor nie gesehen und auch nie von der Serie gehört. Er nahm an, dass es eines der vielen Projekte war, bei denen seine Mutter als junge Frau während ihrer Zeit als Film- und TV-Assistentin mitgearbeitet hatte.
Er rettete die Kassetten und einen alten, ramponierten Videorekorder. Es dauerte jedoch einige Wochen, bis er sich die Mühe machte, den Rekorder an den Fernseher anzuschließen, und dann noch einmal ein paar Wochen, bis er, spätabends in seinem kalten neuen Zimmer in Richters Haus, die erste Kassette hineinschob.
Zunächst schaute er es sich nur mit mäßigem Interesse an, denn Sunderworld war ein wenig kitschig und sah billig aus. Hölzernes Schauspiel, dürftige Kulissen, und das Bild war manchmal sogar unscharf. Die Serie folgte den Abenteuern eines scheinbar unauffälligen Jungen namens Max, der auf der ausgedörrten Wiese hinter seinem Wohnsilo einen sprechenden, halb mechanischen Kojoten trifft. Der gestresste und kurz angebundene Kojote gibt Max einen Schlüssel, bevor er sich in Flammen auflöst. In der Unterführung unter einer Schnellstraße findet Max die zum Schlüssel passende Tür, entdeckt eine angenehm klischeehafte magische Gesellschaft, die sich in den Winkeln und Ecken von Los Angeles verbirgt, und findet schließlich heraus, dass er nicht nur ein Funke ist – wie die magisch befähigten Einwohner von Sunder sich nennen –, sondern ein überragendes Medium, ein Channeler, der große Macht besitzt, aber auch die Pflicht, Sunder vor Noxum zu beschützen, monströsen Eindringlingen aus dem Neunten Reich. Max lernt, wie man einen Ätherbündeler benutzt, und verbringt den Rest der Staffel damit, auf Sunders Straßen Noxum zu vermöbeln, und zwar auf sehr einfallsreiche – und für eine Kindersendung erstaunlich blutige – Weise.
Schon mit zwölf war Leopold die billige Produktion aufgefallen, aber die Serie und ihr abgefahrenes Fantasy-L. A. hatten etwas, das sein Herz gefangen nahm.
Es dauerte nicht lange, und er war völlig besessen von ihr.
Er schaute Sunderworld so oft, bis der antike Videorekorder Bandsalat aus seinen Kassetten machte, den er nur dank Essstäbchen und chirurgischer Präzision wieder aus dem Gerät herausfädeln konnte. Nachdem er alle Episoden auswendig konnte, gierte er nach mehr, denn die Geschichte war ganz eindeutig nicht zu Ende erzählt. Also machte er sich daran, selbst neue Episoden zu erfinden. Auf einem linierten Schreibblock verfasste er handschriftlich Drehbücher, trug Kostüme und Requisiten aus Flohmärkten zusammen und rekrutierte Kinder aus der Nachbarschaft als Schauspielende. Seinen besten Freund Emmet Worthington besetzte er als Max, und in Aufenthaltsräumen und Hinterhöfen in ganz L. A. spannen sie die Abenteuer von Max und seinen magischen Gefährten weiter. Viele Wochenenden verbrachten sie mit Dreharbeiten und bastelten nächtelang an Ungeheuern mit entstellten Gesichtern, aus denen fontänenartig Blut aus Maissirup herausspritzte. Sie brachten keine einzige Episode zu Ende, doch das spielte keine Rolle. In der traurigsten Zeit seines Lebens war Leopold immer dann glücklich, wenn er sich nach Sunder versetzen konnte.
»Vergiss die Fountain«, sagte sein Vater mit einem rauen Seufzen. »Dann nimm eben den Sunset. Ich muss mir sowieso die neue Reklame anschauen.«
Leopold, der versucht hatte, mittels vielen schmerzlichen Linksabbiegens in einem Bogen zur Fountain zurückzukehren, spürte, dass sich seine Brust löste, als er den Blinker zu einer relativ leichten Rechtsabbiegung setzte. Die emotionale Temperatur im Auto fiel allmählich. Der Verleger seines Vaters hatte eine physische Werbekampagne mit dessen Gesicht geschaltet, und die Aussicht darauf, sein eigenes Gesicht fünfzig Fuß breit auf den Sunset Boulevard herabblicken zu sehen, schien Richters Laune beinahe augenblicklich aufzuhellen.
Vorsichtig reihte sich Leopold in den sechsspurigen Zirkus ein, den der Sunset im Berufsverkehr darstellte. Jetzt musste er sie nur noch nach Hause bringen, ohne dabei nach Sunder zu sehen.
In jenem längst vergangenen Sommer, der auf den Tod seiner Mutter gefolgt war, war es zum ersten Mal passiert, als er gerade auf der Suche nach einem Drehort in der Nähe der Asphaltseen war. In einer Seitengasse zwischen Gardner und Detroit, wo lauter überquellende Müllcontainer herumstanden, hatte er zwei Rostteufel gesehen, die sich über einen Haufen alter Computer hermachten. Sie hatten mit auf den stumpfen Hauern aufgespießten Tastaturen aufgeschaut und Leopold grüne Galle entgegengespuckt.
Entsetzt war er nach Hause geflüchtet.
Leopold hatte es für einen Tagtraum gehalten. Aber eine Woche später war es erneut passiert. Er war mit Emmet und ein paar anderen Freunden in Hollywood gewesen. Dort hatten sie auf dem Gehsteig darauf gewartet, dass Emmets Mutter sie nach einer Matinee im El Capitan abholen würde. Die Gestalt in ihrem langen Ledermantel, den Stiefeln und dem gläsernen Ätherbündeler, der in einem Holster an ihrem Gürtel baumelte, war als Paladinfrau unverkennbar. Sie hätte eine der vielen Nachahmerinnen sein können, die in Hollywood Trinkgeld sammelten. Außerhalb von Leopolds kleinem Freundeskreis war Sunderworld jedoch vollkommen unbekannt – außerdem war der Kopf der Frau von einem hellen blauen Leuchten umhüllt gewesen.
Außer ihm hatte sie niemand bemerkt.
Als Leopold sich wieder gefasst hatte und ihr in den Waschsalon nebenan gefolgt war, war sie verschwunden. Diesmal jedoch hatte er keine Angst bekommen.
Vielmehr war er begeistert.
Max hatte in der Serie ebenfalls Dinge gesehen, die nicht zur Realität passten. Noch vor seiner Begegnung mit dem Kojoten, noch bevor er den Schlüssel bekommen hatte, hatte Max Einblicke in Sunder erhalten. Sie sollten seinen Verstand auf Sunder vorbereiten, damit er kein regelrechtes Trauma erlitte. Natürlich glaubte Leopold, seine Episoden sollten ihn nun auch auf Abenteuer vorbereiten, dass er bald einem halb mechanischen Boten begegnen, seinen eigenen Schlüssel bekommen und seine eigene Tür finden würde. Eine Gewissheit, wie er sie seit dem Tod seiner Mutter nicht mehr gehabt hatte.
Trotzdem erzählte Leopold niemandem davon, nicht einmal Emmet.
Er strich sich den Tag im Kalender an: Schlüssel wurden normalerweise zur Sommersonnwende vergeben. Aber nachdem die Sonnwende seines zwölften Lebensjahrs ohne den Besuch eines Schlüssel verleihenden Kojoten verstrich, war Leopold niedergeschmettert. Es zog ihm den Boden unter den Füßen weg, und der Tod seiner Mutter traf ihn mit voller Wucht, drohte ihn zu zermalmen. Sein Vater, der sich von seiner Frau verbittert hatte scheiden lassen, half Leopold nicht in dessen Trauer, sondern schleppte seinen Sohn zu einer Reihe von Trauertherapeuten. Der Junge versank in Düsternis und entfremdete sich vom Großteil seiner Freunde.
Als ein weiteres Jahr ohne Schlüssel verstrich, fragte sich Leopold, ob es vielleicht daran lag, dass er aus dem Haus ausgezogen war, in dem er so lange mit seiner Mutter gelebt hatte. Vielleicht hatte ein Beamter aus Sunder schlicht versäumt, dem Kojoten den Adresswechsel mitzuteilen. Deshalb verbrachte er die Sonnwende seines vierzehnten Lebensjahrs auf dem Bürgersteig vor dem alten Haus in Venice, in dem nun Fremde lebten.
Doch ihm wurde kein Schlüssel übergeben.
Vom stundenlangen Sitzen im Freien hatte er einen Sonnenbrand bekommen, aber kein Kojote war aufgetaucht.
Und mit vierzehn hatte er die Hoffnung schließlich aufgegeben, den Glauben verloren, hatte aufgehört, Funken und magische Geschöpfe zu sehen. Ein Therapeut hatte ihm zu der Einsicht verholfen, dass er diese Dinge nur sah, weil er diese Fantasievorstellungen brauchte, um durch die tiefsten Tiefen seiner Trauer zu gelangen.
In dieser Hinsicht hatte Sunder ihn gerettet, auch wenn es nur eine billige, alte Fernsehserie war. Zumindest dafür war er dankbar.
Er hatte die Requisiten weggeschmissen und die Kassetten in einem Schrank verstaut. Inzwischen dachte er nur noch selten an Sunder. Die Serie war so unbeliebt und abseitig, dass sie nie auf DVD oder Blu-ray veröffentlicht worden war. Es hatte sich noch nicht einmal jemand die Mühe gemacht, sie auf YouTube hochzuladen. Seit drei Jahren hatte er keinen einzigen Ausschnitt daraus mehr gesehen. Seit drei Jahren hatte er nicht mehr nach Sunder gesehen, auch wenn er seine Episoden nicht mehr so bezeichnete.
Und heute hatte er gleich zwei Episoden gehabt.
Und dann explodierte Richter, und das war die nächste.
Fünf
Auslöser war die Reklametafel. Sie stand auf einem Hügel über Carney’s Restaurant – auf der Nordseite der Straße gegenüber dem Sunset Tower Hotel –, und als sie in Sicht kam, bekam Richter augenblicklich einen Tobsuchtsanfall.
In den Namen seiner Website hatte sich ein Druckfehler eingeschlichen.
Leopolds Adrenalinspiegel schoss in die Höhe, während sein Vater brüllte, dass er den Drucker verklagen würde, und von seinem Sohn verlangte, dass er sich gefälligst ansehen sollte, mit welcher Inkompetenz er es zu tun hatte …
Leopold warf nur einen kurzen Blick auf die Reklametafel, und als er wieder auf die Straße sah, entdeckte er etwas Rotes, das den Großteil der Windschutzscheibe einnahm. Irgendein Bahnwaggon querte vor ihnen die Straße, raste über die Kreuzung – und sie würden direkt mit ihm zusammenstoßen.
Leopold schrie auf und stieg auf die Bremse.
Die Sitzgurte stellten sich fest, als eine Welle aus Abfall vom Rücksitz über sie hereinschwappte. Vom Hupen ausweichender Fahrzeuge untermalt, geriet der Volvo ins Schlingern. Das enthemmte Brüllen setzte ein, noch ehe das Auto ganz zum Stehen kam.
»Willst du uns umbringen?! Hast du den Verstand verloren?«
»Wir wären fast in diese … diese rote Bahn hineingefahren …«
»Welche Bahn? Was faselst du da? Tickst du noch richtig?«
Leopold sah erneut auf die Straße.
Keine Bahn fuhr links den Berg hinauf. Im Asphalt waren keine Schienen verlegt.
»Ich sollte dir den Führerschein entziehen!« Richter klaubte ein zerknittertes Hamburger-Papier von seinem Schoß und schleuderte es auf seinen Sohn. »Dieses Scheißteil wird gleich morgen früh verschrottet. Und diesmal meine ich es ernst.«
Sein Vater stieg aus, knallte die Tür zu, verdeckte einen Moment sein eigenes riesiges Gesicht und ging dann schnellen Schrittes den Sunset Boulevard entlang. Leopold sollte die Scheiße selbst ausbaden.
Dessen Hände zitterten und juckten. Er versuchte, den Volvo zu starten. Da er vorher bereits gestottert hatte, weigerte er sich jetzt natürlich, anzuspringen.
Vor blinder Wut stieß Leopold einen Schrei aus und schlug so fest er konnte mit beiden Händen gegen das Lenkrad – woraufhin rote Funken aus ihnen hervorspritzten wie aus einem Römischen Licht, ihn kurz blendeten und das Innere des Wagens mit bernsteinfarbenem Rauch füllten. Es dauerte ein paar Sekunden, bis dieser sich verzogen hatte und nur geisterhaft wirbelnde weiße Dampfschlieren in der Luft zurückblieben.
Völlig benommen hockte Leopold da, während sich auch diese letzten Spuren auflösten. Das Hupen und die anderen Geräusche vom Sunset Boulevard hörte er nicht mehr – nur das Rauschen des Pulses in seinem Ohr.
Er drehte die Hände und starrte sie an. Sie pochten ein wenig, aber abgesehen von der Reihe alter, ein wenig erhabener und mondförmiger Schwielen in der Mitte seiner beiden Handteller sahen sie ganz normal aus.
Allerdings juckten sie nicht mehr.
Sechs
Allmählich drang der Lärm der Stadt wieder an seine Ohren: Hupen, Bremsen, Brüllen. Er blockierte zwei Spuren des Sunset Boulevard im Berufsverkehr. Er versuchte zu vergessen, was mit seinen Händen geschehen war. Die Wirklichkeit war gerade dringlicher. Wenn es ihm nicht bald gelingen würde, seinen Wagen fortzubewegen, wäre es nur eine Frage der Zeit, bis er abgeschleppt würde, jemand hinten auffahren oder ihn erschießen würde.
Er drehte den Zündschlüssel, obwohl er wusste, dass es zwecklos war. Der Motor röchelte nur. Leopold seufzte und schlug mit dem Kopf gegen das Lenkrad, während ihn ein vertrautes Versagensgefühl einhüllte. Als er den Kopf wieder hob, sah er als Erstes das riesige Gesicht seines Vaters vor dem Himmel aufragen und Enttäuschung ausstrahlen. Und dann las er unter dem Titel des neuen Buchs, dass das vorige ein »sofortiger Bestseller« gewesen wäre. Da rief er sich die ungeöffneten Kisten voller Bücher ins Gedächtnis, die sein Vater für sich gekauft hatte und die sich in der Garage bis zur Decke stapelten, und etwas in Leopold verwandelte sich in heißes Metall.
Er riss an der Verriegelung der Motorhaube, stieß die Tür auf und stieg aus, ohne auf eine Lücke im Verkehr zu warten. Er ignorierte das Hupen der anderen Verkehrsteilnehmenden, ging um den Volvo herum, klappte die Motorhaube hoch und zupfte ein Kabelbündel neben dem Ansaugrohr auseinander. Das Kabel des Sauerstoffsensors hatte sich mal wieder gelöst. Er steckte es fest und umwickelte es mit Isolierband, das er für solche Fälle immer dabeihatte. Ein neuer Sensor war teuer, ihn zusammen mit den anderen zu erneuernden Teilen zu ersetzen, hätte mehr gekostet, als der Volvo wert war. Den Großteil des Gelds, das er diesen Sommer beim Cappuccino-Servieren im Café verdient hatte, hatte er in Bessie gesteckt, um noch mit ihr fahren zu können. Sein Vater hatte freilich keinerlei Interesse, Geld in ein Auto zu investieren, das Ölflecken in seiner unbefleckten Einfahrt hinterließ. Richter hatte sogar versucht, Leopold mit einem weniger alten und mechanisch überlegenen BMW zu bestechen, wenn der doch nur den Volvo aufgeben würde, aber Leopold hatte abgelehnt. Richter hatte die Sache ruhen lassen, weil er davon ausging, dass Kosten und Mühen, die mit den ständigen Reparaturen des Volvos verbunden waren, den Willen seines Sohns letztlich brechen würden. Leopold hatte jedoch gelernt, mit den meisten Pannen außer den komplexen Problemfällen selbst zurechtzukommen. So war er im vergangenen Jahr zu einem Experten geworden, was die scheinbar endlosen Macken eines Volvo 240 Kombi, Baujahr 1991, anging.
Das überraschte Richter nur deshalb, weil er seinen Sohn kaum beachtete. Leopold war schon immer stur und stolz gewesen und bastelte gern mit den Händen an komplizierten, technischen Dingen herum. Angefangen hatte es damit, dass er gelernt hatte, den altersschwachen Videorekorder zu reparieren, als er am Tag zehn Stunden Sunderworld geschaut hatte. In jüngerer Zeit hatte er der temperamentvollen, fünfzig Jahre alten Espressomaschine im Café neues Leben eingehaucht, als sie kaputtging. Leopold fand, dass er zu sich selbst kam, wenn er sich auf solche Aufgaben konzentrierte. Sie lenkten ihn von dem mentalen Treibsand aus Ängsten und Selbstzweifeln ab. Jetzt lenkte ihn das Zurückstecken des abgegangenen Sauerstoffsensorenkabels von der Frage ab, ob er den Verstand verlor. Während links und rechts gefährlich nahe Autos vorbeischossen, rätselte er, ob er die Grenze von der Sturheit zur Dummheit überschritten hatte. Schließlich riskierte er sein Leben für ein altes Auto. Vielleicht war es tatsächlich an der Zeit, Bessie aufzugeben.
Als er gerade mit dem Umwickeln der Steckung fertig war, tat es einen lauten Schlag, dass der Boden bebte und der erschrockene Leopold sich den Kopf an der Motorhaube anschlug. Er kroch darunter hervor, rieb sich den Schädel und sah zum Himmel – der vor einer Minute noch wie immer smogfarben angelaufen gewesen war –, an dem sich nun Gewitterwolken ballten.
Urplötzlich fing es an zu schütten. Er klappte die Motorhaube herunter und floh ins Auto, allerdings nicht schnell genug, denn er war bereits völlig durchnässt. Einen Moment lang saß er nur da und starrte auf seine noch pochenden Hände, dann hinaus in den Regen.
Im Hinterkopf flüsterte eine Stimme: War ich das?
Er verbannte den Gedanken und drehte den Zündschlüssel. Der Volvo sprang an.
Der Regen verwandelte die Windschutzscheibe in eine Tränenschliere aus gebrochenem Neonlicht. Er schaltete die Wischer ein, aber nur der auf der Beifahrerseite funktionierte. Der andere war schon im März von Vandalierenden abgebrochen worden – da hatte es in L. A. zum letzten Mal geregnet –, und er hatte sich noch nicht die Mühe gemacht, ihn zu ersetzen. Er bog den Oberkörper über die Mittelkonsole, um durch die gewischte Hälfte der Windschutzscheibe zu blicken, und fuhr, indem er mit gestrecktem Bein und spitzen Zehen die Pedale betätigte.
So reihte er sich in den stockenden Feierabendverkehr ein. Ein paar Straßen weiter stellte er fest, dass er nicht die Absicht hatte, nach Hause zu fahren. Er wollte seinem Vater nicht gegenübertreten, würde keine weitere Predigt ertragen und wollte Bessie nicht an einen Ort bringen, wo womöglich ein Abschleppwagen darauf wartete, sie zum Schrott zu transportieren. Wenn überhaupt jemand den Volvo entsorgen würde, dann wäre es Leopold selbst, wenn und wann er sich aus freien Stücken dazu entscheiden würde. Deshalb fuhr er einfach weiter, und der Glanz des touristischen Abschnitts des Sunset Boulevards wich den rauen Strip Malls Hollywoods, und er versuchte, sich zu erklären, was mit ihm geschehen war.
In der Rückschau schien alles nur zu offensichtlich.
Der brennende Waschbär, die geflügelte Frau, der rote Bahnwagen: Episoden, die sich alle nur in seinem Kopf abspielten. Und die roten Funken? Konnte sein Geist sich wirklich etwas derart real Wirkendes ausdenken, nur wenige Zoll von seinen Augen entfernt?
Er klappte die Finger seiner rechten Hand ein, um mit ihnen über die Narbe in seiner Handfläche zu fahren. Sie stammte von einer Wunde, die er sich vor Jahren selbst zugefügt hatte, als er oft so sehr die Fäuste geballt hatte, dass seine Fingernägel dauerhafte Halbmonde in seine Haut geschnitten hatten. Das Jucken und die Hitze könnten von einer neuen Phase des Heilungsprozesses herrühren, vermutete er. Er hatte gehört, dass Narben manchmal ein Jahrzehnt brauchten, um ganz zu verheilen.
Aber der Regen: Den hatte er sich nicht eingebildet.
Die Stadt litt unter einer monatelangen Dürre. Es war so trocken, dass in den Hügeln Waldbrände ausgebrochen waren. Kein Regen war angekündigt gewesen. Selbst Nieselregen hätte es in die Nachrichten geschafft. Plötzlich schien er nicht genug Luft einatmen zu können.
Natürlich hast du es nicht regnen lassen.
Den Gedanken auch nur zu erwägen, weckte in ihm das Gefühl, den Sinn für die Realität zu verlieren. Es war offensichtlich ein Zufall, und mehr daraus zu machen, war gefährlich. Wenn er sich zu glauben gestattete, dass er das Wetter beherrschen konnte, wer weiß, was er dann morgen glauben würde – und dann wären dem Wahnsinn sämtliche Tore geöffnet, und er wäre wieder in dem Zustand wie vor Jahren, als er auf sprechende Kojoten gewartet hatte, die ihm einen magischen Schlüssel brachten. Nein, nein, das war alles nur in seinem Kopf – alte, unverdaute Traumata, die wieder herausgewürgt wurden. Er betete, dass die Episoden aufhören sollten. Es war eine Sache, wenn ein verletzlicher Zwölfjähriger, der ein Elternteil verloren hatte, unter zeitweiligen Psychosen litt – um es beim Namen zu nennen –, aber bei einem fast Achtzehnjährigen, der sich eigentlich an einer Eliteuni bewerben sollte?
Der Regen wurde stärker, und der Verkehr bewegte sich nur noch im Kriechtempo. Selbst durch die gewischte Hälfte der Windschutzscheibe sah Leopold kaum noch etwas. Bessie schob sich langsam an einigen heruntergekommenen Motels vorbei, deren Schilder mit »Elektroheizung« warben. Als der Verkehr zum Stoppen kam, sammelte Leopold die Fast-Food-Verpackungen und Parktickets ein, die bei der Notbremsung nach vorn gepurzelt waren, und warf sie in eine Einkaufstüte. Als er damit fast fertig war, entdeckte er darunter etwas, das ihn stocken ließ.
Ein dünnes Buch, das fest unter dem Beifahrersitz gesteckt hatte. Es war der alte Thomas Guide seiner Mutter, ein Straßenatlas von Los Angeles in Spiralbindung mit einem verblichenen Foto der stoppeligen Skyline des Stadtzentrums auf dem Cover. Obwohl Leopold seit Jahren keinen Blick mehr darauf geworfen hatte, hatte er nie vergessen, dass der Atlas hier war.
Allerdings war er längst nicht mehr aktuell. Schon vor 7261 Meilen war er veraltet gewesen, aber seine Mutter hatte sich geweigert, ohne ihn irgendwohin zu fahren. Nur für den Fall, hatte sie immer gesagt, aber nie verraten, für welchen genau. Nachdem er den Führerschein gemacht hatte, hatte er ihn eines Tages aufgeschlagen und auf der Innenseite des Covers eine Notiz gefunden, eine Widmung an ihn in der Handschrift seiner Mutter.
Für Leopold. Nur für den Fall.
Er hatte ihn wieder unter den Sitz geschoben, als wäre er radioaktiv, und dort war er geblieben.
Auch jetzt schob er ihn wieder hinunter. Ein Lastwagen hupte, und Leopolds Kopf fuhr hoch, als hätte er etwas Verbotenes getan. Er trat aufs Gas, und Bessie fuhr mit einem Ruck an, wobei sein Herz unerklärlicherweise hämmerte – und dann erblickte er durchs Beifahrerfenster eine vom Regen verschwommene Gestalt, und sein Verstand kramte ein Wort hervor, an das er seit Jahren nicht mehr gedacht hatte.
Shiggoth.
Leopold beruhigte sich. Ein Shiggoth war ein eidechsenartiges Monster aus Sunderworld. Aber das hier war nur eine Frau, die sich mit einem triefenden Dach aus Karton vor dem Regen schützte und deren Haare tropften wie ein nasser Wischmopp. Sie lief auf eines der mit grellem Neonlicht werbenden Motels zu und stellte sich unter eine undichte Markise. Das Fade Inn war das schäbigste Motel der Gegend, die Fenster waren vergittert, und das Schild war kaputt und blinkte unregelmäßig.
Die Frau schien Leopold anzustarren, und sie drehte den Kopf mit, als sein Volvo im Schritttempo an ihr vorbeifuhr. Dann machte sie den Mund auf, und eine lange, schmale Zunge schoss heraus, schnappte etwas aus der Luft und rollte sich wieder ein.
Leopold dachte: Nein.
Das sollte sein Mantra sein.
Nein. Heute nicht.
Die Frau nahm sich einen Moment Zeit, um sich im Mund zergehen zu lassen, was immer sie gefangen hatte. Dann warf sie ihren Pappschirm weg und hastete in das Motel.
Nein, nein, nein, das passiert jetzt nicht, wiederholte Leopold vor sich hin. Der Verkehr löste sich, und er fuhr weiter.
Jetzt pochte sein Herz. Langsam bekam er es mit der Angst zu tun. Nicht vor den Erscheinungen, aber vor seinem eigenen Wahnsinn. Er fluchte und schimpfte, stieß eine lange, wütende Reihe von Verwünschungen aus, die an ihn selbst und sein verräterisches Gehirn gerichtet waren.
Ihm war bewusst, dass er das Auto stehen lassen und einen Uber rufen sollte, aber er war zu dickköpfig, um zwanzig Kröten für eine Strecke zu berappen, die er blind hätte fahren können. Seine Hände hatten sogar schon die Rechtsabbiegung auf die Las Palmas genommen, da sie anscheinend noch vor seinem Gehirn wussten, wo er hinwollte.
Denn er musste mit Emmet sprechen.
Emmet Worthington, Leopolds bester Freund seit der vierten Klasse, war der einzige Mensch auf der Welt, mit dem Leopold sich vorstellen konnte, über den etwaigen Verlust seines Verstandes zu reden. Als ihm das gerade dämmerte, fing sein Telefon an zu vibrieren. Mit einiger Anstrengung kramte er es aus der Hosentasche.
Gedankenverschmelzung. Es war Emmet.
»Bist du bald da?«, sagte Emmet und schrie beinahe, weil es im Hintergrund so laut war. »Ich seh dich nicht.«
»Bald wo?«, fragte Leopold, doch dann fiel es ihm ein, und ihm wurde flau im Magen.
»The Stench. Mikas Konzert.« Emmet klang genervt. »Ihre Band spielt in einer halben Stunde.«
Mika war Emmets Freundin, und Emmet war ein durch und durch pflichtbewusster Partner. Im Chaos der letzten Stunden hatte Leopold völlig vergessen, dass er versprochen hatte, da zu sein. Was bedeutete, dass es sehr schwer werden würde, mit Emmet allein zu sprechen.