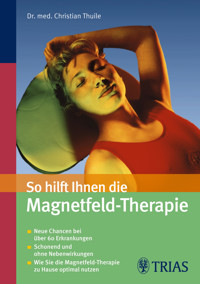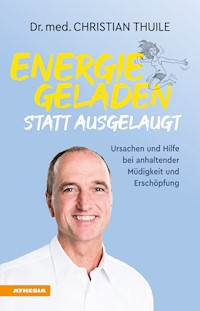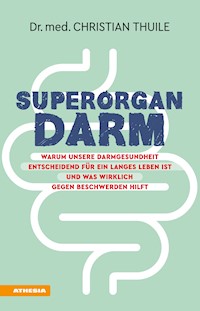
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Obwohl selten darüber gesprochen wird, sind Darmbeschwerden sehr häufig. Verdauungsprobleme wie Sodbrennen, Blähungen oder Durchfall kennen viele von uns. Dabei sind die Beschwerden nicht nur weit verbreitet, auch der Leidensdruck ist für viele Betroffene enorm. Was sich die meisten nicht vorstellen können: Sehr viele gesundheitliche Probleme haben ihre Ursachen im Darm. Selbst unser Denken und Fühlen und auch unser Gewicht wird von den Verdauungsorganen gesteuert. Der Beststellerautor und Komplementärmediziner Dr. med. Christian Thuile untersucht und berät täglich Patient*innen mit Darmbeschwerden jeglicher Art in seiner Praxis. In seinem neuen Buch will er nicht nur über die typischen akuten und chronischen Darmerkrankungen (Symptome, Therapie und Hausmittel) aufklären, sondern grundsätzliches Wissen über eines unserer wichtigsten Organe an Leser*innen weitergeben. Er erklärt, wie unsere Körpermitte mit unserem Immunsystem und unserer Psyche zusammenhängen, welchen Sinn Darmsanierung und Darmspiegelung machen und wie sich das, was wir essen, auf unsere Billionen Mitbewohner im Darm auswirkt. Ein gesunder Darm schenkt uns reine Lebensqualität!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in diesem Buch die männliche Form verwendet.
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.
Kümmere dich um deinen Körper. Es ist der einzige Ort, den du zum Leben hast.
Jim Rohn
INHALT
VON OBEN BIS UNTEN: WIE VERDAUUNG FUNKTIONIERT
Beißen, kauen, schlucken und was danach passiert
Von wegen verzichtbar: drei wichtige Zuarbeiter
Billionen Mitbewohner – unsere Darmflora
IM ZENTRUM: DIE BEDEUTUNG UNSERER KÖRPERMITTE FÜR DIE GESUNDHEIT
Unsere Versorgung: Wie aus Nahrung Nährstoffe werden
Unsere Abwehrkraft: Wo das Immunsystem zu Hause ist
Unser zweites Gehirn: Wie der Darm auf die Psyche wirkt (und umgekehrt)
Unsere Linie: Was die Darmflora mit dem Gewicht zu tun hat
GUTE FREUNDE: WAS UNSEREM DARM GUTTUT
Probiotika und Präbiotika
Bitterstoffe
Kohle
Fasten
Bewegung
ÄRGSTE FEINDE: WAS UNSEREM DARM ZUSETZT
Stress
Zu schnell, zu viel und zu oft
Unverträglichkeiten: Wenn das Essen krankmacht
Medikamente
KRANK SEIN UND GESUND WERDEN: DARMERKRANKUNGEN UND BESCHWERDEN, DIE VOM DARM AUSGEHEN
Wenn es im Bauch schmerzt
Gastritis
Blähungen
Sodbrennen
Verstopfung
Durchfall
Darmpilz
Entzündungen im Darm
Leaky Gut: Der „durchlöcherte“ Darm
Reizdarm
Dünndarmfehlbesiedelung
Darmkrebs (Kolon- oder Rektumkarzinom)
VON ARZT UND APOTHEKER: WIE DIE MEDIZIN HELFEN KANN
Darmsanierung – der Schlüssel zu einem gesünderen Leben
Stuhl-Spende für die Darmsanierung
Koloskopie
SCHLUSSWORT
REGISTER
VON OBEN BIS UNTEN:Wie Verdauung funktioniert
BEISSEN, KAUEN, SCHLUCKEN UND WAS DANACH PASSIERT
Es ist eine fast unglaubliche Zahl: 330 Kilogramm feste Nahrung nimmt ein Mensch in einem Jahr zu sich. Viele von uns sicherlich noch das ein oder andere Kilogramm mehr. Das sind in einem Leben – wenn man 80 Jahre alt wird – sagenhafte 26 Tonnen. Also 26.000 Kilogramm. Dazu kommen noch gut 50.000 Liter Flüssigkeit, die wir als Wasser, Saft, Bier oder Wein ins uns reinkippen.
Was hier ziemlich imposant wirkt, beeindruckt uns normalerweise kaum bis gar nicht. Mund auf, abbeißen, kauen, schlucken – aus dem Auge aus dem Sinn gewissermaßen. Natürlich isst das Auge mit. Und auch die Riechrezeptoren und Geschmacksknospen erfreuen sich zumindest kurzzeitig an dem feinen Mahl, dem schnellen Schokoriegel oder dem knackigen Apfel. Doch was danach mit all den Leckereien passiert, nehmen wir nicht mehr bewusst wahr. Meistens zumindest. Hin und wieder machen sich die hochkomplexen Verdauungsvorgänge, die sich nach dem Schlucken in unserem Inneren abspielen, durch Grummeln, Ziehen oder einen harmlosen Pups bemerkbar. Normalerweise aber nehmen wir unsere Nahrung erst dann wieder wahr, wenn wir uns Stunden und Tage später auf der Toilette sitzend ihrer Reste entledigen.
Dazwischen – von oben nach unten – haben sich allerdings spektakuläre und meistens hocheffiziente Vorgänge abgespielt, die unser Überleben sichern, aber auch unser Denken und Fühlen beeinflussen und über Wohl und Wehe, Gesundheit und Krankheit, Hoch und Tief in unserem Leben entscheiden. Es lohnt sich also, diese komplexen Prozesse aus dem Dunkel unseres Körpers an das Licht zu holen.
Wir beginnen unsere Reise durch den ungefähr acht Meter langen Magen-Darm-Trakt oben, im Mund. Dort fällt der Startschuss für die Verdauung, zu einem Zeitpunkt, an dem wir durch unser willentliches Zutun noch Einfluss auf die Verwertung unserer Nahrungsmittel nehmen können. Verdauung bedeutet im Grunde nichts anderes als die Zerlegung der Nahrung in unserem Körper und die Aufnahme der unterschiedlichsten Nährstoffe in den Organismus. Der Duden führt das Wort „verdauen“ auf das Althochdeutsche firdewen zurück und schreibt ihm die Bedeutung „verflüssigen“ oder „auflösen“ zu. Genau das passiert mit jedem Stück Brot, jedem Bissen Fleisch, jedem Keks oder Schokowürfel, den wir essen: Es wird zerhackt, zerkleinert und geknetet, bis nur mehr ein zähflüssiger Brei übrigbleibt. Bis dahin hat unser Körper alles, was an Wertvollem in unserem Essen steckt, herausgezogen und für sein und unser Funktionieren verwendet.
Gut gekaut ist halb verdaut
Nehmen wir an, wir essen Spaghetti mit Tomatensoße. Dann mag das für uns nur lecker schmecken und unseren Hunger stillen, unser Organismus giert aber nach den inneren Werten unserer Mahlzeit: nach ihren Kohlenhydraten, Fetten, Eiweißen, Vitaminen und Mineralstoffen. Um an diese zu gelangen, ist er auf unsere Unterstützung angewiesen: Durch Beißen und Kauen bringen wir die Nudeln – und alles, was wir essen – auf portionsgerechte, vor allem aber auf verdaubare Größe. Das ist bereits der erste Schritt, der einem effizienten Verdauungsprozess zugrunde liegt.
Wenn wir zu schnell essen oder stressbedingt zu hastig kauen, geht dieser erste wichtige Verdauungsschritt verloren. Unglaublich viele Bauchprobleme können bereits hier ihren Ursprung nehmen und werden oft übersehen. Je weniger gekaut unsere Nahrung in den Magen gelangt, umso schwerer ist ihre Verdauung und umso länger liegt uns das Essen schwer im Magen. Das kann auch zu einer Übersäuerung führen, denn je größer die Teile sind, die in den Magen kommen, desto mehr Säure brauchen wir, um sie zu zerkleinern. Mehr Säure erhöht wiederum das Risiko für eine Magenschleimhautentzündung (Gastritis) oder für das häufige saure Aufstoßen, das sogenannte Sodbrennen. Ebenso der Reizmagen, unter dem immer mehr Menschen leiden, hängt ganz eng mit den Verdauungsvorgängen in unserem Mund zusammen. Viele, die über Bauchschmerzen oder Verdauungsprobleme klagen, haben das Gefühl, fast gar nichts mehr zu vertragen. Dabei liegt die Ursache meist nur in einem zu wenig gekauten Nahrungsbrei. Außerdem kann laut neuesten Studien durch das Kauen auch unser Mikrobiom, also die Bakterienlandschaft in unserem Darm, ganz wesentlich und nachhaltig beeinflusst werden.
8 Meter legt ein jeder Bissen vom Mund bis zum Darmausgang zurück. Nur ein kleiner Teil dieser Strecke entfällt auf Speiseröhre und Magen. Mit bis zu 6 Metern ist der Dünndarm der längste Abschnitt im Verdauungstrakt.
Nicht von ungefähr kommt deshalb das Sprichwort „Gut gekaut ist halb verdaut“. Je besser wir kauen, umso kleiner sind die Nahrungsbrocken und umso größer ist deren Oberfläche, die eine ideale Angriffsfläche für die Verdauungssäfte ist. Diese Vorverdauung im Mund nimmt Magen und Dünndarm viel Arbeit ab und sorgt dafür, dass unser Organismus schneller an die wichtigen Nährstoffe gelangt. Diese bestehen aus langen Ketten fest miteinander verbundener Bausteine, die in ihre Einzelteile zerlegt werden müssen. Erst dann wird jene Energie und Kraft frei, die über das Blut zu den Organen gelangen und dort wirksam werden kann. Ein anschaulicher Vergleich ist der mit einem Baumstamm: Er muss zunächst zersägt und in handliche Holzscheite gehackt werden, bevor er im Ofen angefeuert werden und wohlige Wärme spenden kann.
KRAFTVOLL ZUBEISSEN
Unsere Beißkraft ist erstaunlich: Die Backenzähne zermahlen die Nahrung mit einem Druck von 80 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Damit können wir durchaus mit der Kraft mithalten, mit der ein Wolf zubeißt, nicht aber mit jener eines weißen Haies, die mit 1,8 Tonnen angegeben wird, und jener eines Löwen mit 560 Kilogramm Druck.
Neben den Kaubewegungen und dem Kaudruck spielt im Mund auch der Speichel eine essenzielle Rolle für die Verdauung. Aus sechs großen und mehreren Hundert kleinen Speicheldrüsen strömt Flüssigkeit in den Mundraum – nicht erst beim ersten Kontakt mit unseren Spaghetti, sondern bereits bei deren Geruch und Anblick. Uns läuft im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser im Mund zusammen. Gleichzeitig aktivieren Nervenimpulse bereits den Verdauungstrakt: In der Wand des Magens springen Drüsen an, die noch vor dem ersten Bissen Magensaft produzieren und in den Magen pumpen.
Wo Verdauung beginnt: Der Mund- und Rachenraum
Bis zu 1,5 Liter Speichel wird an einem Tag gebildet – rund um die Uhr, die größte Menge allerdings beim Essen. Er wird beim Kauen mit der Nahrung vermischt und macht diese schlüpfrig und breiig. Der Speichel enthält auch wichtige Enzyme, die man sich als Schneidewerkzeuge vorstellen kann. Sie beginnen bereits im Mund damit, die langen Nährstoffketten „aufzuschneiden“ bzw. aufzuspalten. So zerlegt das Enzym Amylase langkettige Kohlenhydrate, die in Nudeln, Brot oder Kartoffeln enthalten sind und aus Zuckermolekülen gebildet werden. Aus diesem Grund schmecken die Nudeln süß, wenn wir lang genug daran kauen. Das Enzym Lipase hingegen ist für die Aufspaltung der Fette zuständig.
Weil mit jedem Nahrungsmittel, das wir zu uns nehmen, nebenbei unzählige Bakterien und potenziell gefährliche Mikroorganismen in unseren Mund gelangen, enthält der Speichel auch eine Armada an Abwehrstoffen, die ihren Angriff auf mögliche Feinde bereits in der Mundhöhle starten.
Grob zerkleinert, mit wichtigen Verdauungs- und Abwehrhelfern ausgestattet und gleitfähig für den Weitertransport gemacht, sind unsere Nudeln nun bereit für den zweiten Schritt – in einem Schluck geht es an den für die weitere Aktivierung der Abwehrkräfte wichtigen Zungen- und Gaumenmandeln vorbei in den Rachen. Damit die Nahrung weiter in die Speiseröhre rutscht und nicht in die Luftröhre, legt sich beim Schlucken automatisch der Kehldeckel auf die Luftröhre, während sich gleichzeitig das Gaumensegel hebt, um die Nase abzudichten.
Das Schlucken der gekauten und damit bereits vorverdauten Nahrung ist der letzte Schritt des Verdauungsvorganges, den wir bewusst wahrnehmen und steuern können. Mit dem Verlassen des Mundraumes beginnt unser Verdauungssystem autonom zu arbeiten und unsere Nudeln ohne unser Zutun in oft mehrstündiger Arbeit bis an das Ende des Magen-Darm-Traktes zu bringen.
In Wellen abwärts
Mit wellenartigen Muskelbewegungen, der Peristaltik, wird der Nahrungsbrei über die etwa 20 Zentimeter lange Speiseröhre nach unten, in Richtung Magen, befördert. Dort, am unteren Ende der Speiseröhre, sorgt ein Schließmuskel dafür, dass die Nahrung zwar in den Magen gleiten kann, ein Zurückströmen in die Speiseröhre aber verhindert wird. Passiert dies doch, ist also dieser Schließmuskel geschwächt, spricht man von Sodbrennen. In Notfällen beteiligt sich der Schließmuskel zwischen Speiseröhre und Magen auch an einer Umkehr des gesamten Verdauungsprozesses – das Gegessene wird wieder zurück in Richtung Mund befördert. Erbrechen, wie wir später im Buch noch erfahren werden.
Bei aufrechtem Gang oder Stand unterstützt die Schwerkraft das Hinabgleiten des Speisebreies in den Magen. Notwendig ist sie allerdings nicht. Die wellenartigen Muskelbewegungen der Speiseröhre, die ohne unser Zutun oder unsere Steuerung einsetzen, ermöglichen auch ein Schlucken gegen die Schwerkraft. Theoretisch könnten wir also im Kopfstand essen und trinken – dank der Peristaltik, die es im Übrigen auch im Darm gibt. Bequem ist das natürlich nicht.
PERISTALTIK
Der Begriff „Peristaltik“ beschreibt die Muskeltätigkeit verschiedener Hohlorgane. Die Wände von Speiseröhre, Magen, Dünndarm und Dickdarm werden zum Großteil von einer Muskelschicht gebildet. Durch wellenförmige rhythmische Kontraktionen dieser Muskeln, die autonom, ohne unser aktives und bewusstes Zutun, einsetzen, wird die Nahrung durch die Verdauungsorgane transportiert. Die propulsive Peristaltik beschreibt die Vorwärtsbewegung der Nahrung, die retrograde Peristaltik geht in die entgegengesetzte Richtung und führt zum Erbrechen. Eine weitere Form, die nichtpropulsive Peristaltik, kennt keine Richtung, sondern dient dem Durchmengen und Durchmischen der Nahrung, zum Beispiel im Magen und im Darm. Die Peristaltik lässt sich übrigens „von außen“ unterstützen, zum Beispiel durch Bewegung. Daher kommt der Rat zu einem Verdauungsspaziergang nach einem üppigen Mahl.
Willkommen in der Chemiefabrik
Im Magen werden unsere mehr oder weniger grob zerhackten Nudeln schon erwartet – vom Magensaft, der in Aussicht des üppigen Mahles in den Magen gepumpt worden ist. Zwei bis drei Liter dieser Flüssigkeit werden jeden Tag von speziellen Drüsen in der Magenwand hergestellt, je nach Mahlzeit ist es etwa ein halber Liter. Die Zusammensetzung dieses Saftes lässt den Magen zu einer wahren Chemiefabrik werden: Zum Großteil besteht er aus aggressiver Salzsäure, die nicht nur bei der Zerkleinerung und Aufspaltung unserer Nahrungsmittel hilft, sondern auch Bakterien, Viren und Pilze, die mit unserem Essen in den Magen gelangen, unschädlich macht. Nur ein Bakterium zeigt sich häufig unbeeindruckt von der ätzenden Magensäure: Helicobacter pylori. Dieser Krankheitserreger produziert ein Enzym, das Säuren neutralisieren kann. So schafft er sich ein säurefreies Umfeld und nistet sich in der Magenwand ein, wo er zu dauerhaften Entzündungen der Magenschleimhaut (Gastritis) und Geschwüren bis hin zum Magenkrebs führen kann.
Die Säure ist derart aggressiv, dass sie auf Dauer selbst Stein und Eisen gefährlich werden könnte. Dass sie nicht auch den Magen selbst „verdaut“, ist einer schützenden Schleimschicht zu verdanken, die von speziellen Magendrüsen gebildet wird und mit der die Innenfläche des Magens überzogen ist.
Magensaft enthält noch weitere für die Verdauung wichtige Stoffe: Das Verdauungsenzym Pepsin beginnt im sauren Milieu des Magens mit der Aufspaltung der Eiweiße, während das Enzym Lipase die Verdauung der Fette in Angriff nimmt. Im Magensaft befindet sich auch ein Stoff namens „Intrinsic-Faktor“, ein Eiweiß, das gewissermaßen als Leibwächter für das Vitamin B12 dient. Dieses kann vom Körper nicht selbst hergestellt werden, sondern muss mit der Nahrung oder bei einem Mangel – den heutzutage sehr viele Menschen aufweisen – über Ergänzungsmittel zugeführt werden. Es ist für den Körper lebenswichtig, weil er es für die Bildung der roten Blutkörperchen und wichtiger Nervenbotenstoffe, für die Zellerneuerung sowie den Eiweiß- und Fettstoffwechsel benötigt. In den Magen gelangt Vitamin B12 an Eiweiße gebunden. Magensäure und Pepsin lösen diese Verbindung, woraufhin der „Intrinsic-Faktor“ ins Geschehen eingreift und das wichtige Vitamin unbeschadet zum Dünndarm transportiert, wo es ins Blut aufgenommen werden kann.
MAGENSÄUREHEMMER
Magensäurehemmer, auch Protonenpumpenhemmer oder „Magenschutz“ genannt, sind Medikamente, die die Bildung von Magensäure in den Drüsenzellen des Magens durch Hemmung von sogenannten Protonenpumpen um bis zu 90 Prozent reduzieren. Bekannte Wirkstoffe solcher Medikamente sind Pantoprazol oder Omeprazol. Sie werden bei Schäden der Magen- oder Speiseröhrenschleimhaut verschrieben, die durch die Magensäure hervorgerufen wurden. Auf diese Weise können beispielsweise eine Gastritis, Magengeschwüre oder Sodbrennen ausheilen. Sie werden auch verschrieben, wenn Medikamente über einen längeren Zeitraum eingenommen werden müssen, die Magenbeschwerden begünstigen können. Allerdings ist vor allem eine Langzeiteinnahme in der Ärzte- und Forscherwelt umstritten. Wird zu wenig Magensaft produziert, beeinflusst dies die Verdauung negativ. Die aufgenommene Nahrung wird weniger gut vorverdaut, Krankheitserreger haben leichteres Spiel, und Vitamin- und Nährstoffmängel können auftreten, da zum Beispiel Vitamin B12, Eisen, Kalzium und Magnesium auf Magensäure angewiesen sind, um in den Körper aufgenommen werden zu können. Deshalb ist von einer Dauereinnahme abzusehen.
Der Magen bearbeitet seinen Inhalt aber nicht nur chemisch, sondern auch mechanisch: In regelmäßigen Abständen ziehen sich alle drei Muskelschichten der Magenwand zusammen und schaukeln die Nahrungsbröckchen durch das sackartige Hohlorgan. Dabei zerfallen die Speisereste in immer kleinere Teile. Unsere Spaghetti werden immer dünnflüssiger und gelangen schließlich an das untere Ende des Magens, wo ein Ringmuskel den nur etwa reiskorngroßen Ausgang zum Dünndarm kontrolliert, der Pförtner – nomen est omen. Dieser lässt nur Flüssigkeiten oder maximal ein Millimeter große Bröckchen passieren. Je nach Beschaffenheit der Nahrung kann dies mitunter mehrere Stunden dauern. Kohlenhydrate wie unsere Nudeln sind relativ schnell – in ungefähr einer halben Stunde – auf „Durchlassgröße“ gebracht, bei Fetten und Eiweißen, also beim Steak oder den Hülsenfrüchten, dauert dies oft beträchtlich länger. Abhängig ist die Verweildauer im Magen auch von der Kauleistung zuvor im Mund: Schlecht gekaute Nahrungsmittel müssen oft stundenlang im Magen bearbeitet werden.
Wie schnell sich der Magen seines Inhaltes entledigen kann, hängt auch von Hormonen und den Millionen Nervenzellen ab, die den Magen-Darm-Trakt durchziehen und deshalb gerne als „zweites Gehirn“ oder „Bauchhirn“ bezeichnet werden. Diese Nervenzellen stehen im ständigen Austausch mit dem Gehirn im Kopf und signalisieren diesem zum Beispiel, wann man satt oder hungrig ist. Umgekehrt kommuniziert der Kopf mit dem Bauch und veranlasst etwa bei Stress eine langsamere Darmtätigkeit (mehr dazu auf Seite →). Die Nerven signalisieren dem Magen bzw. dem Pförtner aber auch, wie viel Nahrungsbrei bereits im Dünndarm ist, sodass dieser danach seine Tätigkeit ausrichten kann: Ist der Dünndarm gut gefüllt, lässt der Pförtner weniger Nachschub aus dem Magen durch, leert sich der Dünndarm, öffnet auch der Pförtner seine Schleusen wieder.
Feste Nahrung verbringt ungefähr eine bis fünf Stunden im Magen. Er ist damit gewissermaßen ein Zwischenspeicher auf dem Weg in den Dünndarm, der Verdauungs-Hochburg. Dort endet die Reise für Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, Vitamine und Spurenelemente, die wir mit unserer Mahlzeit aufgenommen haben.
DER MAGEN
Der Magen liegt im linken Oberbauch, direkt unter dem Zwerchfell. Sein Eingang („Cardia“) befindet sich in der Regel auf der Höhe des 10. Brustwirbels, der Magenausgang („Pförtner“) auf Höhe des 1. bis 2. Lendenwirbels. In mäßig gefülltem Zustand ist der Magen etwa 20 Zentimeter lang, und er hat eine Füllmenge von 1,2 bis 1,6 Litern.
Das Zentrum der Verdauung
Rein äußerlich ähnelt der Dünndarm einem etwa vier Zentimeter breiten Schlauch, der geschickt aufgeknäuelt und gefaltet in der Bauchhöhle liegt. Ausgerollt hätte der Dünndarm eine Länge von fünf bis sechs Metern – er ist damit drei- bis viermal länger als der Mensch, der ihn beherbergt. Und als wäre das allein nicht schon bemerkenswert genug, steckt in dem Dünndarm noch viel mehr: Gefaltet ist nämlich nicht nur der Dünndarm selbst, sondern auch sein Innerstes. Bildlich kann man sich das so vorstellen: Würde man den Dünndarm aufschneiden und aufklappen, käme eine Schleimhaut zum Vorschein, die sich ihrerseits noch mal faltet und wölbt. Auf den zig Falten sitzen Ausstülpungen, die Zotten. Und auf diesen befinden sich noch Millionen von Darmzellen mit fingerartigen Fortsätzen, was der gesamten Schleimhaut ein samtiges Aussehen gibt. Um diese Zotten und Fortsätze schmiegt sich der Speisebrei, der durch den Dünndarm rutscht. Ziel dieses ausgeklügelten Systems ist es, die Oberfläche des Dünndarms massiv zu vergrößern, um die Aufnahme der lebenswichtigen Nährstoffe in den Blutkreislauf zu erleichtern und zu beschleunigen – immerhin die Hauptaufgabe des Darms. Auf diese Weise bringt es der Dünndarm, würde er entfaltet und glattgestrichen, auf eine Fläche von gut und gerne 100 bis 200 Quadratmetern – was in etwa einem Tennisfeld entspricht. Zum Vergleich: Unsere Hautoberfläche misst ungefähr zwei Quadratmeter, unsere Darmwelt ist also bis zu hundertmal größer. Der Darm ist damit die größte Kontaktfläche zur Außenwelt. Denn auch wenn die Verdauungsorgane im Inneren unseres Körpers liegen, sind sie gewissermaßen ein oben und unten zur Außenwelt geöffneter Schlauch. Dessen Wände fungieren als ein wichtiger Schutzwall – darauf ausgerichtet, nur Gutes durch sie hindurch in den Körper zu lassen und Schlechtes abzuwehren und aus dem Körper zu transportieren.
Ein Blick in unseren Dünndarm
DER EWIG JUNGE DARM
Während der Mensch Tag für Tag altert, bleibt der Darm ewig jung. Jeden Tag werden nämlich Milliarden Darmzellen in der Schleimhaut ausgemustert und durch neue, frische Zellen ersetzt. Die meisten der Darmzellen werden innerhalb von fünf bis sieben Tagen komplett ausgetauscht, kein Teil der Darmwand ist älter als ein paar Wochen. Die Fähigkeit, sich eigenständig zu erneuern und aus Darmstammzellen jegliche Art von Darmzellen zu bilden, ist entscheidend für die natürliche Anpassungsfähigkeit der Verdauungsorgane.
Unser Nahrungsbrei erreicht, wenn er vom „Pförtner“ am Magenausgang durchgeschleust wurde, zuerst den Zwölffingerdarm. Nomen est omen auch hier: Der erste Teil des Dünndarms wurde nach seiner Länge benannt – er ist in etwa so lang wie zwölf nebeneinander gelegte Finger breit sind, also 25 bis 30 Zentimeter. In peristaltischen Bewegungen wird der Speisebrei weiter durchmischt und durch das Dünndarm-Schlauchsystem geschleust. Er ist zwar schon ziemlich weit aufgearbeitet, dünnflüssig und schleimig, enthält allerdings noch den Großteil seiner inneren Werte. Der Magen selbst nimmt nämlich kaum etwas von den Nährstoffen auf. Wie bereits erwähnt, geschieht dies nun im Dünndarm. Der Nahrungsbrei wird hin- und hergeschaukelt, mit verschiedenen Enzymen vermischt, die Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate auf Molekülgröße bringen, und gegen die Ausstülpungen und Falten der Darmschleimhaut gepresst. Hilfe erhält der Dünndarm bei dieser Arbeit von Bauchspeicheldrüse und Leber bzw. Gallenblase, die mit ihren Sekreten die Aufspaltung und Verwertung der Nährstoffe unterstützen und den im Magen angesäuerten Nahrungsbrei neutralisieren und die wir später noch kennenlernen werden (siehe Seite →).
Im zweiten Teil des Dünndarmes, dem Leerdarm, werden Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette zu Zuckermolekülen, Aminosäuren und Fettsäuren zerlegt. Sie können nun von den Zellen der riesigen Darmschleimhaut aufgenommen und ins Blut und in den Lymphkreislauf abgegeben werden. Damit erreichen sie das Innere des Körpers.
Auch jede Menge Flüssigkeit gelangt rund um die Uhr in den Dünndarm: Es sind zwei bis drei Liter, die wir jeden Tag trinken sollten, aber die weitaus größere Menge – man schätzt ungefähr sieben Liter – sind Speichel, Magensaft sowie Sekrete aus Galle und Bauchspeicheldrüse.
Der größte Teil der Flüssigkeit wird über die Darmschleimhaut in den Körper aufgenommen. Über den Blutkreislauf wird sie zu den Zellen transportiert. Flüssigkeit, die dort nicht verbraucht wird, gelangt mit den Abfallstoffen aus den Zellen über das venöse Blut in die Nieren, wird gefiltert und als Urin über die Harnleiter in die Blase geleitet. Von dort verlässt es wieder den Körper. Der kleinere Teil der Flüssigkeit – etwa 1,5 Liter – ist dem Nahrungsbrei untergemischt, der vom Dünndarm in den Dickdarm gleitet wird.
Mit dem Blut und der Lymphflüssigkeit verteilen sich die Nährstoffe auf den gesamten Organismus. Dort, in den Körperzellen, stehen sie als Energiespender oder Bausteine für Enzyme, Hormone und neue Zellen entweder unmittelbar zur Verfügung oder werden für den Bedarf gespeichert. Auch für Vitamine und Mineralstoffe ist die Reise durch den Magen-Darm-Trakt an dieser Stelle zu Ende: Sie marschieren, ohne dass sie vorher aufgespalten werden mussten, durch die Darmschleimhaut an ihren Bestimmungsort (siehe Seite →).
Neben Zellen zur Aufnahme der Nährstoffe und Zellen, die Schleim abgeben, um damit den Darminhalt gleitfähiger zu machen, enthält die Darmschleimhaut auch Zellen zur Abwehr von Krankheitserregern und Schadstoffen. Einige überstehen nämlich den Säureangriff im Magen, andere können sich im Zuge des Verdauungsvorganges bilden. Damit sie nicht ins eigentliche Körperinnere gelangen, umgibt eine schützende Armada an Abwehrzellen die Darmwände. Mittlerweile weiß man, dass immerhin bis zu 80 Prozent aller Abwehrzellen, die der Mensch besitzt, im Darm zu finden sind, einige davon im Dünndarm. Folgerichtig heißt es deshalb, dass unser Immunsystem im Darm sitzt. Es leistet Tag für Tag Schwerarbeit, muss es doch jedes Molekül, das die Darmschleimhaut zu überwinden versucht, überprüfen, auf seine Gefährlichkeit einstufen und bei Bedarf unschädlich machen. Ist dies nicht mehr möglich und der Eindringling besonders gefährlich, muss an dieser Stelle von den Verteidigungszellen mitunter ein Notfallprogramm in Gang gesetzt werden, das uns als Erbrechen bekannt ist: Muskeln in Darm, Magen, Speiseröhre und Rachen ziehen sich krampfhaft zusammen und befördern den Mageninhalt wieder nach oben in Richtung Mund – ein reiner Schutzmechanismus unseres Immunsystems im Dünndarm.
Ab in die Resteverwertung
Am Ende des Dünndarms angelangt, ist der Großteil unseres Mahles im wahrsten Sinne des Wortes verdaut: Nährstoffe und ein Großteil des Wassers sind über die Darmwand in den Körper gelangt, auch Enzyme und Gallensäfte sind mit speziellen Transportmolekülen wieder aus dem Nahrungsbrei gefiltert und in den Körper zurückgebracht worden. Und doch gibt es einiges an Unverdaulichem, das der Dünndarm nicht aufnehmen kann und will. Dazu zählen beispielsweise Ballaststoffe, wie sie in Hülsenfrüchten, Vollkornprodukten, Gemüse und Obst enthalten sind. Sie wandern vom Dünndarm durch einen Ringmuskel in den etwa 1,5 bis zwei Meter langen und sechs Zentimeter breiten Dickdarm – unseren Resteverwerter. Eine ventilartige Klappe aus Schleimhautfalten verhindert an dieser Stelle, dass Darminhalt, einmal im bakteriell stark besiedelten Dickdarm angelangt, wieder in den Dünndarm zurückströmen kann.
Anatomisch betrachtet umrahmt der Dickdarm den Dünndarm – ähnlich wie ein Bilderrahmen –, windet sich im rechten Oberbauch steil nach oben, biegt in einer 90-Grad-Wendung nach links, um an der linken Körperseite wieder nach unten zu zielen, wo er mit dem Rektum und dem Analkanal endet. In diesen 1,5 Metern befindet sich das Reich von Millionen von Mikroorganismen: großteils Bakterien, aber ebenso Viren und Pilze. Die Gesamtheit aller im Darm lebenden Mikroben nennt sich Darm-Mikrobiom oder die Darm-Mikrobiota. Weit verbreitet ist auch der Begriff „Darmflora“, der aus einer Zeit stammt, als Bakterien fälschlicherweise dem Pflanzenreich zugeordnet wurden. Obwohl diese Erkenntnis mittlerweile überholt ist, hat sich der Begriff derart etabliert, dass ich ihn auch in diesem Buch verwende.
Ein Großteil dieser Bakterienwelt in uns ist im Dickdarm beheimatet, eher weniger im unteren Teil des Dünndarms. Diese Mikroben „kümmern“ sich in den nächsten ein bis zwei Tagen um die Reste unserer Mahlzeit. Mithilfe von Gärungs- und Fäulnisprozessen zersetzen sie das, was von Kohlenhydraten und Eiweißen übriggeblieben ist. Dabei entstehen mitunter Gase wie übelriechende Schwefelwasserstoffe, die als Darmwind bzw. Flatulenz dem Körper entweichen.
10 Prozent der vom Menschen benötigten Energie wird von den Mikroorganismen im Dickdarm beigesteuert.
Außerdem produzieren viele Bakterien aus den Überbleibseln der Nahrungsmittel über ihren eigenen Stoffwechsel Substanzen, die der Körper dringend braucht: Das sind Vitamine und Nährstoffe, die über die Wände des Dickdarms in den Körper gelangen. Damit leisten sie für den Organismus einen wichtigen Dienst: Knapp zehn Prozent der vom Menschen benötigten Energie wird von den Mikroorganismen im Dickdarm beigesteuert. Zudem schützen die Bakterien der Darm-Mikrobiota den Menschen vor Krankheitserregern, indem sie ihr Revier, den Dickdarm, nach Leibeskräften verteidigen. Weil aber auch die Darmbakterien dem Menschen gefährlich werden können, wenn sie aus dem „Schlauch“ des Dickdarms in das Körperinnere gelangen würden, ist dieser Bereich der Verdauungsorgane mit besonders vielen Immunzellen bestückt. Damit spielt der Dickdarm für das