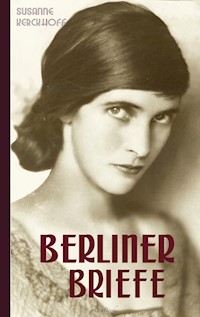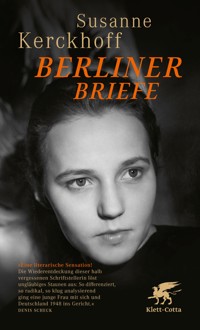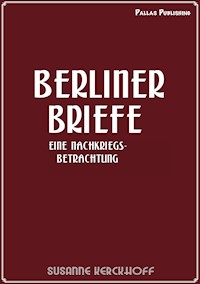
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pallas Publishing
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Susanne Kerckhoff: Berliner Briefe | Für die eBook-Ausgabe neu lektoriert, voll verlinkt, mit eBook-Inhaltsverzeichnis und Fußnoten | Die ersten fünf Jahre nach dem Ende des Naziregimes erscheinen aus heutiger Sicht wie eine black box. Es war auf deutscher Seite eine Zeit der Scham, des sich Unsichtbarmachens, der kollektiven Verdrängung was zur Folge hatte, dass es damals kaum literarische oder journalistische Zeitschau gab. Im Gegensatz dazu sind die Weimarer Republik und der Nationalsozialismus durch Reportagen und Dokumentationen ausgeleuchtet, wie keine anderen Abschnitte der deutschen Geschichte. Susanne Kerckhoff schickt nun mit ihren Berliner Briefen, die erstmals 1948 publiziert wurden, aber für Jahrzehnte vergessen waren, ein krasses Lichtbündel in diese unmittelbare Nachkriegszeit, wirft Licht in die Düsternis des Vergessens, öffnet Augen und hilft verstehen. Das dürfte der Grund sein, warum das Büchlein von Rezensenten als Wunder (Thea Dorn) und Literarische Sensation (Dennis Scheck) gefeiert wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
— INHALT —
Innentitel
Vorbemerkung des Herausgebers
BERLINER BRIEFE
Vorbemerkung
Erster Brief
Zweiter Brief
Dritter Brief
Vierter Brief
Fünfter Brief
Sechster Brief
Siebenter Brief
Achter Brief
Neunter Brief
Zehnter Brief
Elfter Brief
Zwölfter Brief
Dreizehnter Brief
Impressum
Fußnoten
Vorbemerkung des Herausgebers
Die ersten fünf Jahre nach dem Ende des Naziregimes erscheinen aus heutiger Sicht wie eine black box. Es war auf deutscher Seite eine Zeit der Scham, des sich Unsichtbarmachens, der kollektiven Verdrängung – was zur Folge hatte, dass es damals kaum literarische oder journalistische Zeitschau gab. Jeder war schließlich damit beschäftigt, zunächst seine eigenen Scherben aufzukehren. Im Gegensatz dazu sind die Weimarer Republik und der Nationalsozialismus durch Reportagen und Dokumentationen ausgeleuchtet, wie keine anderen Abschnitte der deutschen Geschichte. – Susanne Kerckhoff schickt nun mit ihren Berliner Briefen, die erstmals 1948 publiziert wurden, aber für Jahrzehnte vergessen waren, ein krasses Lichtbündel in diese unmittelbare Nachkriegszeit, wirft Licht in die Düsternis des Vergessens, öffnet Augen und hilft verstehen. Das dürfte der Grund sein, warum das Büchlein von Rezensenten als ›Wunder‹ (Thea Dorn) und ›Literarische Sensation‹ (Dennis Scheck) gefeiert wurde.
Eine junge Berlinerin, Kerkhoff nennt sie Helene, schickt eine Reihe von Briefen an einen befreundeten jungen jüdischen Mann, der in den 30er Jahren aus Deutschland flüchten musste. Als sich Hans 1947, zwei Jahre nach Kriegsende, aus Paris bei Helene meldet, beginnt dieser Briefwechsel.
Der Zugang mittels der literarischen Form des Briefromans – bei dem man nur Helenes Briefe zu lesen bekommt, nicht die von Hans – macht es Kerckhoff möglich, ihren inneren Monolog, ihre Selbstbefragung über Schuld und Mitläufertum, über den prekären moralischen Zustand des Landes nach dem Krieg auf einzigartige Weise mit feinen Beobachtungen und konkreten Erlebnissen aus ihrem Alltag im Nachkriegsdeutschland zu verknüpfen. Es gelingt ihr so, Einblicke in diese verdrängte Zeit zu geben, die viel erhellender sind, als geschichtswissenschaftliche Abhandlungen.
Zugleich mit der Rückschau und kathartischen Aufarbeitung blickt Helene nach vorne. Es ist die Zeit, als sich die Teilung Deutschlands manifestiert, als aus einem ungewissen Status quo sich zwei getrennte deutsche Staatsgebilde herausformen, die ihren Bürgern völlig konträre Lebensentwürfe anbieten. So stürzt man aus einer Zeit des Terrors in eine Phase des geistigen Chaos.
Susanne Kerckhoff (1918–1950, bei Kriegsende 27 Jahre alt) kennt diese beiden Lebensentwürfe. Aus einer gutsituierten, humanistisch gebildeten Westberliner Akademikerfamilie stammend, geht sie nach ihrem Philosophiestudium und der Scheidung vom Buchhändler Hermann Kerckhoff 1947 nach Ostberlin, steht den Sozialisten nahe, tritt in die SED ein, arbeitet für die satirische Wochenzeitung Ulenspiegel und später als Kulturredakteurin für die linientreue Berliner Zeitung, wo sie als gerade 30-jährige zur Feuilletonchefin aufsteigt.
Doch Freidenkerin die sie war, ordnete sie sich keiner Parteilinie unter. Wichtig waren ihr das freie Wort und der unabhängige Gedanke. Nach aufreibenden politischen Auseinandersetzungen mit dogmatischen Kollegen und Politikern, die ihr eine »schwankende ideologische Haltung« vorwarfen, schied sie, die eigentlich am Aufbau eines neues, besseren Deutschland tatkräftig mitwirken wollte, am 15. März 1950 freiwillig aus dem Leben. Obwohl Jahrzehnte lang von der Literaturwissenschaft in Ost und West übersehen, ist Susanne Kerckhoff nun zu Recht wiederentdeckt. Ihre markante Stimme bleibt, und prägende Worte wie diese hallen nach: »Wer im Frühling 1945 nicht aus dem Gefängnis oder dem Konzentrationslager kam, ist mitverantwortlich«.
© Pallas Publishing, 2022
BERLINER BRIEFE
Vorbemerkung
Berlin, Dezember 1947
Irgendeine Berlinerin, deren Schicksal weniger bedeutend ist als das Schicksal Tausender, schreibt Briefe an irgendeinen Emigranten. In diesen Briefen spiegeln sich Ratlosigkeit und Hoffnung. Ein Mensch bemüht sich, innerhalb der gegebenen Situation über das politische Woher und Wohin Rechenschaft abzulegen.
Die belletristische Form wurde gewählt, weil dieses Büchlein kein endgültiges, ausgereiftes Credo sein kann. Im Zeitgeschehen verdunkeln und erhellen sich die Erkenntnisse. Jeder Tag bringt neue Entscheidungen. Beständig bleiben nur die Wachheit des Gewissens und der Wille, die Wahrheit unermüdlich zu suchen und ihr zu dienen. Daher ist der vorliegende Versuch fehlerhaft – aber er ist ehrlich. Womit nicht gesagt sein soll, dass andere Versuche unehrlich wären. Ebenso sicher ist es, dass diese Form der politischen Auseinandersetzung mit dem Nachkriegsgeschehen kein privates Spiel einer ›Ich-sitze-gern-zwischen-den-Stühlen‹-Koketterie ist. Noch um die endgültige Erkenntnis ringen, heißt nicht, der Aktion ausweichen, sondern sich im Gegenteil auf sie vorbereiten.
Susanne Kerckhoff
Erster Brief
Lieber Hans!
Nach zwei Jahren Waffenstillstand erreicht mich Dein Brief aus Paris. Du fragst nach mir. Aber damit nach uns. Ich soll schildern, wie es mir ergangen ist. Warum hast Du damals, schon ein Jahr vor Ausbruch des Krieges, die Korrespondenz abgebrochen? Weil ich Dir schrieb, Du möchtest Deine politischen Ansichten nicht mehr äußern, wir kennten uns doch? Ich dachte, Du würdest diesen Satz ohne Weiteres begreifen. Aber in all den Jahren danach hat es mich verfolgt, Du identifiziertest mich vielleicht, dieser vorsichtigen Mahnung wegen, mit Stukas und Konzentrationslagern.
Ich glaube, ich weiß wenig von mir zu berichten. Als wir uns kannten, stand ich noch in dem Lebensalter, wo man sich nicht real in die Geschehnisse einbezieht, sondern für eine Besonderheit mit gesondertem Schicksal hält. Jetzt ist das ganz anders geworden. Mein Lebensgefühl verdeutlicht sich vielleicht in dem Bild, als sei ich ein Teil des Trümmeratems von Berlin – Staub, Ruinen, Tote – aber auch Hoffnung, Zuversicht, Neubau, manchmal gleißend bunt und lügnerisch; es gibt Augenblicke, wo ich Zuversicht und Neubau für gesund halte.
Ich möchte Dir von den anderen Dingen erzählen, in denen ich bin. Ob Du zurückkehrst? Credo, quia absurdum est.1
Meine Weise der Schilderung erhebt nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit, es ist ›mit meinen Augen‹ gesehen. Ich darf nicht für alle sprechen, für keine Gruppe, keine Partei, keine Kirche, keine Klasse, nicht einmal für meine Generation – denn noch niemals habe ich mich als Repräsentanten gefühlt. Überhaupt haben mich Verallgemeinerungen mit der Tarantel gestochen.
Gestern sprach ich mit einem Achtzehnjährigen über Russland. Er hatte Ansichten. Genau so ausgeprägte, rundliche Ansichten hatte er wie einst Du und ich. Er wusste, was Demokratie, was Freiheit meint. Er verstand unter Freiheit Amerika. Es war alles ganz einfach, was er sagte. Plastisch. Ich redete, wie er mir vorwarf, ›drum herum‹. Erwartest Du anderes von mir? Ich kann nur noch an die Dinge heran, wenn ich um sie herum gehe. Ich schleiche wie eine Katze um den heißen Brei, mit einem verbrannten Geschmack auf der Zunge. Aber niemand hat mich gebrannt oder auf den Mund geschlagen, außer meine eigene Einsicht.
In ein bestimmtes Lager gehöre ich – in das Lager derjenigen, die sich noch in gar keiner Weise beruhigt haben – über Nationalsozialismus und Krieg, über Sozialismus und Kapitalismus, über Schuld und Sühne, über eigene Schuld und eigene Sühne, kann ich mich nicht beruhigen. Auch nicht über unsere Spiegelbilder und unsere Verzerrungen, nicht über Papierverordnungen, an denen Blut und Hunger haften. Ich weiß kein Heilmittel gegen diese Unruhe, und wüsste ich eines, ich würde es nicht anwenden. Es ist mir weder möglich mit einer Phraseologie und Heilpraktiker-Lehre Strohfeuer zu zünden, die niemanden, außer den Brandstifter persönlich, erwärmen. Soll ich mich an dem Beispiel weiden, dass der Karren nach 1918 ähnlich schief gefahren wurde? Ich sähe keine Zier darin, zur vielgeschmähten, ›deutschen Innerlichkeit‹ abzusinken, nur deshalb, weil sie geschmäht wurde.
Ich habe Descartes stets um den großen Augenblick bewundert und beneidet, da es ihm gelang, sich aller Vorurteile, allen Wissens, aller ausgetretenen Pfade zu entschlagen, um zu finden: cogito ergo sum!2 Warum soll ich es Dich erst herausfinden lassen, dass vorurteilsloses Denken nicht meine Stärke ist? Ich bin voll Unruhe – ich bin nicht objektiv – es gibt Äußerungen und Geschehnisse, zu denen ich rot sehe. Ich male schwarz-weiß, sicher tue ich das. Zu vielen Bildern, die sich mir aufdrängen, mache ich einfach die Augen zu: das will ich nicht sehen! Eine besondere Art der Verwahrung? Die Wogen des Mitleids, des Grauens – ich will mich nicht von ihnen überspülen lassen. Ich gehe sparsam mit mir selbst um. Für welche Richtung, welchen Weg spare ich mich eigentlich auf? Trotzdem kann ich nicht hindern, dass es auf mich zukommt: krauses materielles und geistiges Elend, das Elend falscher und verfälschter Absichten!
»Ach ja, es tut schon weh–« hat Haringer3 in einem Abschiedsgedicht vor sich hingesagt. Ich finde nicht, dass es sich sentimental anhört. Oder fasst Du es so auf?
Helene
Zweiter Brief
Lieber Hans!
Noch weiß ich aus keiner Zeile, wie Du Dich entwickelt hast.
Ich erinnere mich gut all unserer Gespräche. Ich hatte mit Wahrheitsfanatismus, der einseitig und glühend war, die ›Macht der Stulle‹ entdeckt! Wie viel Ethik legte meine Gruppe – die Arbeitsgemeinschaft sozialistischer Kinder – in diese Stulle! Der Katechismus flog mir um die Ohren und ich aus der Religionsstunde. Abenteurer des Materialismus waren wir und entlarvten Lehrer, Pfarrer und Eltern. Uns selbst entlarvten wir nicht. Wir waren wunderbar gläubig, in mancher Weise gläubiger als Du. Wir träumten weder von Macht, noch von Vermassung. Freiheit – Gleichheit – Brüderlichkeit – darauf kam es uns an. Wir hofften, auf schnellstem Wege die irrende Menschheit dazu zu bewegen, eine gerechte Verteilung der Güter vorzunehmen, alle lächerlichen Vorurteile abzubauen, niemals der Stimme des Blutes, sondern immer nur der Helligkeit des Verstandes zu lauschen. Die Menschheit sollte sich dazu bekennen, dass sie gut ist.
Der Revolutionär pflegt in reiferen Jahren die Raupen vom Kohl seines Gartens zu lesen – Ideale haben es an sich, von Schuhsohlen platt getreten zu werden – wer Hörner hat, läuft sie sich ab, falls er auf dem Kopf läuft.
Was ist aus uns geworden?
Möglicherweise glaubst Du, die Schreckensjahre hätten mich so weit gewandelt, dass ich den Kosmos und meine Rolle in der Welt jetzt anders begriffe? Das ist nicht so. Unter Hitlers Herrschaft haben sich meine Träume von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit konserviert, sie haben sich gehalten, ohne sich in positiver oder negativer Richtung zu entwickeln. Ich konnte mit dem Pfund, das ich in mir trug, nicht arbeiten. Ich musste es vergraben – es blieb ein Pfund. Politische Naivität blieb politische Naivität. Schwarz waren die Totenkopfmachthaber für mich, die sich die Menge dienstbar machten, indem sie ihre niedrigsten und dumpfsten Triebe glorifizierten.
Nein – die Märtyrer ließen es nicht zu, dass ich mich in eine höhere Gelassenheit finden konnte! Wie ich Deinen Vater auf dem Kurfürstendamm traf. Er versuchte, grußlos an mir vorüberzugehen, um mich nicht in den vergifteten Kreis seines gelben Sterns zu ziehen. Ich ließ mir diese Rücksichtnahme nicht gefallen. Da blieb er stehen und hielt den Hut vor seinen Stern. Ich wollte sprechen, dazu hatte ich mich ihm ja in den Weg gestellt, und nun konnte ich es kaum. Ich fühlte die mechanische Zermalmung des flutenden Verkehrs um uns, die tödliche Gleichgültigkeit des Asphalts, auf dem wir standen. Sein Blick kam auf mich zu mit der grauen Größe eines Schmerzes, der ihm noch bevorstand, und den er bereits überwunden hatte. Plötzlich merkte ich, dass ich ihm leid tat. Was soll ich daran noch schildern? Am nächsten Tag wollte ich ihn aufsuchen, aber er war nicht mehr in der Uhlandstraße. Eure Wohnung war mit einer Plombe der Gestapo versiegelt.
Deinen Bruder fand ich in seinem möblierten Zimmer in der Wittelsbacher Straße. Er musste Kisten auf dem Schlesischen Bahnhof schleppen. Wir haben uns oft gesehen, bis er plötzlich auch fort war. Seine Wirtin endlich – Du kennst sie doch noch? – hatte ich bewogen, zu mir zu ziehen. Sie konnte schneidern. Wir hatten beschlossen, sie als Hausschneiderin herumzureichen, damit sie ihren Wohnort öfter wechseln könnte. Bei mir sollte ihr festes Domizil sein. Eines Tages holte sie mich dann vom Geschäft ab, mit einem kleinen Köfferchen. Schon wollte ich mit ihr zum Stadtbahnhof gehen, da fiel mir ein, dass mein Brot nicht reiche. Ich ging in einen Bäckerladen. Als ich wieder herauskam, war sie verschwunden. Ich habe sie gesucht und nicht finden können. Ich hörte später – darauf war ich nicht gekommen –, dass sie plötzlich in ihre Wohnung zurückgelaufen war, den Häschern gerade in die Arme.
Es ist ja Wahnsinn, verzeih mir, dass ich Dir diese Dinge schreibe! Es gab andere, lautere, noch grauenhaftere Geschehnisse! Die Erschütterungen aber, die zum Abgrund der seelischen Existenz hinschwingen, halten uns fest.
Um die schwarze, blutige Kriegsmaschine Deutschland lag für mich eine weiße, schimmernde Welt. Im Osten verstrickte Mütterchen Russland mit heißblütig slawischer List die gierigen Geier in frierendes Toteneis, verteidigte den tapferen Versuch, der Menschen Dinge neu zu ordnen, gegen unsere stählernen Mordpanzer. Im Westen schimmerte die Sonne der Freiheit vertrauter in den Abendfarben unserer Kultur. Alle miteinander waren sie für mich wie der Erzengel Michael, zu dem ich rief: Verteidige uns im Kampfe, gegen die Nachstellung des Satans sei unsere Schutzwehr! Für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit hatte dieser, mein Michael, zu streiten. Nicht um Länderfetzen, nicht um europäisches Gleichgewicht, nicht um die Macht einer Nation.
Ich habe das Kriegsende in einem westdeutschen Dorf, nahe Holland, erlebt. Ich ging gerade, Milch zu holen, als ich ganz nahen Kanonendonner von der Front hörte. Ich habe nicht eine Sekunde die nahende Gefahr gefürchtet. Alle Psalmen sind stumm, verglichen mit der Dankhymne, die in mir aufbrach, weil der Erzengel Michael gekommen war, mit seinem Schwert die Kerker aufzuschlagen, die Konzentrationslager aufzuriegeln, die bleiche Menschen im Moor ersticken ließen – dass nach dieser Sintflut von Mord, Hass und Gier ein Stahlgewitter von Menschenliebe, Freiheit und Gerechtigkeit seine Blitze senden müsste! Und Du warst da. Plötzlich hatte ich keine Angst, Du könntest nicht mehr leben.
Ich glaube, dass sehr viele Deutsche, mochten sie auch beim Bier skeptischer klügeln, von dem gleichen Glückstaumel berauscht, von der gleichen Hoffnung durchglüht waren wie ich.
»You all have been Nazis«, sagten die Kanadier.
Dann kamen polnische Truppen und sagten das gleiche.
Es war selbstverständlich. Es war noch Krieg. Wir waren Feinde und alle Nazis. Dass ich nicht daran gedacht hatte – glaubte ich denn, auf meiner Stirn stünden meine Gesinnungen zu lesen wie auf der Kains das Mordmal?
Später kamen die Engländer mit einer No-Fraternization-Order. Die Nazis sagten: »Wir wollen ja gar nicht mit denen reden!« Die Realisten sagten: »Eine verständliche Verordnung«.
Ich bin nicht zu stolz, zuzugeben, dass mich die oben zitierten Äußerungen, die Verordnungen, nicht nur kränkten, sondern schwer persönlich verwundeten.
Stell’ Dir ein unschuldiges Mädchen vor, das sich, nach inneren Kämpfen, aus wärmster Neigung einem Mann hingibt, und dann erntet sie frivoles Misstrauen. – Das muss ein ähnliches Gefühl der Verwundung geben.
Neulich unterhielt ich mich mit Bekannten über jene Zeit und führte dieses Beispiel an.
»Das stimmt nicht«, meinte einer mit deutscher Unfehlbarkeit.
Aber es stimmt. Wer es nicht mitempfindet, hat eben niemals für den Sieg der Alliierten aus ganzem Herzen gebetet – zu welchem Gott auch immer.
Helene
Dritter Brief
Lieber Hans!
Dass Du