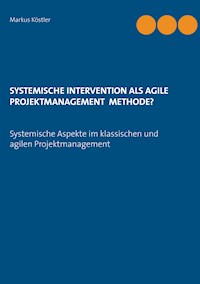
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die zunehmende Verbreitung agiler Methoden im Projektmanagement und der Trend zu systemischen Zusatzausbildungen klassischer Projektmanager und Projektmanagerinnen verändern gegenwärtig das Bild des klassischen Projektmanagements. In diesem Buch werden aktuelle agile und klassische Projektmanagement Methoden sowie die systemische Intervention im Kontext von Projekten vorgestellt und entlang der Dimensionen Prozesse, Rollen und Elemente verglichen. Alle drei Ansätze besitzen sowohl zahlreiche Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten: Im Bereich der Prozesse besitzen agile Methoden und die systemische Intervention große Ähnlichkeiten, das klassische Projektmanagement hingegen weißt große Unterschied zu den beiden anderen Ansätzen auf. Im Bereich der Rollen weisen alle drei Ansätze gemeinsame Grundsätze auf, unterscheiden sich jedoch in der Flexibilität der Rollenträger bei der Erfüllung Ihrer Aufgaben. Im Bereich der Elemente weist das klassische Projektmanagement einen starken Fokus auf Planungs- und Kontrollwerkzeuge, agiles Projektmanagement und die systemische Intervention hingegen auf das sichtbar machen von Veränderung und Weiterentwicklung sowie den Aufbau Beziehungen und von Vertrauen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Klassisches Projektmanagement
2.1 Prozesse
2.2 Rollen
2.3 Elemente
2.4 Merkmale und Erfolgsfaktoren
3 Agiles Projektmanagement
3.1 Grundstruktur agiler Softwareentwicklungsprojekte
3.1.1 Envision
3.1.2 Speculate
3.1.3 Explore
3.1.4 Adapt
3.1.5 Close
3.1.6 Agile Ansätze abseits von IT Projekten
3.2 Scrum
3.2.1 Prozesse
3.2.2 Rollen
3.2.3 Elemente
3.2.4 Merkmale und Erfolgsfaktoren
3.3 Zwischenfazit – Vergleich agiles und klassisches Projektmanagement
4 Systemische Intervention
4.1 Grundstruktur der systemischen Intervention
4.2 Prozesse
4.3 Rollen
4.4 Elemente
4.5 Merkmale und Erfolgsfaktoren
4.6 Zwischenfazit – Vergleich systemische Intervention und klassisches Projektmanagement
5 Klassisches und agiles Projektmanagement sowie die systemische Intervention im Vergleich
5.1 Prozesse
5.2 Rollen
5.3 Elemente
6 Literaturverzeichnis
Darstellungsverzeichnis
Nr.
Bezeichnung
Darstellung 1: Projektmanagement Prozess im zeitlichen Kontext
Darstellung 2: Magisches PM Dreieck
Darstellung 3: Projektcontrollingzyklus
Darstellung 4: Rollen im Projektmanagement
Darstellung 5: Magisches PM Dreieck aus klassischer und agiler Sicht
Darstellung 6: Das agile Manifest
Darstellung 7: Grundstruktur agiler Softwareentwicklungsprojekte
Darstellung 8: Scrum Prozess
Darstellung 9: Rollen in Scrum
Darstellung 10: Methoden und Werkzeuge in Scrum
Darstellung 11: Kano Modell der Kundenzufriedenheit
Darstellung 12: Story Board
Darstellung 13: Systemische Schleife
Darstellung 14: Prozessebenen im „systemischen Haus“
Darstellung 15: Kriterien der Teamzusammensetzung
Darstellung 16: Beteiligte Systeme an der Beratung
Darstellung 17: Methoden in der systemischen Intervention
Darstellung 18: Ausgangssituation im Reflecting Team
Darstellung 19: Das Klientensystem in der Zuhörerposition
Darstellung 20: Ausgangszustand in einer Aufstellung
Darstellung 21: Aufstellung nach erster Befragung der Repräsentanten
Darstellung 22: Endzustand der Aufstellung
Darstellung 23: Tetralemmaaufstellung
Darstellung 24: Soziogramm
Darstellung 25: ABC-Gruppe
Darstellung 26: Triadisches Contracting
Darstellung 27: Klassisches, agiles und systemisches magisches Dreieck
Tabellenverzeichnis
Nr.
Bezeichnung
Tabelle 1: Klassische PM-Werkzeuge der Startphase
Tabelle 2: Aufgaben des Projektauftraggeberteams
Tabelle 3: Aufgaben des Projektmanagers/der Projektmanagerin
Tabelle 4: Aufgaben des Projektteams
Tabelle 5: PM-Werkzeuge in der Projektstartphase
Tabelle 6: PM-Werkzeuge in der Projektkoordinationsphase
Tabelle 7: PM-Werkzeuge in der Projektcontrollingphase
Tabelle 8: PM-Werkzeuge zur Bewältigung einer Projektdiskontinuität
Tabelle 9: PM-Werkzeuge in der Projektabschlussphase
Tabelle 10: Leitprinzipien in der Explore Phase
Tabelle 11: Gegenüberstellung mechanisches und systemisches Weltbild
Tabelle 12: Funktionen der Steuergruppe
Tabelle 13: Arten systemischer Fragen
Tabelle 14: Phasen der Zukunftskonferenz
Tabelle 15: Systemische Methoden und Einsatzmöglichkeiten in Projekten
Abkürzungsverzeichnis
bzw. — beziehungsweise
DoD — Definition of Done
etc. — etcetera
FH — Fachhochschule
i.A. — in Ausbildung
ICB — IPMA-Kompetenzrichtlinie
IPMA — International Project Management Association
IT — information technology
MRI — Mental Research Institute
PM — Projektmanagement
pma — Projekt Management Austria
PMBoK — Project Management Body of Knowledge
PMI — Project Management Institute
PRINCE2 — PRojects IN Controlled Environments 2
RTSC — Real Time Strategic Change
u.a. — und andere
usw. — und so weiter
WKO — Wirtschaftskammer Österreich
Danksagung
Danken möchte ich Mag.(FH) Horst Rysavy für die Betreuung meiner Diplomarbeit, aus der dieses Buch entstanden ist, Mag. Dr. Michael Schmidt für zahlreiche Literaturhinweise, sowie Frau Mag. Sabine Lehner, MA für die zahlreichen anregenden Gespräche zu systemtheoretischen Aspekten. Mein besonderer Dank gilt meiner Frau Katharina für das Hinterfragen von Formulierungen, das Korrigieren von Orthografie- und Grammatikfehlern, sowie ihre endlose Geduld während des Schreiben der Diplomarbeit. Meinen beiden Kinder Johannes und Andrea danke ich für ihre Geduld und ihr Verständnis, wenn ich anstatt Zeit mit ihnen zu verbringen, an meiner Diplomarbeit gearbeitet habe.
1 Einleitung
Im Projektmanagement sind gegenwärtig zwei große Trendbewegungen zu erkennen: Einerseits nimmt die Verbreitung agiler Projektmanagementmethoden (noch immer) stetig zu, andererseits absolvieren klassische Projektmanager und Projektmanagerinnen immer häufiger systemische (Zusatz-) Ausbildungen.1 Dass diese Trendbewegungen keine Modeerscheinungen, sondern ernstzunehmende Schritte zur (Weiter-)Entwicklung eines integrativ-situativen Ansatzes im Projektmanagement sind, lässt sich beispielsweise daran festmachen, dass sich in der WKO Wien die Gruppe „Systemische Unternehmensberatung und Projektmanagement“ seit Mai 2012 mit der Förderung dieses Ansatzes beschäftigt.2 In beiden Trends spielen „weiche Faktoren“, wie beispielsweise Kommunikation, Beziehungen oder Reflexion3, eine große Rolle. Angesichts dieser Entwicklungen stellt sich nun die Frage, ob und wie weit diese beiden Themengebiete zueinander in Relation gesetzt werden können und welche Auswirkung diese Entwicklung auf die Ausrichtung des klassischen Projektmanagements hat. Besitzt das klassische Projektmanagement überhaupt noch eine Existenzberechtigung oder sind nicht alle Aufgaben mit agilen und systemischen Methoden effizienter und effektiver zu lösen? Oder ist es vielleicht vielmehr so, dass sowohl das klassische als auch das agile Projektmanagement als auch die systemische Intervention gleichberechtigt ihren Platz im Methodenkoffer des modernen Projektmanagements haben sollten, allerdings jedes für sich mit unterschiedlichen Anwendungsschwerpunkten? Vermischt sich die Sichtweise auf das Projektmanagement, je nach Projektart, Unternehmenskultur oder ähnlichem? Oder sind die drei vorhin erwähnten Überbegriffe nichts weiter als Deckmäntel für ähnlich gelagerte, vielleicht sogar gleiche Methoden, Techniken und Zugangsweisen nur aus anderer Denkrichtung kommend? Ausgehend von diesen Überlegungen stellt sich nun die Frage, inwieweit die systemische Intervention gar als agile Projektmanagementmethode gesehen werden kann. Dieser Thematik bin ich im Zuge meiner Diplomarbeit im Masterstudiengang „Projektmanagement und Organisation“ nachgegangen, welche die Basis für das vorliegende Buch bildet.
Die zuvor skizzierten Fragestellungen lassen sich in drei Fragen zusammenfassen:
Inwieweit ist die systemische Intervention
4
eine agile Projektmanagement Methode?
Was ist systemisch an den klassischen Projektmanagement Methoden?
Was ist systemisch an agilen Projektmanagement Methoden?
Zur Beantwortung dieser drei Fragen gliedert sich dieses Buch in vier Abschnitte. Im ersten Abschnitt wird das klassische Projektmanagement als grundlegende Prämisse für die folgenden Abschnitte eingeführt. Im zweiten Abschnitt werden die Grundkonzepte des agilen Projektmanagements erläutert und anschließend Scrum als Beispiel für die konkrete Umsetzung dieser Grundkonzepte vorgestellt. Im dritten Abschnitt werden zunächst die Grundzüge der Systemtheorie und ihre Einsatzmöglichkeiten in der Beratung und in Projekten dargestellt, anschließend wird die Methode der systemischen Intervention detailliert erläutert. Diese ersten drei Abschnitte gliedern sich jeweils entlang der Dimensionen Prozesse, Rollen und Elemente. Im vierten Abschnitt werden das klassische und das agile Projektmanagement, sowie die systemische Intervention miteinander verglichen und die zuvor skizzierten Fragestellungen beantwortet.
1 Vgl. Oesterreich (2008) S. 18 sowie Königswieser/Hillebrand (2004) S. 7.
2 Vgl. Dalheimer (2013) online.
3 Vgl. Vahs (2012) S. 39ff sowie Oesterreich (2008) S. 18.
4 Im Rahmen dieses Buches wird die systemische Intervention ausschließlich im Kontext der Organisationsberatung betrachtet, ausdrücklich nicht im psychotherapeutischen Kontext.
2 Klassisches Projektmanagement
Im folgenden Kapitel werden die Prozesse, Rollen und Elemente des klassischen Projektmanagements beschrieben, um die Basis für den späteren Vergleich mit den agilen und systemischen Methoden zu legen. Abschließend werden die wichtigsten Merkmale und die Erfolgsfaktoren des klassischen Projektmanagements kompakt dargestellt.
2.1 Prozesse
Darstellung 1: Projektmanagement Prozess im zeitlichen Kontext5
Darstellung 1 zeigt den Projektmanagement Prozess nach GAREIS im zeitlichen Kontext. Am Beginn des Prozesses steht der unterschriebene Projektauftrag, danach folgen die Projektstartphase und abhängig von der Projektdauer mehrere Projektcontrollingzyklen. Parallel dazu findet laufend die Projektkoordination statt. Das Ende des Projektmanagement Prozesses bildet die Projektabschlussphase mit der finalen Projektabnahme. Diese Teilschritte bilden das fixe Grundgerüst des Projektmanagement Prozesses. Die Bewältigung einer Projektdiskontinuität stellt eine optionale Phase dar und wird nur bei Vorliegen einer Projektkrise oder einer Projektchance durchlaufen.6 Die inhaltliche Projektarbeit findet parallel und unabhängig vom Projektmanagement Prozess statt.7 Den zeitlichen Kontext bilden die vor Beginn des Projektprozesses stehende Vorprojektphase und die nach dem Ende des Projekts befindliche Nachprojektphase.8 Eine andere Sicht auf den Projektmanagement Prozess nimmt etwa das PMI ein: Hier wird, umgelegt auf die zuvor vorgestellte Sichtweise, sowohl die Vorprojektphase als auch die Nachprojektphase als Teil des Projekts selbst gesehen.9
Vorprojektphase
In der Vorprojektphase wird, basierend auf einer (Projekt-)Idee, eine grobe Projektwürdigkeitsprüfung durchgeführt, die Antworten auf die Fragen, ob die Idee zur Strategie der projektdurchführenden Organisation passt und ob die Organisation, die zur Realisierung der Idee notwendigen Ressourcen besitzt bzw. sie diese beschaffen kann. Fällt diese Prüfung positiv aus, so stehen als Realisationsformen für die Idee die Organisationsformen „Projekt“ und „Programm“ zur Wahl. Sollten Projekt- oder Programmorganisation nicht den passenden organisatorischen Rahmen für die Umsetzung der Idee bieten, steht alternativ dazu die Organisationsform „Stammorganisation“ zur Wahl. Die Aufbereitung der Entscheidungsgrundlagen für die Projektwürdigkeitsprüfung erfolgt idealtypisch durch eine Gruppe von Personen in einem Antragsteam, die Entscheidung selbst wird ebenfalls von einer Gruppe entsprechend dazu ermächtigter Personen der Organisation getroffen. Als Entscheidungsgrundlagen werden Grobvarianten der in der Projektstartphase erzeugten Projektmanagementdokumentation, wie beispielsweise Business Case Analyse, Projektdefinition, Projektauftrag oder Projektumweltanalyse, verwendet.10
Projektstartphase
In der Projektstartphase „[…] werden vor allem die notwendigen Strukturen und Voraussetzungen betreffend die involvierten Systeme geschaffen bzw. beschafft. Das Schwergewicht dieser Phase liegt auf dem In-Gang-Setzen.“11 Einerseits wird das Projekt mit seinen organisatorisch-technisch-sozialen Strukturen etabliert, andererseits werden die in der Vorprojektphase erstellten Grobvarianten der Projektmanagementdokumentationen verfeinert und fertiggestellt:12
Projektorganisation und Projektkultur werden entwickelt.
Die Beziehungen zu den Projektumwelten werden etabliert.
Die Eckpunkte des in
Darstellung 2
abgebildeten magischen PM Dreiecks Anforderungen, Zeit und Ressourcen werden fixiert.
Risikoplanung und Diskontinuitätenvorsorge werden vorgenommen.
Darstellung 2: Magisches PM Dreieck13
In Tabelle 1 sind die für die Projektstartphase notwendigen PM-Werkzeuge zusammengefasst.14
Tabelle 1: Klassische PM-Werkzeuge der Startphase15
In Kapitel 2.3 Elemente werden die einzelnen PM-Werkzeuge näher vorgestellt.
Projektkoordinationsphase
In der Projektkoordinationsphase liegt der Fokus auf der Zusammenführung der Zwischenergebnisse der einzelnen Arbeitspakete.16 Dazu wird der Fortschritt der einzelnen Arbeitspakete überwacht und abgearbeitete Arbeitspakete abgenommen. Die gesamte Projektorganisation und die relevanten Projektumwelten werden im Sinne des Projektmarketings über den auf diese Weise konstruierten aktuellen Projektstatus aktiv informiert. Daneben werden die im Projekt genutzten Ressourcen koordiniert. Die für diese Aktivitäten notwendigen Kommunikationsprozesse mit den einzelnen betroffenen und beteiligten Personen und Gruppen können auf schriftliche und/oder mündliche/persönliche Art und Weise durchgeführt werden. In dieser Phase verwendete PM-Werkzeuge sind die TODO-Listen, Sitzungsprotokolle sowie Abnahmeprotokolle.17
Projektcontrollingphase
Ziel der Projektcontrollingphase ist es, den aktuellen Projektstatus festzustellen, ihn auf Abweichungen gegenüber der Projektplanung zu überprüfen, gegebenenfalls gegensteuernde Maßnahmen zu setzen und die Ergebnisse des Projektcontrollings zu kommunizieren.
Darstellung 3: Projektcontrollingzyklus18
Darstellung 3 zeigt die innerhalb eines Projektcontrollingzyklus ablaufenden Einzelschritte. In der Projektkontrolle werden in einem ersten Schritt die in der Projektkoordination gesammelten Informationen benutzt, um eine gemeinsame Sicht auf das Projekt innerhalb der Projektorganisation zu konstruieren und damit den gegenwärtigen Projektstatus festzustellen. Explizite Teile der Betrachtungsobjekte des Projektcontrollings sind neben dem magischen PM Dreieck die Projektorganisation und –kultur sowie die Beziehung des Projekts zu den relevanten sachlichen und sozialen Umwelten. Im zweiten Schritt wird ein Soll-Ist-Vergleich durchgeführt, um Abweichungen von der Projektplanung und deren Auslöser festzustellen. In der Projektsteuerung werden Maßnahmen geplant, die unerwünschte Abweichungen korrigieren bzw. neue Chancen im Projekt erschließen sollen. Im Schritt der (Neu-) Planung des Projekts wird die in der Projektstartphase erstellte Projektplanung an die neue Projektwirklichkeit angepasst. In Zuge der Erstellung der Projektcontrolling Berichte werden nicht nur die Ergebnisse des aktuellen Projektcontrollingzyklus schriftlich dokumentiert, sondern auch aktiv an die relevanten Personen und Gruppen kommuniziert, um auch diese in die neu konstruierte Projektwirklichkeit „einzuladen“. In der Durchführung der Projektarbeit werden die zuvor definierten Änderungen im Projektalltag umgesetzt. Basierend auf Komplexität und Dauer des Projekts wird der Regelkreis des Projektcontrollings unterschiedlich oft durchlaufen.19
Wesentliche, in dieser Phase verwendete PM-Werkzeuge sind der Projektcontrollingbericht, die Projektcontrollingsitzung und die Project Score Card.20
Bewältigung einer Projektdiskontinuität
„Eine Projektdiskontinuität ist eine Phase der Instabilität in einem Projekt, die zu einer Änderung der Projektidentität führt […]“.21 Unter Projektidentität wird die Summe aus den Beziehungen des Projekts zu seinen sachlichen und sozialen Umwelten und der inneren Struktur des Projekts verstanden.22
Zur Bewältigung einer Projektdiskontinuität sind folgende Schritte zu durchlaufen:23
Kontextbezogene Definition der Diskontinuität,
Planung und Durchführung von Sofortmaßnahmen zur Bewältigung der Diskontinuität,
Analyse der Ursachen der Diskontinuität,
Planung alternativer Strategien zur Bewältigung der Diskontinuität,
Planung und Durchführung von Zusatzmaßnahmen zur Bewältigung der Diskontinuität,
Beendigung der Diskontinuität.
Die Definition der Diskontinuität nimmt immer Bezug auf die Komplexität, Dauer oder die Bedeutung des Projekts für die durchführende Organisation. Kurz- und mittelfristige Maßnahmen, die getroffen werden, um die Diskontinuität unmittelbar zu bearbeiten, werden als Sofortmaßnahmen bezeichnet. Als Zusatzmaßnahmen werden jene Maßnahmen bezeichnet, die basierend auf den Ergebnissen einer Detailanalyse der Ursachen der Diskontinuität getroffen werden.24
Als grundlegende Alternativmaßnahmen zur Bewältigung einer Projektdiskontinuität stehen
das bewusste Nicht-Reagieren auf die Diskontinuität,
der Abbruch,
die Unterbrechung
oder die Anpassung der Projektplanung
zur Auswahl. Sind die im Zuge der Diskontinuität im Projekt gemachten Lernerfahrungen für nachfolgende Projekte gesichert, die Bewältigungsmaßnahmen festgelegt und wurde mit deren Umsetzung begonnen, wird die Diskontinuität als bewältigt angesehen.25 PM-Werkzeuge dieser Phase sind TODO Listen und Beschreibungen der Sofort- und Zusatzmaßnahmen sowie der alternativen Bewältigungsstrategien.26
Projektabschlussphase
„Die Abschlussphase eines Projekts ist dadurch gekennzeichnet, dass sich die Managementaktivitäten auf das vertragsgerechte Vervollständigen und Beendigen der noch laufenden Arbeitspakete konzentrieren.“27 Parallel dazu werden die im Projekt gewonnenen Erfahrungen für die projektdurchführende Organisation gesichert, die Beziehungen zur Projektumwelt abgebaut und abschließend das Projektteam als solches mit der Abnahme des Projekts aufgelöst.28 Da die Auflösung des Projekts durch Beharrungstendenzen verschiedener Umwelten, aber auch des Projektteams selbst, erschwert werden kann, ist der bewussten Auflösung des Konstrukts „Projekt“ gleich große Aufmerksamkeit zu schenken wie dem Aufbau des Projekts in der Projektstartphase.29 PM-Werkzeuge, welche in dieser Phase verwendet werden, sind die Projektumweltanalyse, das Projektabnahmeprotokoll, der Projektabschlussbericht sowie ein Projektabschlussevent.30 Am Ende dieser Phase ist das Projekt vorläufig, jedoch formal abgeschlossen. Der Projektleiter/die Projektleiterin wird zu diesem Zeitpunkt noch nicht formal entlastet.31
Nachprojektphase
In der Nachprojektphase werden einerseits offene Restarbeiten aus dem Projekt durchgeführt,32 andererseits der Projekterfolg abschließend auf Basis der Business Case Analyse aus der Projektstartphase und die Qualität des Projektmanagements aus ex-post Sicht beurteilt.33 Sind diese Tätigkeiten abgeschlossen, findet die finale Projektabnahme statt und der Projektleiter/die Projektleiterin selbst wird entlastet.34 Dazu werden Workshops, Präsentationen, Dokumentenanalysen, Interviews oder Fragebogenerhebungen eingesetzt.35
Vergleich mit anderen Projektmanagement Ansätzen
Der hier vorgestellte Ansatz des klassischen Projektmanagements orientiert sich größtenteils an der Sicht auf das klassische Projektmanagement nach GAREIS. Seiner eigenen Beschreibung zufolge handelt es sich bei seiner Sicht um einen system- und phasenorientierten Ansatz.36 Der Kontext seiner Sichtweise ist jener einer Managementstrategie, also losgelöst von der inhaltlichen Projektarbeit.37 Aus meiner Sicht ist dieser Ansatz eher als ein Methodenkoffer zu sehen, der eine große Anzahl von detailliert beschriebenen Projektmanagement Werkzeugen und Methoden beinhaltet, die für alle denkbaren Projektarten eingesetzt werden können. Der Titel des umfangreichsten Kapitels in seinem Buch „Methoden zum Projekt- und Programmmanagement“ verdeutlich das für mich.
Eine weitere Sichtweise, die ebenfalls Eingang in die Darstellung des klassischen Projektmanagements gefunden hat, ist der Projektmanagement Ansatz nach PATZAK/RATTAY. Diese beiden Autoren nehmen ebenfalls für sich in Anspruch, eine system- und phasenorientierte Sicht auf das Management von Projekten einzunehmen, und das ebenso wie GAREIS aus der Perspektive eines Managers/einer Managerin.38 Im Unterschied zu GAREIS ist für mich dieser Ansatz stärker prozessorientiert aufgebaut, da die Methoden und Werkzeuge explizit jeweils in den Kontext der einzelnen Projektmanagement Phasen gestellt werden, was zusätzlich durch die Gliederung des Buches nach den Projektmanagementphasen und der Namensgebung der einzelnen Kapitel, sowie des relativ gleichverteilten Kapitelumfangs unterstrichen wird. Sowohl der Ansatz von PATZAK/RATTAY explizit39 als auch der Ansatz von GAREIS implizit40, weisen die Verwandtschaft ihrer Sichtweise mit der der ICB der IPMA hin. In der ICB steht der Projektmanager bzw. die Projektmanagerin und die für die erfolgreiche Abwicklung von Projekten notwendigen Kompetenzen, im Sinne der Kombination von Wissen und Erfahrung, im Mittelpunkt nicht jedoch der eigentliche Projektmanagement Prozess.41
Als „Gegenentwurf“ zu dieser kompetenzbasierten Sichtweise auf das Management von Projekten können die Ansätze des PMI bzw. PRINCE2 gesehen werden. Im Projektmanagement Ansatz nach PMI, dokumentiert im PMBoK, wird der gesamte Projektmanagement Prozess in fünf Teilprozessgruppen gegliedert, die angelehnt an die Projektmanagement Phasen zusammengestellt sind.42 Ebenso wie bei ICB entsteht dadurch ein von der Projektart unabhängiger Ansatz, allerdings mit eindeutiger Prozessorientierung im Gegensatz zur ICB.43 Aufgrund dieser Prozessstrukturierung und der detaillierten Gliederung nach Input, Tools and Techniques und Outputs der einzelnen Prozessschritte kann das PMBoK als eine konkrete „Projektmanagement Checkliste“ verwendet werden. Aus meiner Sicht bergen aber genau diese konkreten Hilfestellungen die Gefahr, den Blick für die Projektrealität mit ihrer Komplexität und Dynamik zu trüben, und verleiten dazu blind der „Checkliste PMBoK“ zu folgen. Wie der PMI Ansatz ist auch PRINCE2 prozessorientiert aufgebaut. Projektmanagement wird in acht Prozesse und diese wiederrum in insgesamt 45 Subprozesse aufgegliedert. Ebenso wie im PMBoK werden Input und Output der einzelnen Subprozesse spezifiziert.44 PRINCE2 enthält explizit die Möglichkeit, das Vorgehensmodell an die jeweiligen Bedürfnisse des Projekts anzupassen.45 Im Gegensatz zum PMBoK werden konkrete Methoden in PRINCE2 nicht beschrieben, der Projektmanager bzw. die Projektmanagerin wird angeregt diese für sich selbst zu finden.46
Im nachfolgenden Kapitel werden nun jene Team- und Individualrollen mit ihren Zielen, Verantwortungen und Aufgaben beschrieben, die in klassischen Projekten für die erfolgreiche Durchführung der Projektarbeit benötigt werden.
2.2 Rollen
In einer (Projekt)Rolle werden Erwartungen zusammengefasst, die an den oder die Inhaber bzw. Inhaberin(nen) dieser Rolle gestellt werden. Die Rolle ist somit nicht mit der Person oder Gruppe von Personen ident, die sie ausfüllen, sondern personenunabhängig getrennt von diesen zu sehen. Diese Differenzierung erzeugt Sicherheit und Vertrauen, indem sie ein gemeinsames Grundverständnis und abgestimmte Verhaltensweisen in typischen (Projekt)Situationen ermöglicht, ohne jedoch dem Rolleninhaber zu verbieten, seine individuellen Eigenschaften, Erfahrungen und Werte bzw. die situationsspezifischen Notwendigkeiten in die Ausführung der Rolle miteinfließen zu lassen. Die Erwartungen an Rollen lassen sich in zwei Kategorien einteilen, einerseits in Erwartungen an die Funktion/Aufgabe und andererseits in Erwartungen an den Prozess.47 Entlang dieser Einteilung der Erwartungen werden in diesem Abschnitt die einzelnen Rollen im Projektmanagement dargestellt.
Darstellung 4: Rollen im Projektmanagement48
Darstellung 4 zeigt die nach GAREIS in Projekten vorkommenden Team- und Individualrollen49
Projektauftraggeberteam
50
Projektmanager/Projektmanagerin
Projektteammitglied/Projektteammitarbeiter/Projektteammitarbeiterinnen
Projektteam/Projektsubteam
in Form eines Projektorganigramms.
Projektauftraggeberteam
In Tabelle 2 sind die Aufgaben des Projektauftraggeberteams in den einzelnen Projektmanagementphasen zusammengefasst.
Tabelle 2: Aufgaben des Projektauftraggeberteams51
Projektmanager/Projektmanagerin
Tabelle 3 fasst die Aufgaben des Projektmanagers/der Projektmanagerin in den einzelnen Projektmanagementphasen zusammen.





























