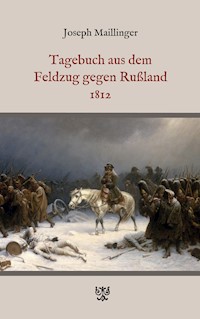
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Offizier Joseph Maillinger diente 1812 als Angehöriger des bayerischen Kontingents in der Großen Armee Napoleons im Feldzug gegen Rußland. Mit seinem Tagebuch hinterließ Maillinger als Augenzeuge dieser bewegenden Zeit ein wertvolles historisches und menschliches Zeugnis, welches dem Leser das tragische Schicksal der Abertausenden in den endlosen Schneefeldern Rußlands Gebliebenen vor Augen führt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt.
Vorwort.
Ausbruch und Vormarsch bis an die russische Grenze.
Vom Njemen zur Düna.
In und um Polozk.
Erste Schlacht von Polozk.
Gefecht bei Bjelaja.
Äußere und innere Verhältnisse bis Mitte Oktober.
Zweite Schlacht von Polozk und Kämpfe bei Strunja.
Beginn des Rückzugs.
Die Greuel in Wilna.
Von Wilna über die russische Grenze.
Fahrt durch Polen und Ostpreußen nach Plozk.
Heimreise.
Schlußwort.
Vorwort.
DAS vorliegende Tagebuch des Hauptmanns Maillinger behandelt den Feldzug der beiden Bayerischen Korps (VI. Korps der Großen Armee) an der Düna; es umfaßt somit die große Moskauer Tragödie nicht, schließt aber auch den Rückzug Wredes aus, den der bayerische General nach seiner im November erfolgten Trennung von den Franzosen gegen Wilna ausführte, da der mit seiner Kompagnie zur unmittelbaren Bedeckung Gouvion St. Cyrs kommandierte Verfasser den Marschall auf dessen Rückfahrt bis an die ostpreußische Grenze begleitete, wo ihn St. Cyr in recht eigentümlicher Weise entließ.1
Trotzdem hat Maillinger viel gesehen und erlebt. Er machte den ganzen Vormarsch der Bayern von dem Tage an mit, als sein Regiment durch den Englischen Garten in München zog, bis zur Ankunft in dem öden, ungesunden Platze Polozk und nahm am darauffolgenden Feldzuge einschließlich der beiden Schlachten vom 16.-18. August und vom 18.-20. Oktober teil. Von beiden bringt sein Tagebuch eingehende Schilderungen, wichtige Beiträge zur Kenntnis der in jenen Tagen an der Düna stattgehabten Kämpfe, die in der bayerischen Kriegsgeschichte eine hervorragende und für die Beteiligten überaus ehrenvolle Rolle spielen. Freilich sind diese Schilderungen, wie wir sehen werden, zum größten Teile nicht eigene Arbeit Maillingers. Dagegen ist dieser wohl überall Originalberichterstatter, wo er von den Verhältnissen des Hauptquartiers, den in Polozk herrschenden Zuständen und von dem überall umherschleichenden Elende spricht, das dem schönen bayerischen Korps weit mehr Menschen kostete als die blutigen Schlachttage. Auch auf dem Rückwege, auf dem er, wie gesagt, den verwundeten und deshalb seiner Truppe vorauseilenden Marschall St. Cyr begleitete, hatte Maillinger manche sonderbaren Erlebnisse. Er war ein fast unmittelbarer Zeuge der Befreiung des in Moskau gefangenen russischen Generals Wintzingerode, gewann einen tiefen Einblick in die grauenhaften Verhältnisse der Wilnaer Spitäler, rettete unter ganz eigentümlichen Umständen am Ponariberg einen Wagen, der aller Wahrscheinlichkeit nach einer der Reisewagen Napoleons selber war, und hat noch vielerlei getan und erlebt, was man der Aufzeichnung wert nennen darf.
Einen besonderen Stempel erhalten aber diese Aufzeichnungen durch die Beziehungen des Verfassers zu St. Cyr, den er aus nächster Nähe beobachten konnte. Das Verhältnis der verbündeten Truppen zu den Franzosen blieb während des Feldzugs natürlich nicht ungetrübt; man wird dabei an die „socii“ der Römer erinnert. Während des Rückzuges haben sich die „Verbündeten“ oft genug untereinander um die schmalen Bissen und die Unterkunft in verwüsteten Häusern geschlagen - ein begreiflicher Vorgang; doch auch mit der französischen Befehlsführung ergaben sich oft genug ernsthafte Reibungen, aus denen Gegensätze erwuchsen, die sich noch heute in den Beurteilungen der militärischen Leistungen durch Angehörige der verschiedenen Nationen widerspiegeln. Wer wirklich historisch verfahren will, muß hier Licht und Schatten besonders vorsichtig verteilen. Neben mancher französischen Anmaßung stoßen wir auf der anderen Seite auch mehrfach auf Starrsinn; Wrede, Thielmann und verschiedene württembergische Kommandeure waren nicht eben leicht zu behandelnde Untergebene. Wo sich auf französischer Seite ritterliche Gesinnung zeigt, fanden sich auch die Fremden bereit, sie anzuerkennen. Von dem bei Borodino gefallenen Montbrun sprechen die Schwaben, vom Vizekönig Eugen die Bayern mit Bewunderung; den „herrlichen Eugen“ nennt ihn General v. Hailbronner, und Freiherr v. Widnmann hat der Andenken des kaiserlichen Stiefsohnes seine Erinnerungen gewidmet.
Maillinger unterließ es, dem Marschall Gouvion St. Cyr einen Denkstein solcher Art zu errichten. Es war auch keine Veranlassung dazu vorhanden, denn der bayerische Hauptmann mußte in der Person dieses Marschalls den französischen Charakter von wenig liebenswürdiger Seite kennenlernen. Gouvion, ein geborener Lothringer, den übrigens auch Napoleon keineswegs liebte, war ein starker Egoist, in dessen Gesamtbilde sich glänzende Geistesfähigkeiten und abstoßende Selbstsucht zu einem unharmonischen Ganzen verschmelzen. Neben künstlerischen Anlagen, die sich auch im Stil seiner Memoiren2 nicht verleugnen, besaß er hervorragendes Feldherrntalent, durch das er sich dem Führer des II. Korps Oudinot ebensoweit überlegen zeigte, wie er ihm an Charakter nachstand.3
Kaum ist der Herzog von Reggio in der ersten Schlacht bei Polozk verwundet und St. Cyr hat das Kommando übernommen, als auf französischer Seite alles ein ganz anderes Ansehen gewinnt. Der hellblickende St. Cyr überfällt die Russen, schlägt sie und vermag sich infolge seines Sieges einen so unternehmungslustigen Gegner wie Wittgenstein auf zwei Monate vom Leibe zu halten. Auch in der zweiten Schlacht bei Polozk zeigt er seine Überlegenheit und er würde den unvermeidlich gewordenen Rückzug über die Düna aller Wahrscheinlichkeit nach ziemlich verlustlos bewerkstelligt haben, wäre nicht der Schleier des Geheimnisses, dessen man zum glücklichen Gelingen bedurfte, durch die Ungeschicklichkeit eines Untergebenen vorzeitig zerrissen worden.
Allein dieser geistvolle Heerführer war, wie gesagt, in seinem Privat leben eine wenig anziehende Erscheinung. Habgierig, geizig und rachsüchtig zeigt er sich seiner Umgebung und es wird wohl schwerlich der in unserem Tagebuche so scharf gezeichnete Kammerdiener Tattegrin allein gewesen sein, der den Marschall veranlaßte, die im Jesuitenkloster zu Polozk gefundenen Weine und Lebensmittel den hungernden Soldaten und kranken Offizieren größtenteils vorzuenthalten, um sie für die Tafel des Höchstkommandierenden aufzusparen. Gouvion St. Cyrs ganzes Wesen enthüllt sich noch einmal, als er beim Abschiede seine treuen Begleiter, die Bayern, nachdem er ihre Dienste gründlich ausgenutzt hatte, ohne ein einziges Wort des Dankes entläßt.
Alle diese Erlebnisse und Erfahrungen trägt Maillinger in einer Sprache vor, die des lyrischen Schwunges mancher, namentlich französischer Berichterstatter völlig entbehrt, aber in ihrer einfachen, ungekünstelten Weise den Eindruck der Wahrhaftigkeit hervorruft. Nichts von den Anflügen romantisch-ritterlicher Gefühle, wie sie sich in den Erinnerungen des Oberstleutnants v. Widnmann und vor allem in den „Erlebnissen“ des späteren Generals v. Hailbronner4 spiegeln, aus denen der ritterliche und schneidige Reiteroffizier in jeder Zeile hervortritt. Der Infanteriehauptmann Maillinger ist ein nüchterner, aber scharfer Beobachter, seinem innersten Wesen nach ein Verstandesmensch, wie der von ihm beurteilte St. Cyr, freilich ohne dessen glänzende Eigenschaften, aber auch ohne seine häßlichen Fehler. Wir sehen ihn überall selbstlos seine Pflicht erfüllen, auch dem herzlosen Menschen gegenüber, der ihm dies häufig recht schwer macht, weshalb denn Maillinger oft genug, aber immer vergebens, um Ablösung von seinem Posten beim Marschall bittet. St. Cyr weiß den ehrlichen Mann doch zu schätzen, und obwohl er ihm manchmal grollt, z. B. wenn Maillinger bei der Auffindung von Lebensmitteln seinen kranken Kameraden etwas zukommen läßt, sind ihm dessen Dienste viel zu kostbar, um ihn aus seiner Nähe zu entlassen, und er hütet sich wohl, auf dem gefährlichen Rückwege durch das feindliche Land eine andere Begleitung als den pflichttreuen Hauptmann mit seinen zuverlässigen Leuten mitzunehmen.
Alle diese Umstände zusammen werden eine Veröffentlichung der Aufzeichnungen dieses wohlunterrichteten Offiziers gerade zur gegenwärtigen Zeit rechtfertigen. Sie erfolgt aufgrund einer Abschrift, die der um die Feststellung der Leistungen bayerischer Truppen im Feldzuge von 1812 hochverdiente Oberstleutnant a. D. Oskar Freiherr v. Hofenfels im Jahre 1895 von der damals im Besitze des Geh. Rechnungssrates Anton Maillinger5 befindlichen Originalhandschrift genommen hat. Freiherr v. Hofenfels, dessen leider bis jetzt noch ungedruckte, von ebenso reichem Verständnis als verblüffendem Fleiße zeugende Arbeit „Anteil der bayerischen Armee, insbesondere der bayerischen Kavallerie am russischen Feldzuge 1812“, sich durch die hochherzige Schenkung des Verfassers gleichwie die Abschrift des Maillingerichen Tagebuches im K. B. Kriegsarchiv zu München befindet6, hat dieser eine Anzahl von Noten beigegeben. Sie beziehen sich fast ausnahmslos auf russische Ortsnamen und sind in der Folge durch die Bezeichnung „Anmerkung in der Handschrift“ besonders kenntlich gemacht. Die übrigen Anmerkungen stammen vom Herausgeber, der sie mit Hilfe des ihm vom K. B. Kriegsarchiv in reichlichem Umfange zur Verfügung gestellten Materials beizusteuern imstande war.
Noch aber müssen wir einige Worte über die Selbständigkeit der Maillingerschen Aufzeichnungen, ihr Verhältnis zu anderen und ihre bisherige Benutzung anreihen. Wer die Quellen zur Geschichte des russischen Feldzuges eingehender untersucht, wird die Beobachtung machen, daß sie in höherem Grade, als auch sonst bei Memoirenschreibern der Fall zu sein pflegt, gegenseitig voneinander abhängig sind. Dies ist erklärlich. Bei den herrschenden Verpflegungs- und Witterungsverhältnissen war es selbst den eifrigsten Tagebuchschreibern nicht immer möglich, der freiwillig übernommenen Verpflichtung nachzukommen. In dem Journal des bayerischen Leutnants Münich7 findet sich an einer Stelle ausdrücklich vermerkt, daß der Schreiber seiner erfrorenen Hände wegen das Tagebuch nicht habe fortsetzen können, und die Schriftzüge bestätigen die Wahrheit der Angabe. In solchen, aber auch in anderen Fällen griff man oft später zu den Niederschriften von Kameraden, die sie bereitwillig überließen, um die vorhandenen Lücken auszufüllen, auch interessante Begebenheiten aus ihnen abzuschreiben. Es sind ganz bestimmte Anzeichen dafür vorhanden, daß verschiedene Tagebücher zu diesen und wohl auch zu bloßen Lesezwecken sich stark im Umlaufe befanden. Manche Chronisten haben eine solche Benutzung fremder Niederschriften, die ja nun an sich den Wert ihrer eigenen Erzählung nicht herabsetzt, offen zugestanden; andere haben es dem Forscher anheimgestellt, sie daraufhin nachzuprüfen.
Bei Maillinger insbesondere findet sich im ersten Teile seiner Aufzeichnungen eine auf den ersten Blick in die Augen fallende Übereinstimmung mit dem Tagebuche des im gleichen Regiment gestandenen Oberleutnants und Adjutanten Friedrich Winther.8 Sie betrifft nicht und nur sachliche Dinge; auch Schilderungen von Zuständen, wie z. B. die
Auffindung der in einer polnischen Ortschaft massenhaft verhungerten Kühe und Schweine und die Beschreibung der Stadt Polozk, stimmen selbst im Ausdrucke - großenteils wörtlich - überein, doch so, daß Maillinger wie auch sonst nach Anlage seines Tagebuchs der umständlicher Berichtende ist, während Winther sich meist erheblich kürzer faßt.
Schon aus diesem Grunde erscheint nicht Winther, sondern Maillinger als jener, der die Aufzeichnungen des befreundeten Kameraden9 in einem allerdings bisweilen weitgehenden Umfange benutzt. Von der Ankunft in Polozk an, wo sich beider Wege trennen, wird Maillinger von Winther unabhängiger, freilich nur, um alsbald in ein neues Abhängigkeitsverhältnis zu einem anderen Berichterstatter zu treten. Im Jahre 1818 vollendete Oberst Graf Seyboltstorff ein darstellendes Werk „Das Königlich Bayerische Armeekorps in dem Feldzuge gegen Rußland“, das bisher niemals gedruckt wurde, sich aber in drei Exemplaren handschriftlich im K. B. Kriegsarchiv befindet.10 Auch Seyboltstorff tritt als Augenzeuge auf, da er wie Maillinger und Winther den Feldzug an der Düna im Regiment König und zwar als Major mitmachte. Laut der an die Spitze seines Werkes gestellten „Vorerinnerung“ benutzte er für die Darstellung des Krieges an der Düna neben amtlichen Materialien „mehrere Tagebücher von einzelnen Offizieren“, darunter ein eigenes und „vorzüglich“ das des „dortmaligen Regimentsadjutanten, nunmehrigen Hauptmanns Winther.“
Nun aber stimmen zahlreiche Abschnitte, schon etwa von S. → der Seyboltstorffschen, S. → der Maillingerschen Handschrift an, in auffallender Weise miteinander überein. Besonders gilt dies von der Schilderung der ersten Schlacht bei Polozk (Seyboltstorff S. → ff., Maillinger S. → ff.), wo umfangreiche Absätze wörtlich oder nahezu wörtlich gleich lauten. Die nächstliegende Vermutung ginge dahin, daß Seyboltstorff Stellen aus dem Maillingerschen Tagebuche in einer allerdings für einen historischen Darsteller weitgehenden Ausdehnung übernommen habe, allein ein genauerer Vergleich beider Texte ergab die Unwahrscheinlichkeit dieser Annahme. Denn der Text Seyboltstorffs erscheint durchweg als der ältere, im Ausdrucke manchmal unvollkommenere, auch noch mehr mit dem Französischen entlehnten Fremdwörtern (z. B. Inondation für Überschwemmung usw.) durchsetzte als jener Maillingers11, vor allem jedoch als der sprachlich unvollkommenere und altertümlichere. Wendungen wie „eine Vermutung machen“, „45jährige Waffenbrüder“, u. dgl., die sich bei Seyboltstorff finden, sind in Maillingers Tagebuch entsprechend abgeändert, verunglückte Sätze nicht selten verbessert. Von der Besorgnis der Bayern beim Anblicke des in der Schlacht von Polozk sich dem Feinde heldenmütig aussetzenden Deroy heißt es bei Seyboltstorff S. →: „Jeden Augenblick zukte (!) das Auge, des Gene Schusses vorbang, der den grauen Helden dieses Wagestück mit dem Tode bezahlt machen könnte.“ Dafür bei Maillinger S. →-37: „Jeden Augenblick befürchteten dessen Umgebungen, daß ein feindlicher Schuß für dieses Wagestück dem ergrauten Helden den Tod bringen könnte.“ Wer hier Original, wer verbessernder Abschreiber ist, ergibt sich von selbst.
Außer solchen rein sprachlichen Gründen aber lassen sich auch noch geschichtliche dafür anführen, daß nicht der Major in die Fußstapfen des Hauptmanns trat, vielmehr dieser seinem Vorgesetzten in einer Weise folgte, die mit militärischem Gehorsam nichts zu tun hat. Während der zweiten Schlacht bei Polozk (18. Oktober) war der dort stattfindende Kampf von dem etwa zwei Wegstunden entfernten Brückenkopfe von Strunja zu sehen. Seyboltstorff, der dortselbst zugegen war, schreibt darüber S. →: „Aus dem Schlosse von Strunja konnte man die verschiedenen Angriffe der Russen auf Polozk, die mit dem Morgen 7 Uhr begannen, genau unterscheiden.“ Auch diese Stelle findet sich wörtlich gleich bei Maillinger (S. →), der zur Zeit aber nicht bei Strunja, sondern in Polozk selbst gewesen war. Es liegt auf der Hand, daß hier der Nichtanwesende den Augenzeugen, nicht umgekehrt dieser den ersten abschrieb, von dem zu entlehnen er unter solchen Umständen gewiß keine Veranlassung hatte. Dazu kommt endlich die frühzeitige Abfassung des Seyboltstorffschen Werkes, das schon 1818 vollendet vorlag, denn am 27. Mai dieses Jahres ist die „Vorerinnerung“ unterzeichnet.
So darf man als feststehend annehmen, daß das Maillingeriche Werk in der hier vorliegenden, recht sorgfältig ausgearbeiteten Gestalt von starken Entlehnungen aus anderen Quellen, namentlich aus Seyboltstorff, keineswegs frei ist. Auch an späteren Stellen tritt dies noch mehrfach hervor und ebenso erscheint für den Aufenthalt in Polozk (am Ende des Feldzuges) Winther wieder stark ausgebeutet. Maillinger war damals krank und deshalb wohl kaum in der Lage, alles selbst zu erfahren, was er berichtet.
Der sachliche Wert seiner Mitteilungen leidet durch unsere Feststellungen nur wenig, da auch Winther und Seyboltstorff sehr ernstzunehmende Zeugen der von ihnen erzählten Begebenheiten sind und Seyboltstorff überdies amtliches Material benutzte, das zum Teil ebenfalls in Maillingers Arbeit übergegangen ist. Völlig unanfechtbares Eigentum des Hauptmanns Maillinger bleiben dagegen dessen Mitteilungen über das Verhältnis St. Cyrs zu seiner Umgebung und alles dort Vorgefallene, sowie auch über den merkwürdigen, im Gefolge des Marschalls ausgeführten und von den Bewegungen des VI. Korps völlig unabhängigen Rückmarsch und mancherlei andere interessante Einzelheiten. In dieser Hinsicht darf das Tagebuch Maillingers den Geschichtsquellen ersten Ranges beigezählt werden.
Im wesentlichen aber wird es den Inhalt seines ursprünglichen, aus dem Feldzuge selbst mitgebrachten Journals wiedergegeben haben, das er wohl aus eigenem Gedächtnis und anderen Mitteilungen ergänzte und auch aus den Schriften der Freunde bereichern zu dürfen glaubte, indem er ihre Worte mit einer gewissen Harmlosigkeit meist einfach übernimmt, ohne sich nur die Mühe zu geben, die Form zu ändern. An sich mochte ihm dieses Verfahren um so entschuldbarer erscheinen, als sicher auch die Freunde sich in Maillingers Feldzugsnotizen vertieften; denn auch Winthers Tagebuch verrät, wenigstens in seiner vorliegenden Gestalt, spätere Überarbeitung, wie dies bei einer großen Menge von Tagebüchern aus dem Feldzuge der Fall ist, deren Urschriften heute in alle Winde zerflattert sind.
Wenn aber Maillinger zweifellos Schilderungen aus fremder Feder in seine Aufzeichnungen herübernahm, kargte er wohl auch seinerseits mit der Mitteilung seines Eigenbesitzes nicht. Denn es ist leicht zu erweisen, daß schon Th. Krauß für seine „Geschichte der bayerischen Heeresabteilung im Feldzuge gegen Rußland 1812“ das damals nur handschriftlich vorhandene Tagebuch Maillingers benutzte.12
Jenes Werk wurde von Krauß anfangs 1857 fertiggestellt. Im vorhergegangenen Jahre war Joseph Maillinger zur großen Armee ins Jenseits abberufen worden, nachdem er zur Anerkennung für langjährige Dienste in der Truppe wie in der Gendarmerie und für seine Teilnahme an den Feldzügen der napoleonischen Zeit, deren er nicht weniger als sechs mitmachte, bis zum Generalmajor aufgestiegen war.13
Schließlich sei noch eine Bemerkung über die Behandlung des Textes in der vorliegenden Veröffentlichung angefügt. Der Bearbeiter verhielt sich hierbei möglichst schonend und erhaltend; nur an wenigen Stellen, namentlich zu Anfang und am Ende, wo das Tagebuch wesentlich auf Angabe der Marschroute hinausläuft, fand eine etwas schärfere Zusammenfassung statt, immerhin jedoch nur soweit, daß unter Nennung aller wichtigeren Orte, die berührt wurden, sowie aller irgendwie bemerkenswerten Begebenheiten die Linie genau verzeichnet blieb, auf der sich der Verfasser von seinem Standorte München aus über die Grenzen des feindlichen Landes und aus diesem wieder rückwärts nach der Heimat bewegte.
1 Maillinger führte die 1. Füsilierkompagnie des Regiments König, 1. Inf. Brig. (General Stebein) der 1. bayer. Division (19. der Großen Armee), weshalb seine Aufzeichnungen einen wichtigen Beitrag zur Geschichte jenes Regiments bilden. Außerdem nahmen auch noch die 1. Füsilierkompagnie des 6. Linien-Infanterieregiments und ein Pikett vom 5. Chevaulègersregiment an der Begleitung des Marschalls St. Cyr teil.
2 Mémoires pour servir à l’histoire militaire sous le directoire, le consulat et l’empire, 4 Bände, Paris, 1829-31.
3 Auch das spätere Leben St. Cyrs liefert Beweise für die Richtigkeit unserer Anschauung. Zur Hochflutzeit der Reaktion half er die ehemaligen Waffengefährten rücksichtslos verfolgen, war aber dann klug genug, während seines eigenen Ministeriums (er war 1817-19 Kriegsminister) viele von ihnen, deren Dienste man brauchen konnte, gegen den Willen der strengen Royalisten wieder anzustellen. Auch verdankt Frankreich seinem Organisationstalent das vorzügliche Aushebungsgesetz von 1818. (Vgl. Guillon, Les complots militaires sous la Restauration, Kap. I und Fastes de la Légion d’honneur, unter „Gouvion Saint-Cyr.“
4 Auszüge aus Widnmanns Erinnerungen (K. A. Hdschr. Samlg. Nr. 339) habe ich in der Unterhaltungsbeilage zur „Täglichen Rundschau“ Nr. 210 und 211 vom 7. und 8. Sept. 1912 veröffentlicht; Hailbronners Erlebnisse (Hdschr. Samlg. Nr. 328a) sind, gleichfalls mit Textproben, von mir in Nr. 32 der Sonntags-Beilage zur Vossischen Zeitung vom 11. August 1912 Nr. 406 eingehender besprochen.
5 Anton Maillinger war der einzige Sohn des Verfassers.
6 K. A. Hdschr. Samlg. Nr. 329a bzw. 330a.
7 K. A. Hdschr. Samlg. Nr. 333.
8 Ebend. Nr. 170.
9 Dieser Freundschaft gedenkt er selbst an einer Stelle seines Tagebuches.
10 K. A. Hdschr. Samlg. Nr. 336.
11 In diesem wurden für die vorliegende Ausgabe die Fremdwörter nach Möglichkeit ganz beseitigt.
12 Spätere Benutzungen der jetzt im. B. Kriegsarchiv befindlichen Abschrift haben natürlich öfter stattgefunden.
13 Joseph Maillinger, am 30. Dezember 1784 zu Mannheim als Sohn eines Offiziers geboren, wurde 1800 im 1. Lin.-Inf.-Leib-Regt. König Junker, 1803 Unter-, 1807 Oberleutnant und 1809 dortselbst Hauptmann. Am 31. Dezember 1813 zur Gendarmerie versetzt, rückte er 1824 zum Major, 1833 zum Oberstleutnant, 1840 zum Obersten und Chef des Gendarmeriekorps, 1847 zum char. Generalmajor vor. Im Jahre 1850 pensioniert, starb er am 31. Mai 1856 in München. Feldzüge: 1800 gegen Frankreich, 1805 gegen Österreich, 1806/7 gegen Preußen, 1809 gegen Österreich, 1812 gegen Rußland, 1813/14 gegen Frankreich. Auf diesen zahlreichen Kriegszügen hatte er nur einmal, am 25. September 1809, beim Rückzuge von Loser gegen Reichenhall, eine leichte Verwundung davongetragen. Verschiedene Orden und Ehrenzeichen schmückten die Brust dieses tapferen Offiziers.
Aufbruch und Vormarsch bis an die russische Grenze.
AM 6. Februar 1812 kam Befehl, alle in Urlaub befindlichen Offiziere und Soldaten einzuberufen und sich in marschfertigen Stand die zu versetzen.14 Bis 14. abends waren auch alle nicht zu weit von ihren Regimentern entfernten Leute in den Garnisonen eingetroffen. Am 15. mittags marschierte das Regiment König, zwei Bataillone und zwölf Kompagnien (wovon ich die 1. Füsilier -, früher Leibkompagnie befehligte), jede 134 Mann stark, an dem Hofgarten und der Residenz vorbei, wo Ihre Königlichen Majestäten geruhten, die defilierenden Truppen in Augenschein zu nehmen. Der Marsch ging durch den Reitschulbogen, die Schönfeldstraße und den Englischen Garten über die eben fertig gewordene neue Bogenbrücke durch Bogenhausen nach Ismaning; wegen heftigen Schneegestöbers war er, obgleich nicht stark, sehr ermüdend.
Am 19. rückte das ganze Regiment mittags in Regensburg ein. Abends machte das Offizierskorps seine Aufwartung beim Fürsten von Thurn und Taxis, dann folgte eine Theatervorstellung. Am 26. Februar kamen wir nach Bayreuth, am 2. März nach Kemnath, wo sich die 1. Schützenkompagnie unter der Leitung des Hauptmanns von Lüneschloß beim Löschen eines Feuers auszeichnete und bei allen Kompagnien des Regiments eine Geldsammlung für die Abgebrannten veranstaltet wurde. Am 8. März marschierte das Regiment nach Bayreuth zurück. Hier befand sich bereits General St. Cyr, der unterm 6. das Kommando über die bayerischen Armeekorps erhalten hatte.
Am 12. März marschierte das Regiment nach Hof, am 13. morgens über die sächsische Grenze nach Plauen, vom 14.-19. über Zwickau, Chemnitz und Freiberg nach Dresden. Am 19. war Rasttag; das Offizierskorps machte seine Aufwartung bei der königlichen Familie. Vom 20. bis 31. März ging der Marsch über Bischofswerda, Bautzen, Löbau, Reichenbach, Görlitz, Lauban, Bunzlau, Haynau, Polkwitz in die Gegend von Guhrau, wo das Brigadequartier und der Stab des 1. Bataillons lagen.
Der 1. April war ein Rasttag. Da die Verpflegung in den Königlich Preußischen Staaten auf Kaiserlich Französische Rechnung geschah, erging Befehl, daß die Truppen sich genügen ließen und keine übertriebenen Forderungen stellten. Die festgesetzte Verpflegungsordnung war folgende: Nach der Konvention bestand eine Lebensmittelration in ¾ Pfund Fleisch, das in Glogau gepökelt und schlecht empfangen wurde, 1½ Pfund Brot aus ¾ Weizen und ¼ Roggen, ¼ Pfund Suppenbrot, ganz aus Weizen, und 1/30 Pfund Salz; ferner für einen Tag 1 Unze Reis und dann auf zwei Tage je 2 Unzen Erbsen, an Getränken entweder täglich ½ Liter Bier oder 1/6 Liter Branntwein; für die Pferde der Husaren, Chasseurs, Kanoniere zu Pferde, sämtliche Pferde der Infanterieregimenter, der Kriegskommissäre, Offiziere der Suite usw. eine Futterration zu 10 Pfund Heu, 10 Pfund Stroh. 2/3 Scheffel Hafer. Nach Breslauer Maß gab eine leichte Ration 2 Metzen Hafer, 6 Pfund Heu, 9 Pfund Stroh, eine schwere Ration aber 3 Metzen Hafer, 8 Pfund Heu, 9 Pfund Stroh; in dieser Höhe wurde die Ration allgemein angenommen.
Am 2. April kam ganz unerwartet der Befehl zum Weitermarsche. Wir rückten an diesem Tage nach Polnisch-Lissa, am 3.-9. über Schmiegel, Gluchowo und Moschin nach Posen, am 11. nach Briesen; am 12. durch Czerniejewo und Witkowo, wo der Stab blieb, nach Chlomdowo und Szestowo; das Hauptquartier befand sich in Czerniejewo (Schwarzenau).
Hier blieben wir bis auf weiteres und exerzierten täglich recht fleißig. Meine Wohnung, ein kleines hölzernes Haus, dort Schlößchen genannt, lag an einem kleinen See, an dessen jenseitigem Ufer, ungefähr zwei Büchsenschuß entfernt, alle Morgen ein paar Dutzend Wölfe erschienen, um zu saufen. Es gibt, zum Teil mit Hunden vermischt, sehr viele Wölfe in dieser Gegend, doch sind sie nur dann gefährlich, wenn sie der Hunger treibt. Einzelne sah man den ganzen Tag auf den Feldern herumlaufen, ohne daß sich die Einwohner darum bekümmerten.
Am 17. April war ich in Trzemesno15, wo sich ein großes Magazin befand, um Lebensmittel für das Regiment zu empfangen; am 23. ritt ich mit meinem Freunde Oberleutnant Winther16 über Mieltschin nach Rudy. Vom 28. April bis zum 3. Mai ging der Marsch über Ruchocinek, Skompe, Ostrowo, Slupzy, Kleczewo, Slawoszewek, Sompolno, Bierzwenna nach Kutno, am 4. von 6 Uhr morgens bis abends 4 Uhr durch Gombin nach Polnisch-Troszyn an der Weichsel; dabei hatten wir ein heftiges Donnerwetter. Sergeant Richter kam mit einem Teile der Kompagnie nach Deutsch-Troszyn, Sergeant Uhl nach Borki und Korporal Sprinzenberg nach Troszynek. Der Stab blieb in Gombin. Das Armeekorps bezog in dieser Gegend Kantonierungsquartiere; das Hauptquartier war in Kutno, der 1. Brigade- und der Regimentsstab mit der 1. Grenadier- und 2. Füsilierkompagnie lagen in Gombin, der II. Bataillonsstab mit der 2. Schützenkompagnie in Czermno, die 1. Schützen- und 5. Füsilierkompagnie in Grabie und Strzemeszna, die 3. Füsiliere in Guzewo und Waliszewo, die 7. Füsiliere in Koszelewo. Staw und Reszki, die 4. Füsilierkompagnie in Topolno und Barcik, die 6. und 8. Füsilierkompagnie in Lipinskie, die 2. Grenadierkompagnie in Kamien, die 1. Füsilierkompagnie in Troszyn und Revier auf lauter hübschen Weichselinseln oder Halbinseln. Die Weichselzopfkrankheit wird hier sehr häufig auch unter den eingewanderten deutschen Kolonisten getroffen, da nicht Unreinlichkeit allein, sondern wahrscheinlich auch das Wasser dazu beiträgt. Am 6. besichtigte ich sämtliche Stationen meiner Kompagnie; es wird täglich exerziert. Am 9. von 11-2 Uhr wurde an die Schiffbrücke (30 Pontons) eine Stunde oberhalb Plozk an der





























