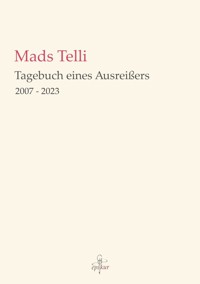
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die persönlichen Aufzeichnungen Mads Tellis zu nahezu allem - Metaphysik, Zeitgeschehen, Erotik, Kunst und Literatur: sehnsüchtige, ironische und kritische Blicke aus der seelischen Ferne des Ausreißers auf die Dinge, die Menschen umtreiben. Psychologie ist Kunst, ist Poesie - wenn man es will. "Der Begriff des Ausreißers lässt an ausbüxende Kinder oder statistische Messwerte außerhalb eines Erwartungsbereichs denken. Ausreißer stellen jene Ordnungssysteme, deren Teil sie sind oder sein sollen, durch ihr Sein in Frage. Ihre Individualität überwiegt. Sie sind und bleiben Ausnahmen. Ausnahmen, die, weil sie Tatsachen sind, die Quelle von Kreativität im Individuellen wie im Kollektiven sind. Sie sind Nochniedagewesene und bringen Nochniedagewesenes hervor. Ihre Werke und Taten sagen: Ohne Freiheit bist du nichts. Aber ohne Freiheit sind auch keine Kulturen möglich. Das organisierte Zusammenleben der Menschen mit all seinen Strukturen, sozialen Rollen, seinen metaphysischen und weltlichen Erzählungen, die Menschen zu Einwohnern derselben Sphäre machen, war und ist der vermutlich folgenreichste kreative Akt, den wir über die Jahrtausende hervorgebracht haben. Am Anfang standen die Ausreißer, stand das Unwahrscheinliche, Ungedachte, die Ausnahme."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 573
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mads Telli, geboren 1972, ist das Pseudonym eines Diplom-Psychologen und Buchautors. Unter anderem Namen sind von ihm bisher mehrere Romane sowie Sachbücher zu Psychologie und Philosophie erschienen.
Inhalt
FRAKTUREN
Sich neu beginnen
Sinn und Schönheit
Der verschlafene Philosoph
ZEHNTAUSEND DINGE
Schattenblicke
Psyche und Eros
Der Schauspieler
TAGEBUCH EINES AUSREIßERS
I Die Spiele der Unglücklichen (2007 – 2013)
II Liebe dein Symptom wie dich selbst (2013 – 2017)
III Ketten unter Oberflächen (2017 – 2020)
IV Der Einbruch des Absurden (2020 – 2023)
FRAKTUREN
SICH NEU BEGINNEN
2015 - 2019
Nachtbücher, nicht Tagebücher, müssten sie heißen. Die Nachtschwärze, die sich durch die Zeilen zieht, eine Farbe wie Obsidian.
***
Ich las gestern Abend in Sloterdijks Zur Sprache kommen, zur Welt kommen, darin das zweite Kapitel, dessen Anfang ich M. vorlas.
Die Kunst des Anfangens. Die Kunst des Neuanfangens.
Da wir in diesem Leben erst mit unserer bewussten Erinnerung beginnen, nachdem unser Leben schon lange angefangen hat und wir das dunkle „Vorher“ nur aus den Erzählungen kennen, sind wir dementsprechend ungeübt in der Kunst des Am-Anfang-Anfangens. Wir sind darauf geeicht, etwas einmal Begonnenes zu übernehmen, (mit etwa drei Jahren, plus/minus), und es dann, nach einer Zeit sozialisierender Einweisung, sukzessive eigenständig weiterzuführen. Doch den Neuanfang kennen wir kaum. Vielleicht wird im Laufe des erwachsenen Lebens ein Neuanfang notwendig, dann müssen wir ohne Übung, ohne Training und ohne Hilfe einer Tradition oder Erinnerung diesen Neuanfang wagen. Und dieser ist ein Sprung ins Unbekannte.
Tradition – lässt sich übertragen auf die persönliche Geschichte, die wir angesammelt haben. Diese ist die Tradition, und von ihrer Güte hängt es ab, ob wir einen Neuanfang brauchen oder nicht. In meinem Fall spricht alles für einen Neuanfang, eine Neuerfindung der Form des Wesens, das ich bin. Das Installieren einer neuen Persönlichkeit.
Alle Ideen, die für eine solche in Frage kommen könnten, sind notwendigerweise Rudimente meiner Biografie, Ideen von Nicht-mehrrauchen, Kunstmachen, dieses und jenes usw. Auf Ideen zu verzichten, würde bedeuten, einzig der mutigen Handlung zu vertrauen, der Handlung, deren Ausgang ungewiss ist. Aber dieser Ausgang der Handlung ist das einzig verlässliche Kriterium für die nachfolgenden Entscheidungen und Nachfolgehandlungen.
***
Die Meditation über den Tod ist ein vielbefahrenes Feld, gleichsam ein öffentlicher Geistesraum, und sie hat auch manchmal etwas Pathetisches. Lukrez wies darauf hin, dass uns der Tod, da wir über ihn nichts wissen können, nichts anginge.
Doch was ist mit der Geburt? Öffne ich mich dieser Vorstellung, scheint mir, als hätte jemand von Pandoras Büchse den Deckel gerissen und als umgäben mich seitdem all die Übel wie ein atmosphärischer Uterus. Nur die Hoffnung bleibt als verkrusteter Bodensatz im Inneren und wirkt von dort, geheimnisvoll, täuschend, eine seelische Krücke, die das Wollen und Sehnen aufrecht gehen lässt und den Blick irrt.
***
Doch gibt es drei Ereignisse, die unser Leben in Geheimnis hüllen: erstens die physische Geburt, zweitens das Erwachen des Ich-Bewusstseins (bzw. die Bündelung des Bewusstseins in einem immer konzentrierter und dichter werdenden und erinnerbaren Identitätspunkt, der dann zum Ich wird) mit ca. 2 oder 3 Jahren, und drittens der Tod.
In fast allen Philosophien und spirituellen Konzepten fehlt das zweite Ereignis. Es ist aber jenes, das die Mythen aller Religionen in ein neues Licht stellt: Die vermeintliche vorzeitliche Ewigkeit wäre dann eine Reminiszenz an die ersten zwei/drei Lebensjahre: Konzepte von Seele, Vorleben, Karma, einem Licht, das alles sei, Paradiesen, die man verlassen habe etc.
Bis in heutige Tage wird der Beginn eines menschlichen Lebens uterozentrisch gedacht. Die Beobachtung von außen legt es nahe: In den meisten Fällen gibt es Zeugen bei der Geburt und während der ersten Lebensmonate. Doch wie anders erschiene uns das Leben, könnten wir es aus einer radikal subjektiven Perspektive betrachten. Wir fänden uns vor in einem Leben, das bereits eine nebulöse Vergangenheit hat, von der wir nur aus zweiter Hand erfahren. Es bleibt ein diffuses Ahnen davon, es müsse schon etwas geschehen sein, an das wir uns nicht erinnern. Diese existenzielle retrograde Amnesie drängt nach Antworten. Die Antworten der Eltern und Großeltern scheinen uns gar zu prosaisch und unspektakulär; sie resonieren nicht mit jener erfühlten oder intuierten Bedeutsamkeit jener vergessenen Ereignisse (sofern sie überhaupt vergessen und nicht nur nicht abgespeichert wurden). So suchen wir nach Geschichten, die geeignete Pendants zu jener erahnten Bedeutsamkeit sein könnten: Vorleben, Reinkarnationen, Parallelwelten, mögliche Heimstätten einer Seele, die noch nicht (wieder)geboren wurde. Diese Geschichten mögen kapriziös sein, sind in ihrer metaphorischen Bedeutung aber wahr, so wie ein Traum als Sinnbild auch wahr ist.
***
Insofern stehen Metaphysik, Spiritualität und Esoterik in nachbarschaftlicher Nähe zu Kunst und Fantasie, aber auch zu Traum und Tiefenpsychologie. Sie sind zu verstehen als neurologische und/oder semantische Straßen, auf denen das Bewusstsein in Gleichnisse verpackte Wahrheiten über sich selbst aus einer nicht erinnerbaren Vergangenheit in eine bewusst erfahrene Gegenwart transportiert. Der größte Gewinn der Menschheit, aber auch sein größter Fluch: diese Straßen manifestiert zu haben. Wer die mitunter brüchigen oder eisglatten Straßen und die entsprechenden Fahrzeuge nicht zu beherrschen weiß, läuft Gefahr, sich auf Abwegen zu verirren, oder, schlimmer noch, in einem psychoexistenziellen Straßengraben zu enden.
***
Es ist ja so leicht, gerade heute, von sich zu behaupten, man sei einmalig, also ein Nochniedagewesener. Man fordert ein Attribut für sich, ohne die Gegenleistung zu erbringen, ohne das Fundament aus Tat und Sein schaffen zu wollen. Man lebt in der Gleichförmigkeit des allgemeinen Trotts mit, füllt soziale Rollen aus, beliebig austauschbar, selbst die Vater- und Mutterrollen sind heute beliebig austauschbar – und behauptet von sich, den Zeitgeist nachplappernd, man sei einzigartig, einmalig, ein Individuum, ein Nochniedagewesener. Doch ein Nochniedagewesener zu sein, ist eine Auszeichnung, die in sich selbst errungen werden muss, und die nicht im sozialen Kontext vergeben wird, es gibt auch keine Preisverleihungen dafür, keine Nachricht in den Medien. Es ist eine Auszeichnung, die ganz im intimen Verborgenen stattfindet, die sich in der Unzweifelhaftigkeit des eigenen bewussten Seins zeigt.
Der Nochniedagewesene findet seine abstrakte Entsprechung im Bild des antiken Heros. Es gibt nur einen Grund, sich den Namen eines Helden zu merken, seine Taten zu berichten, zu besingen, in Epen zu verewigen: seine Einmaligkeit. Mit ihm tauchte etwas Nochniedagewesenes auf, schlug ein wie ein Meteor, verschmolz mit dem Boden, in den er versank und den er für immer veränderte. Er wird nie wieder erscheinen, er war ein einmaliges Ereignis, eine Gewalt, die den Sphären des Menschseins Spuren und Muster einprägte, Dellen hinterließ und Kanten abschlug.
Doch der Held muss nicht im Großen wirken, der Nochniedagewesene nicht bekannt werden. Es reicht, ganz er selbst zu sein. Was heißt das? In erster Linie eine Negation: nicht das sein, zu was er programmiert und konditioniert wurde. Nur durch diese Negation wird der Weg frei für das Nochniedagewesene. Und dann? Einen Anfang finden, sich zum Anfang bringen, Sichanfangen – sagt Sloterdijk. Wir sind ja mit dem Anfang nicht vertraut, nicht mit den ersten drei, vier Jahren, über die ließen wir uns bestenfalls berichten. Dieser Fremdbericht liefert das Modell für alle späteren Identifikationen, die uns vom Nochniedagewesensein abhalten und uns zum Funktionsparameter der Gesellschaften machen. Also muss man den Fremdbericht verwerfen. Er ist ohnehin in der Außenperspektive verfasst und enthält keine Aussagen über das Wesentliche: über mich selbst, über das, was ich erlebte. Wo also setze ich den Anfang? Wie beginne ich mich selbst?
Wie kann ich mich entbinden?
***
Und so müsste ein neues Buch geschrieben werden, ein ungeplantes Protokoll des wahnwitzigen Versuches, sich aus der bisherigen Lichtung, deren Licht unerträglich ist, weil vergiftet, herauszuheben und hineinzusetzen in das benachbarte Dunkel, um dort ein neues Licht zu pflanzen, das man selbst ist, ein Licht, das wärmer leuchtet, das mehr dem Seelenkern entspricht, das sich nicht der Neonröhren der kollektiven Fertigungshallen bedient, sondern nur eine Quelle kennt: das eigene Wesen. Mag es anfangs nur glimmen wie ein mageres Streichholz, irgendwann wird es strahlen wie der Stern, der wir eigentlich sind.
Hoffe ich.
Und wenn nicht? Dann war es den Versuch wert. Das eigene Licht zu erleben – gibt’s ein besseres Ziel?
***
Doch wie leicht lässt es sich aufgeben und wie schwer ist der Weg… eine Flasche Wein und tausend Seiten über das Sein und das Nichts. Ich glaube Sartre nicht. Ich halte ihn für nicht integer. Er bemüht sich zu wenig. Dass es den Anschein hat, liegt an seiner Intelligenz und seiner Bildung. Er hat sich eingerichtet im Café de Flore, trinkt roten Wein und vögelt Studentinnen. Mehr nicht. Camus: Ihm vertraue ich, ein aufrechter Mensch, so scheint es, aber eben auch einer, der nicht besser, nicht schlechter lebte als alle anderen und dann starb. Absurderweise nicht, wie man befürchtete, an den Folgen der Tuberkulose und seinem Rauchen, (er gab es deswegen sogar zeitweise auf), sondern durch einen Autounfall. Die Philosophie des Absurden.
***
Ich schrieb vom Sichneubeginnen, davon, sich überhaupt beginnen zu können. Verwoben war dieser Gedanke mit dem des Nochniedagewesenen, und ich frage mich, ob und wie weit ich das geschafft habe. Manchmal spüre ich das innere Licht, doch schnell vergesse ich es wieder – Zeichen guter Dressur, Zeichen anständiger Angst, das eigene Licht über die Grenzen des Innenraums hinaus leuchten zu lassen. Und doch hat sich etwas geändert. Während ich damals nach fremder Glut suchte, um mich entfachen zu können, vermeide ich diese mittlerweile. In mir der Anspruch, die eigene Quelle zu finden – oder zu verlöschen. Das ledigliche Mitbrennen in den großen Scheiterhaufen sozialer Identifikationsangebote kommt mir wie reine Zeitverschwendung vor.
***
„Autofiktion“ – Knausgård zum Beispiel, aber auch Und im Abgrund… Letztlich das: Autofiktion. Eine Authentifizierung der Tatsache, dass jeder Roman, der Individuelles berichtet, im Grunde eine Art psychische Autobiografie ist. Üblicherweise wurde dies bisher nur dezent angedeutet, etwa von Hesse, dessen Held aus dem Steppenwolf, Harry Haller, durch seine Initialen und den Sprachrhythmus an den Autor erinnert. „Psychische“ Literatur sollte also gar nicht erst versuchen, etwas zu erfinden, sie schöpft aus der Psyche und den Erfahrungen des Autors. Drum herum können Szenen erfunden werden, also Parcours, auf denen dieses Geschehen stattfindet. Die Romanform ist eine fast juristische Angelegenheit: Man erzeugt den Schein, als wäre alles eine Fiktion, und installiert sich somit ein Abwehrsystem gegen eventuelle Persönlichnahmen. „Es ist ein Roman, und alle Ähnlichkeiten mit realen Personen oder Geschehnissen sind rein zufällig“ – der Autor genießt Immunität, sein Roman gehört zum Diplomatengepäck.
***
G. überrascht mich mit einer aus dem Candomblé stammenden Theorie. Sie sieht die Narbe unterhalb meiner Brust und ich erzähle ihr von der Operation, ohne die ich als Säugling nicht überlebt hätte.
G. sagt, in ihrer Tradition nenne man Menschen wie mich Abiku. Ein Abiku sei jemand, dessen Seelenplan ein frühes Ende dieses Lebens in der Kindheit vorsieht, der aber, man könnte sagen aus metaphysischer Schludrigkeit heraus, gerettet wird, zum Beispiel durch einen engagierten Arzt. Fortan, so G., lebten diese Menschen nun ohne jenen tieferen Seelenplan, der andere durchs Leben führt. Ab dem Zeitpunkt der außerplanmäßigen Rettung wäre jeder Tag für die Abiku ein Bonus, ein Leben losgelöst von Vision, Ziel, Wollen. Diese Menschen fühlten sich oft allein, missverstanden, haltlos, natürlich ziellos, aber sie würden bisweilen über ungewöhnliche Fähigkeiten verfügen. G. sagt, es obliege aber dem Abiku, sich Ziele herauszusuchen. Er sei frei. Freier, als es Menschen sein können, die an ihren Seelenplan gebunden seien.
Das Konzept spricht mich an. Nur leider vermisse ich jene besonderen Fähigkeiten. Verfügte ich zum Ausgleich meiner Lebensziellosigkeit über einige metaphysische Superkräfte, wäre die seelische Wartezeit in diesem Bonusleben sicher unterhaltsamer.
Als Abiku bin ich ziemlich ehrgeizlos, aber dennoch frei, mir Ziele auszusuchen. Besteht nicht darin ein Vorteil? Der Ehrgeiz, der andere zermürbt, bleibt mir erspart. Handlungen dürfen sich ihren Selbstzweck bewahren. In der Wahl der Ziele bin ich frei, weil es keinen Seelenplan gibt, dem sie entsprechen könnten. Es sind Lust und Interesse, die mich leiten dürfen. Die Lust am mentalen Vagabundieren. Auch an der Innenschau, die eine gewisse humorvolle Komponente enthalten darf.
***
Will der Künstler sich selbst verstehen? Es wäre leicht für ihn, leichter als für viele andere. Seine Werke sind konkrete Formgebungen seiner inneren Muster, seiner Psyche, seiner Fragen und Antworten. Man muss sich vom Gedanken des Metaphorischen befreien: Ein Kunstwerk ist nicht metaphorisch, es ist konkret. Es symbolisiert nicht etwas, es ist dieses Etwas.
***
Die Einsamkeit ist so übel nicht. Sie hält mich frei.
Die Neigung zur Ablenkung heißt Schindluder mit der Freiheit treiben.
***
Ein nahezu crowleyeskes Gefühl, den Abgrund zuzulassen. In der Tiefe schauen zu lernen. In einer Tiefe, die nur deswegen Tiefe ist, da sich in ihr all die Wahrheiten bündeln, deren Kenntnisnahme das Ich bisher verweigert.
Es ist nicht die Magie, welche die Assoziation zu Crowley erzeugt, sondern das unverschämte Lebensgefühl. Die Bereitschaft mich selbst in einer Art zu akzeptieren, die dem Selbstbild so gar nicht entspricht.
Woher? Warum? Es sind die Rückblicke, die erst ab einem bestimmten Lebensalter möglich sind, Rückblicke, die in ihrer Gesamtheit und Vielfalt die Vergeblichkeit eines Wollens und Wünschens offenbaren, die durch Erziehung und Prägung auf die Festplatten des Ichs installiert wurden, und die nicht meiner Natur entsprechen. Rückblicke, die zeigen, dass diese Natur ihre ganz eigenen Bahnen zieht, ihre eigenen Pfade geht, und dass jenes innere Idealbild des „guten Menschen“ keinen Millimeter dieses Weges ändern konnte, sondern lediglich ein dauerhaftes Gefühl von Schuld und Scheitern hat entstehen lassen.
Das Ich ist zu klein, um als Gefäß den Weltengeist und die Natur zu fassen, und so bleibt nur die Hingabe an das „Größere“. Die Rationalität des Ichs taugt nur zur Feinjustierung des täglichen Handelns.
Die Schulung der Achtsamkeit ist dementsprechend nicht Zweck, sondern Kunst. Die Achtsamkeit ist eine Fertigkeit des Bewusstseins, nicht des Denkens, und somit frei von Zielgebundenheit.
Es ist, als griffe man in die Bahnen des Schicksals nicht mehr ein, als ließe man sie zu, wie sie sich zeigen, und als stürze man sich dennoch mittenhinein.
Das rationale Wollen meines Ichs hat nicht die Macht, dieses Hervordrängende zurückzuhalten, und es hat auch nicht die Macht, den eigenen rationalen Willen dem entgegenzustellen. Beharrt es aber darauf, vergibt es sich die Chance eines unerwarteten Erfolges anderer Natur.
***
Alles, was ich wissen kann, jedes Bild, jede Erinnerung, jede Vorstellung, jede Schlussfolgerung: Was wäre, wenn all das nichts als Einbildung ist, wenn alles das zusammen eine Blase ergäbe, gefüllt von Hologrammen, Projektionen, die einzig ihre Ursache und ihren Zweck haben in einem autokreativen Entwurf, der dem Leben einen Sinn geben soll, der an sich nicht vorhanden ist? Teil dieser Blase könnte die Vermutung sein, dass es jenseits dieser Blase eine transzendente Wirklichkeit gibt, in der man nach dem Zerplatzen aufgefangen wird. Diese Vermutung scheint den Menschen wichtig genug zu sein, um sie als Religionen zu institutionalisieren. Was nicht gelebt werden kann, trotz des Verlangens danach, wird ins Jenseits verlagert. Oder es wird dort getröstet. Doch was, wenn dahinter, hinter den Außenwänden der Einbildungsblasen nichts als Leere, Vakuum wäre, ja nicht einmal das, schlicht nichts? Dann bliebe die Auflösung dieses Irrtums den Religiösen erspart. Die Nichtreligiösen hingegen sind zur Freiheit ihres Lebens verdammt, zur eigenverantwortlichen Ausgestaltung jener knappen Zeit zwischen Geburt und Tod.
Doch in den ersten zwei Jahrzehnten werden die Inhalte dieser Blase fremdprogrammiert, und so kommt der Zufall ins Spiel, jenes existenzialistische Geworfensein in das Leben, das uns wie auf den Sand geworfene Fische zappeln lässt, bis wir am Leben erstickt sein werden. Wo der Fisch landet, ist Zufall, denn der Werfer kümmert sich darum nicht. Mit vollen Händen wirft er, was ihm aus seinem Fang in die Finger kommt.
So kann man Glück haben, und die Fremdprogrammierungen der ersten Lebensjahre erleichtern dem Nichtreligiösen das freie Leben. Oder man hat das zufällige Pech, mit ungünstigen Einbildungen leben zu müssen, Einbildungen von persönlicher Schuld, Unvollkommenheit, Minderwertigkeit, persönlicher Wirkungslosigkeit. Diese sind die wahren Verdammten. Doch das ist Zufall.
***
Der Mensch ist ein soziales Tier, er kann nicht allein sein. Eremiten der Wüste oder des Gebirges halten das Alleinsein nicht lange aus. In ihrer Blase konstruieren sie sich ein oder mehrere Gegenüber, deren Suggestivkraft so stark wird, dass sie an deren reale Existenz zu glauben beginnen und nach ihrer Rückkehr davon berichten werden. Dieser Bericht ist verführerisch: Nie wieder allein sein, denn es gibt Wesen, die immer um einen herum sind.
Dazu sinngemäß Peter Sloterdijk: Sie gehen in die Wüste, nicht um allein, sondern um in besserer Gesellschaft zu sein. Auch: asymmetrische Selbstverdoppelung.
Der Teufel ist der Zweifler an der konstruierten Gewissheit übersinnlicher Begegnungsmöglichkeiten. Diese Überzeugungen sind nur wirksam, wenn man von ihrer Richtigkeit unzweifelhaft überzeugt ist. Der Zweifel schwächt oder vernichtet die heilsame und wohltuende Illusion, nie allein zu sein, behütet zu sein, sinnstiftend durch das Leben geleitet zu werden, auch wenn man diesen Sinn nicht immer versteht (die Großen Unsichtbaren werden schon wissen, warum dies alles).
Der Teufel ist der Zweifler. Doch wenn er den Zweifel sät, etwa an der Göttlichkeit des Christus oder an der Existenz Gottes selbst, leugnet er auch sich selbst. Also gibt es keinen Teufel. Der Teufel ist der Gedanke des Realisten, der sich des Blasencharakters seines Weltbildes bewusst wird und über die schlichte Leere dahinter Bescheid zu wissen meint. Und so kann es ihn nicht geben. Dies als Tipp für alle Religiösen: Seid ohne Furcht vor dem Teufel, es gibt ihn nicht.
Zweifel ist entweder eine Konsequenz der Unwissenheit oder ein Resultat mangelnder Überzeugung. Wenn man unzweifelhaft von etwas überzeugt ist, nennt man es Wissen. Zweifeln wir an dem Wissen, dann ist es nicht überzeugend genug, es scheint fehlerbehaftet. Das ist die buddhistische Unwissenheit, advidya. Statt einen Teufel ins Feld zu führen, ist das Konzept der Unwissenheit eleganter.
***
Wie kann man sich nur in Kleinigkeiten verstricken, wenn es doch um den Kampf gegen das Verlöschen geht? Wenn wir das Verlöschen akzeptieren können, wird es zur Frage nach der Gestaltung der Zeitspanne zwischen Geburt und Tod. Andernfalls werden wir Kombattanten in jenem Krieg, der seit Jahrtausenden gegen das Verlöschen geführt wird. An vorderster Front stehen die Mystiker, wahre Helden, sie hauen Breschen in das Dickicht der Unmöglichkeit.
***
Das Verlöschen ist ein Gegner, der so furchterregend, so entsetzlich ist, dass der Mensch vermeidet, sich seiner gewahr zu werden. Der eigentliche Krieg des Menschen wird seit Jahrtausenden gegen das Verlöschen geführt, doch dessen sind sich die meisten nicht bewusst. Alle anderen Kämpfe sind dagegen kleine Scharmützel, überflüssige Gefechte um Nebensächlichkeiten, die den Menschen aufreiben und in Atem halten. Das Verlöschen ist die eigentliche Essenz des menschlichen Seins, und seine Geistesgeschichte nur dadurch zu erklären.
Stufenmodelle des Bewusstseins, deren höchste Sprossen in die Möglichkeit einer Unsterblichkeit greifen – im Yoga, Buddhismus, in neuen esoterischen Ideen etc. – scheinen fieberhafte Versuche, einen Weg aus der Bedrohung des Verlöschens zu finden.
Die Yogis und Buddhisten trainieren den Ernstfall, indem sie sich auf ein geistiges Dasein in einer immateriellen Welt vorbereiten. Die Westler setzen auf die Manipulation des genetischen Quellcodes.
Yogi: „Es muss ohne Körper gehen. Wir trainieren zu Lebzeiten den Tod. Simulierte Körperlosigkeit. Nur noch Bewusstsein.“
Westler: „Wir schicken Raumschiffe mit menschlicher DNS ins All. Die Astronauten trainieren in simulierter Schwerelosigkeit. DNS ist reine Information. Eine materialistische Konzeption der Unsterblichkeit.“
***
Wie oft treffen wir Entscheidungen, ohne dabei das Große und Ganze zu berücksichtigen.
Das Große und Ganze, zumindest jenes unseres ureigenen Wesens, was ist das – aus unserer menschlichen Perspektive?
Vielleicht diese seltsame Truhe, die sich mit der Geburt auftut und uns den Blick gestattet in ihr Inneres, auf all die Diamanten, Preziösen und auch all den Dreck darin, und die mit dem Tod wieder zuklappt, manchmal leise und behutsam, manchmal mit dem Krachen eines herunterfallenden Deckels?
Welche dieser Elemente aus dieser Kiste nehmen wir heraus, schenken sie den Menschen? Was wird von uns in der Welt bleiben? Was holen wir heraus, um es selbst zu bestaunen und legen es behutsam wieder hinein? Was darin veredeln wir? Säubern wir? Formen wir um? Spielerisch oder verbissen, von einer geheimnisvollen Agenda getrieben?
Unsere Entscheidungen bekommen ein anderes Gewicht, manche scheinen leichter, manche schwerer, wenn man sich den kurzen Zeitraum der offenen Schatzkiste namens Leben vor Augen hält.
***
Das Ich – ja was? Eine amüsante Tautologie: „Ich weiß, dass das Ich nicht existiert.“
***
Manchmal scheint mir dieses Leben wie das Ausrollen eines Judokas nach dem Hineingeworfensein in diese Welt. Manchen gelingt es recht elegant, manchen weniger.
Und manche fallen erst weich, wie auf ein Trampolin, werden wieder in die Höhe geschleudert und sind dann jeder existenziellen Fallschule unkundig, wenn sich der Grund unerwartet als Granit entpuppt.
***
psychostasia: das Wägen der Seele. Zeus wiegt mit goldener Waage die Seelen, als Achilles und Memnon kämpfen. Die Keren, (der Tod eines Menschen, geflügelte Wesen), ziehen Memnons Waagschale nach unten.
***
Das Leib-Seele-Problem: Das ist nicht das Problem, sondern das Symptom.
***
Es ist manchmal so dicht beieinander: die Verlorenheit und der Rausch der Freiheit.
***
Man kann sein Leben verändern, wenn man in unglücklichen inneren wie äußeren Bedingungen verstrickt ist, indem man sich auf das undenkbar Neue, auf unmögliche Liebe, auf radikal anderes Denken einlässt, wenn man also bereit ist, Schritte ins Unbekannte zu wagen. Nicht vorrangig etwas aufgeben, sondern bislang ungegangene Wege wagen. Dann, und nur dann, ist Veränderung möglich. Dieser Weg ist meist schmerzvoll, aber lebendig. Er ist aber der Einzige, der zu einer Veränderung führt.
Es ist ein Irrtum anzunehmen, wir beendeten etwas, damit es danach besser werde – vielmehr verlassen wir lediglich einen Weg, auf dem es nicht weitergeht und wechseln auf neue Pfade, die uns weiterkommen lassen.
***
Jede Erfahrung bringt auch ein Geschenk mit sich. Eine Erfahrung zu bereuen, etwa eine berauschte Nacht, heißt, das Geschenk zu ignorieren. Das Geschenk besteht in der unmittelbaren Anordnung der einzelnen Elemente der Erfahrung. Diese Anordnungen zeigen auf, was vorher nicht klar im Bewusstsein war.
***
Das Leben sei schrecklich, denn wir seien zum Tode verurteilt, da habe Thomas Bernhard recht, sagte Reich-Ranicki. Dieser Satz ist falsch. Vielleicht ist es schrecklich, dass unser Weg unausweichlich in den Tod führt, aber das berührt die Qualität des Lebens nicht. Schrecklich ist das Leben, wenn die Zelle, in der wir auf unsere Hinrichtung warten, einsam, kalt und feucht ist und wenn die Henkersmahlzeit nicht schmeckt.
***
Egozentrik wie ein wuchernder Fremdkörper im Geist. Der Geist arbeitend bemüht, ein Abbild zu schaffen von der Wirklichkeit, um handlungsfähig zu sein, wohl wissend, dass er die Wirklichkeit an sich nicht erkennen kann.
***
Glaubte Mephisto wirklich, mit einem Kneipenbesuch bei Faust durchzukommen und damit die Wette um seine Seele schon gewonnen zu haben? Der übende Teufel. Mephisto ist nicht unfehlbar.
SINN UND SCHÖNHEIT
2013/14
Gestern am Morgen war ich noch achtzehn, am Abend dreißig. Über Nacht wurde ich vierzig. Das Erschreckende ist, dass es über Nacht passierte, sozusagen im Schlaf. Und nun ist wieder ein Morgen, hoffe ich. Ein Morgen eines Tages, der weniger Möglichkeiten und weniger Illusionen bereithält.
***
Eine Zeitlang setzte ich meine Hoffnung auf Meditation. Doch ein detektivischer Blick auf die Psychotechniken zeigte: Meditationen sind Bestätigungsinstrumente des Weltbildes, aus dem sie entwickelt wurden. Alle yogischen Meditationen scheinen das yogische Weltbild zu bestätigen. Und alle buddhistischen Meditationen die Philosophie des Buddhismus. Teresa von Ávila sprach von den sieben Wohnungen Gottes – die Beschreibung ist dem Chakrasystem nicht unähnlich, nur dass in den Wohnungen sich zunehmend der Geist Gottes offenbart. In der siebten Wohnung ist der empirische Beweis Gottes erbracht. Jede Meditation führt also zu den Einsichten, die das entsprechende Weltbild als die höchsten Ziele postuliert.
Der Krieg, der im Hintergrund tobt, seit Jahrtausenden, ist der Kampf des Menschen gegen das Verlöschen. Gegen das Nichts, aus dem wir Individuen für einen Wimpernschlag lang unerklärlicherweise auftauchen und sofort wieder vergehen. Wie sinnlos, wie erschreckend. Wäre es da nicht besser, gar nicht erst entstanden zu sein? Oder?
Jede Meditation führt im idealen Fall, (der im Grunde nie eintritt), zur Einheit mit einer göttlichen Wesensessenz, die jenseits von Raum und Zeit existiert. Die höchsten Stufen offenbaren dann die Einheit mit ihm, mit Gott, Allah, Shiva, der Buddhanatur. Die Handlungsanweisungen, die zu diesem Erlebnis führen sollen, sind in all diesen Fällen klar und streng, aber unterschiedlich. Die einen schwören auf gerade Sitzhaltung, die anderen auf gebücktes Gebet in Demut, wieder andere auf die Ekstase durch exzessives Drehen des Körpers zu tranceinduzierenden Trommeln.
Aber das Ziel ist die Einheit mit einem Wesen, von dem behauptet wird, wir seien dieses schon immer gewesen, wenn auch unwissentlich. Dieses Wesen ist unsterblich, es ist gefeit vor Verlöschung, weil es sich jenseits der Zeit aufhält. Es muss dementsprechend anorganisch und nichtmateriell sein, andernfalls wäre es der Zeit unterworfen und damit vergänglich.
Wenn wir Zeit und Raum als menschengemachte Parameter unseres künstlichen Weltbildes definieren, heißt das, dass dieses transzendente Wesen weder Anteil an unserem Weltentwurf hat noch diesem unterworfen ist. Was, wenn dieses Wesen nur die Sehnsucht des Menschen nach einer Existenz jenseits der Gefahr des Verlöschens verkörperte? Wenn es eine Erfindung der mystischen Conquistadores ist, die sie uns wie eine transzendente Mohrrübe vor die Nase halten? Was, wenn es nicht um das Erreichen eines Bewusstseinszustandes geht, der zumindest als Potential existierend gedacht wird, nur eben verdeckt? Was, wenn all die mystischen Bemühungen ein verzweifelter Versuch wären, die aberwitzig geringe Chance zu ergreifen, mit Hilfe unseres mächtigsten Werkzeugs, des Bewusstseins, einen Schleichweg zu finden, der uns am Verlöschen vorbeiführte? Meditiert, rufen sie uns zu, übt, trainiert! Wir errichten eine kognitive Architektur, eine kosmische Blase aus Einbildung, in der wir uns vor dem Verlöschen verstecken können wie in einem Atombunker!
Buddha wäre derjenige, der nachhaltig das Problem benannt hätte, und Sokrates mit dem berühmten Satz, dass er nur wisse, dass er nichts wisse, hätte ungleich kürzer und auf fast spartanische Weise auf das Gleiche verwiesen. Jesus hätte sich als megalomanischer Architekt eines kognitiven Weltentwurfs erwiesen, der dem, der sich vertrauensvoll in ihm heimisch macht, das Verlöschen erspart. Die dennoch Verlöschten lassen sich schlecht in den Zeugenstand rufen.
Castaneda hätte sich als desillusionierter Einwohner der bereits höheren Etagen gezeigt, als er Don Juan sagen ließ, es gäbe nur einen Jäger, und der gewinne immer, und dieser sei der Tod. Ihm zu entgehen, sei so gut wie unmöglich, die Bemühungen darum würden in den meisten der ohnehin seltenen Fälle zu grotesken Verformungen des Bewusstseins führen. Aber da wir ohnehin keine Chance hätten, schon gar nicht, wenn wir uns dem Schicksal ergeben, wäre es aufregender, den „Kubikmillimeter Chance“ zu ergreifen, der uns ja vielleicht doch bliebe.
Timothy Leary hätte mit seiner ‚Neurologic‘ und der neuronalen Schaltkreistheorie lediglich wieder aufgegriffen, was seit Jahrtausenden die Mystiker berichten. Doch hin und wieder muss eine alte Wahrheit reformuliert werden, um den Zeitgenossen die Möglichkeit zu geben, sie zu verstehen – es werden sowieso nur Wenige sein, aber die sollten nicht an unverständlich gewordenen Vokabeln antiquierter Sprachen scheitern.
Wie genau ist das Strickmuster dieses Weges: das gewöhnliche Weltbild deinstallieren durch das Stoppen des inneren Monologes; die Plastizität des Gehirns nutzen, um es in einem neuen Sinn umzuformatieren; das Installieren eines Weltbildes, das ein Bewusstsein postuliert, das das Endziel erreicht hat (oder sich schon immer in ihm befindet), und sodann die Einheit mit diesem herstellen. Klingt einfach. Ist aber schwer, wie alle Meditierenden bestätigen können. Die Beharrungstendenzen eines einmal etablierten neuronalen Netzwerks erweisen sich als stabil.
Die Nihilisten und Existenzialisten: Sie ergeben sich der Resignation über die zum Scheitern verurteilte Mission des Bewusstseinsprojekts und raten zur bestmöglichen Gestaltung der kurzen Zeit, die uns eben beschieden ist und dazu, keinen Gedanken an das Danach, das Davor etc. zu verschwenden.
***
Die Befürchtung, das Leben wäre zu kurz, um das eigentliche Anliegen zu erfüllen oder das inhärente und kaum erahnte Ziel zu erreichen. Zu kurz, um den Geist zu klären, all die verwirrende Vielfalt an Wissen, Theorien, Erfahrungen, Wünschen, Träumen zu klären.
Zu kurz, um die Verwirrung aufzulösen, die babylonische Sprach- und Bildverwirbelung: Göttinnen, Shakti, Anima, Prana, Yin und Yang, Unterbewusstsein, Unbewusstes, Überbewusstsein, überhaupt all diese Stufenmodelle von Entwicklung des Geistes, diese Stockwerke, diese dürftigen Metaphern aus der Behausungskultur. Das alles zu verstehen, aus den Netzen dieser Begriffe sich zu befreien… reicht dazu das Leben? Und wenn es dazu reicht: müsste doch danach erst das Abenteuer beginnen, die geistige Reise in einem freien, einzusehenden „Raum“, ungehindert von all den menschlichen Begriffen, die unseren Geist in Scheiben, Kategorien, Schubladen, Kästchen schneiden.
***
… Doch wer kann das?
Vielleicht reicht ja doch das Leben… wenn es sich befreit aus den Netzen des rationalen Geistes, die doch nur Werkzeuge des Ichs sind. Was kann man tun? Man haut Breschen in das Unterholz des Nichts und zeigt sie stolz als neue Pfade vor. Oder man erhebt sich darüber und berichtet von der Schönheit und dem Hässlichen.
Man muss entscheiden: Man versucht entweder, der Welt Erkenntnisse abzuringen und sie der Welt als seine Errungenschaften vorzuweisen. Oder man feiert die Schönheit der Welt – die Schönheit der Welt, die aus den Faltenwürfen des Gewandes Gottes besteht; Gottes, der den kosmischen Tanz tanzt und sich in Schwung bringt. Und die der eigenen menschlichen Existenz als im Wind wirbelnde Staubkörnchen aus dem Tuch Gottes. Jeder Windhauch ein Teil der kosmischen Choreografie, jedes wirbelnde Staubkorn unverzichtbares Element der göttlichen Dramaturgie.
Wo die Wahrheit erahnt wird, sind die Texte kurz und lyrisch. Ihre Wahrheit offenbart sich nicht durch sophistische Gelehrsamkeit, die sich lang und breit wie klebriger Teer ausbreitet, sondern durch ihre Schönheit, die über jeden Zweifel erhaben ist.
Solch Lyrik ist oft mystisch, doch werden die Texte erst dadurch zum Mysterium, weil der verstrickte Geist sie nicht verstehen kann.
Die Musik ist oft der bessere Text. Musik ist das bessere Gebet. Man muss ein wahrhaft großer Dichter sein, um mit seiner Dichtung so das Göttliche ehren zu können, wie es die Musik vermag.
***
Und doch hat er sich korrumpieren lassen, hat an Texten gearbeitet, die weder schön noch wahr sind, die erwartet wurden von jenen, die genauso verstrickt sind wie er selbst. Wenn er die gleiche Blindheit beweist, an der alle kranken, ohne es zu wissen, werden sie ihn anerkennen als einen der ihren, werden ihm Respekt zollen und Geld geben.
Doch jeder ehrt das Göttliche auf seine Weise und nach seinen Möglichkeiten. Als er das Buch über den Tarot schrieb, kämpfte er sich durch das Dickicht seiner inneren Dunkelheit und ließ sich von einem fernen Licht leiten. Später schrieb er die Geschichte seines Stolperns und Strauchelns; über das Licht musste er schweigen, denn es war allzu fern und er kannte es nicht aus der Nähe.
***
In meinen jungen Jahren mangelte es mir an der nötigen Ernsthaftigkeit, um zu verstehen, dass das Leben kurz ist; zu kurz, um alles zu erreichen, was man zu erreichen für nötig hält, um ohne Groll das Leben wieder zu verlassen; und zu kurz, um all die später erst entstehenden Wünsche und Ziele noch umsetzen zu können, wenn man sich in jungen Jahren nicht hinreichend vorbereitet hat. Nun ist vieles, wenn auch nicht alles, zu spät.
Vielleicht hätte ich vor zwanzig Jahren Camus lesen sollen, den Sisyphos, aber vermutlich wäre ich über die entscheidenden Einsichten hinweg gegangen – eben aus jenem Mangel an Ernsthaftigkeit. Als Camus so alt war wie ich jetzt, war er bereits ein Bestsellerautor, vor allem aber jemand, der zu einer tiefen Ernsthaftigkeit gelangt war.
Hätte ich den Anfang von Camus` Sisyphos damals gelesen und ernst genommen, wäre ich zur richtigen Zeit mit der Frage konfrontiert gewesen, was das Leben für mich lebenswert macht, und ich hätte eine Antwort finden müssen – wenn auch eine, die sich im Laufe der Jahre immer wieder selbst redigiert. Ich wäre auf das Nietzschezitat gestoßen, dass vom Philosophen verlangt, mit seinem Leben ein Beispiel zu geben, und ich wäre auf Galilei aufmerksam gemacht worden, der seine Theorie, dass die Erde um die Sinne kreise, problemlos widerrief, als er vor der Wahl stand, für sie zu sterben oder nicht. Wenn er für diese Theorie nicht zu sterben bereit gewesen war, so hätte ich resümieren können, war sie ihm auch nicht wert, für sie zu leben – sie war, wie Camus richtig folgert, zutiefst gleichgültig. Und diese Erkenntnis hätte mich zu der Frage gebracht, was denn für mich nicht gleichgültig ist.
Da ich mir diese Fragen nicht stellte – was ich wahrscheinlich auch nicht getan hätte, wenn ich Camus gelesen hätte – verbrachte ich viel Zeit mit zutiefst gleichgültigen Ideen und Vorhaben und ließ mich noch mehr von gleichgültigen Einstellungen und Überzeugungen leiten. So gingen die Jahre ins Land.
Wenn ich nun, mit 41 Jahren, vor die Frage gestellt würde, ob ich mit meinem Leben, wie ich es bisher geführt, mit den Entscheidungen, die ich gefällt, und mit den Resultaten, die ich wissentlich oder unwissentlich, absichtlich oder unabsichtlich, erreicht und herbeigeführt habe, zufrieden bin, ich also beruhigt sterben könnte, würde meine Antwort instinktiv Nein heißen. Es wäre ein Nein, das aus tiefster Seele käme, ein Aufschrei, ein im Zustand der Not vorbeirauschender Lebenszeit herausgerufenes Nein.
Die Einsicht in dieses fundamentale doppelte Versäumnis – was macht mir mein Leben lebenswert, und wie kann ich gemäß dieser Einsicht aufrichtig leben – lässt meinen Eigendünkel in sich zusammenbrechen.
***
Ziel eines Textes kann sein, eine Perspektive für die Höhen, für die noch zu erreichende Weite des Bewusstseins, aufzuzeigen. Eine Vision zu erzeugen. Nur welche? Tausende Esoterik-Bücher treten an, den Menschen Orientierungen anzubieten, aber zu welchem Preis, mit welch primitiver Qualität: Hört auf zu denken, denkt magisch wie die Kinder! Glaubt an Reiki, an Engel, an Chakras, an den Weihnachtsmann, an Tarotkarten, an die Klopfmethode, an den Kaffeesatz. Das, so wird versprochen, löse das Problem der Dunkelheit an den Rändern der Heideggerschen Lichtung.
Doch manche Visionen sind voller Tiefe. Wie will man das auseinanderhalten, wenn man doch selbst darüber noch nicht aussagefähig ist?
Die Esoterik als eine Schatzkiste mit zehntausend Glasperlen, darunter eine echte. Die Suche nach ihr würde sich als eine unendliche erweisen.
***
Indien hat mich auseinandergenommen. Das alte Ich will sich erhalten, verweigert die Transformation. Und eine andere Kraft, die schon lange erwacht ist, will nach vorn, nach oben, in die Weite. Das Ich kann nur wahrnehmen, was es kennt, wohin es den Blick schon gewendet hat. In Indien hat sich etwas etabliert, für das das Ich keinen Blick hat, es wirkt aus dem Unbewussten.
Sinnhaftigkeit herzustellen, wenn auch nur als eigenständige Konstruktionsleistung, ist eine der Aufgaben des Ichs. Wenn das Ich aber nun widerstreitende Informationen bekommen hat, löst sich die alte Sinngebung auf. Eine neue ist noch nicht errungen. Das Ich taumelt in einem sinnleeren Raum. Ohne Sinn fehlt die Motivation zur Tat. Das I Ging spricht von einem Gehege ohne Wild. Nun steht man mit der Armbrust da. Wohin soll man schießen? Auf einen Baumstamm? Dazu gibt es keinen Grund. Also lässt man die Waffe sinken und schaut sich suchend um.
***
In letzter Zeit eine heilsame Dekonstruktion des spirituellen Imperativs zum unbedingten Sinn.
In einem Fall sind sich Kirchen und Esoteriker einig: Nach dem Tod geht’s weiter. Diese Überzeugung ist verhängnisvoll: denn wenn sie nicht stimmt, hat der Gläubige das einzige Leben, das er hat, diesen kurzen unwahrscheinlichen Moment der Teilhabe am Universum, in den Dienst einer Zukunft gestellt, die es nicht gibt. Die Weihnachtsgans, die auf den Urlaub im Februar spart. Und selbst wenn sie stimmen sollte, es also nach dem Tod für eine subtile Wesenssubstanz weitergehen sollte, welchen Sinn hätte es, dieses Leben hier deswegen zu vermeiden? Sobald der Gedanke an Lohn oder Strafe in einem nächsten Leben auftaucht, ist das ganze Leben schon korrumpiert. Güte und Nachsicht wären lediglich Investitionen in ein angenehmeres Jenseits. Das Hoffen auf gute Wiedergeburten: der spirituelle Bausparvertrag. Jede Handlung, jeder Gedanke würde verzerrt, krumm und schief, führte uns weg von der Wahrhaftigkeit der eigenen Person, von seiner Kongruenz, es würde ein verlogenes Leben werden, und solche Leben stiften in der aller Regel nur Leid bei anderen und bei einem selbst.
Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit. Nur ein aufrechtes Leben ist auch ein erfülltes. Alles andere hinterlässt ein schales Gefühl von Vergeudung, von „da hätte mehr passieren können“. Und im Falle eines Weiterexistierens: Ohne Wahrhaftigkeit hätte man schlechtes Karma angesammelt, Spannungen erzeugt, die sich auf unsanfte Weise entladen werden.
***
Das Hinausgreifen ins Nichts durch die Ideen der Menschen. Alles sind Versuche, sind Möglichkeiten, sind Experimente. Für was? Um mit der eigentlichen Sache umgehen zu können: dem Verlöschen. In der Genesis steht es bereits: Sie waren des Todes. Das wären sie ohnehin gewesen, wie auch die Tiere, aber nun wissen sie es. Sie wissen es schon zu Lebzeiten. Sie wissen mitunter Jahrzehnte vor dem eigentlichen Verlöschen darum, dass sie sterben werden. Das erzeugt Angst, die fundamentalste Angst, die vorstellbar ist. Ich rede nicht vom Tod an sich, der könnte als „Pforte“ umgedeutet werden und wird es bis heute reichlich. Ich rede vom Verlöschen, das keine Ausrede mehr zulässt. Dieses Problem zu lösen, ist die Idee eines richtenden Gottes und eines Reiches, in welches man post mortem aufgenommen wird, nicht übel. Sie erleichtert. Aber ist sie wirklich so funktional? Ich sagte es schon: die Korruption, die damit zwangsläufig einhergeht. Das Herunterdrosseln der menschlichen Potentiale an Vernunft, Geistesklarheit, an Aufrichtigkeit, an Gewahrsein des Schönen. Der Preis ist also hoch, zu hoch vielleicht.
Die Entscheidungen des Lebens festzumachen an dem Glauben an einen Gott, an ein Gericht post mortem etc. ist ein Kinderglaube. Wer dem nachhängt, ist im Herzen Kind, das sich einer strengen väterlichen Figur oder einer richtenden Instanz beugt. Die Motivation zu einem guten Leben ist extrinsisch, die wahren Motive und Bedürfnisse bleiben im Verborgenen, man verdrängt sie aus Scham und Angst. Das Leben bleibt in weiten Zügen ungelebt, die wahre Persönlichkeit entfaltet sich nicht.
Der Mündige hingegen traut sich selbst die Entscheidungen für gut und richtig zu; er ringt darum, er macht es sich nicht leicht. Er sucht nach brauchbaren Kriterien. Eines solcher Kriterien könnte sein: das Verringern und/oder Vermeiden von Leid anderer und einem selbst. Das epikureische Denken – ein kluger Lebensratgeber – impliziert das. Das reine unreflektierte Ausleben von Bedürfnissen führt nicht immer zu Lust. Meistens hat es Leid zur Folge. Wenn Epikur zur Lust rät, dann ist dieser Rat nicht einfach zu befolgen. Er setzt Empathie und Weitsicht voraus. Die Lust erschöpft sich im Auskosten des Vorgefundenen. Sonst wird Lust zu Wollust. Wollust will, Lust genießt. Das Lustversprechende abzulehnen, wäre eine mühevolle Verweigerung des Lebens- und Ereignisflusses. Aber man verzichtet auf übermäßige Völlerei, denn im Nachhall erzeugt sie mehr Leid als Lust.
Was erzeugt Lust? Je nach Reifegrad des Geistes: Für einen wachen Geist ist die höchste Lust das schauende Gewahrsein, die Klarheit des Geistes, mit der die Welt, die man kurz erleben darf, überhaupt erst wahrnehmbar wird. Die Meditation ist also nicht mehr Vorbereitung für ein Leben im Bardo, im Paradies oder sonst wo, sondern das Mittel, um den Geist zu klären, auf dass die Welt in ihrer Schönheit wahrgenommen werden kann; um die Schleier von falschen Glaubenssätzen und Überzeugungen zu ziehen, die uns das Leben verstellen, und die uns von unwissenden und verlöschungsängstlichen Menschen in langwierigen Erziehungsprozessen injiziert wurden. All das gilt es aufzulösen, beiseitezuschieben, wegzuräumen, rauszuschmeißen aus dem Geist. Aus dieser Klarheit heraus werden das Leid, das Glück, das Schicksal der Menschen wahrnehmbar, aus ihr wird auch deutlich, welche Handlungen richtig sind, (obwohl wir das in Gänze nie wissen können), weil sie unserer inneren Aufrichtigkeit entsprechen. Doch die Maßstäbe dessen schaffen wir erst selbst, wenn wir mündig sind. Andernfalls werden solche Maßstäbe in uns installiert, und es sind Maßstäbe, die dem korrumpierten Geist der Verlöschungsängstlichen entspringen.
***
Freiheit. Heißt dementsprechend Freiheit von den falschen Götzen, falschen Moralvorstellungen, falschen Jenseitsvorstellungen, von ungeprüften Glaubenssätzen oder religiösen Fantasien.
Heißt das nun, dass ich nicht an Götter glaube? Man muss nur wissen, was die Götter sind. Es gibt Kräfte und Mächte im Außen, auch Wirkmechanismen unserer Psychophysis, die per se nicht direkt wahrnehmbar sind. Es ist nichts Falsches daran, diesen ein Bild zu geben, es ist auch nichts Falsches daran, diese zu lieben oder zu mögen, es spricht nichts dagegen, diese anzurufen, um sie zu aktivieren, denn so funktioniert unsere Psyche. Die Große Göttin ist das Bild für die kraftvolle Macht im Universum, Dinge zu erzeugen, sie ist power und sie hat auch etwas Sexuelles – nicht im reduzierten Sinne des Beischlafs, sondern eine sexuelle power, eine inhärente Erotik, die allen Kräften von Anziehung, Formung, Verschmelzungstendenzen etc. innewohnt. Wer sie verehrt – aufrichtig verehrt, nicht nur aufgrund von Konditionierung sie anbetet – der spürt diese Kraft in sich selbst; natürlich, denn man selbst ist ja Teil dieses Universums. Der Verehrende spürt, dass er Teil von etwas Größerem ist, von einem erotischen Grundprinzip von Kinetik, Thermodynamik, von Gravitation und elektromagnetischer Kraft, von Zusammenprall und Trennung, von Verschmelzung und Schöpfung, von Werden und Vergehen. Dieses Teil-Sein von dem Größeren, das nur abstrakt gedacht werden kann, bezieht sich auch auf den zeitlichen Aspekt, der das Verlöschen bedingt. Doch die Zeit unseres Seins darin kann verehrend und liebend geschehen. Es ist immer unsere Wahl.
***
Liebe, von der man sagt, dass sie sich so und so oder ganz anders äußern könne. Liebe ist die Antwort auf die primordiale Einheit mit dem Ganzen, ist jeder Vorgang, der von den abertausenden, ja unzähligen Verbindungen zeugt, die innerhalb des Ganzen herrschen. Liebe ist der Trieb, das Paaren von Kuh und Stier, aber auch das Schlagen der Zähne eines Tigers oder eines Gepards in den Hals einer Gazelle. Liebe sollte als ein Kontinuum gedacht werden. Liebe ist Trieb, ist Eros, ist Selbstliebe und Selbstbehauptung (Thymos), ist Agape, Empathie, Mitgefühl, tiefes Verstehen und auch das Verstehen-Wollen. Liebe ist auch Neugier, Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Und Liebe ist das bereitwillige Hingeben an die Schöpfung, an die Gesetze des Seins dieses Universums. Auf diesem Kontinuum von Trieb bis tiefstes Verstehen bewegen sich die lebenden Wesen, zumindest dieses Planeten.
In dieser Bereitschaft zur Liebe, ja mehr noch, zur Hingabe an das Universum, an das eigene Schicksal, an die natürlichen Bedingungen, die wir als lebende Wesen vorfinden, liegt Schönheit.
***
Doch ich erwähnte das Schicksal: Ja, es gibt ein Schicksal, auch wenn man alle religiösen Fantasien beiseiteschiebt. Es liegt in den Bedingungen, die wir vorfinden, die uns zu dem machen, die wir sind. Es ist mein Schicksal, Mensch zu sein und nicht Tiger. Und so habe ich mich der menschlichen conditio humana zu fügen. Als solcher bin ich Körper, habe Hunger, Appetit, Lust, will mich bewegen, erfahre meine Grenzen, bin auch Gefühl und Emotion, bin Affekt, bin Zorn und Freude gleichermaßen. Ich bin auch Geist, kann denken, meditieren, schreiben, lesen, sprechen, diskutieren. Ich bin auch Wille und kann – auf der Basis der Bedingungen und des schon Geschaffenen, Entstandenen – in der Gegenwart dem Geschehen neue Impulse geben. Da ist Determination und Freiheit, und beide sind miteinander verwoben und gehören zusammen. Das ist Menschsein, und dieses Menschsein kann man Schicksal nennen. Alles, was darüber hinausgeht, ist schon durch religiösen Eifer angekränkelt, etwa wenn von Verhängnis, Vorherbestimmung etc. die Rede ist.
Wer also lieben kann – mehr noch (denn jeder liebt): Wer das Kontinuum der Liebe zulassen kann, sich als Getriebener, als Erotiker, als Selbstbehauptender, als Mitfühlender, als achtsam Handelnder, als Verstehender gleichermaßen sehen kann – erfährt die Schönheit der Welt, des Seins.
Das Wahre, Schöne und Gute, so sagte man bei den Griechen, seien die drei Kriterien des wünschenswerten Seins.
***
Das Schöne ist Gegenwart, das nur Wahre verweist auf etwas, das woanders ist, das nur Gute auf etwas, das zu anderer Zeit sein sollte, aber jetzt nicht ist.
***
Schönheit. Wenn man die Trinität von Wahrem, Gutem und Schönem mit einem Bekenntnis zur Schönheit in Beziehung setzt, wird man fragen: Warum nicht das Gute? Warum nicht das Wahre? Die Antwort auf diese Fragen ist zuhöchst persönlich. Sie führt in den Intimraum, der von öffentlichen Diskursen ausgeschlossen sein sollte.
Solange man die Tiefe der Schönheit nicht auslotet, sondern sie nur als gefällige Oberflächen, wohlgeratene surfaces oder als notwendige Bedingung im Spiel des Begehrens begreift, müssen das Gute und das Wahre jeweils autonome Rollen einnehmen. Das verwirrt den Geist.
In der Schönheit, wenn es gelingt, über sie wirklich tief zu kontemplieren, offenbaren sich auch das Gute und das Wahre. Das nur Wahre kann ich nicht lieben, auch wenn es mir wichtig ist. Bestimmte Wahrheiten sind nicht schön und doch sind sie unumstößlich.
Aber Wahrhaftigkeit ist ein Attribut des Schönen. In der Wahrhaftigkeit verschmelzen das Wahre und das Schöne miteinander, und so kann ich auch die Wahrhaftigkeit lieben. Das Gute ist oft zu moralisch, um schön sein zu können; in ihm sind die Heuchelei und die Lüge zu Hause. Das Gute wird erst durch Aufrichtigkeit rein. Aufrichtigkeit aber ist eine Konsequenz aus dem Wahren und dem Schönen.
Das Gute wird durch Aufrichtigkeit zur Güte.
Liebe ist tiefes Verstehen, und dieses geht einher mit Mitgefühl und Güte.
Wenn die drei Grundeigenschaften des Wahren, Guten und Schönen nicht im Einklang sind, sind Gedanken und Handlungen nichts davon; sie sind dann nur Lüge und Betrug, Ausdruck von Unwissenheit und Blindheit.
Ich verliebte mich einst in eine Frau, die ich sehr schön fand. Und doch konnte ich mir diese einfache Wahrheit nicht eingestehen: dass ich mich in sie verliebte, weil sie so schön war. Also brachte ich eine angebliche Wahrheit ins Spiel und auch das vermeintlich Gute. Beides hatte nur die Funktion der Rechtfertigung und Erklärung für ein Phänomen, das ich in seiner erhabenen Einfachheit nicht verstehen konnte. Ich glaubte, dass Verliebtheit und Liebe miteinander zu tun hätten, wobei Verliebtheit doch nur ein kurz aufflackernder Sonderfall der Liebe ist, ein Ausnahmezustand, in dem die Gefühlsaufwallungen jede kontemplative Klarheit hinwegspülen. Liebe ist wie eine Leiter, deren untere Sprossen das Verlieben und deren höchsten Sprossen das bedingungslose und nichtwollende Verstehen sind. Ich wollte das Schöne, das ich vor mir sah, haben: Das ist Begehren. Aber ich wendete den Blick nicht in mein Innen, in das tatsächliche Empfinden. Ich hätte da die Energie der Erregung, die Aktivierung der Lebenskraft entdecken können, die durch mich floss, und hätte diese, als Ausdruck des Lebens an sich, lieben und genießen können. Leichter fällt die nicht-haben-wollende Liebe bei Dingen, die man per se nicht haben kann, etwa einen Sonnenaufgang oder eine gotische Kathedrale.
Ist Liebe nur Wollen, nur Begehren? Kann es eine Liebe geben, die sich selbst genügt, die nichts braucht und nichts wünschen lässt? Vielleicht die Liebe, die angesichts des Schönen aufblüht …
Ich empfand Liebe zur Schönheit, als ich zum ersten Mal auf einem Boot an einem sommerlichen Spätnachmittag in den Canale Grande hineinfuhr und die überwältigende Schönheit der Palazzi, Kirchen und Villen Venedigs in dem goldenen Licht der späten Sonne sah. Als ich nachts in Tulum in Mexiko aus dem Taxi stieg und zum ersten Mal in meinem Leben einen tropischen Strand sah, vom Vollmondlicht beschienen, das auch auf den sich sanft wiegenden Blättern der Kokospalmen glitzerte. Am Seine-Ufer, am Pont Neuf und in den Gassen des Montmartre empfand ich diese glückliche Liebe, die nichts fordert, die nur Freude und tiefe Ergriffenheit angesichts des Schönen ist, und ebenso in den Tälern des Pamirs in Mittelasien, auf dem Fort von Jodhpur mit seiner orientalischen Schönheit, in Gokarna, der alten Hindu-Pilgerstadt mit seinen schmalen Gassen und den verwunschenen Häusern inmitten von Palmenwäldern. Ich empfand diese Schönheit und die nichts wollende Liebe, als ich zum ersten Mal bewusst das Sechste Brandenburgische Konzert von Bach hörte, das Vierte Klavierkonzert von Beethoven oder ein Sitar-Konzert von Ustad Shahid Parvez an den Ghats von Varanasi. Ich fand diese Schönheit in einigen Büchern, etwa in Tagores Sandkörnchen im Auge oder in Gedichten von Kalèko oder Rilke. Es gibt Architekturen, die mein Herz ergreifen, berühmte, wie das Taj Mahal in Agra, oder unbekannte, wie eine kleine Kapelle aus der Zeit der Renaissance bei Porto Venere in Ligurien. Die sanfte Hügellandschaft Südenglands, die majestätischen Berge und Fjorde Norwegens, vor denen man das Meer glitzernd in der Sommersonne sieht und das Licht den Raum zur Unendlichkeit zu öffnen scheint, die ferne Verheißung des Himalayas, wenn man seine Gipfel von den Garhwal-Bergen aus sieht, die dunkelblaue Klarheit des Mittelmeeres, der bergige Dschungel im Inneren Sri Lankas, die kühle und klare Morgenluft in den Bergen bei Rishikesh, die roten Blüten der Sträucher um die Ruinen einer antiken Stadt in Rajasthan, überall dort empfand ich die Schönheit. Und diese Schönheit weckt in mir die Liebe.
***
Schönheit ist nicht moralisch, sie ist aber auch nicht unmoralisch – sie steht über der Moral. Der Verrat ist nicht schön, denn er kennt keine innere Harmonie.
Der Streit ist hässlich, denn er zerstört die Harmonie und führt zu Trennung vom einheitlichen Gefüge, das den ganzen Kosmos durchdringt.
Religionen sind zutiefst unschön, wenn sie eifern, aber von einer erhabenen Schönheit, wenn sie die kosmischen Harmonien spiegeln.
Die Askese ist unschön, weil sie verneint, die Meditation ist schön, weil sie bejaht. Der mystische Yoga ist schön, weil er die Geheimnisse des Universums sichtbar macht, die Freiheit der antiken griechischen Seele ist schön, weil sie dem Menschsein seine Möglichkeiten offenbart, die rinascita war schön, weil sie dem Menschen, seinem Wissensdurst und seiner Lust zum Leben die Grenzen nahm. Aus dem umgekehrten Grund sind die kommunistischen und faschistischen Diktaturen abscheulich, sind fanatische Revolutionen hässlich, ist der moderne Konsum widerwärtig.
Bücher, die auf das Wahre, Schöne oder Gute verweisen, ohne es selbst zu sein, sind schlicht abstoßend und langweilig.
Camus: „Ich bin kein Philosoph. Ich glaube nicht genug an die Vernunft, um an ein System zu glauben. Was mich interessiert, ist, wie man leben soll. Und noch genauer: Wie man leben soll, wenn man weder an die Vernunft noch an ein System glaubt.“1
Die Vernunft und jedes nur vernünftige Argument, (auch oder gerade in Büchern), ringt dem Hörer oder Leser bestenfalls widerwillige Zustimmung ab. Aber wenn die Schönheit fehlt, wie soll man ein Buch, so vernünftig seine Argumentation sein mag, lieben können? Wie soll es Orientierung sein können? Es ist auffällig, dass die meisten Texte der Weisheitsliteratur aller Kulturen tatsächlich schön sind. Ihre Ästhetik ist es, die in erster Linie anspricht, und diese Ästhetik ist es, die den auch wahren Gedanken tragen kann. Mehr noch: Durch die Ästhetik werden Gedanken wahr; die Ästhetik ist der Seismograf, der die Wahrheit, besser die Wahrhaftigkeit eines Gedankens offenbart, oder als Irrtum, im schlimmeren Fall als Lüge und Betrug, enttarnt.
Die Wahrheit ist der Schönheit inhärent. Und wo Wahrheit ist, muss nicht mehr gesucht werden.
***
In einem Gespräch zwischen Albert Einstein und dem bengalischen Dichter Rabindranath Tagore über die Natur der Wirklichkeit vertritt Tagore die Überzeugung, das Unendliche sei der menschlichen Persönlichkeit untergeordnet, und dementsprechend jede Wahrheit des Universums eine menschliche Wahrheit.
Er sagt: „Ich habe eine wissenschaftliche Tatsache genommen, um das zu illustrieren: Die Materie ist aus Protonen und Elektronen zusammengesetzt, mit Zwischenräumen, obgleich uns die Materie fest zusammengefügt erscheint und die Verknüpfungspunkte der Protonen und Elektronen sich nicht unmittelbar zeigen. Auf ähnliche Weise ist die Menschheit aus Individuen zusammengesetzt, deren Verbindung gerade in den menschlichen Beziehungen besteht, die das Gefüge der Menschenwelt fest zusammenhalten. Ich habe diesen Gedanken durch Kunst, Wissenschaft und das religiöse Bewusstsein der Menschheit verfolgt.“2
***
Ich spie die Theorien aus, als ich in dunklen Hotelzimmern in Varanasi im Fieber lag. Ich sah ihre glitzernd-kristallinen Muster, die mein Gehirn durchzogen wie messerscharfe Fäden aus Glas. Die Hitze des Fiebers ließ das Glas schmelzen. Ich schwitzte es aus.
Die Muster jenes Denkens sackten hinab in die tiefen Quellcodes des Fühlens und Denkens und wurden zu einer Erfahrung unter vielen. Was bleibt, ist ein Wissen darum; eine Erinnerung, die den Erfahrungen der Gegenwart eine Tönung verleiht.
***
Als ich akzeptierte, dass es keine Aufwärtsbewegung für einen Menschen geben kann, nicht in einem Leben, nicht in dieser Kürze, mit jenem Verlöschen als Gewissheit, begann ich in die Tiefe zu schauen.
All die finalistischen Ideen der Moderne, von denen wir durchdrungen sind, zwingen uns zu einem stetigen Weiter, Immer-weiter. Wir werfen flüchtige Blicke in die dunklen Kammern unserer Seele, schnell bei der Hand mit der Abrissbirne, um den „Schatten“ der Seele auszumerzen, uns freizumachen für ein ideales Ziel von Transzendenz, Erleuchtung, Erlösung. Unsere tiefen Eigenschaften werden zu Rohstoffen zur späteren Gestaltung und Vergoldung nach einem vorgefertigten Muster.
Als ich davon losließ und akzeptierte, dass mein Jetzt-Wesen so und nicht anders ist und sich auch nicht ändern wird, nahm ich einen tiefen Atemzug, betrat die dunklen Kammern und fand darin die Schönheit der Nacht, und mein Atem warf sanfte Lichtspuren in die Schwärze, durchdrang sie wie leuchtende Maserungen in schwarzem Marmor.
***
Unter mir das Gedankenmeer. Ein Wogen von Hoffnungen, ein Branden von Zorn an die Riffs des Unumgänglichen, eine Gischt aus Angst, ein Aufspritzen von Freude.
***
Der Kern jeder Sucht, sei sie substanzgebunden oder nicht, ist eine verzweifelte Suche – leider in eine Richtung, in der es keine Lösung gibt. Der Grund liegt entweder in der Unkenntnis über den eigentlichen Mangel, der durch das Objekt der Sucht ausgeglichen werden soll, oder im Wissen um die Aussichtslosigkeit anderer Wege. In jedem Fall aber ist Sucht Ausdruck einer Seele im Kampf. Wer Süchtige verurteilt, weiß nichts von den seelischen Räumen, in denen sie sich bewegen – sie sehen nur die diesseitige verkohlte Abschussrampe, nicht aber die seelischen Raumschiffe, die nach lebenswerten neuen Räumen suchen.
***
Nachhall eines Traumes:
Art informel: Der Künstler macht sich zum ausführenden Organ des Zufalls und fügt somit das Bild in die objektive Welt der Universalien ein, in der es keinen Sinn und keine Bedeutung gibt. Das Bild darf nicht durch Absichten oder Konzepte verfälscht werden. Denn diese sind Ausdruck der subjektiven Menschenwelt, in der es Sinn und Bedeutung gibt.
Sinn und Bedeutung: Der zufällige Brei der Wirklichkeit kennt keinen Sinn und keine Bedeutung, seine fließenden Texturen aber nehmen wir nur bruchstückhaft wahr. Wir schneiden uns an den Bruchstellen in der Textur der Wirklichkeit, (natürlich nicht in der Wirklichkeit selbst, sondern in unserer Wahrnehmung von dieser, die ihre eigene Welt erzeugt), die Flächen, Grenzen, Tiefen etc. entstehen lassen. An diesen Grenzen entlang verläuft der Sinn, die Bedeutung. Bedeutung und Sinn entstehen durch die Fragmentierung der Wirklichkeit, durch ihre Verscherbelung (besser: Scherblierung, von ‚Scherben machen‘).
Die Brüche sind die Grenzen des Sinns, der auf der einen Seite so und auf der anderen Seite anders ist. Ursache ist der Bruch selbst.
***
Im Buddhismus, hinter all seiner philosophischen Eleganz, steckt auch ein Aspekt der Feigheit.
Leidenschaften seien zu vermeiden, da diese unweigerlich zu Leid führten. Die Liebe, der Zorn, die Attraktivität und die Aversion führen unweigerlich zu einem Ende. Im Loslassenmüssen steckt oft genug Schmerz, oft auch Enttäuschung (was immer man aus ihr schöpfen mag, Freude bereitet sie selten). Zwar sagt der Buddhismus, die Wurzel des Leides sei die Unwissenheit. Doch durch Askese wird man auch nicht wissender.
Den kleinen Schmerz, der wie in einer mathematischen Funktionsgleichung auf jede gelebte Leidenschaft folgt, zu vermeiden, rät also der Buddhismus, die Funktionsgleichung gar nicht erst anzugehen. Darin liegt die Feigheit.
Am Ende, bei aller Askese, werden wir ja dennoch loslassen müssen – das umfassende Loslassen, und entsprechend wird auch der Schmerz sein.
Warum also nicht akzeptieren, dass Leidenschaft und Leid, dass „gutes Werk und schlechtes Werk“ das Menschsein ausmachen?
Und den Schmerz tragen lernen, darin, und nicht in der Entsagung/Vermeidung, die Größe sehen.
***
Ist eine Religion denkbar, die nicht aus Not heraus entsteht?
Meine eigene Religiosität mag zwar das Dogmatische vermeiden und eine Freestyle-Religion sein, aber sie ist dennoch eine, und sie ist aus Not geboren, immer aus Not: in Zeiten von Angst, Verlust, Schmerz, Verzweiflung.
Religion ist immer eine Notlösung. Kein Mensch käme auf die Idee, eine Religion zu erfinden, wenn es ihm ganzheitlich gut geht.
Zu beten heißt das Vertrauen in sich selbst zu verlieren, heißt, den Flow zu verlassen, den Flow, in dem ein Kind sich treiben lässt, wenn es selbstvergessen spielt oder sich von Papa und Mama führen lässt.
***
Mir träumte, ich hörte John Lennons Imagine und war ergriffen von dessen Schönheit und der Zeile living love and death. Erst als ich schon eine Weile wach war, begriff ich, dass der Traum diese Zeile erdichtet hatte; in Lennons Song kommt sie nicht vor.
Ich kenne zwei Arten von Todessehnsucht. Die eine ist resignativ und entsteht aus Verzweiflung, wenn das Leben ein Ausmaß an Leid annimmt, dem man nur noch entfliehen möchte. Es ist das Bedürfnis nach Frieden und Ruhe, und wenn es nicht anders geht, dann auch ein Frieden, der in der Abwesenheit des erfühlten Unfriedens und im Auslöschen besteht. Es ist eine Sehnsucht, die sich weniger in der Faszination des Todes als eher in der Vermeidung des Lebensleides begründet. Es ist kein Wohin, es ist ein „weg von…“.
Die Stimmung der anderen Art der Todessehnsucht ist der obigen entgegengesetzt. Sie entspringt der Euphorie, der völligen Angstfreiheit, aus der heraus man in das Unbekannte vordringen will. Noch ein fremder Ort, noch eine magische Begebenheit, eine noch intensivere Empfindung, ein starkes Fühlen des Lebens, besser des Bewusstseins, denn was ist Leben anderes als Bewusstsein. Der unbändige Trieb nach dem Immer mehr, dem Immer weiter führt unweigerlich irgendwann zu der Schwelle des Todes, denn erst da werden die letzten Limitationen des Ichs, des Körpers aufgehoben, die unsere Erfahrungen drosseln und im Kleinen, immer noch Bekannten und Gewohnten halten. Die unfassbare Intensität der Meditation des klaren Bewusstseins, die an keine Rituale mehr gebunden ist, die sich im reinen Erfahren offenbart, im Reisen, in der Liebe, in der Musik, in der atemberaubenden Geschwindigkeit der Eindrücke, derer wir gewahr werden, peitscht uns weiter, immer weiter zu noch stärkeren Intensitäten. Daraus wächst das Bedürfnis, Grenzen zu sprengen, Grenzen des Gewohnten, des Alltags, des Vorhersehbaren. Es mag beim Aufgeben der Wohnung, der Heimat beginnen, beim Verkaufen des Besitzes, um sich von ersten Limitationen freizumachen, geht weiter über das Bereisen von Ländern, die dem eigenen Herkunftsland in Art und Weise völlig verschieden sind, Klima, Pflanzen, Tiere, Menschen, Kultur – alles nur, um neue Intensitäten zu erfahren. Ein Alexander der Große-Effekt. Die Möglichkeiten des körperhaften Ichs, hier als Fahrzeug der Intensität verstanden, werden bis zum Äußersten ausgereizt. Der eigentliche Reiz liegt im Erfahren der Psyche, in einem fieberhaften Ausloten dessen, was dem Menschen möglich ist. Damit meine ich keine geschäftlichen oder künstlerischen Erfolge, denn dass diese möglich sind, weiß man, und diese sich selbst zu beweisen, ist für diese Art von Grenzüberschreitungen uninteressant. Das Interesse liegt im Ausloten des Unbekannten, sei es auf materieller, auf emotionaler, auf seelischer oder spiritueller Ebene. Caravaggio ist einer von ihnen, aber nicht wegen seiner Kunst, sondern wegen seines intensiven Lebens. Oft ist ein solches Leben kurz, weil das Überschreiten der Grenzen bedeutet, auch die Grenze des physisch oder psychisch Machbaren zu missachten oder sie gezielt zu überschreiten. Caravaggio, Alexander Große, Rimbaud, Jesus von Nazareth gehörten zu diesen Menschen. Doch die Mehrzahl jener Getriebenen kennt man nicht. Goethe, Augustus, Rubens, Hesse oder Buddha gehörten nicht zu jenen. Mit einem feinen Überlebensinstinkt ausgestattet, zwangen sie ihren Trieb zum Unbekannten in das Joch des physisch Notwendigen. Sie disziplinierten sich.
Ekstase kann süchtig machen – die Suche nach dem Erleben der Ekstase wird zum vorherrschenden Lebenselement, Rücksichten werden unsinnig. Denn was bedeutet Rücksicht auf die Grenzen des Körpers? Diese Rücksicht hieße, zugunsten eines Verbleibens auf sicherem Grund auf die Ekstase zu verzichten. Doch was bedeutet der sichere Grund schon? Mehr noch: Der sichere Grund ist genau das Land, aus dem der seelische Grenzgänger schnellstmöglich fliehen will. Motiv ist die Ex stasis, das Aus sich heraustreten. Heraustreten aus den gewohnten Begrenzungen bereits erlebter Routinen – und jedes Wiedererkennbare steht bereits im Verdacht der Routine. Das Beachten der Grenzen des Machbaren ist Routine und steht der Ekstase im Wege. So mussten Jim Morrison, Arthur Rimbaud oder Mozart früh sterben. Das Wollen zur Ekstase erzeugt zwangsläufig einen Drang nach dem letzten Heraustreten. Auch Grenzüberschreitungen, wenn schon oft vollzogen, können zur Routine werden. Was bleibt, ist die Möglichkeit des Überwindens der letzten Grenze, auch zu dem Preis einer unmöglichen Wiederkehr. So verliert der Lebenstrieb an Spannkraft, der Todestrieb gewinnt die Oberhand, dort erst geht das Abenteuer weiter, frei von jeder Begrenzung. Es ist die Sehnsucht nach dem Land auf der anderen Seite, dessen Gras grüner ist, und grüner heißt, mehr sensations





























