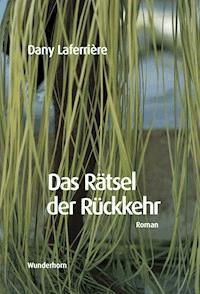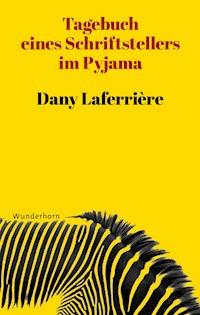
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Das Wunderhorn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
In 182 nachdenklichen und humorvollen Notaten und Beobachtungen komponiert Laferrière einen Roman der Lektüren. Ein Bad in der Literatur und eine Reise um die Welt. Eigenwillig blickt er auf die Klassiker der Weltliteratur, auf die Eitelkeiten des Schreibens und die Leidenschaft des Lesens. »Ich reise pfeifend durch die Welt und lasse meine abdriftige Insel hinter mir. Ohne sie je zu vergessen, wusste ich von Anfang an, dass ich auf Abstand gehen muss, damit sie mich nicht in ihre Abwärtsspirale zieht. Hier bin ich und habe in meiner Tasche als einzigen Besitz sechsundzwanzig Buchstaben des Alphabets.«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dany Laferrière
Tagebuch eines Schriftstellers im Pyjama
Roman
Aus dem Französischen von Beate Thill
Wunderhorn
Titel der Originalausgabe:
Journal d’un écrivain en pyjama © 2013 Éditions Grasset & Fasquelle, Paris Lektorat: Angelika Andruchowicz © 2015 Verlag Das Wunderhorn GmbH Rohrbacherstrasse 18, D-69115 Heidelbergwww.wunderhorn.de
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Gesamtgestaltung: Werner Ehrle, Cyan, Heidelberg Umschlaggestaltung: Leonard Keidel Titelabbildung: William Warby ISBN: 978-3-88423-490-7
Ein Messer ohne Klinge, an welchem der Stiel fehlt.
LICHTENBERG, aus demGöttingenschen Taschenkalender, 1798
Für Alain Mabanckou, für Edwidge Danticat, zur Erinnerung an ihre aufsehenerregenden Debüts.
Und für Marie Abraham Despointes, die so gerne liest.
DAS VERSPRECHEN DES ERSTEN ROMANS
I Der erste Anlauf
Damals wohnte ich in Montreal in einer überhitzten möblierten Wohnung und versuchte einen Roman zu schreiben, um dem Teufelskreis kleiner Jobs in abgelegenen Vorortfabriken zu entkommen. Meine Nachbarn waren junge Penner, die Bier soffen, weil sie sich Kokain nicht leisten konnten. Die Armenviertel der Stadt waren damals noch nicht so vom Crack überschwemmt. Samstagabends traf ich meine Kumpel aus der Fabrik in Diskotheken, wo Frauen verkehrten, die unsere Mütter hätten sein können. Das ist das Versprechen, das Amerika Leuten gibt, die noch vor Tagesanbruch zur Arbeit gehen und am Abend zurückkehren, um vor einem schlechten Film in der Glotze ihre Spaghetti zu essen. Doch ich wollte für mich das Versprechen, das Amerika den wohlbehüteten Kindern aus den piekfeinen Vierteln gibt. In der Fabrik gab man auf mich keinen Pfifferling, da ich mit meinen Händen nicht besonders geschickt bin. Außer zum Schreiben. Man vergisst, Schreiben ist Handarbeit. Doch kann jemand ein Buch schreiben, der keiner Autorengruppe angehört, nicht einmal einem Lesezirkel? Ich las alles, was mir in die Hände fiel. Aber Schreiben ist etwas anderes als Lesen. Der Schriftsteller ist am einen, der Leser am anderen Ende der Kette.
II Die Maschine
Ich habe mir dann an der nächsten Straßenecke eine alte Schreibmaschine gekauft, die ich schon länger im Fenster eines Trödlers gesehen hatte. Ich wollte meinen Roman nicht von Hand schreiben. Ich lebte jetzt in dem Teil der Welt, der mit Hilfe von Maschinen reich geworden ist. Ich wollte ein moderner Autor sein und nicht einer dieser Tölpel aus der Dritten Welt, die bei der Erfindung des Rads stehengeblieben sind. Es war eine alte, gut erhaltene Remington 22. Ich stellte sie auf den Küchentisch neben einen Korb mit Früchten. Diese Vorliebe habe ich, weil ich aus der Karibik komme. Ich liebe es, wenn mich der aufdringliche Geruch reifer Bananen und gelber Mangos überfällt, sobald ich die Tür öffne. Ein paar Tage später setzte ich mich vor die Maschine, um meinen ersten Satz zu schreiben. Ich wartete den ganzen Nachmittag darauf, wie es weitergeht. Ich wusste noch nicht, dass es nichts Anstrengenderes gibt als den ersten Satz. Wenn er gut ist, läuft der Rest des Buches wie von selbst. Den ganzen Sommer über tippte ich mit einem einzigen Finger und ernährte mich von Obst und Gemüse. Ich wurde ein richtiger Schreibathlet. Nach einem Monat wusste ich, dass ich eher ein Sprinter war als ein Marathonläufer.
III Die Schmerzen
Ich hatte beschlossen, nicht allzu viel zu leiden, während ich diesen Roman schrieb. Da ich Arbeiter war, sah ich das Schreiben als Zeitvertreib. Um mich herum war vom Leiden des Schriftstellers die Rede, aber das sagte mir nichts. In einer Literatursendung im Radio behauptete ein berühmter Autor, man könne nur schreiben, wenn man gelitten habe. Ein anderer ergänzte, Schreiben bedeute auch Leiden. Sie sprachen an diesem Tag nur über das Leiden. Das vermittelte mir den Eindruck, dass sie das Wort besser kannten als die Realität, die sich dahinter verbarg. Ich hingegen hatte auf diesem Gebiet bereits einen Adelstitel erworben. Ich hatte eine irrwitzige Diktatur hinter mir gelassen und war nach Nordamerika geraten, wo ein Schwarzer immer noch ein Bürger zweiter Klasse ist. Weiter oben ist es erträglich, aber nicht im Bodensatz der Arbeiterklasse, wo der Tag immer grau anfängt und der Himmel niedrig hängt. Um aus diesem tristen Alltag herauszukommen, beschloss ich, mir ein Leben zu schaffen, so prickelnd wie ein Glas Champagner. Zu jener Zeit faszinierte mich die Eleganz, die ein Autor wie Francis Scott Fitzgerald ausstrahlte – er blieb auch in den unerträglichsten Lebenslagen immer er selbst. Als hätte er eines Tages entschieden, eine Romanfigur zu sein. Genau so wollte auch ich werden.
IV Die schlafende Stadt
Ich las in der Badewanne und schrieb auf dem kleinen Tisch in der Küche. Trotz der beengten Umgebung fühlte ich mich wie ein Gott, man hörte nur die Musik der Fliegen, in der Gluthitze angelockt vom durchdringenden Geruch der Früchte. Es war so heiß, dass die Luft nach Schwefel roch. Von Zeit zu Zeit rannte ich unter die Dusche, aber sobald ich rauskam, war ich schon wieder schweißgebadet. Ich ging im Zimmer im Kreis, wie hypnotisiert von der Schreibmaschine, die mir alle Versprechen dieser Welt zu verheißen schien. Ich wusste, sie hatte alle Sätze meines Romans im Bauch. Ich musste sie einen nach dem anderen aus ihr herausziehen. Es war nicht immer leicht, aber ich hatte viel Zeit, das war auch alles, was ich besaß. Ich verbrachte den ganzen Tag mit dem schönsten Spielzeug der Welt. Ich änderte ein Wort in einem farblosen Satz, und schon sprühte er Konfetti. Wenn mir ein Satz gelungen war, wenn mir Rhythmus und Musik gefielen, ging ich raus, um Luft zu schnappen und wanderte wie ein Schlafwandler durch die Stadt. Nach einer guten Stunde, manchmal im Regen, kehrte ich zurück und setzte mich wieder an meinen Arbeitstisch. Das ging so weiter, bis tief in die Nacht. Es kam vor, dass ich aufwachte, um eine Idee oder ein Stück Dialog aufzuschreiben. Ich blieb lange Zeit im Dunkeln liegen, ganz gefangen in meinen Träumereien. Dann begab ich mich wieder an die Arbeit, wobei ich die Tasten sehr vorsichtig anschlug, dass man es kaum hörte. Kurz darauf vergaß ich mich und tippte wie ein Irrer, bis ein Nachbar brüllte, ich solle endlich aufhören mit diesem Krach. Es war eine große Lust, in der schlafenden Stadt zu schreiben. Ich hatte nur eines im Kopf. Schreiben. Es war für mich ein unendliches Fest.
V Die materielle Seite
Ich weiß nicht, warum ich so sicher war, dass dieses Buch mich aus diesem Loch herausholen würde. Um schreiben zu können, hatte ich meinen Job gekündigt. Meine geringen Ersparnisse schmolzen dahin. Ich musste es in kurzer Zeit schaffen. Ich verfügte nicht über die finanziellen Mittel wie die jungen amerikanischen Autoren, die es beim ersten Roman auf sechshundert Seiten bringen. Ich lebte allein in einer unbekannten Stadt. Ich beschränkte meine Ausgaben daher auf das Allernotwendigste und beschloss, die Tochter des Besitzers dieses Mietshauses zu verführen, in dem ich meine Bude hatte. Der Hausbesitzer, ein Italiener, konnte mich nicht leiden. Ich richtete es so ein, dass ich seiner Tochter mehrmals am Tag im Treppenhaus begegnete. Bis wir eines Abends in meinem Zimmer landeten. Danach musste ich keine Miete mehr bezahlen. Von dieser Sorge befreit, war noch das Problem mit dem Essen zu lösen. Mir war aufgefallen, dass eine ältere Kassiererin mich nicht aus den Augen ließ, wenn ich im Supermarkt bei Pellat’s mein Obst und Gemüse kaufte. Irgendwann erzählte sie mir, dass sie eigentlich aus Afrika stammte, trotz ihres Aussehens. Sie war nämlich blond. Als Kind hatte sie ein Buch über Afrika gelesen und seither träumte sie davon, dort zu leben. In meinem Roman ist von ihr eine Spur, wo es heißt, einer Weißen, die mit einem Schwarzen schläft, könne es passieren, dass sie im Senegal aufwacht. Zwischen uns war aber nie mehr als ihr Wunsch, mich zu beschützen. Sie tippte nur ein Zehntel meiner Einkäufe in die Kasse, während die Tochter des Vermieters, die ihrem Vater die Buchhaltung führte, meine Schulden strich. Doudou Boicel, der Besitzer des Jazzclubs Soleil levant hatte mir gleich bei meiner Ankunft geraten: »Stell dich gut mit den Frauen, die haben Herz.« Auf diese Weise konnte ich in Ruhe meinen ersten Roman schreiben.
VI Ein Bild
Es gibt Bilder, die packen den Leser im Nacken, er steckt dann den Kopf so tief ins Buch, dass er meint, er läse den Schriftsteller und nicht das Buch. Wenn man an Proust denkt, sieht man einen Mann, der den ganzen Tag in seinen Pelz gewickelt im Bett liegt. Hemingway mit einem Jagdgewehr oder auf seinem Fischerboot, eine dicke Havanna rauchend. Der alte Miller, der Tischtennis mit Striptease-Tänzerinnen spielt. Gertrude Stein (aggressives Gebiss und weit gespreizte Beine) blickt dem Gesprächspartner direkt ins Auge, während sie ihm eröffnet, sein Roman habe ihr überhaupt nicht gefallen. Mishima lässt sich von seinem Liebhaber mit einem Säbel den Kopf abhauen. Günter Grass, dessen Schnauzer so tief hängt, dass er wie ein Knallkopf aussieht. James Baldwin lachend in den Armen von Marlon Brando. Virginia Woolf mit ihrem unendlich müden Blick. Borges allein in der Hotelhalle, seinen Blindenstock eingeklemmt zwischen den Beinen. Tolstoi in seiner Muschik-Weste. Der unbekannte Schriftsteller, wie man vom unbekannten Soldaten spricht, im Pyjama.
VII Das Versprechen
Mein erstes Buch erschien im November 1985, das veränderte mein Leben. Ich wurde nicht reich, ganz und gar nicht, aber seither lebe ich so, wie ich es mir immer erträumt habe. Es war richtig, das ganze Geld und alle Energie auf diese eine Karte zu setzen. Ich hatte an die Märchen geglaubt, die meine Kindheit erfüllten, vor allem an das eine, wo der arme Schlucker wie durch Zauberhand zu einem Prinzen wird. Man braucht nur eine gute Fee, in meinem Fall war sie das Schreiben. Es wundert mich noch heute, dass ich seit einem Vierteljahrhundert bei meinen vielen Reisen kein einziges Flugticket, kein Hotelzimmer, nicht einmal eine Mahlzeit in einem Restaurant selbst bezahle. Ich habe das Geld aus meinem Blickfeld weggezaubert. Ich reise pfeifend durch die Welt und lasse meine abdriftige Insel hinter mir. Ohne sie je zu vergessen, wusste ich von Anfang an, dass ich auf Abstand gehen muss, damit sie mich nicht in ihre Abwärtsspirale zieht. Wenn man einen aus einer Notlage befreien will, darf man nicht mit drinstecken. Hier bin ich und habe in meiner Tasche als einzigen Besitz sechsundzwanzig Buchstaben des Alphabets. Satz für Satz, Abschnitt für Abschnitt, Kapitel für Kapitel wächst ein Berg, in dem Empfindungen, Eindrücke und Gefühle umhergeistern. Das alles habe ich dem unbekannten Leser vor den Latz geknallt, aber statt sich zu ärgern, hat er es freundlich aufgenommen. Ich habe noch viele weitere Romane geschrieben, aber seinen Erstling gelb gebunden zwischen Moravia und Hemingway im Schaufenster einer Buchhandlung zu entdecken, dieses Glück ist unvergleichlich. Ich kenne keine größere Freude, als wenn ich im Vorbeigehen höre, wie ein junges Mädchen der Freundin ins Ohr flüstert: »Das ist der Schriftsteller, von dem ich dir erzählt habe.« Ich bin es tatsächlich.
VIII Im Pyjama
Man fühlt sich einem Mann, der einem im Pyjama die Tür öffnet, sofort vertraut, selbst wenn er eine ebenso trübe Miene macht wie ein grauer Tag im November. Er geht Ihnen voraus in die Küche und grummelt etwas, das Sie nicht richtig verstehen. Leute, die zu lange allein waren, haben immer diese teigige Sprechweise – es kommt vor, dass sie tagelang mit sich reden, ohne einen Laut von sich zu geben. Sie verstehen zu spät, dass Sie ihm die Zeitung reichen sollten, die der Zeitungsjunge gerade vor die Tür geworfen hat. Sie setzen sich ohne Eile zum Gespräch und trinken dabei brühheißen Kaffee. Der brühheiße Kaffee, noch so eine Manie des allein Lebenden. Man spricht von allem außer vom Schreiben, denn es heißt nicht umsonst Fach-Simpeln. Offenbar hat er viel Zeit, lässt aber durchblicken, dass er nicht mehr lange zu leben hat. »In meinem Sack ist nicht mehr viel Zeit«, wirft er im gleichen Ton hin, als würde er sagen, dass es bald schneit. Ich bemerke das dicke Manuskript hinten auf dem Tisch. Ein Monster, das gefüttert werden will. Während er mich zur Tür begleitet, sagt er mir nur, es sei sein letzter Roman, an dem er seit über zehn Jahren schreibt. Er wird sich nicht sofort wieder an die Arbeit setzen, sich zuerst den Kaffee bereiten, den er eigentlich allein hatte trinken wollen und dabei so ruhig wie möglich zu Werke gehen. Er bewegt sich langsam in der stillen dunklen Wohnung, er hat die Gardinen nicht aufgezogen seit seine Tochter türenschlagend das Haus verließ (das hat er mir ohne die Spur einer Emotion erzählt). Jetzt sitzt er endlich vor der Schreibmaschine. Vielleicht passiert nichts, weil mein Besuch alles über den Haufen geworfen hat, aber genau in diesem Nichts findet das Schreiben statt. Er legt sich wieder ins Bett und macht, an zwei Kopfkissen gelehnt, Notizen. Warum kann ich mir so gut vorstellen, wie er sich in der Wohnung bewegt? Es kam im Auto wie eine Ahnung über mich. Als ob ich den Mann im Pyjama nur zu gut kennen würde. Ich habe den fast bedenklichen Eindruck, selbst einmal durch den finsteren Flur gegangen zu sein, das kleine Wohnzimmer zu kennen, die winzige Küche, den gelben Pyjama mit den blauen Streifen, dieses zerknitterte stoppelige Gesicht, auch wenn er viel älter ist als ich. Schon am Telefon war mir die Stimme bekannt vorgekommen. Ich möchte wenigstens den Titel dieses dicken Manuskripts wissen, mindestens 900 Seiten, das ich auf dem Arbeitstisch liegen sah. Um es zu schreiben, hat er sich in diese Wohnung geflüchtet, abgeschnitten von dem gesellschaftlichen Leben, immer in diesem mit Flecken von Kaffee und Spaghettisauce übersäten Pyjama. Kann ein Pyjama als Arbeitskleidung taugen?
TAGEBUCH EINES SCHRIFTSTELLERS IM PYJAMA
1. Die Schwelle
Im Grunde handelt es sich um Ratschläge, die ich mir selbst gebe, auch wenn sie etwas spät kommen. Anfangs war ich ein unbekümmerter junger Autor. Den ganzen Tag tippte ich im Pyjama auf meiner Remington 22. Ich schreibe noch heute, nach einer Pause von gut acht Jahren, aber mir fehlt die Frische jener ersten Zeit. Heute brauche ich Stunden, um die Mühelosigkeit von damals zu finden, als mir die Bilder aus den Fingern zu sprießen schienen, wie Blüten aus ihrem Stengel. Ich hatte mir vorgestellt, dass mit der Erfahrung das Schreiben leichter würde, ich irgendwann wüsste, wie sich Hindernisse umgehen ließen, ich ein alter Profi werden würde, der alle Tricks des Handwerks kennt. In gewisser Weise trifft das zu, doch suche ich offenkundig, ohne den Grund zu wissen, immer noch nach jener anfänglichen Spontaneität. Das Schreiben ist eine seltsame Leidenschaft, man muss die Explosion so lange hinauszögern wie möglich, wenn man nicht will, dass einem am Ende ein schaler Geschmack im Mund zurückbleibt – nichts Schrecklicheres als ein Schriftsteller, der sich schon lange vor seinem Tod ausgeschrieben hat. Muss man deswegen seine Taschen mit Steinen füllen, bevor man in den Tintenfluss steigt? Wenn man nicht sicher ist, das Talent von Virginia Woolf zu besitzen, ist davon abzuraten. Unseligerweise ist ein so großes Talent von furchtbaren Ängsten begleitet. Ich spreche hier auf niedrigerem Niveau. Hier treffen wir Schriftsteller an, die nach einem normalen Arbeitstag ein Glas Rotwein trinken können. Dieser Text ist also an mich selbst gerichtet. Ich gebe mir Ratschläge, die ich nicht mehr brauche, da ich schon ziemlich weit in den Tunnel vorgedrungen bin. Ich kenne meine Probleme beim Schreiben sehr genau, ich sorge sogar dafür, dass sie auftreten, damit ich ich mich um die Lösung kümmern kann. Ich habe es lieber mit einer alten Kiste zu tun, deren Macken ich kenne, als mit einem Neuwagen, bei dem ich nicht weiß, welche Überraschungen er mir unterwegs bereitet. Aber wenn Sie noch am Eingang des Tunnels stehen, nehmen Sie dieses kleine Handbuch ruhig mit. Es wird Ihnen nichts nützen, wenn Sie Talent haben, und im anderen Fall Ihnen nur die Zeit stehlen, aber nehmen Sie es mit, damit Sie es später nicht selbst schreiben müssen. Eine Mühe weniger … Übrigens, die kurzen Bemerkungen unter jedem Eintrag sollen so etwas sein wie ein »Glückskeks«, den man nach dem Essen in einem asiatischen Restaurant geschenkt bekommt. Sie müssen ihn aufbrechen, um zu lesen, was drinsteckt. Der eine Spruch passt ganz genau, der nächste nicht. Wie im richtigen Leben. Dann wartet man auf den nächsten Zug.
Einen Tag im Monat nicht lesen und nicht schreiben, damit Sie einen Fuß in der Realität behalten, so kommen Sie im Traum einen Schritt weiter.
2. Der Schriftsteller ohne Pyjama
Der Typ begegnet mir in der Apotheke. Er hat mich schon öfter angesprochen. Mir fällt sein Name nicht mehr ein. Er durchlöchert mich jedesmal mit Fragen. »Ich schreibe ein wenig«, so fängt er immer an, um das folgende Verhör zu rechtfertigen. Er will alles über mich wissen. Was ich lese. Meine gesundheitlichen Probleme. Wie es um mein Sexualleben steht. Sogar meine Essgewohnheiten. Zu guter letzt kommt die Frage, was ich gerade schreibe. Ich spreche nicht gern über ein Buch, an dem ich arbeite.
»Sag mir wenigstens den Titel.«
»Ratschläge für einen Schriftsteller im Pyjama.«
»Dein Buch richtet sich also nicht an mich.«
»Warum?«
»Ich habe keinen an.«
»Dann kauf dir einen, wenn du dich so sehr mit dem Titel identifizieren musst.«
Auf eine solche Antwort war er nicht gefasst. Normalerweise rede ich freundlich mit Leuten, die mir sagen, was sie von meiner Arbeit halten. Allerdings ist das leichter, wenn das Buch herausgekommen ist. Im Moment bin ich noch etwas empfindlich.
»Ich kenne Schriftsteller im Pyjama, die deine Ratschläge nicht brauchen.«
»Sie müssen es nicht kaufen.«
»Das hört dein Verleger bestimmt nicht gern.«
»Er muss das Buch ja nicht verlegen. Jeder kann selbst entscheiden.«
Diese Sorte Leser ärgert mich. Sie halten mich mit ihrem Gerede auf (wohlgemerkt, ihre Fragen beschränken sich immer auf den Titel) und am Ende geben sie zu, nie etwas von mir gelesen zu haben. Ich möchte keineswegs nur mit Leuten reden, die meine Bücher kennen, aber ich muss nicht alle Schwätzer ertragen, die in den Postämtern und Apotheken herumhängen.
»Ein Ratgeber, ist das nicht was für alte Leute?«
»Ich bin sechzig.«
»Kannst du keine richtigen Bücher mehr schreiben?«
»Ich habe nie ›richtige Bücher‹ geschrieben.«
»Wirklich?«
»Alles bin ich.«
»Was heißt das?«
»Dass ich bei allem, was ich tue, Schriftsteller bleibe – oder das Gegenteil.«
»Das ist mir zu philosophisch …«, wirft er im Gehen hin. »Ich hoffe, du gibst in deinem Buch wenigstens ein paar Ratschläge.«
»Um das zu erfahren, musst du es lesen.«
Er begnügt sich mit einem Schulterzucken, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Meist sind die ersten Versuche gefällig, schreiben Sie auch eine giftige Version, die veröffentlichen Sie, wenn Sie alt sind und sagen dürfen, was Sie denken (Lesen Sie: Mes poisons von Sainte Beuve1).
3. Wie schreiben Sie?
Ein Buch entsteht häufig aus einem anderen. Ich denke an einen jungen Mann, der mir pausenlos Fragen zum Beruf des Autors stellte – trotz der vielen Bücher, die ich im Laufe der Jahre geschrieben hatte, fiel es mir schwer, das Schreiben als Handwerk zu betrachten. Er wollte alles wissen. Jedesmal, wenn ich einer Frage ausweichen wollte (ich bin scheu, wenn Gefühle berührt werden), drang er noch mehr in mich. Ich versuche hier, eine der Fragen zu beantworten (sie kommt am häufigsten, wenn ein junger Autor einen etwas älteren trifft): Wie schreiben Sie? Ich betrete ein neues Buch immer auf Zehenspitzen wie ein Haus, in dem man noch nicht weiß, wie die Zimmer liegen. Erst bei der zweiten Fassung weiß ich, wo ich bin. Dann entdecke ich erstaunt ein neues Universum aus Fluren, die in dunkle oder sonnige Zimmer führen. Wenn ich herausgefunden habe, wo ich mich befinde, weiß ich immer noch nicht genau, wo es hingeht. Die Geschichte steht vielleicht schon in großen Zügen fest, aber es fehlt noch die Wärme, die den Seiten Leben spendet. So gehe ich viele Male auf dem gleichen Weg hin und zurück. Denn es braucht ein gewisses Maß an Emotionen und nachvollziehbaren Fakten, bis die Seite zu leben anfängt. Sonst ist da nur eine dunstige Welt, die sich jeden Moment auflösen kann. Dies alles schreibe ich, damit verständlich wird, von welchen Zweifeln ich geplagt war, als mein Neffe (er war der junge Autor) mich mit seinen Sorgen verfolgte. Warum bin ich heute bereit, ihm zu antworten? Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die beste Schule des Schreibens die Lektüre ist. Beim Lesen lernt man schreiben. Gute Bücher bilden den Geschmack. Unsere Sinne werden geschärft. Wir wissen, wenn ein Satz richtig klingt, weil wir häufig gute Sätze gelesen haben. Rhythmus und Musik fließen dann in unseren Adern. Der Richter bleibt unsichtbar, da er in uns steckt. Er urteilt unbarmherzig. Er übt schon Kritik an der Auswahl der Lektüre, am Geschmack, an den Einfällen, den Plänen. Ihm entgeht nichts. Er bildet eine neue Identität. Das Talent folgt unmerklich nach. Nun kommt es nur noch darauf an, dranzubleiben. Man muss wissen, dass man Schriftsteller ist. Bevor man zu schreiben beginnt, ist man Schriftsteller.
Eine Leserin (80% der Leserschaft sind Frauen) erzählt, sie verschlinge gerade den letzten Roman eines Erfolgsautors. Ein gutes Buch lässt sich nicht verschlingen, es dringt in den Leser ein und gart ihn auf kleiner Flamme.
4. Wozu diese Ratschläge?
Ich bringe in diesem Buch die beiden Männer zusammen. Den einen, der nicht ruht, bis er die Welt um sich herum aufgezeichnet hat, mein Neffe, der in Port-au-Prince lebt, und den anderen, reiferen Alters, der denkt, dass Unwissenheit zu falschen Urteilen führt. Beide wollen verstehen, wie ein Roman funktioniert. Der eine, um zu schreiben, der andere, um besser zu lesen. Die Figuren sind im Romanautor beide vorhanden (Fiktion und Reflexion). In diesem kleinen Buch stehen technische Ratschläge, die, wie ich hoffe, auf die zahlreichen Fragen meines Neffen Antwort geben. Und Abschweifungen, die, wie ich ebenfalls hoffe, meinen Freund erbauen werden. Im übrigen habe ich mich immer gefragt, warum Leute, die viele gute Bücher lesen, selbst so schlecht schreiben (gemeint ist nicht mein Freund Normand Baillargeon, der sich mit seinen brillanten politischen Essays schon bewiesen hat, noch mein Neffe, der eines Tages seinen Beweis liefern wird). Natürlich liegt es daran, dass sie keine eigene Stimme haben. Weil sie nie die Stimme gesucht haben, die durch den Raum mit den vielen Echos irrt. Man muss unermüdlich an ihr arbeiten. Wie Kinder, die alle Samstage ihrer Kindheit und Jugend dem Ballett-, dem Flöten-, dem Klavierunterricht, oder dem Gesellschafts- oder Volkstanz opfern. Dennoch wird man nicht zwangsläufig Konzertmusiker oder Ballettstar. Es dient einfach dazu, eine Aufführung wertschätzen zu können. In der Literatur gibt es nichts Entsprechendes. Alle, die Geschmack am Schreiben finden, glauben das große Abenteuer eines Romans wagen zu müssen. Die meisten scheitern und wenden sich angewidert ab. Diese sehr unterschiedlichen Ratschläge richten sich sozusagen an Leute, die gerne schreiben, ohne Schriftsteller werden zu wollen.
Wenn Sie in der Badewanne lesen, stellen Sie sich am besten den Wecker, damit Sie Ihren Termin nicht verpassen, denn das Wasser begünstigt Träumereien, die die Zeit vergessen lassen.
5. Es ist ein Roman!
Ich schreibe: »Es ist ein Roman!«, wie die Hebamme der Mutter mitteilt, dass es ein Sohn ist. Bei einer Tochter wäre sie nicht weniger begeistert. Hauptsache, das Baby ist gesund, ruft die Mutter aus. Für mich ist es wichtig, dass es ein Roman ist, um mit der Arbeit vorwärtszukommen. Ich bin nicht streng genug, einen Essay zu schreiben. Natürlich habe ich Ideen, wie jeder bequeme Mensch, aber es langweilt mich schon, dass ich sie besonders herausstellen soll. Anschließend muss man sich auch noch prügeln, denn kaum hat man eine einigermaßen logische Ansicht geäußert, stürzen sich lauter Persönlichkeiten, die man vor zehn Minuten noch nicht kannte, auf sie, um sie in der Luft zu zerreißen. Auch das Publikum erwartet, dass ich die rasch hingeworfenen Einfälle mit Klauen und Zähnen verteidige, als wären sie mein Eigentum, wo ich doch meine Meinungen wechsle wie die Hemden. Allein der Gedanke daran ermüdet mich. Häufig muss ich mir einen Satz anhören, der bei mir alles einfriert: »Was Sie sagen, ist vielleicht wahr, aber es gibt Ausnahmen.« Da ist bei mir alles aus. Und es kommt immer in ziemlich aggressivem Ton. Was soll man darauf antworten? Beim Roman dagegen kommt es auf den Zauber an. Mir ist bewusst, dass immer mehr Autoren naturwissenschaftliche Themen in ihre Romane einführen, aber sie dürfen die Bedeutung des Zaubers nicht vernachlässigen, sonst schaut sich der Leser nach etwas anderem um, er ist schließlich kein Spezialist. Wenn heute alles in ihm vorkommen kann, warum soll man nicht einen Roman über die Gedanken eines Amateurs im Pyjama schreiben? Einen Roman über die Panikzustände eines leichtlebigen Autors.
Borges: »Ein Buch als Roman zu bezeichnen ist, als würde man sagen, es hat einen roten Einband und steht ganz links auf dem obersten Regal.«
6. Die Herde
Die Herde wird auch oft mit »Werk« bezeichnet – der Schriftsteller ist ihr Hirte. Er veröffentlicht die Bücher hier und dort, doch wenn er ein gewisses Alter erreicht, verspürt er das Bedürfnis, sie zusammenzutreiben. Dass sich bloß keines von der Herde entfernt. Es muss sofort wieder in den Pferch zurückgebracht werden. Er fragt sich auch, was seine Romane miteinander verbindet. Ich, oder wenn Sie so wollen, der Autor. Ich bin der lange Roman, der sich in mehrere Folgen gliedert. In meinem Fall ist es ein Monolog über fast dreißig Jahre. In all diesen Jahren habe ich so mit dem Alphabet gespielt, dass die sechsundzwanzig Buchstaben möglichst genau ausdrückten, wie ich die Dinge sah. Ich muss hinzufügen, dass dieses Ich nichts mit Autofiktion zu tun hat. Es ist der Hirte mit seinem Hund (dem Lexikon). Meine Schafe haben ein Brandmal (meine Verleger). Ich spüre nicht viel bei diesem Buch (das Sie gerade lesen). Dabei enthält es meine Erfahrungen als Leser und Schriftsteller, ich nehme sie und stecke sie wie Fleisch auf einen Spieß. Heute morgen erwachte ich mit dem Gedanken, dass dem Buch noch das gewisse Etwas fehlt, an dem ich es überall wiedererkennen würde. Aber was könnte das sein? Ich muss ihm die notwendige Dosis persönliche Empfindung einhauchen. Es zu meinem eigenen machen. Dazu muss ich reinschlüpfen.
Schreiben ist vor allem ein Fest des Innenlebens.
7. Das Mehl
Ein Roman gelangt nicht durch Magie auf den Verkaufstisch des Buchhändlers. Außer ihm spielt der Verleger eine entscheidende Rolle in dieser Geschichte. Ich stelle mir ein Buch immer vor wie ein Brot. Den Verlag als Bäckerei, in der nachts gearbeitet wird, damit am Morgen schön warmes Brot geliefert werden kann, das tagtäglich den Geist ernährt. Der Schriftsteller hat für das Mehl zu sorgen. Dazu hält er sich bereit, alles aus der Luft zu holen. Die Geschichten schwirren überall herum, sie verbinden sich mit der Bewegung des normalen Lebens. Noch verstreut, warten sie auf eine Perspektive, die sie zusammenbringt. In diesem Moment beobachte ich aus meinem Hotelfenster einen alten weißen Chrysler, der ständig auf dem leeren Parkplatz des Supermarkts hin und her fährt. Ich bekomme Lust, ein neues Buch zu beginnen. Ein Buch kündigt sich nicht mit einer Idee, sondern einer leichten Erregung an, bei der man nicht weiß, bringt sie Freude oder Angst. Das Mühlrad beginnt sich langsam zu drehen, der Müller legt sich auf den Rücken und wartet, dass es Mehl regnet.
Wir schreiben im Halbdunkel eines kleinen Zimmers, am Fenster, mit Blick aufs Leben.
8. Die Vorbereitung
Es gibt zwei Möglichkeiten der Vorbereitung auf ein neues Buch.
1) Ist es eine Geschichte, die man schon lange mit sich herumträgt, sagen einem Vorzeichen, dass der Moment nicht mehr fern ist. Zuerst sollte man seinen Kopf von allen Zwängen befreien, damit er dieses Buch aufnehmen kann, das bei seinem Durchzug alles niederwalzen wird. Kurz bevor es in den Tunnel geht, teilt man seinen Angehörigen mit, dass man in den nächsten Monaten weniger Zeit haben wird. Viel schlafen, um in Form zu sein, denn jedes neue Buch verlangt einen frischen Geist in einem ausgeruhten Körper. Die neue Lebensgefährtin (oder den neuen Freund) laden Sie am besten zu einem Abendessen zu zweien, um zu erklären, dass Sie ab dem nächsten Morgen nicht mehr alles, was sie Ihnen sagt, verstehen werden. Ihr Geist wird nämlich viel weniger präsent sein als Ihr Körper. Manche Schriftsteller stellen ihre Essgewohnheiten völlig um. Wenn man nachmittags nicht einnicken will, muss man Alkohol und Essen mit aufwendigen Soßen meiden – besser sind Obst und Gemüse. Das sage ich, damit verständlich wird, Schreiben ist keine leichte Sache. Hat man eine schreckliche Geschichte lange mit sich herumgetragen, spürt man, wie das Fieber steigt. Man muss die Temperatur niedrig halten, damit Raum für ruhiges Arbeiten bleibt. García Márquez konnte seine Hundert Jahre Einsamkeit nur schreiben, weil seine Frau ihn völlig vom Alltag abschirmte. Er konnte sich mit einer kleinen Reiseschreibmaschine und einem Stapel Papier in ein kleines abgelegenes Häuschen in seinem Hof zurückziehen. Ohne diese Freiheit hätte das Buch fünfzig statt fünfhundert Seiten und würde Zehn Jahre Einsamkeit heißen. García Márquez wusste, wenn er von den Kurzgeschichten seiner Anfangszeit zu einem dicken Roman kommen wollte, vom Hundertmeterlauf zum Marathon, musste er seine Lebensweise umkrempeln. Trotzdem gibt es Kurzgeschichten, die mehr enthalten als jeder noch so üppige Roman. Aber ein Wälzer braucht mehr Raum.
2) Nach dem Raum kommt die Zeit. Wenn die Geschichte erst kürzlich passierte, wird ihre Umsetzung langwierig und mühsam sein. In diesem Fall sollte man sich nicht zu schnell zum Schreiben hinsetzen. Die Zeit muss noch reifen. Man muss herausfinden, ob es lohnt, sich in dieses Abenteuer zu stürzen. Es gibt Geschichten, die in der Nacht glitzern, aber bei Tagesanbruch verschwunden sind. Man sollte auch das Potenzial der Erzählung ausloten. Sie von allen Seiten beleuchten, um zu sehen, ob sie nicht zu linear ist. Bekanntlich ergibt eine amüsante Anekdote noch keinen Roman. Eine gute Geschichte hat in der Regel mehrere Eingänge. Geschichten, die nur einen Eingang und einen Ausgang haben, sind zu meiden, zumindest für einen schriftstellerischen Anfänger. Auch in der Küche sind die einfachen Gerichte dem Koch mit der größten Erfahrung vorbehalten. In der Literatur ist dies häufig eine einfache, klassische Geschichte, wo das Gute auf das Böse trifft – und am Ende obsiegt. Es ist die Struktur des Märchens, bei dem die Figuren stets typisiert und von der Zeit abgeschliffen sind. Daran darf nichts verändert werden. Der Roman hingegen ist oft voller Überraschungen. Eine Romanfigur kann sich im Laufe der Handlung stark verändern. Das Volksmärchen, ein Licht in der Nacht für die Menschen des Südens, entspringt der mündlichen Kultur und ist über die Jahrhunderte nur sehr geringfügig verändert worden.
Welche Beziehung besteht zwischen Kochen und Schreiben? Man gebe verschiedene Zutaten in heißes Wasser, um einen besonderen Geschmack zu erzielen. Die Kunst des Würzens ist nicht weit entfernt von der des Stils. Doch ist daran zu erinnern, ein guter Koch ist noch kein guter Schriftsteller.
9. Die Zeit
Der Schriftsteller (mit oder ohne Pyjama) empfindet die Zeit zu Anfang als zäh. Er ist noch nicht an den Arbeitsrhythmus gewöhnt, der diese hohe Anstrengung verlangt. Er ermüdet rasch und will das Buch selbstverständlich bis zum Ende der Nacht oder des Monats fertig haben. Wie einem Kind gelingt es ihm nicht, sich ein ganzes Jahr vorzustellen. Der Gedanke erschreckt ihn, eine so hohe Konzentration über so lange Zeit aufrechterhalten zu müssen. Denn Schreiben erfordert vor allem Konzentration: man muss gleichzeitig die Welt reflektieren und das Leben spüren. Geist und Sinne in Harmonie bringen. Man muss die Welt durchdenken, wenn man sie beschreiben will. Daher hat es der junge Schriftsteller eilig, dem Feuerkreis zu entkommen. Der Stuhl, auf dem er sitzt, ist glühend heiß. So wird aus dem Roman, den er schreiben wollte, eine Novelle, aus der Novelle eine Erzählung, aus der Erzählung ein Gedicht. Er bevorzugt das Gedicht, weil man es morgens beginnt und bei Sonnenuntergang fertig hat. Die Zeit des Romans erscheint ihm wie ein durchgehendes Pferd, das er nicht bändigen kann. Ein Roman vermag die gesamte Energie des Körpers abzuziehen – wie im Falle von Proust, der sein Leben schreibend im Bett verbracht hat. Dieses Spielzeug kann einen total beanspruchen. Es umfasst alle Gattungen (Gedicht, Drama, Kurzgeschichte und Märchen). Behauptet deshalb die Dame, der ich auf der Straße begegne, jedesmal, ihr Leben sei ein Roman? Neben dem Kino ist der Roman die populäre Gattung schlechthin – beide sind sich übrigens recht ähnlich. Als richtiger Schriftsteller gilt gewöhnlich nur, wer einen Roman geschrieben hat. Aber der Roman erfordert etwas, das dieses Jahrhundert nicht kennt: Geduld. Wir leben in einer Epoche der Sprinter, die Zeit wird in Sekunden gemessen, während der Roman die Qualitäten eines Marathonläufers verlangt. Wenn man zu schnell schreibt, gleitet man in voller Fahrt über Punkte hinweg, die kaum zu erkennen, aber für die Fiktion notwendig sind. Damit sie einem auffallen, braucht es eine mehrfache, aufmerksame Lektüre und die Geduld eines Mönchs. Es gibt noch eine andere Form der Zeit, es ist die Zeit im Roman. Sie bildet sein Gewebe. Um sie herzustellen genügt es nicht, plötzlich »fünfzehn Jahre später« hinzuschreiben. Man muss sich die Zeit nehmen, um die Figuren altern zu lassen. Der Atem der Zeit lässt sich wiedergeben: Einer kehrt nach Jahren zurück. Ein Kind wird geboren. Der Großvater stirbt. Der Wechsel der Jahreszeiten. Das Elternhaus verfällt. Der Garten verdorrt. Die Lebensalter mit den ersten Schritten des Babys, dem Fieber der Jugend, Reisen, Hochzeiten, Krankheiten. Es gibt tausend Möglichkeiten zu zeigen, wie die Zeit vergeht. Es ist nicht empfehlenswert, in einer Novelle oder kurzen Erzählung mit der Zeit zu spielen. Dies verlangt eine Kunstfertigkeit, die dem Anfänger gewöhnlich nicht zur Verfügung steht. Eine der Grundvoraussetzungen für das Schreiben ist, die eigenen Möglichkeiten kennenzulernen, um nicht nach dem Unerreichbaren zu greifen – zumindest zu Beginn. Mancher gelangt auch auf anderen Wegen ans Ziel. Die Technik der Meister lässt sich ebenso studieren wie in der Malerei und der Musik. Julio Cortázar zeigt in seiner Kurzgeschichte Der Verfolger2 auf wunderbare Weise das Vergehen der Zeit, sie gehört in die Sammlung Die geheimen Waffen. Da werden Sie sehen, wie er das auf die kurze Distanz schafft. Doch eigentlich sind die Autoren der Familiensagas die Uhrmachermeister der Zeit im Roman. Vor allem mit ihren langen Beschreibungen einer so ruhigen Welt, dass sie stillzustehen scheint, gelingt es diesen Routiniers, ihre Auffassung von der Zeit erlebbar zu machen. Man sollte sich ihre Methoden in einem Notizbuch aufschreiben.
Stürzen Sie sich nicht darauf, ein Buch zu schreiben, nur weil Ihnen das Thema interessant erscheint. Das ist vielleicht nicht genug für drei Jahre Angst und ein paar Festtage.
10. Abschweifen vom Thema
Suchen Sie sich einen Schriftsteller aus, den Sie mögen, und lesen Sie alles, was er geschrieben und was man über ihn geschrieben hat, um Ihren Pilotfisch wirklich kennenzulernen.
11. Der Fluchtpunkt
Grob gesagt gibt es mindestens zwei Arten, eine Landschaft darzustellen. Bei der westlichen Sichtweise liegt der Fluchtpunkt im Bildhintergrund. Man hat den Eindruck, eine so einladende Welt vor sich zu haben, dass man meint, sie zieht einen zum Horizont. Wenn man vor dem Bild steht, kann man nicht mehr zurückweichen: man wird geradezu verschluckt. Man möchte dem Gemälde auf den Grund gehen, bis an den kleinen verborgenen Punkt, in dem sich die ganze Anziehungskraft bündelt. Ein großer Teil des von der Neugierde angetriebenen westlichen Denkens lässt sich als Einladung zusammenfassen, eine neue Landschaft zu entdecken. Ein ideales Beispiel findet man in den Bildern von Chirico, die dazu einladen, uns in ihnen zu verirren. Wir bewegen uns etwas verängstigt durch eine unterkühlte Architektur, ohne zu wissen, was uns hinter den strengen Säulen erwartet. Es erinnert mich an einen kleinen Jungen, der auf dem Flughafen mit seinem Nintendo spielte. Ich war fasziniert von den unendlich vielen Perspektiven, die das Spiel bietet, aber auch von dem Kind, das mir vorkam wie eine Fliege, die sich in einem Spinnennetz verfangen hat. Jedes Portal öffnet sich auf eine neue Landschaft, die zum nächsten Level führt. In dieser Kultur scheint das Individuum von einer grenzenlosen Neugierde getrieben zu sein. Genau das Gegenteil findet in der Primitiven Malerei statt, dort scheinen Menschen und Dinge mit einem einzigen Schwung in den Vordergrund zu stürzen. Doch sie fliehen nicht etwa vor einer Gefahr. Sie bilden den Gegensatz zu den Figuren auf einem okzidentalen Bild, die darauf zu warten scheinen, dass man sie betrachtet. Die Figuren auf einem Bild der Laienmalerei3 interessieren sich mehr für die Welt vor ihnen. Sie kommen uns vor wie ein Theaterpublikum und wir sind die Akteure. Sie betrachten uns, während wir über sie reden. Nicht sie stehen im Zentrum der Aufmerksamkeit, sondern wir. Wie kommt dieses Wunder zustande? Der Laienmaler verlegt den Fluchtpunkt nicht in den Bildhintergrund, sondern in den Plexus des Betrachters. Es verändert unsere Art, die Dinge wahrzunehmen. Im gleichen Maß wie wir schauen, werden wir angesehen. Dies geschieht natürlich in beide Richtungen. Sieht man eine Szene auf einem Bild der Laienmalerei, will man unwillkürlich zurückweichen. Hingegen beim okzidentalen Gemälde mit dem Fluchtpunkt im Bildhintergrund bewegt man sich nach vorn. In einem Museum interessiert mich vor allem die Beziehung der Besucher zu den Kunstwerken. Wie sie schauen und wie sich ein Bezug zwischen ihnen herstellt, während sie das selbe Bild betrachten. Je nachdem, ob sie im Norden oder im Süden sind (bestimmt auch im Osten), ändert sich ihr Verhalten. Darin zeigen sich unterschiedliche Sichtweisen von der Welt. Eigentlich liegt keine Naivität in den Bildern der Laienmaler. Sie verdienten, aus dem Blickwinkel des Künstlers betrachtet zu werden, der sie schuf, und nicht aus dem eines westlichen Kritikers, der sie beurteilt, als könnte es nur eine Sichtweise vom Universum geben. Bereits bei meinem ersten Buch wusste ich, dass ich wie die Laienmaler schreibe. Mein Ziel war es, den kritischen Geist des Lesers auszuschalten, indem ich ihn mit Aromen, Düften und Farben berauschte. Das ging so weit, dass er den Eindruck hatte, ich dränge ebenso in ihn ein wie er in mich.
Zielen Sie auf das Herz des Lesers, auch wenn Sie wissen, er liest mit dem Verstand.
12. Der Erzähler
Zunächst ist von Bedeutung, dass der Erzähler nicht zwangsläufig der Schriftsteller ist. Er kann es gar nicht sein, denn was er schreibt, ist ein Kunstwerk. Der Leser verwechselt die beiden oft, vor allem, wenn der Schriftsteller in das Leben des Erzählers hin und wieder Geschichten aus seinem eigenen Leben streut. Der Leser, durch Wikipedia gut unterrichtet, kann saftige Anekdoten über seinen Lieblingsautor sammeln. Selbst bei einem so zurückhaltenden Menschen wie Kafka beeilt er sich, seine Verlobten kennenzulernen, seine verpassten Rendezvous mit dem Leben, seine Obsessionen, Hut und Mantel, sein schwieriges Verhältnis zum Vater, seine Spaziergänge durch Prag, bevor er das Werk peinlich genau liest, um Spuren dieses Privatlebens zu entdecken. Und wer sucht, der findet, ohne zu merken, dass er in die Falle tappt. Denn manche Schriftsteller lieben es, mit dem Leser Katz und Maus zu spielen. Am Ende verliert jedoch der Schriftsteller, denn es wird schwer beziehungsweise unmöglich für ihn, den Charakter des Erzählers zu verändern, den er dem Original so genau nachgebildet hat. Er hat den Fluss der Zeit überquert, jetzt weiß er nicht mehr, an welchem Ufer sich die Realität befindet. Die Leser, die er auf der Straße trifft, sprechen mit ihm lieber über sein fiktives als sein reales Ich. Die Frauen finden nichts dabei, ihm zu berichten, wie verführerisch der Erzähler auf sie wirkt. Ich kenne einen Schriftsteller, der ist so eifersüchtig auf seinen Erzähler, der die Frauen zum Schmelzen bringt, während sie bei ihm eiskalt bleiben, dass er ihn getötet hätte, wäre sein Verleger nicht eingeschritten. Nicht wenige Schriftsteller haben eine Figur geschaffen, die ihnen sehr nah, aber viel lebendiger ist als sie: Bukowski, Miller, Hemingway, Cendrars. Bei ihnen allen wird im Laufe der Zeit der Spielraum immer enger: Der Leser kennt den Erzähler und erwar tet, dass er sich unter ähnlichen Umständen gleich benimmt. Bukowski trinkt in allen Lebenslagen, um seine Fans nicht zu enttäuschen; Miller spielt mit achtzig noch Tischtennis mit Striptease-Tänzerinnen, um seine Leser davon zu überzeugen, dass er sich seit Sexus nicht verändert hat; Hemingway ist immer auf einem Boot oder mit einem Gewehr zu sehen, selbst wenn die Aufnahmen gestellt sind; auf dem Foto spaziert Kafka durch Prag mit dem Gesichtsausdruck eines verirrten Engels, dass man sich fragt, ist er es oder sein Erzähler; Cendrars fährt in seinen Gedichten mit der Transsibirischen Eisenbahn, die er im Leben nie genommen hat; und schließlich spielen die Geschichten von Modiano fast alle in derselben düsteren, todbringenden Atmosphäre Frankreichs unter deutscher Besatzung, einer Epoche, die der Autor mehr geträumt hat als dass er sie selbst erlebte. Angesichts dieser Fährnisse ziehen manche Schriftsteller einen distanzierten Erzähler vor, der die Figuren als Marionetten betrachtet, eine Art Erzähler ähnlich wie eine körperlose Stimme aus dem Off, die man nur in den »objektiven« Romanen der literarischen Avantgarde findet.4 Als hätte man in einer Ecke des Zimmers eine Kamera aufgestellt, die alles aufnimmt, was in ihr Blickfeld gerät.
Markieren Sie (mit einem gelben Stift) alle »aber« und »vielleicht« in ihrem Manuskript, dann springt Ihnen Ihr schriftstellerisches Temperament in die Augen.
13. Der Schluss
Sie mögen Schlüsse? Ja ich weiß. Eine traurige Manie. Die beiden Momente, die man dem Schriftsteller gönnt, sind der Anfang und der Schluss. Das »Dazwischen« hat er offenbar nicht im Griff. Manche Autoren schreiben den Schluss des Buchs, bevor sie es überhaupt angefangen haben, so meinen sie zu wissen, wohin es geht. Die Zahl möglicher Schlüsse ist freilich beschränkt. Wie wir etwas abschließen, sagt viel über unseren Charakter aus. Ziehen wir die Versöhnung vor oder die Trennung? Den Kuss, der vereint, oder den Tod, der trennt? Die besten Schlüsse sind jene, die dem natürlichen Verlauf der Handlung folgen, selbst wenn dann die Überraschung fehlt. Die großen Klassiker haben den unerwarteten Schluss gemieden. Sie gingen lieber geradewegs auf das Ende zu. Oft endet ein Leben, beispielsweise stirbt der Großvater, und die dazu passende überraschende Wende ist eine Geburt. Für einen Tod (zu Beginn) und eine Geburt (am Ende) ist Herr über den Tau von Jacques Roumain ein gutes Beispiel. Chronik eines angekündigten Todes von García Márquez zeigt, dass ein Buch interessant sein kann, obwohl das Ende keine Überraschung verspricht – der Titel verrät schon alles. Ärgerlich ist es aber immer, wenn der Autor sich auf den letzten Seiten abmüht für ein Finale, das die Handlungsstränge sammelt oder etwas Spektakuläres bietet. Dabei wäre ein allmähliches »Fade-out« angebracht. Wenn nicht ein Eklat naheliegt (d.h. ein Knalleffekt, der zur Linie der Erzählung passt), ist eine behutsame Auflösung besser. Welches Ende ist am häufigsten? Der Kuss oder die Versöhnung, wie im Liebesroman. Beliebt ist auch, wenn das Ende auf den Anfang verweist, so wird die Handlung wie eine Kugel rund und beruhigend. Doch es riecht nach Amateurschriftsteller, wenn der Erzähler am Schluss aus einem Alptraum erwacht. Häufig ist ein einfaches Ende ohne Drama oder große Überraschung besser. Eine Figur verschwindet in der Menge.
Wenn sich Ihr Leben hauptsächlich zwischen 17 und 19 Uhr abspielt, in einem Raum voller Menschen, die trinken und reden, dann können Sie als Schriftsteller einpacken.