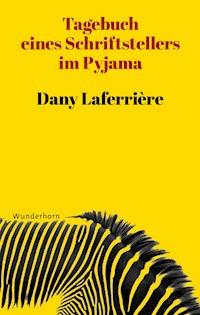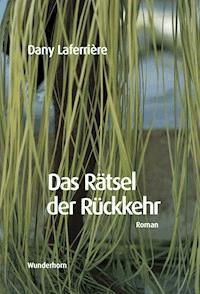Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Das Wunderhorn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er hat den Auftrag eine große Reportage über Nordamerika zu schreiben. Der erste Schwarze Schriftsteller, der Amerika von einem Ende zum anderen bereist, ein Roadtrip nach dem Vorbild von Jack Kerouac, mit Walt Whitman als Reisegefährten. Er notiert alles, was er erlebt: im Zug nach Vancouver, im Bus in den Süden, in einem vegetarischen Restaurant in San Francisco, einem Taxi vor einem Nachtclub in Manhattan. Er trifft sich mit Filmgrößen wie Spike Lee, dem Rapper Ice Cube, schreibt über den Musiker Miles Davis, den Maler Jean-Michel Basquiat. Er durchleuchtet die amerikanische Gesellschaft in all ihren Kontrasten und verzehrenden Mythologien, wobei sein Blick sich auch auf die Gesichter richtet, die wie ein Cocktail aus explosiver Gewalt und Sex das Land prägen: Martin Luther King und Norman Mailer, Spike Lee und Calvin Klein, James Baldwin und Madonna, Truman Capote und Naomi Campbell. Der Roman zeichnet zugleich das Porträt eines jungen, kultur- und freiheitsliebenden Schriftstellers, inmitten eines Amerika, das seine großen Versprechen nicht immer hält.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Buch wurde im Rahmen des Programms NEUSTART KULTUR aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
Titel der Originalausgabe:
Cette grenade dans la main du jeune Nègre est-elle une arme ou un fruit?
Zuerst erschienen 1993.
© 2015 Dany Laferrière
© 2016 Éditions Grasset & Fasquelle, Paris
© 2021 Verlag Das Wunderhorn GmbH
Rohrbacherstraße 18, D-69115 Heidelberg
www.wunderhorn.de
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Gestaltung und Satz: philotypen/Dortmund
eISBN: 9783884236604
Granate oder Granatapfel was hat der Schwarze in der Hand?
Dany Laferrière
Aus dem Französischenübersetzt von Beate Thill.
Gewidmet
dem Romanautor James Baldwin,*
dem Musiker Miles Davis,
dem jungen Maler Jean-Michel Basquiat,
alle drei sind in Amerika gestorben.
In der Neuen Welt herrscht Krieg.
*Gewiss, Baldwin starb in Frankreich, aber die tödliche Wunde wurde ihm in Amerika zugefügt.
Ich verleugne meine Herkunft nicht, ich verstehe mich nur nicht mit den anderen Schwarzen.
Ich finde, Schwarzsein ist nicht alles im Leben.
Graffito in einer New Yorker U-Bahn.
Inhalt
SCHREIBEN IN NORDAMERIKA
DIE KUNST, BERÜHMT ZU WERDEN OHNE ZU ERMÜDEN
I. TEIL WO?
II. TEIL DIE REISE
III. TEIL AMERICANA
IV. TEIL WARUM?
V. TEIL WIE? (RÜCKBLENDE)
VI. TEIL DREI AMERIKANISCHE PAARE
VII. TEIL DAS MATERIELLE LEBEN
VIII. TEIL EIN PAAR REGELN, UM IN AMERIKA ZU ÜBERLEBEN
IX. TEIL AUCH DAS IST AMERIKA
X. TEIL DIE PARALLELWELT
XI. TEIL HALL OF FAME (ZEHN ZEITGENÖSSISCHE AFROAMERIKANISCHE HELDEN)
XII. TEIL AMERIKA IST EIN RIESIGER FERNSEHER MIT WIMMELBILDERN
XIII. TEIL DIE RÜCKKEHR
SCHREIBEN IN NORDAMERIKA
I
Dies ist kein Roman. Hier denke ich an Magritte, der eine Pfeife zeichnete und darunterschrieb „Dies ist keine Pfeife“.
Ich verfasse dieses Buch nach Notizen, die ich mir an vielen Orten in Nordamerika gemacht habe. Im Zug Richtung Vancouver, in dem eine dicke Frau mir gegenüber saß und mich während der ganzen Fahrt anstarrte, weil sie dachte, ich zeichnete ihr Porträt (was übrigens stimmte). Im Bus Richtung Süden (Key West) an einem sonnigen Freitag, mit der schrecklichen Bläue des Meers beiderseits der nicht endenden Brücke. Im vegetarischen Restaurant in San Francisco, wo ich nichts gegessen habe, wegen eines winzigen Fettkrümels im Mundwinkel der Langen, drei Tische links von mir. Im Taxi vor einem Nachtclub in Manhattan, um drei Uhr morgens (wir suchten verzweifelt nach Bagels). In der Toilette des Shade (eine modische Bar in Montréal, am Boulevard Saint-Laurent, angesagt bei jungen Schauspielerinnen mit metallischen Brüsten, die dir ihr Laserzwinkern zuwerfen), wo eine grünhaarige Frau heulte, weil sie die Vene nicht finden konnte, um sich den ganzen Dreck in den Leib zu fixen. In Amerika ist man pausenlos unterwegs. Der weite Raum Amerikas ruft nach Geschwindigkeit.
II
Ich habe den Auftrag, für ein hochangesehenes Magazin an der Ostküste eine große Reportage zu schreiben. Sie wollen offenbar eine Sondernummer über Amerika herausbringen.
„Was kümmert es mich, ob Amerika 500, 400 oder 600 Jahre alt ist!“
Das sagte ich dem Typen am Telefon, der mich in meiner Bude aufgespürt hatte.
„Fuck Amerika, Alter, hier ist das Geld, und zwar ein schönes Päckchen, nimm’s, sonst kriegt es ein Anderer.“
„Warum ich?“ (Wie lange man diese dämliche Frage schon stellt!) „Tja, vielleicht bist du ‚das Parfüm des Monats‘ für sie.“
„Wieso?“
„Sie haben dich anscheinend überall gesucht und jetzt …“
„Was ist mit dir?“
Kurzes Schweigen.
„Sagen wir mal, ich bin schon ‚das Parfüm des Monats‘ gewesen.“
„Lange?“
„Ja … gut drei, vier Monate.“
„Nur!“
„Hier geht das sehr schnell“, erwiderte er mit einem trockenen Lachen.
„Was wollen die genau?“
„Keine Ahnung … Ich nehme an, sie wollen einen Schwarzen, der nicht hier lebt, sich hier aber gut auskennt, du weißt, was ich meine …“
„Warum keinen schwarzen Amerikaner?“, fragte ich ganz unschuldig.
„Afroamerikaner heißt das jetzt, das hat sich auch geändert.“
„Wenn man seine Identität in den Wörtern sucht … Dennoch, warum keiner von denen?“
„Sie wollen wohl keine Schwierigkeiten … nicht jemanden, bei dem sich alles um den Gegensatz zwischen Weiß und Schwarz dreht, das interessiert sie nicht.“
„Dann ist es schon vorbei, denn es ist das Einzige, was mich an Amerika interessiert.“
„Bei dir“, sagte er lachend, „ist das eher der Zusammenprall der Weißen Frau mit dem Schwarzen Mann.“
„Auch eine Art, sich dem Problem zu nähern …“
„Möglich, aber das gehört in die Freizeit. Wenn nicht von Geld die Rede ist, fühlt sich der Weiße nicht angesprochen.“
„Du meinst, der Reiche.“
„Kein linkes Gewäsch, Alter, hier ist der Reiche weiß.“
„Ich hasse Auftragsarbeit.“
„Du entscheidest … Passt ‚das Parfüm des Monats‘ nicht zu dir? Du fährst auf ihre Kosten ein wenig herum und schreibst deine Eindrücke auf, und die zahlen verdammt gut, Alter … das ist Amerika!“, schloss er mit einem lauten, bitteren Lachen.
„Ach! Haben sie denn vor den Schriftstellern so viel Respekt?“
„Willst du mich auf den Arm nehmen?“
„Nein nein …“
„Ganz einfach“, behauptete er, „sie wollen ihre Sondernummer (die eigentlich vollständig von Ford, Getty, Mallon, Morgan, Rockefeller et cetera gesponsert wird, Alter, lediglich eine Methode, um Steuern zu sparen, aber das nur unter uns). Sie wollen was Großes hinterlassen und sind offenbar bereit, auch den Preis dafür zu zahlen.“
„Was soll ich also machen?“
„Du rufst einfach an und sagst, du bist einverstanden.“
„Klingt nach Callgirl.“
„Es ist das gleiche Prinzip.“
„Hey! Du hast mir noch gar nicht deinen Namen genannt!“
„Kunta!“, sagte er, dann legte er mit einem trockenen und bitteren Lachen auf. Es ist das Lachen eines jungen Schwarzen, der sich am starken Licht Amerikas bereits verbrannt hat.
III
Es passiert nicht alle Tage, dass ein schwarzer Schriftsteller einem anderen schwarzen Schriftsteller einen interessanten Tipp gibt, damit meine ich, der ein bisschen Geld einbringt. Ich rief an. Sie wollten tatsächlich jemanden, mit dem sie einen guten Deal abschließen konnten. Das ist ihre Philosophie auf allen Stufen der Karriereleiter: Der beste Deal heißt, es soll sie möglichst wenig kosten. Es gibt dafür nichts Besseres als einen jungen Schriftsteller, der soeben einen netten kleinen Erfolg geerntet hat. Das Parfüm des Monats. Bist du zu naiv, hast du schon verloren. Betont durchblicken! Betont zynisch sein! Alles diskutieren! Schon gab ich der Redaktionsleitung am Telefon bekannt, dass die Rassenfrage mir nach wie vor viel bedeutet.
„Inwiefern?“, fragte mich der Typ am anderen Ende der Leitung.
„In sexueller Hinsicht!“
Ich kenne keinen Weißen, dem schwarz-weißes Vögeln nicht den Mund wässrig macht, um die Sache höflich auszudrücken. Solange auch nur ein Abnehmer dafür bleibt, habe ich in Amerika zu tun.
„Warum dieses Thema?“
Der Heuchler!
„Erstens, weil mich an Nordamerika nur das interessiert …“
Der Spruch wurde schon zum Mantra.
„Wir arbeiten in ganz Amerika … Mittelamerika, Nord- und Südamerika, auch in der Karibik“, fügte er in diesem honigsüßen Ton hinzu.
„Hören Sie (unterbrach ich ihn scharf), wer Sie auch sein mögen … Wenn ich in Nordamerika leben will, dann weil mir die Mayas und Azteken egal sind. Für mich sind die toten Zivilisationen zu Recht ausgestorben.“
„Da Sie aus der Karibik kommen, dachten wir …“
Immer dieses „Wir“, sobald sie sich ein bisschen bedrängt fühlen!
„Die Karibik! Immer der gleiche Blödsinn! Die Leute sollen über die Ecke schreiben, aus der sie kommen! (Alle herhören: Da bin ich empfindlich.) Ich schreibe über Dinge, die passieren, wo ich lebe … Außerdem ist die Karibik heute in New York und Lateinamerika in Miami.“
„So habe ich das nicht gemeint …“
„Dann sagen Sie mir doch gleich, was ich schreiben soll!“, jetzt kläffte ich richtig.
Ich spürte, wie er am anderen Ende einen Satz zurück machte.
„Das war nur ein Vorschlag.“
„Ich habe mir die Unabhängigkeit in Amerika erkämpft, indem ich acht Stunden am Tag auf einer alten klapprigen Schreibmaschine getippt habe. Die Fabrik war die Alternative. Zuerst war es noch beides. Und ganz allmählich war es nur noch das. Wenn jetzt einer kommt und mir meine Remington 22 nehmen will, schieße ich ihm eine Kugel in den Kopf … Achtung, ich bin ein Spinner und kann zielen.“
Natürlich war das ziemlich übertrieben, aber ich hatte Spaß daran, in den etwas weichen aristokratischen Schädel dieses höflichen jungen Mannes einen Nagel reinzuhauen. Er kommt bestimmt gerade von Harvard oder einer anderen Spitzenuniversität, die junge WASPs so gut darauf vorbereiten, von der Wall Street aus die Dritte Welt verhungern zu lassen. Zum Glück beherrschten sie nicht den Kampf Mann gegen Mann, die bevorzugte Sportart der Hungerleider.
„Einverstanden“, stammelte er endlich.
Dabei hatte ich ihm meine Entscheidung noch gar nicht zu Ende erklärt.
„Was waren die Azteken eigentlich? Hä? Nichts als ein paar stinkreiche Degenerierte, dazu arrogant und pervers, die das Volk arbeiten ließen, damit sie selbst untätig bleiben konnten. Die aztekische Kunst? Geschaffen von mies bezahlten Leuten. Heute sind die Amerikaner an ihre Stelle gerückt und keinen Deut besser. Eines Tages sind die Schwarzen an der Reihe. Die Schwarzen werden die schlimmsten Imperialisten sein, denn sie haben zu viel gelitten. Man sollte das Schicksal des Planeten nicht in die Hände derer legen, die durch die Hölle gegangen sind.“
Kein Laut am anderen Ende. Ich hatte den Feind platt gemacht. Nun blieb mir nichts mehr übrig, als die Festung einzunehmen. Wirklich wahr, in der Neuen Welt herrscht Krieg.
IV
Ich bin also überall in Nordamerika hingefahren. Ich habe gesehen, wie die Schwarzen, die Weißen, die Roten und die Gelben leben. Also eigentlich alle. Und ich fand heraus, Alter, dass wahr ist, was man über Amerika sagt. Amerika schluckt alles. Es ist der weiche Bauch der Welt. Das letzte unschuldige Volk. Dagegen erscheinen die Buschleute wie listige Teufelchen. Sie werden sagen: Was? Er wiederholt das abgehalfterte Klischee des naiven Amerika, Alter, damit ist es doch längst vorbei! Im Gegenteil, Bruder! Es gilt immer noch. Die Mechanik läuft wie neu. Zweihundert Jahre sind im Vergleich zur Menschheitsgeschichte eben nicht mehr als ein Augenzwinkern, so viel wie nichts. Amerika ist wie eines der gut genährten Babys aus der Reklame. Und die Amerikaner leben miteinander, als gäbe es auf dem Kontinent niemanden sonst. Oder auf dem Planeten. An der Tankstelle, wo ich volltanke, meine ich gerade den Ansturm einer Horde eindrucksvoller Barbaren zu erleben. Studenten aus Indianapolis (jeder Staat hat ein eigenes Autokennzeichen) kicken einen Fußball zwischen den Autos und den Tanksäulen hindurch. Sie haben weite T-Shirts mit den Farben ihrer jeweiligen Unis an. Sie sind groß, blond, athletisch. (Trägst du da nicht ein bisschen dick auf? Nein, Bruder, sie sind wirklich so, wie man sie sich vorstellt.) Jede ihrer Bewegungen scheint wie neu, als hätten diese jungen Männer keine Verbindung zur übrigen Menschheit. Sie sind einzigartig. Sie verschlingen tonnenweise Hamburger, trinken Bäche von Coca Cola und verbringen die Hälfte ihres Lebens vor dem Fernseher. Sie beten alle möglichen Götter an und außerdem einen einzigen Gott. Sie töten auf alle erdenklichen Weisen. Sie kennen keine Reue. Die Welt ist ein Kinderspielzeug in ihren Händen. Sie machen es kaputt, reparieren es wieder und werfen es dann weg. Sie wissen nichts von der Vergangenheit und verachten die Zukunft. Sie kennen nur den gegenwärtigen Moment. Sie sind Götter. Und ihre Schwarzen sind Halbgötter.
V
In Amerika ist nur eines von Bedeutung: der Erfolg. Um jeden Preis. Egal mit welchen Mitteln er erreicht wird. Das Wort „Erfolg“ hat nur in Amerika einen Sinn. Es heißt, dass die Götter dich lieben. Dann kommen die anderen Menschen näher, schnuppern an dir (das betäubende Parfüm des Erfolgs), fassen dich an und beginnen um dich herum zu tanzen. Du bist ein Gott. Ein Gott unter den Herren der Welt. Weiter kannst du nicht aufsteigen. Das ist der Gipfel. Das Dach der Welt. Und vor allem: Jetzt sehen sie dich. Wer in Amerika schaut, ist immer der Unterlegene, bis ein anderer auf ihn schaut. Es ist nur ein verstohlener, kurzer Blick (nicht länger als fünfzehn Minuten, nicht wahr, Warhol!), denn in Amerika gibt es immer etwas Neues zu schnuppern. Eben, „das neue Parfüm“.
VI
Lange Zeit meinten die Schriftsteller, auf den Erfolg pfeifen zu können. Es galt schlicht als unmöglich, gleichzeitig ein guter und ein bekannter Schriftsteller zu sein. Die Autoren gaben sich mit mickrigen Auflagen zufrieden und waren deshalb von der Gunst der Verleger, Buchhändler und weiterer Mittelspersonen abhängig. Und doch wagten diese Autoren, anderen Ratschläge zu erteilen. Das Schlimmste an dem Zustand ist, dass sich bis heute nicht viel verändert hat. Welcher junge Schriftsteller hätte den Mut, die Veröffentlichung seines Romans bei Gallimard (ich wähle die beste Adresse in Frankreich) abzulehnen, nur weil die Vertragsbedingungen schlecht sind? Im Gegenteil, er ist glücklich, Fleisch von seinem Fleisch und Blut von seinem Blut fast kostenlos zu opfern, denn so nenne ich das, wenn einer fünf Jahre hart geackert hat. Am Tag der Unterzeichnung lädt er sogar ein paar Freunde ein, um diesen Vertrag zu feiern. Man würde ihm gerne in aller Freundschaft erklären, dass Gallimard primär ein Geschäftsmann ist (aber ja doch) mit dem Hauptziel, Bücher zu verkaufen (hoffentlich), und zwar so viele wie möglich. Man würde ihm auch gerne erläutern, dass dieser mächtige Verlag eine Armee von Buchhaltern besitzt und äußerst nervöse Erben, die mehr Zeit verbringen, Geschäftsbücher zu wälzen als die Gedichte von René Char zu lesen. Aber nur eine Andeutung in diese Richtung, und er läuft schreiend davon. Dieser junge Autor schreibt nicht, um reich oder bekannt, sondern um bewundert zu werden (und das hält er bereits für ein Zugeständnis). Ich bin verblüfft, dass ein klar denkender und intelligenter junger Mann (das schreiben selbst die Kritiker), die enge Verbindung nicht sieht zwischen der Frage, ob man gelesen wird und der, ob man bekannt und reich ist. Je mehr du gelesen wirst, desto bekannter bist du und desto schneller wirst du reich. Und am Ende auch frei. Diese Gleichung hatte ich immer vor Augen.
VII
Ich habe acht Hefte mit Szenen mitten aus dem Leben vollgeschrieben und Hunderte Fotos geknipst. Amerika ist ein Berg fertiger Bilder. Für diese Reportage habe ich das Muster der Städte nachgezeichnet. Die großen Städte verbindet nichts, was eine Gesamtheit, ein Land ergeben würde. Die Städte sind über die Landschaft verteilt (New York, Miami, Chicago, Dallas, Washington, Baltimore, Los Angeles, Boston, San Francisco), jede bewahrt ihre Persönlichkeit, ihre Unabhängigkeit, ihre Stimmung, ihren Stil, aber alle streben mit wildem Verlangen danach, eine amerikanische Stadt zu sein. Dagegen sind die Kleinstädte echte Rattenlöcher, mit den immer gleichen Läden, den gleichen Banken, dem gleichen halben Dutzend Fast-Food-Restaurants, mit den gleichen Redneck-Bullen, die nur am Samstagabend abgehen, mit dem gleichen bescheuerten Lokalfernsehen (neulich erzählte ein Schriftsteller, in dem kleinen Fernsehsender einer Stadt im Mittleren Westen habe man ihm am frühen Morgen die Frage gestellt: „Dann handelt Ihr Buch vom Wesen des Menschen?“), dem gleichen tendenziösen Provinzblatt und den gleichen verblödeten Jugendlichen. Was ist eine amerikanische Stadt? Die amerikanische Realität (der Raum, die Zeit, die Leute und vor allem die Dinge) erscheint mir näher am Film als am Roman zu sein, näher am schnellen Schnitt als an langen Einstellungen, die Szenen schieben sich ineinander statt aufeinander zu folgen, diese Realität scheint mir näher an der Wut als am Mut, näher am Instinkt als am Verstand. Wenn die amerikanische Realität einem Spielfilm gleicht, ist das Leben eines Amerikaners ein Videoclip.
Aus allen diesen Gründen haben die amerikanischen Schriftsteller (ich rede nicht von Leuten, die ihre Wälzer in den Supermärkten losschlagen) Probleme mit dem Roman und zeichnen sich so sehr mit ihren Kurzgeschichten aus. Der zeitgenössische amerikanische Roman ist in der Regel eine Sammlung kurzer Texte, die ein fester, aber dehnbarer Faden verbindet (das Gefühl, amerikanisch zu sein). Dagegen ist das Leben eines Amerikaners eine Sammlung von Fakten (daher der Eindruck der Leere). Auch dieses Buch folgt der Regel des amerikanischen Romans.
DIE KUNST, BERÜHMT ZU WERDEN OHNE ZU ERMÜDEN
Ich hatte Erfolg mit dem Titel meines ersten Romans. Auch Leute, die das Buch nie gelesen haben und, vor allem, auch nie lesen wollten, kennen den Titel. Ihn zu finden hat genau fünf Minuten meines Lebens gekostet. Für das Schreiben des Buchs brauchte ich drei Jahre. Wenn ich das gewusst hätte … Unnötig, Hunderte von Seiten vollzuschreiben, neun Wörter hätten genügt. DIE KUNST, EINEN SCHWARZEN ZU LIEBEN OHNE ZU ERMÜDEN.
Ich habe mir etwa zwanzig Reaktionen genau notiert, die sich nur auf den Titel bezogen:
1.Auf einer Cocktailparty in Outremont (Quebec):
„Sind Sie der Autor des Romans mit diesem Titel?“
„Ja, leider.“
„Warum leider? Er ist wunderbar! Sie sind enorm talentiert!“
„Danke.“ (Meine einzige Frage: Soll ich sie flachlegen oder nicht?) Sie schaut mich weiter mit diesem blödsinnigen Lächeln auf den Lippen an. Ihr Mann lächelt ebenfalls. Die beiden sind Kunstsammler und besitzen eine Kette von Bekleidungsgeschäften.
„Mein Mann hat das Buch nicht gelesen, aber über den Titel hat er sehr lachen müssen (erzählt sie und lacht dabei ebenfalls), das kann ich Ihnen sagen. Der Titel ist so witzig!“
„In unseren Geschäften in der Provinz verkaufen wir auch Dessous …“ (Bemerkt er ein wenig verlegen.) „Ich sagte zu meiner Frau, Ihr Titel würde gut in unseren Katalog passen …“
„Hören Sie nicht auf ihn“, redet die üppige Rothaarige sofort dazwischen, „er denkt nur ans Geschäft …“
„Aber nein“, werfe ich ein, „ich finde das eine gute Idee …“
Sie lacht lauthals und klatscht (ein wenig krampfhaft) Beifall.
„Sie würden das machen! Wundervoll! Zu allem ist er überhaupt nicht eingebildet! Wirklich, Sie muss ich unbedingt treffen …“
„Hören Sie mal“, der Mann spricht nun wieder im harten Ton des Geschäftsmanns, „wir probieren das im Frühjahrskatalog mal aus. Wenn es gut läuft, bekommen Sie einen Vertrag … Ich selbst bin überhaupt kein Rassist, aber ich muss abwarten, wie die Kundschaft reagiert. Keine Sorge, ich bin fast sicher, dass das laufen wird …“
„Was erzählst du da, Schatz? Das läuft bestimmt …“, wendet sie sich mit einem bereits verständnisinnigen Lächeln an mich. „Es ehrt uns, Ihren Namen in unserem Katalog zu haben.“
Er zieht seine Frau weg in Richtung Bar.
„Vergessen Sie nicht, wir müssen uns unbedingt treffen. Ich bestehe darauf …“, wirft sie mir mit einem gehauchten Kuss zu.
2.In Madrid (Spanien) ruft mir eine junge Feministin entgegen: „Ich habe deinen Titel nur ein bisschen verändert, willst du wissen, was rauskommt?“
„Klar.“
„Die Kunst, einen Schwarzen zu lieben ohne IHN zu ermüden.“
3.Zuvor hatte ich schon beim Filmfestival in Leeds (England) einem jungen Mädchen auf die Frage geantwortet, warum ich diesen Titel gewählt hätte: „Junge Dame, ohne diesen Titel wären Sie vielleicht heute Abend nicht hier.“ Gelächter im Saal.
4.In New York (USA) kam ein junges Mädchen (noch eines!) bei der Premiere des Films, der nach dem Buch gedreht wurde, auf mich zu:
„Sind Sie der Autor des Romans?“
„Ja.“
„Schämen Sie sich nicht wegen dieses Titels?“
„Nein.“
Da schleuderte sie mir den Inhalt ihres Weinglases ins Gesicht.
5.In London (England) lädt mich ein sehr langer, hagerer Typ ein, mit ihm ein Glas zu trinken.
„Soeben habe ich meinen Roman beendet. Der Verleger meint, der wird einschlagen, nur gefällt ihm der Titel noch nicht.“
„Das ist immer das Problem mit den Verlegern.“
„Nun, es ist wohl das erste Mal“, sagt er mit einem leisen Lächeln, „dass ein Weißer darüber schreibt, wie sehr er sich zu schwarzen Männern hingezogen fühlt.“
„Ach ja …“
„Der Verleger sagt, das gibt einen Skandal … Ich möchte Sie etwas fragen (plötzlich in verändertem Ton). Es ist sehr persönlich … Natürlich können Sie ablehnen. (Herrgott!, denke ich. Ich soll ihm einen blasen, hier, in diesem Pub. Die Engländer sind wirklich schräg.)
„Leihen Sie mir Ihren Titel?“
„Was?“
Ein sehr breites Lächeln.
„Nicht wahr, das gab es noch nie! Jedenfalls noch nie mit der Zustimmung des Autors. Der Verleger sagt, wenn Sie es erlauben, ist das juristisch abgesichert. Zu meinem Thema passt nur Ihr Titel. Solange ich darüber nachdenke, es kommt nur Ihr Titel in Frage.“
„Wenn nur er in Frage kommt, wie Sie sagen, nehmen Sie ihn, aber ich warne Sie, er bringt kein Glück! Man wird ihn nicht so einfach los …“
„Die Kunst, einen Schwarzen zu lieben ohne zu ermüden, von John Ferguson. Wissen Sie, mein Verleger ist ein enger Freund des Verlegers von Salman Rushdie.“
6.In Paris (Frankreich) gesteht mir eine junge, etwas flippige Frau bei einem Glas Wein im Café Flore: „Weißt du, ich habe dein Buch nicht zum Lesen gekauft. Es liegt auf meinem Nachttisch, das hält mir die Aufschneider vom Leib.“
7.Ein junger Weißer aus Chicago fand den Titel beleidigend. Ein junger Schwarzer aus Los Angeles fand den Titel rassistisch. Eine junge Frau aus Montréal fand ihn sexistisch. BANCO! Ich nehme es mit allen auf!
8.In Toronto (Kanada) las ein junges Mädchen den Roman im Bus, bis sie merkte, wie alle sie neugierig anschauten.
„Ich hatte nicht daran gedacht, dass sie den Titel auf dem Buch lesen konnten.“
„Und weiter?“
„Noch nie im Leben war mir etwas so peinlich.“
9.In Tokio (Japan) wurde der Titel komplett ausgetauscht. Der Mann vom Vertrieb sagte zur Begründung: „Im Japanischen haben wir diese Wörter nicht.“
10.In Pretoria (Südafrika) lädt mich eine etwa fünfzigjährige Weiße zu einem Glas ein, in einer Bar in der Nähe der Alliance Française, wo ich gerade einen Vortrag gehalten habe.
„Sie können sich nicht vorstellen, welchen Effekt Ihr Titel auf mich hat.“
Schweigen.
„Mein ganzes Leben hatte ich an diese Möglichkeit gar nicht gedacht. Und plötzlich lese ich im Schaufenster einer Buchhandlung diese schrecklichen Worte.“
„Welche Worte?“
„Ihr Titel, Monsieur … Eine Woche lang bin ich jeden Tag zu dem Buchladen gegangen, nur um diesen Titel zu sehen. Und jedes Mal hatte er die gleiche Wirkung auf mich. Es gibt keine Worte, um auszudrücken, was ich dabei empfinde. Wie wenn heißes Blei in meinen Adern fließt. Ich ging nach Hause und musste mich sofort ins Bett legen, so erschöpft war ich. Als hätte ein Güterzug mich überrollt. Worte können schlimmer sein als Taten, wissen Sie.“
11.In Rom (Italien) flüsterte eine kleine, magere Frau (wirklich nur Haut und Knochen) eines gewissen Alters von der Sorte Baronin Soundso mir direkt ins Ohr:
„Sie werden nie erraten, wo ich mir Ihren Titel habe hin tätowieren lassen.“
„Nein.“
„Das habe ich mir schon gedacht“, ließ sie geheimnisvoll fallen, während sie in der Menge des mondänen Empfangs bei Gräfin Soundso entschwand.
Wohin hatte sie sich auf diesen spargeldünnen Leib nur diesen langen Titel tätowieren lassen?
12.In Port-au-Prince (Haiti) raunte mir ein blasierter Freund zu: „An deinem Buch ist nur der Titel interessant.“
13.In Brüssel (Belgien) brüllte mich ein afrikanischer Schriftsteller an:
„Merk dir gut, was ich dir jetzt sage, Bruder, in drei Wochen redet keiner mehr von deinem Buch.“
14.In Antwerpen (Belgien) hat die Übersetzerin den Titel noch verbessert, auf Flämisch heißt er: „Die Kunst, einen Schwarzen zu lieben ohne schwarz zu werden.“
15.In den USA haben alle großen Zeitungen den Titel zensiert: die New York Times, die Washington Post, der Miami Herald, die Los Angeles Times, die Chicago Tribune, die Daily News, der Boston Globe, die New York Post, alle.
Ich wurde gebeten, den Titel zu ändern. Darauf erwiderte ich, Amerika müsse sich ändern.
16.In San Francisco (Kalifornien) fanden sie den Titel gut, aber San Francisco zählt nicht.
17.In Sydney (Australien) hat mich eine Frau ziemlich frech aufgefordert, den Beweis meines Titels anzutreten.
Es gibt auch solche Tage.
18. In Stockholm (Schweden) hat mir eine blonde junge Frau (was für ein Zufall, Alter!) lachend ihren Schwarzen Freund vorgestellt.
„Frag mal Seko, wer als erster müde wird.“
„Bestimmt Seko“, antwortete ich.
Seko brach in ein schallendes guineisches Lachen aus.
„Die Kunst, zwei Schwarze zu lieben ohne zu ermüden“, murmelte sie mit Schlafzimmerblick.
Seko lachte nicht mehr.
19.In Amsterdam (Niederlande) verlangte eine junge Sekretärin Antwort auf die schwerwiegende Frage:
„Was ist die Kunst, einen Schwarzen zu lieben ohne zu ermüden?“
„Man muss es IHM überlassen.“
20.Überall auf der Welt hat man mir die gleiche Frage gestellt: Warum dieser Titel? Warum nicht! Eines ist sicher: Ich will nichts mehr davon hören! Ich hatte eine Überdosis. Jetzt löst er bei mir Brechreiz aus. Ich verrate Ihnen mal, wie er zustande kam. Bouba hat ihn gefunden. Ich erinnere mich, wir gingen in Montréal die Rue Saint-Denis hinunter. Es regnete. Ein Sommerregen. Da sagte Bouba (wie in einer Traumszene) sehr langsam: „Die Kunst, einen Schwarzen zu lieben, wenn es regnet und man nichts anderes zu tun hat.“ Sein Titel war länger, aber noch witziger.
Mein erster Roman. Die Götter hätten wenigstens den dritten abwarten können, bevor sie mich straften. Beim ersten Schuss ins Schwarze. Nicht einmal mit dem ersten Roman. Nur mit dem Titel.
I. TEILWO?
ICH BIN EIN SCHWARZER SCHRIFTSTELLER
Eine junge Frau sprach mich mitten im Verkehr auf der Straße an.
„Sind Sie der Schriftsteller?“
„Manchmal.“
„Kann ich Ihnen eine Frage stellen?“
„Nur zu.“
„Ist das Ihre Geschichte?“
„Was meinen Sie?“
„Ich habe Sie neulich im Fernsehen gesehen und frage mich, ob Sie das wirklich alles erlebt haben.“
„Teils, teils.“
Sie schien weder überrascht noch verblüfft zu sein. Sie wollte einfach eine Erklärung.
„Ist das alles?“
„Ich weiß nicht, was ich sagen soll … Keiner kann eine Geschichte genau so erzählen, wie sie sich zugetragen hat. Man probiert herum. Man versucht, die Empfindung des Moments wiederzufinden. Am Ende wird man nostalgisch. Und wenn es etwas gibt, was fern jeder Wahrheit liegt, ist es die Nostalgie.“
„Dann ist es also nicht Ihre Geschichte.“
„Ich möchte Ihnen auch eine Frage stellen.“
„Wieso mir!“, wehrte sie errötend ab, „Ich habe doch kein Buch geschrieben.“
„Ja, aber Sie lesen.“
„Stimmt, ich lese gern.“
„Warum ist es Ihnen so wichtig zu wissen, ob die Geschichte so passiert ist?“
Kurze Pause.
„Ich möchte wissen, ob der Autor das alles echt erlebt hat.“
„Ja … aber warum?“
„Ich weiß nicht …“, sagte sie mit ihrem empfindsamen Lächeln.
„… man fühlt sich ihm dann näher.“
„Und wenn er Sie anlügt?“
„Wieso?“
„Wenn er behauptet, er hätte das erlebt und es ist nicht wahr?“
„Dann bin ich enttäuscht …“ (sie lachte etwas geniert.) „Man wird die Wahrheit wohl nie erfahren.“
„Warum also?“
„Nur so eine Idee.“ Und lachend: „Wollen Sie etwas verbergen?“
„Vielleicht, aber ich weiß nicht, was …“
Sie lächelte wieder.
Ich fragte sie völlig unvermittelt: „Wie lesen Sie?“
„Überall.“
„In der U-Bahn?“
„Auch in der U-Bahn.“
Nichts ist für mich faszinierender als ein junges Mädchen, das in der U-Bahn liest. Ich weiß nicht warum, aber Tolstoi ist in der U-Bahn mit Abstand der Sieger, mit Anna Karenina, natürlich.
„Es gibt Leute, die überall lesen, aber nicht irgendwas“, sagte ich, um irgendwas zu sagen.
„Ich lese alles mögliche.“
„Dann sind Sie die perfekte Leserin.“
Ein Wagen fuhr dicht an uns vorbei. Sie sprang zur Seite.
„Ich bin sicher, Sie lesen die Bücher nicht zu Ende.“
„Entschuldigen Sie, das habe ich nicht richtig verstanden“, sagte sie, während sie sich mit Mühe wieder fing.
„Wenn Sie ein Buch beginnen, lesen Sie es bis ans Ende?“
„Immer.“
Sie war wieder da.
„Irgendwo stimmt was nicht“, behauptete ich mit einem Lächeln.
Sie lachte leise.
„Vielleicht, dass ich mir nichts merke.“
„Was heißt das, nichts.“
„Ich meine, weder den Namen des Autors …“
Es gab mir einen kleinen Stich ins Herz.
„… noch den Titel“ fügte sie hinzu.
„Eigentlich ist das nicht schlimm, denn wichtig ist nur das Buch.“ Ein leiser Seufzer.
„Ich kann mir auch nicht merken, worum es geht … Manchmal kommt es mir vor, als hätte ich noch nie ein Buch gelesen.“
„Das ist unglaublich … Sie lesen etwas und im nächsten Augenblick haben Sie es vergessen?“
„Genau.“
Ein längeres Schweigen.
„Warum lesen Sie überhaupt?“
„Zum Zeitvertreib.“
„Ach so … Macht es Ihnen etwas aus, dass Sie alles vergessen?“
„Oh ja!“
Jetzt wurde ihr offenbar peinlich bewusst, dass ich ihr eine sehr persönliche Frage gestellt hatte.
„Doch in Ihrem Alltag stört Sie dieses Handicap nicht?“
„Nein, denn es geht mir nur mit den Büchern so. Sie meinen, mir fehlt etwas? Bestimmt nicht, ich arbeite in einem Büro ganz in der Nähe und ich schwöre Ihnen, da brauche ich ein gutes Gedächtnis … Ich bin Anwaltsgehilfin.“
„Wie kommt es, dass Sie mich einfach auf der Straße angesprochen haben? Ich merke doch, dass Sie eigentlich schüchtern sind …“
Sie schenkte mir ihr schönes kehliges Lachen.
„Ja, ich bin schüchtern. Ich weiß nicht. Vielleicht weil ich Sie schon im Fernsehen gesehen habe.“
„Vielleicht haben Sie auch schon eines meiner Bücher gelesen.“
„Nein, das glaube ich nicht.“
Kurze Pause.
„Oder doch … Vielleicht habe ich eines Ihrer Bücher gelesen.“
„Sie geben einem wirklich keinen Anlass, stolz zu sein.“
Wieder dieses kleine schüchterne Lachen.
„Entschuldigen Sie …“
„Ich möchte Sie gerne etwas fragen …“
„Ja“, hauchte sie und legt den Kopf zur Seite.
„Sind Sie verliebt?“
Diesmal war ihr Lachen heiser:
„Sie sind aber neugierig … Es ist wahr, Sie sind ein echter Schriftsteller.“
„Ein Schwarzer Schriftsteller“, ergänzte ich lachend.
„Was heißt das? Ist es besser?“
„Leider nicht.“
„Das heißt?“
„Es ist nicht besser.“
„Ach so.“
„Ja.“
„Schade.“
„Es hat auch Vorteile …“
„Nämlich?“
„Wir sind weniger … Es fällt leichter, der größte lebende Schwarze zu werden.“
„Und dann?“, fragte sie mit einem verschmitzten Lächeln.
„Dann stirbt man.“
Mein Blick war kurz von einem Mädchen abgelenkt, das auf der anderen Straßenseite entlangging. Sie hatte einen wirklich kurzen grünen Rock (ein Taschentuch) und Beine, die wohl noch etwas teurer waren als eine Brosche bei Tiffany’s. Als ich mich wieder umwandte, um das Gespräch fortzusetzen, war meine Gesprächspartnerin weg. Woher kam sie? Wohin ging sie? Was wollte sie? Das sind Fragen, die man in Nordamerika nicht stellt.
IN DER BADEWANNE
Damals wohnte ich in der Rue Saint-Hubert, hinter dem Busbahnhof von Montréal. Die Autobusse starteten pausenlos zu Zielorten (Shawinigan, Rimouski, Gaspé), die für mich damals exotisch klangen. Von meinem Fenster beobachtete ich noch mit einem Gefühl der Überlegenheit (da waren Passagierdampfer was anderes), wie sie losfuhren. Ich wohnte allein, in einem Zimmer im dritten Stock. Eine kleine Küche, ein aufgeplatzter Sessel, ein Sofa und überall Bücher. Dazu meine Remington 22. Es war nicht schwierig, an der Ecke frisches Gemüse zu kaufen und bei dem winzigen Dépanneur gleich nebenan fand ich billigen Wein bis in die Nacht. Wenn ich mich einsam fühlte, brauchte ich nur die U-Bahn zu nehmen und konnte mit einer Fahrkarte mir den ganzen Tag meinen Weg durch diesen Dschungel aus Leibern, Hintern und Sprachen bahnen und vor allem den fremden Geruch dieser Menschen schnuppern. Die meisten Leute fahren im Sommer lieber mit dem Bus. Ich steige gern in die Erde hinab, auf der Suche nach dem Minotaurus. In der U-Bahn auf die Jagd zu gehen, ist wie Angeln in einem Aquarium. Du musst nur hineinlangen und den schönen prallen rosa Fisch herausholen. Man kann es sich leisten, wählerisch zu sein. An diesem Fisch ist mir nicht genug Fleisch, ich glaube, ich lasse ihn weiterschwimmen. Einfach so. Aus Lust und Laune. Es gibt ja noch andere. In der U-Bahn herrscht kein Mangel an Mädchen. Sie fahren weg, sie kommen an. Und das alles nur drei Minuten zu Fuß von meiner Bude entfernt. Geil! Es kommt manchmal vor, dass ich ein Mädchen mit zu mir nehme, ohne sie überhaupt nach dem Namen gefragt zu haben. Umgekehrt gilt das wohl auch. Ihr ist mein Name ebenfalls völlig egal. Heute höre ich häufig, die Männer dächten nur an den Akt, während die Frauen mehr auf Zärtlichkeit Wert legten. Bullshit! Ich glaube, es sind stets dieselben Gefühle (Zärtlichkeit und sexuelles Verlangen), die alle empfinden, nur gehen manche Menschen mehr aus sich heraus. Ich kenne sehr starke lautlose Orgasmen. Ich sehe ganz genau die junge Chinesin mir gegenüber an, wie sie ein Buch liest, mit ihren feingliedrigen Fingern. Welches? Ich lehne mich nach vorn. Hemingway. Der berühmte kubanische Schwertfischangler, Ernest, der Rohling. Was sucht er denn in der U-Bahn von Montréal? Noch als Toter richtet er bei den stillen jungen Mädchen Verheerungen an. Seltsam, wie sehr die schüchternsten Frauen sich von Ungeheuern angezogen fühlen. Aber heute Morgen möchte ich es nicht mit Papa aufnehmen. Meine Stimmung ist eher beschaulich. Sie liest also Paris ist ein Fest auf Französisch, das kleine hübsche Büchlein, das Hemingway seiner Lieblingsstadt und Hardley widmete, einer Frau, die er noch als junger linkischer Provinzler aus Illinois kennengelernt hatte. Ich betrachte die sorgenvolle Stirn und den winzigen Mund des jungen Mädchens, der sich bewegt, ohne dass ich einen Laut höre. Stilles Lesen. Ein ganzes Netz von Sprachen. Zuerst Chinesisch (woher ich weiß, dass sie Chinesin ist? Sie ist an der Station Place d’Armes eingestiegen, die mitten im Chinesischen Viertel liegt), dann Englisch (die Sprache Hemingways), schließlich das Französische (der Übersetzung). Gehen wir davon aus, dass mein Blick kreolisch ist (meine Muttersprache). Alles spielt sich ab, während die U-Bahn blind ihre Fahrt durch den Tunnel fortsetzt. Irgendwann, an der Station Bonaventure, ist ein Mann mit einer Kamera eingestiegen und hat die Leute zum Sommer befragt. Was sie an dieser Jahreszeit mögen. Mit ihrer Mimik hat die junge Chinesin so getan, als könne sie kein Französisch, um nicht antworten zu müssen. Eine gut gekleidete Dame hat viel von den Nachteilen erzählt, die der Sommer bringt. Diese unerträgliche Hitze, zumal Montréal auch noch so feucht ist. Den anderen Fahrgästen schienen ihre Äußerungen nicht zu gefallen. Ein Mann sagte sogar, die Leute seien nie zufrieden: Den ganzen Winter über riefen sie nach dem Sommer, und sei er endlich da, kritisierten sie ihn. Der Mann mit der Kamera wollte mir die Frage lieber nicht stellen, aber ich habe trotzdem ein wenig darüber nachgedacht. Ich bleibe im Sommer am liebsten in der Stadt. Und da alle genau dann wegfahren aufs Land, teile ich Montréal mit der glitzernden Schar der Liebhaber des Jazz, des Feierns und des Kinos. Die Leute reisen aus ganz Amerika hierher. Eine anregende Truppe. Wenn ich sie sehe, habe ich Ameisen im Hirn. Echt aufregend. Eine neue Energie. Mädchen in kurzen Röcken mit einem Programm des Jazzfestivals in der Hand, das ist vielversprechend. Ich setze mich gern auf die Bank am Eingang des Pariser Kinos, um mir die erleuchteten Gesichter der Leute anzusehen, die aus den verdunkelten Sälen kommen. Ich flaniere auch gerne über die Rue Saint-Denis, wo die Jazzliebhaber herumstehen mit ihrem sehr speziellen Aussehen. So viel ist klar, ich schaue lieber, als tätig zu werden. Am besten wäre es, ich könnte all das erleben, ohne meine Bude zu verlassen … Diesen Sommer habe ich keine Lust, aus meiner Badewanne zu steigen. Aber sich nicht zu rühren, ist kostspielig. Ich habe wahrscheinlich nicht genügend Geld, um mir diesen Luxus zu leisten. Kaum beginnt der Sommer, stürzen die Leute in die Läden, um sich irgendein Buch zu kaufen, Hauptsache es hat mindesten 600 Seiten, der Autor ist Amerikaner oder die Farben auf dem Titelbild passen einigermaßen zu ihrem Badeanzug. Und ach! Fast hätt’ ich’s vergessen, der Titel muss möglichst blödsinnig sein. Anschließend rennen sie ins Reisebüro, um schleunigst den Mexikanern auf den Keks zu gehen. Jeden Sommer ertappe ich mich bei dem Traum, sie mögen nie mehr zurückkehren. Was für ein Träumer ich bin, sie kommen jedes Mal zurück und haben Handtuch, Buch und Hund am Strand vergessen.
Als ich heute Abend nach Hause kam, fand ich in meinem Briefkasten wie immer Rechnungen, die ich sofort zerriss (ich weiß, viele Hausfrauen würden das auch gerne tun, ich kann es mir leisten, weil ich nichts besitze, was der Gerichtsvollzieher bekleben könnte: nur ein paar Bücher und eine alte Schreibmaschine, trotz meines erfolgreichen Romanerstlings. In den Augen der anderen sehr erfolgreich, privat weiterhin arm). Doch was sehe ich ganz unten im Kasten? Einen kleinen gelben Umschlag. Ich öffnete ihn so gierig, dass ich fast den Scheck zerrissen hätte (ein saftiger Vorschuss für die Reportage über Nordamerika, schon klar, hauptsächlich über die Vereinigten Staaten, denn daher kommt mein Geld. Wie beim Kino, wo das Filmland von der Herkunft des Geldes abhängt. So vermeidet man die lächerlichen Identitätsdebatten, die den Professoren für Postkoloniale Literatur so viel bedeuten). Dieses Geld ist für die Reisekosten vorgesehen: die Flugtickets, die Zugfahrkarten, die Busfahrkarten, die Mahlzeiten, Hotels et cetera. Diese Typen sind wirklich schnell. Bei mir ist es das Gegenteil. Ich bin sehr langsam. Ich werde mich einen guten Monat ausruhen müssen, bevor ich meine Erforschung Amerikas unternehme. Am besten fange ich damit an, diesen Scheck auf den Kopf zu hauen. Nachdem ich die Miete für den gesamten Sommer auf die Seite gelegt hatte (obwohl man nicht da ist, muss man die Miete, das Telefon, den Strom et cetera bezahlen), ging ich und kaufte mir das Gesamtwerk von Walt Whitman, dazu alle Romane von Dostojewski aus dem Verlag La Boëtie, eine Reiseerzählung von Naipaul und einen wunderschönen Brieföffner. Da Heißwasser mich nichts kostet, verbringe ich den ganzen Tag in der Badewanne. Nur nachts gehe ich vor die Tür. Ich lege mich in die randvolle Badewanne, nachdem ich auf einen Stuhl in Reichweite die Bücher und dazu ein Frottiertuch gelegt habe, um die Hände abzutrocknen. Dieses Abenteuer unternehme ich zum allerersten Mal. Einen ganzen Monat einen einzigen Autor zu lesen (Whitman spare ich mir für die Reise auf). Ich glaubte, so ein snobistisches Verhalten legten nur Proustleser an den Tag. In dieser Badewanne, die ich nur verließ, um mir mittags einen Obstsalat und abends Spaghetti mit Tomatensoße zuzubereiten, habe ich dann die aufregendste Reise meines Lebens unternommen. Zum einen durch das riesige zumeist vereiste Russland, zum anderen durch eine noch mysteriösere Gegend, das Herz von Dostojewski. Mehr brauche ich nicht zum Glücklichsein.
Dann kommt immer der Moment der Entscheidung, wenn meine Nachbarin, und zwar die, die jeden Sommer fast nackt auf ihrem Balkon sonnenbadet, bei mir klopft, damit ich ihr helfe, eine Flasche Rotwein zu öffnen (Wein ist für mich nur der rote). Ich komme ins Schwimmen. Ich bin schon derart beschäftigt mit der schrecklichen Gruschenka, wegen der sich die beiden Brüder Karamasov in Verlangen und Eifersucht verzehren werden. Mörderischer Liebeswahn. Aber diesmal hat sie einen anderen Vorwand, sie will von mir eine Zitrone. Sogleich und vor meinen Augen nimmt Sonia, so heißt die Nachbarin, die Züge von Gruschenka an. Ist dieser Schriftsteller so stark? Warum waren mir bisher die hohen Wangenknochen, die vollen Lippen und die Augen einer Tartarenprinzessin bei meiner Nachbarin nie aufgefallen? Dass sie immer so viel trinkt, bis sie am Boden liegt. Ihr strahlendes Lächeln, das mit finsteren Blicken wechselt. Ich sehe wieder, wie sie mir an manchen Tagen mit verschlossener, wütender, finsterer Miene begegnet. Die schwarze Flagge der Depression. Wenn ich die Treppe heraufkam, hatte ich häufig ein lautes Gebrüll aus ihrer Wohnung gehört und das immer auf die Einsamkeit der Ehefrauen zurückgeführt, wenn der Mann auf den Baustellen von Saint James-Bay arbeitet. Die Traurigkeit der Verlassenen. Ich fülle heißes Wasser nach (gerade heiß genug, dass es mir angenehm ist) und tauche wieder in das dostojewskische Universum. Dieser Fjodor Michailowitsch ist ein echter Teufel! Nach drei Abschnitten hat er mich wieder am Haken.
Da kommt die schreckliche Sonia schon wieder. Ich höre auf der Treppe ihre entschiedenen Schritte. Sie hat sich umgezogen und trägt jetzt ein leichtes gelbes Kleid, aber keine Schuhe, und eine Fußkette (eine Schlange) an einer der Fesseln. Sie bringt Austern, Zitrone, Salz, zwei Flaschen Wein und zwei Gläser. Ich schließe die Augen und sie setzt sich voll angezogen zu mir in die Wanne.
„Ich komme, um mit dir den Sommer zu feiern“, sagt sie nur.
AMERIKA, WIR KOMMEN!
Damals versuchte ich (keine Ahnung, wie dieser Ehrgeiz von mir Besitz ergreifen konnte) einen Roman zu schreiben und in Amerika zu überleben. Eines davon war zu viel. Du musst dich entscheiden, Alter. Doch ich wollte alles. Der beste Weg in den Untergang. Ich wollte den Roman, die Mädchen (die es seit der Moderne und der Erfindung der Schlankheitsdiäten gibt und auf die Männer reiferen Alters so scharf sind), den Alkohol und den Spaß. Alles, was mir zustand. Alles, was Amerika mir versprochen hatte. Ich weiß, Amerika hat einer Masse von Leuten sehr viel versprochen, aber mir sollte es alles einlösen. Ich war zornig, denn ich will mich nicht an der Nase herumführen lassen. Damals, Anfang der Achtzigerjahre (so lang ist das schon her!) wimmelten die Bars jeder nordamerikanischen Stadt von alten Hippies ohne Plan, schon ohne Plan, bevor sie Hippies wurden, von Afrikanern mit leerem Blick und immer einer Trommel am Ärmel – sie werden sich nie ändern, unabhängig von Ort und Zeit –, die Bars wimmelten von identitätssuchenden Antillanern, hungernden Dichterinnen, die sich von Luzernesamen und indischen Mythen ernährten, von hochaggressiven jungen Schwarzen Frauen, weil sie bei diesem verrückten Poker keine Chance hatten, denn die Schwarzen Männer interessierten sich nur für die Weißen Frauen und die Weißen Männer nur für Geld und Macht. Ich irrte spätnachts durch diese Mondlandschaft, wo die körperliche Begierde vollends jedes Gefühl ersetzt hat. Ich notierte alles. Ich schrieb in den Toiletten dieser schäbigen Bars. Ich führte bis in die frühen Morgenstunden Gespräche mit am Hungertuch nagenden Intellektuellen, arbeitslosen Schauspielerinnen, machtlosen Philosophen, schwindsüchtigen Dichterinnen, kurz, mit dem ganzen Gesocks der Underdogs. Zuweilen sprang ich auch ins kalte Wasser und wachte dann in einem unbekannten Bett neben einem Mädchen auf, das ich meiner Erinnerung nach nie getroffen hatte (gestern bin ich mit einem gelbhaarigen Feger nachhause gegangen und jetzt ist da diese gefärbte Blondine mit grünen Fingernägeln). Dabei nahm ich niemals Drogen. Gott hatte mir eine schallende, wohltönende, fröhliche und dazu ansteckende Lache geschenkt, ein Kinderlachen, das die Mädchen kirre machte. Sie wollten so gerne lachen und hatten damals so selten Gelegenheit dazu. Als ich nach Nordamerika auswanderte, hatte ich nichts in meinem alten Blechkoffer als diese Lache. Ein uraltes Erbstück. Bei mir zuhause wurde immer gelacht. Unser Haus bebte vom Lachen meines Großvaters. Nun lachte ich, trank Wein, vögelte mit der Wonne eines Kindes, das aus Versehen in einen Süßwarenladen eingesperrt wurde, und schrieb alles auf. Sobald das Mädchen auf die Toilette ging, kritzelte ich meine Notizen, auf der Bettkante, auf einer Ecke des Tischs, überall. Ich notierte mir einen Spruch, eine sinnliche Geste, ein schmerzliches Lächeln, irgendeine Einzelheit. Alles erregte mich. Ich notierte alles, was sich bewegte, und das hörte nie auf, glaube mir. Alles um mich herum, die Welt (das Mädchen, das Kleid auf dem Boden, mein zwischen dem Bettzeug versteckter Slip, der lange nackte Rücken auf dem Weg zur Stereoanlage, die Musik von Bob Marley), ich will sagen, mein Universum drehte sich in rasanter Geschwindigkeit. Warum sollte ich die fliehende Zeit, die wechselnden Mädchen, das immer wieder neue Begehren mit Worten festhalten? Ich stellte mir oft, den Kopf gegen die alte Remington 22 gepresst, diese quälenden Fragen. Bin ich der Griot dieses schäbigen Amerika, immer am Rande einer Überdosis, mit dem Gesicht an der Wand, in Handschellen und dazu zwei Polizisten im steifen Nacken? Dieses Amerika, das beim Leben noch einen Rabatt herausschlägt, das immer sein Geld zählt, das Amerika der Einwanderer, der Schwarzen, der völlig plan- und mittellosen Weißen Frauen? Das Amerika der leeren Blicke und des fahlen Morgengrauens? Am Ende schrieb ich den verfluchten Roman und Amerika war gezwungen, was mich betraf, wenigstens einen Teil seiner Versprechungen zu halten. Ich weiß, einigen gibt Amerika im Überfluss, wohingegen den übrigen auch noch das letzte Stückchen Schwarzbrot aus der verkrampften Faust gerissen wird, mir wurde immerhin ein Drittel der Schulden zurückgezahlt. Viele werden diese Naivität belächeln, aber ich schwöre, für meine Gemütsverfassung ist es sehr wichtig, an diesen Sieg zu glauben und sei er noch so klein. Ein Drittelsieg. So vielen anderen bleibt Amerika alles schuldig. Beispielsweise bei der Jugend aus der Dritten Welt hat Amerika eine immense Rechnung offen. Hier ist nicht die Rede von den historischen Schulden (die Sklaverei, die Plünderung der Humanressourcen, die Verschuldung der armen Länder et cetera), sondern von den sexuellen Schulden. Was uns die Zeitschriften, Plakate, Film und Fernsehen nicht alles versprochen haben … Amerika, das sind reiche Jagdgründe, hämmerten sie uns ein, kommt und jagt die verlockendste Beute (die jungen Amerikanerinnen mit den langen Beinen, rosa Mündern und dem verächtlichen Lächeln), kommt, pflückt die wilden Früchte des Gelobten Landes. Amerika, eine Hündin, deren Fell unter euren Liebkosungen zittert, sie wartet nur auf euch, ihr jungen Männer aus der Dritten Welt. Diese Rufe wurden bis in die hintersten Winkel des Planeten vernommen, bis zu den Blauen Reitern in der Wüste. Das globale Dorf. Amerikanisches Fern sehen mitten in der Sahara. Alle machten sich auf nach Westen. Und jedes Mal mussten sich die Neuankömmlinge anhören: „Tut uns leid, das Fest ist gerade vorbei.“ Ich sah das traurige Lächeln des alten, noch wackeren Beduinen (erinnert euch, Brüder, an die alten Böcke im Alten Testament), der sein Kamel verkauft hatte, um beim Fest dabei zu sein. In der winzigen Bar an der Avenue du Parc traf ich sie alle. Bis zum Beginn der nächsten Fiesta, das sagte der Arbeitsvermittler unerschütterlich, müssen Sie arbeiten. In Amerika gibt es Arbeit für alle (noch so ein Lockmittel, Bruder). Schön reingefallen. Arbeit? Dafür war der Beduine nicht hergekommen. Er war durch die Wüste gewandert und über das Meer gereist, weil man ihm gesagt hatte, in Amerika sei Vögeln gratis und reichlich. Da haben Sie was falsch verstanden! Was denn? In allen Liedern, Romanen, amerikanischen Filmen der Fünfzigerjahre geht es nur um Sex und Sie behaupten, wir hätten was falsch verstanden? Was war an dieser reißerischen Sexualität, an dieser Masse nackter Leiber denn misszuverstehen, an diesem Beharren auf dem Intimsten, an dieser Hitze von Hollywood? Auch bei uns in der Wüste haben wir modernste Fernsehgeräte … Wir empfangen Amerika. Glückwunsch zur Qualität der Bilder! Auch in der Sahara ohne Störung. Abends setzen wir uns in unser von der Mattscheibe erleuchtetes Zelt und schauen euch zu. Zuzusehen, was ihr so treibt, bereitet uns Freude. Immer ist da ein lachendes junges Mädchen an einem Strand. Gleich darauf überfällt es ein blonder Kerl. Das Mädchen entwindet sich, er verfolgt sie ins Wasser. Sie wehrt sich. Er umarmt sie leidenschaftlich und sie gehen senkrecht unter. Jeden Abend dasselbe Menü, mit leichten Verbesserungen. Das Meer ist noch blauer, das Mädchen noch blonder und der junge Mann noch muskulöser. Es wird ein Leben dargestellt, das uns leichter vorkommt. Das ist es: ein leichtes Leben. All diese Brüste, diese Hintern, diese Zähne, dieses Lachen wirken sich am Ende auf unsere Libido aus. Leuchtet Ihnen das ein? Deshalb sind wir nach Amerika gekommen und ihr wagt zu behaupten, wir hätten was falsch verstanden? Ich wiederhole die Frage, was sollten wir denn verstehen? Nachdem ihr uns verrückt gemacht habt vor Begierde, seht ihr jetzt vor euch die lange Schlange von Männern (bei uns gehen nur die Männer auf Abenteuer) mit einem Ständer, unersättlichem Appetit, bereit zum Krieg der Geschlechter und der Rassen. Wir gehen bis ans Ende, America.
DER BAUM VON AMERIKA
Ich war nicht mal zum Trinken in die Bar gegangen. Ich wollte nur nachsehen, was aus der Bar du Parc geworden ist, die ich in meiner schwärzesten Zeit regelmäßig aufgesucht hatte, als es mit mir immer weiter nach unten ging und ich dachte, ich würde nie den Grund erreichen. Wenn du untergehst, Alter, schluckst du zwangsläufig einiges an Wasser. Ich hätte den ganzen Fluss austrinken können, keiner hätte mir eine helfende Hand gereicht. Dabei hörte ich ihr Lachen, ihre Spiele, ihre Liebe. Die hellen Stimmen der kleinen Mädchen, die starken Stimmen der Männer und die sinnlichen der Frauen. Der Grund des Flusses ist ein wunderbarer Schallraum. Man hört alles, was oben gesagt wird. Die ganze Musik des Lebens. Den Gesang der Pflanzen, der Luft, des Winds. So geht es selbst den Föten. Sie verlassen die Welt des Wassers für die tödliche der Luft. Ich schlief zwölf bis achtzehn Stunden am Tag und den Rest schaute ich fern. Ich klebte unablösbar vor den Fernsehshows und wusste den Preis jedes beliebigen Putzmittels. Ich kannte den genauen Preis von allem, was Amerika verkaufte. THE PRICE IS RIGHT. Ich schluckte alles. Die wirkungsvollste Propagandamaschine, die Menschen je hervorgebracht haben. Dieses Amerika schrie unaufhörlich heraus, das Leben sei ein Fest und die Bäume dieses Gelobten Landes beugten sich unter wilden, schweren, köstlichen Früchten. Leider trägt der Baum auch bittere Früchte. Um erstere zu pflücken, muss man die Leiter der jüdischchristlichen Gesellschaft erklimmen, hingegen sind die bitteren Früchte für jeden in Reichweite.
EIN ZIMMER IN DER STADT
Ich schrieb gerade am offenen Fenster über dem Lärm der Straße, als Sonia ohne anzuklopfen hereinkam.
„Was machst du?“
„Ich beginne mit der Reportage.“
„Was? Ich dachte, für eine Reportage recherchiert man vor Ort?“
„Die Reise hat schon begonnen.“
„Du schreibst also über Dinge, die du nicht gesehen hast.“
„Aber ich schaue mir seit über zwanzig Jahren Amerika an. Meinst du, ein oder zwei Monate einer Touristenreise würden an dem Bild etwas ändern?“
„Ich finde es trotzdem komisch, was ist das für ein Reporter, der seine Bude nicht verlässt?“
„Das kommt häufiger vor als du denkst … Außerdem bin ich kein Reporter. Ich bin Schriftsteller. Sie verlangen nicht von mir, die Wahrheit zu schreiben. Sie wollen viel mehr. Eine Fotografie der amerikanischen Sensibilität. Was ich besichtigen könnte, ist viel weniger wichtig, als was ich empfinde.“
Sie bewegte sich lautlos durch das Zimmer. Ich spüre gern eine Frau in der Nähe, wenn ich schreibe. Schreiben und Begehren. Es dauerte eine Weile, bis ich merkte, dass sie tanzte. Ihre Füße glitten über den Holzboden. Ich beobachtete sie aus dem linken Augenwinkel. Ihre Bewegungen erschienen natürlich, aber hinter dieser Leichtigkeit spürte man eine ständige Anstrengung und stahlharte, wenn auch geschmeidige Muskeln. Der Tanz ist eine seltsame Kunst, die direkt dem Traum zu entspringen scheint. In meinen Träumen tanze ich häufig. Ich habe noch nie verstanden, warum der Tanz unbedingt mit Musik verbunden sein muss. Daher kommt der falsche Eindruck einer parasitären Kunst. Man hört schließlich Musik, ohne zu tanzen, warum soll man nicht tanzen ohne Musik? Manche Gepflogenheiten sind nur schlechte Angewohnheiten. Sie stellte sich leicht schwitzend hinter mich.
„Ich verstehe … Diese Leute haben dich schon bezahlt, deshalb brauchst du dir nicht mehr den Arsch aufzureißen …“
„Das war nur ein Vorschuss, für die Reisekosten. Den Rest bekomme ich bei Abgabe.“
„Langsam lerne ich dich kennen …“, bemerkte sie mit einem kurzen ironischen Lachen. „Hauptsache du kannst deine Miete bezahlen und hast Zeit zum Lesen …“
„Was kann sich ein Mann noch wünschen?“
Ihre Tartarenaugen verengen sich. Sie lässt sich in den Sessel fallen. Während sie mich ansieht, streift sie ganz nebenbei ihr Kleid hoch, so dass ich den Ansatz ihrer Schenkel sehe. Als ob plötzlich eine lange Nadel in meinen Nacken gestochen würde. Ich versichere Ihnen, das tut weh.
„Schau mal“, ruft sie wie ein kleines Mädchen.
Der rote Kreis der Abendsonne taucht das Zimmer in heißes Licht. Fast wie auf einer Kinderzeichnung. Ich habe plötzlich Lust auf ein gut gekühltes Bier. Sie läuft tänzelnd los und holt mir ein Carlsberg aus dem Kühlschrank. Sie tanzt ihr Leben.
„Was fängst du nur mit deiner Zeit an?“, fragt sie mich kopfschüttelnd, als wüsste sie schon, dass ihr die Antwort nicht gefiel.
„Viel zu viel“, antworte ich und trinke einen großen Schluck von dem kalten Bier. Langsam bekomme ich wieder Luft.
„Was zum Beispiel?“, hakte sie nach.
„Erstens lese ich …“
„Ja, immer Dostojewski …“
„Nein, heute morgen habe ich Walt Whitman angefangen.“
„Wirklich mal was anderes!“, spöttelte sie.
„Ich finde es ungerecht, Whitman hat schon alles Wichtige geschrieben, es ist ungerecht, wenn ich in der Zeit von ein oder zwei Monaten eine bestimmte Energie aufnehmen will, während Whitman sein ganzes Leben dafür eingesetzt hat. Das wird ein schrecklicher Kampf zwischen Walt Whitman und mir. Bin ich stark genug, um in einem Monat den Lebensodem dieser Naturgewalt zu empfangen, die Walt Whitman aus Manhattan besaß? Vorhin habe ich ihn ganz ruhig gelesen, da spürte ich ihn plötzlich direkt in meinem Plexus. Er ist mit solcher Wucht in mich eingefahren, dass ich aufgeschrien habe. Hör dir das an:
Walt Whitman, ein Kosmos, von Manhattan der Sohn,
Ungestüm, fleischlich, sinnlich essend, trinkend und zeugend,