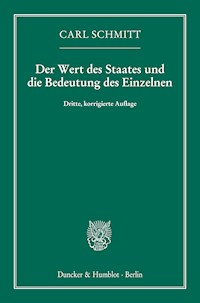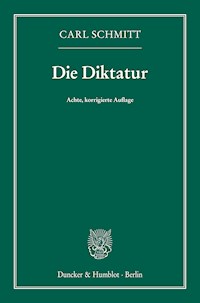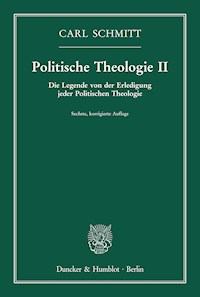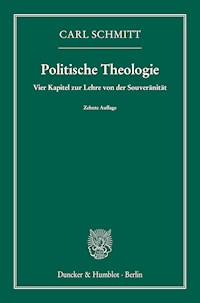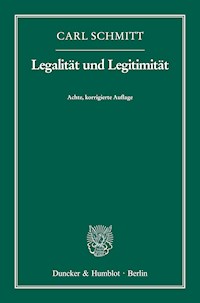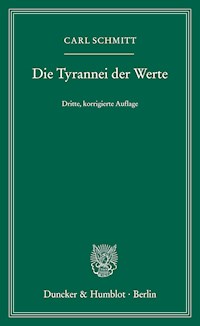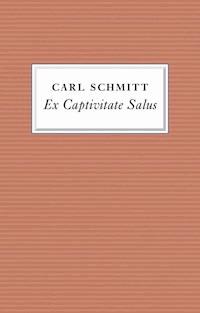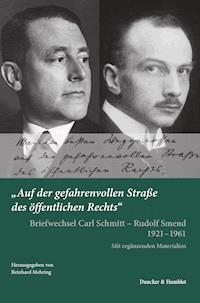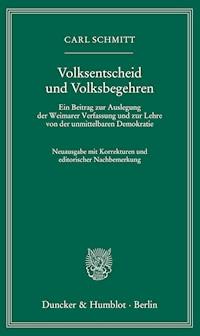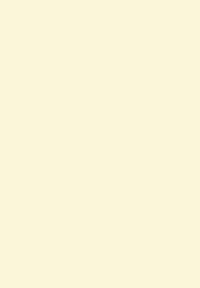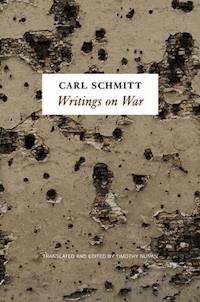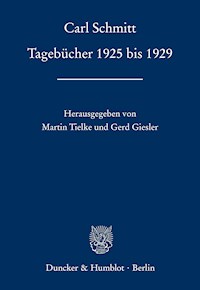
69,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Duncker & Humblot
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In der Reihe der Tagebücher Carl Schmitts, die den Zeitraum von 1912 bis 1934 umfassen, schließt der vorliegende Band nun die Lücke von 1925 bis 1929. Er beschreibt die letzten Jahre Schmitts in Bonn und den Beginn seiner Lehrtätigkeit an der Handelshochschule Berlin. Dieser Übergang markiert eine deutliche Hinwendung des Theoretikers zur politischen Praxis des Regierens und stellt zugleich den Höhepunkt seines wissenschaftlichen Schaffens dar: In dieser Zeit entstehen seine zwei Hauptwerke »Der Begriff des Politischen« und die »Verfassungslehre«. Das Tagebuch wird durch die Fülle der beschriebenen Begegnungen Schmitts mit einflussreichen Persönlichkeiten jener Zeit zu einer wertvollen zeitgeschichtlichen Quelle. Carl Schmitts Tagebücher sind ein ohne jeden Vorbehalt geschriebenes Diarium, das sich durch einen abbreviatorischen Charakter und eine gewisse stilistische Sorglosigkeit auszeichnet. Die nahezu unleserliche Schrift, in der es verfasst ist, deutet darauf hin, dass es der Autor ausschließlich für sich selbst geführt hat, als ein Mittel der Selbstvergewisserung. Die verführerische Klarheit des elaborierten theoretischen Werkes ist die notwendige Kehrseite des schnell und flüchtig Hingeworfenen im Tagebuch. Leben und Werk gehören bei Schmitt gerade in ihrer Gegensätzlichkeit eng zusammen. Wie das vorhergehende und das nachfolgende Tagebuch besteht auch dieses aus dem eigentlichen Diarium und zwei Paralleltagebüchern, die den Gedankenstrom des Autors festhalten. Das Buch ist umfassend annotiert; zu zentralen Personen und Themen bietet es zudem einen Text- und Bildanhang.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Carl Schmitt Tagebücher 1925 bis 1929
Carl Schmitt Tagebücher 1925 bis 1929
Herausgegeben von Martin Tielke und Gerd Giesler
Duncker & Humblot · Berlin
Gedruckt mit Unterstützung der Gerda Henkel Stiftung, Düsseldorf
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten © 2018 Duncker & Humblot GmbH, Berlin Fremddatenübernahme: L101 Mediengestaltung, Fürstenwalde Druck: Druckteam, Berlin Printed in Germany
ISBN 978-3-428-15296-4 (Print) ISBN 978-3-428-55296-2 (E-Book) ISBN 978-3-428-85296-3 (Print & E-Book)
Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706 ♾
Internet: http://www.duncker-humblot.de
Editorisches Vorwort
Mit vorliegender Veröffentlichung ist die Reihe der frühen Tagebücher Carl Schmitts von 1912 bis 1934 geschlossen; zur Geschichte des gesamten Unternehmens s. S. XXXV ff. Die autographe Vorlage des hier gedruckten Textes liegt im Nachlass Schmitts im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung Rheinland in Duisburg unter den Signaturen RW 0265 Nr. 19585, 19598, 20498, 21673 und 21638. Die beiden Paralleltagebücher findet sich unter RW 0265 Nr. 19604 und 19606. Wie die anderen Tagebücher ist auch dieses in Gabelsberger Stenographie geschrieben, die von dem 2013 verstorbenen Hans Gebhardt noch in Klarschrift übertragen worden ist. Kleine Stellen, die Gebhardt ausließ, haben Andreas Kloner und Philipp Gahn übertragen. Das Tagebuch ist mit schwarzer Tinte geschrieben, gelegentlich finden sich Einträge mit Bleistift, die wahrscheinlich aus späterer Zeit stammen. Insgesamt ist die Quelle gut erhalten, sie hat allerdings zwischen dem 20. Oktober 1928 und dem 16. April 1929 kleinere, durch Einrisse bedingte Textlücken.
Schmitt führte sein Journal als Chronik des gewesenen Tages, in der im Telegrammstil und in Kurzschrift dessen Ablauf knapp festgehalten ist. Die Folge der täglichen Einträge ist nicht lückenlos durchgehalten. Das Tagebuch des Jahres 1924 endet am 8. Dezember. Ab Ostern 1925 gibt es vereinzelte knappe Notizen, und erst mit dem 14. August 1925 beginnen die regelmäßigen Tageseinträge, die, mit Unterbrechungen während der Verlobungsreise nach „Illyrien“ vom 19. August bis zum 25. September sowie einer dreiwöchigen Pause im Oktober, bis zum 9. März 1926 fortgeführt sind. Darauf folgt erneut eine längere Pause bis zum 27. Juli, ab wann die Einträge bis zum 6. Dezember im täglichen Rhythmus weitergehen. Am 21. Januar 1927 wird die tägliche Eintragung wieder aufgenommen, um bis zum 11. April 1928 lückenlos beibehalten zu werden. Dann bricht das Tagebuch erneut ab, um erst am 16. Oktober wieder einzusetzen. Bis zum 4. August 1929 ist jetzt die Tagesfolge durchgehalten. Der Rest des Jahres 1929 ist nicht protokolliert.
Schmitts oft nur sehr flüchtig, zuweilen mit blassem Bleistift hingeworfene Schrift ist auch für den erfahrenen Spezialisten nicht immer lesbar, was besonders für Seiten aus den Paralleltagebüchern gilt. Diese Stellen sind mit drei Punkten in spitzen Winkelklammern markiert. Wenn es mehr als ein Wort ist, ist das in eckigen Klammern vermerkt. Unsichere Lesungen sind ebenfalls mit spitzen Klammern deutlich gemacht.
Die im Tagebuch erwähnten Briefe sind nach Möglichkeit nachgewiesen. Der Nachlass Carl Schmitts enthält fast 20 000 Briefe an ihn, eine ungewöhnlich hohe Zahl. Und dennoch: ein großer Teil der Briefe, die Schmitt laut Tagebuch im vorliegenden Zeitraum erhielt, ist in seinem Nachlass – und nicht zu vernachlässigen: ebenso im Nachlass von Piet Tommissen – nicht erhalten.
Carl Schmitt hat sein Tagebuch ausschließlich für sich selbst im Telegrammstil abgefasst. Das bedeutet, dass dem Leser vieles unverständlich bleibt und vom Herausgeber kommentiert werden muss. Dieser Kommentar ist, wie schon in den anderen Tagebuch-Bänden, knapp gehalten, will aber, wo es um Werkzusammenhänge bzw. -genese geht, auf Dinge [VI] hinweisen, die in der Schmitt-Forschung bislang so nicht bekannt waren. Die vielen im Tagebuch genannten Personen und Lokalitäten sind nur bei ihrer erstmaligen Erwähnung annotiert.
Folgende Archive und Bibliotheken wurden dankbar benutzt: Staatsbibliothek Berlin, Universitätsarchiv Bonn, Archiv der Jur. Fak. der Univ. Bonn, Univ.- und Landesbibliothek Bonn, Stadtarchiv Bonn, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin, Landesarchiv Berlin, Archiv der Handelshochschule Berlin im Universitätsarchiv der HU Berlin, Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes Berlin, Dompfarramt St. Hedwig Berlin, Botschaft von Finnland Berlin, Universitätsarchiv Frankfurt a. M., Stadtarchiv Braunschweig, Stadtarchiv Königswinter, Stadtarchiv Mühlheim a. d. Ruhr, Stadt- und Vestisches Archiv Recklinghausen, Archive du Cercle d’Études Jacques et Raïssa Maritain Kolbsheim, Archiv der Benediktinerabtei Maria Laach, Fliedner-Kulturstiftung Kaiserswerth, Museum Burg Altena, Landschaftsbibliothek Aurich.
Von den zahlreichen Personen, die den Herausgebern mit Auskunft zur Seite standen, sind zwei hervorzuheben: zunächst Barbara Nichtweiß, Kennerin und Herausgeberin des Werkes von Erik Peterson. Das vorliegende Tagebuch reflektiert für die Bonner Zeit ein ständiges intensives Gespräch mit Peterson, dessen Inhalt, wenn er denn überhaupt genannt ist, oft nur kryptisch angedeutet wird. Die Entschlüsselung dieser Stellen und die verborgenen Abhängigkeiten Schmitts von Erik Peterson durch entsprechende Nachweise aus dessen Werk zu belegen, wäre ohne Barbara Nichtweiß kaum möglich gewesen. Zweitens muss Carl Erich Kesper besonders genannt sein. Er hat als Leiter der Bibliothek des Juristischen Seminars der Universität Bonn zahlreiche Auskünfte aus den Quellen der Bonner Universität geben können.
Des weiteren sind zu nennen: Gabriele Berthel, Thomas Breitfeld, Hubertus Buchstein, Annett Büttner, Tuuli Elomäki, Katja Engel, Wolfgang Fietkau, Joseph Fischer, Michel Fourcade, Philipp Gahn, Tim Glander, Lydia Hamann-Reintgen, Britta Hemme, Claudia Hilse, Ernst Hüsmert, Lorenz Jäger, Gerhard Keiper, Andreas Kloner, Matthias Kordes, Daniel Laagland, Holger Lüders, Michael Maaser, Florian Meinel, Petrus Nowack, Martin Otto, Giuseppe Perconte Licatese, Angela Reinthal, Jens Roepstorff, Birgit Schaper, Mathias Schmoeckel, Patrick Schnell, Wolfgang Schuller, Wolfgang Hariolf Spindler, Ellen Thümmler, Christian Tilitzki, Auste Wolff, Johannes Ziegler.
Last but not least sei das Nordrhein-westfälische Landesarchiv, Abteilung Rheinland, in Duisburg besonders genannt, das den Nachlass Schmitts hütet. Bei dessen Benutzung standen Matthias Meusch und Emmy Julia Rains den Herausgebern stets mit freundlicher Hilfsbereitschaft zur Verfügung, und Sabine Eibl hat aus den Quellen des Oberlandesgerichts Köln detaillierte Auskünfte zu Schmitts dortiger Tätigkeit gegeben. Für die Genehmigung der Benutzung und Veröffentlichung dieser Tagebücher ist dem Nachlassverwalter Schmitts, Jürgen Becker, zu danken. Für die finanzielle Förderung bei der Transkription aus der Gabelsberger Stenographie danken wir besonders Michele Nicoletti, Università di Trento, und Francesco Ghia für eine erste Manuskriptbearbeitung. Der Verlag Duncker & Humblot, der das Werk Carl Schmitts in vorbildlicher Weise pflegt, hat das auch bei diesem Buch getan; dem Verlagsleiter Florian Simon sowie Heike Frank für die drucktechnische Betreuung sei herzlich gedankt. Schließlich sind Herausgeber und Verlag der Gerda Henkel Stiftung für einen erneut gewährten Druckkostenzuschuss dankbar.
Aurich und Berlin, im Herbst 2017
Martin Tielke und Gerd Giesler
Inhaltsverzeichnis
Editorisches Vorwort
Einführung
Rückblick auf die Editionsarbeit an den fünf Bänden Tagebücher Carl Schmitts aus den Jahren 1912 bis 1934
TAGEBÜCHER 1925 –1929
Tagebuch 1925
Tagebuch 1926
Tagebuch 1927
Tagebuch 1928
Tagebuch 1929
PARALLELTAGEBÜCHER
1. Paralleltagebuch
2. Paralleltagebuch
ANHANG
Briefe, Dokumente und Abbildungen
Quellen und Literatur
Abbildungs- und Quellennachweis
Personenregister
Einführung
Von Martin Tielke
Zu Beginn dieser Aufzeichnungen 1925 ist Carl Schmitt in Bonn fest etabliert und bekleidet eine angesehene Professur. Die rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität war eine der renommiertesten im Deutschen Reich. An ihr Professor zu sein, war fast so ehrenvoll wie eine Professur an der gleichnamigen Berliner Universität. Der Ruf der Bonner Universität zeigt sich daran, dass sie traditionell die Ausbildungsstätte der Kaisersöhne und des Hochadels war, was auch noch in der Republik galt. Prinz Wilhelm von Preußen, der älteste Sohn des deutschen Kronprinzen Wilhelm und Enkel Kaiser Wilhelms II., begann hier 1925 sein Jurastudium, und Schmitt – alles andere als ein Monarchist – erwartete ihn am 25. November aufgeregt, doch vergeblich in seinem Seminar. Das Leben im Rheinland litt nach dem verlorenen Weltkrieg unter der britischen und französischen Besatzung, was sich jedoch in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre normalisierte; vor allem, als die Franzosen sich im Januar 1926 aus der Kölner Zone, zu der Bonn gehörte, zurückzogen. Wie die große Mehrheit begrüßte auch Schmitt das und nahm an der Befreiungsfeier teil. Die Zugehörigkeit des linksrheinischen Gebietes zu Deutschland stand für ihn außer Frage, was er im April 1925 mit seinem Vortrag „Die Rheinlande als Objekt internationaler Politik“ auf der Jahrtausendfeier der rheinischen Zentrumspartei wirkungsvoll unterstrich. Als er am 6. August 1926 mit Erik Peterson in das Café Rittershaus gehen wollte und sah, dass dort die Flagge der separatistischen, Frankreich-freundlichen „Rheinischen Republik“ gehisst war, kehrte er um. Bei allen frankophilen Neigungen, die er in hohem Maße hatte, war ihm nationales Empfinden selbstverständlich. „Kirchheimer mangelt jedes Nationalgefühl, grauenhaft“, notiert Schmitt am 25. Februar 1928 über einen seiner Lieblingsschüler.
Unter den Professoren der Bonner Universität war Carl Schmitt ein Star. Nicht nur Studenten füllten seine Vorlesungen, auch Bonner Bürger kamen regelmäßig, um ihn zu hören. Nach zahlreichen Zeugnissen war Schmitt ein charismatischer Lehrer, der problemlos eine zweistündige Vorlesung frei halten konnte. Ob er ein Manuskript hatte oder nicht, war egal: „5–7 Völkerrecht, es ging ebenfalls ganz gut (obwohl ich mein Manuskript verloren hatte)“ (28.5.29). Ein Lehrer, der sich derart souverän vom Text unabhängig zeigt, zieht die Studenten an. Als Schmitt im Wintersemester 1925/26 mit seiner Vorlesung zum Völkerrecht beginnt, ist der Hörsaal „überfüllt“ (10.11.25). „Ich habe in jedem Semester 5–600 Hörer“, schreibt er stolz an seinen Verleger Feuchtwanger.1 Auch im Wintersemester 1926/27 kann er notieren: „Vorlesung mit ungeheurem Erfolg“ (5.11.26), so dass er in einen größeren Hörsaal wechseln muss; eine Woche später wird die Vorlesung „immer voller“ (11.11.26). Selbst die Übung zum Verwaltungsrecht muss er in einem großen Hörsaal abhalten (4.11.26).
[X] Bei den Vorlesungen, die er zur Fortbildung der Beamten in Koblenz hält, war zwar der Adressatenkreis kleiner, der Andrang aber im Prinzip der gleiche; hier ist am 16. Dezember 1927 von 300 Hörern die Rede. Und auch nachdem er an die Handelshochschule in Berlin gewechselt ist, kann er berichten: „Vorlesung Staatsrecht, überfüllter Hörsaal, das tat mir gut“ (8.11.28).
Die großen Hörerzahlen, die Schmitt hatte, sollten allerdings nicht den Eindruck erwecken, als handele es sich im Bonn der zwanziger Jahre bereits um jene Massenuniversität, wie sie sich in der zweiten Jahrhunderthälfte herausbildete. Die Universität Bonn hatte unter den Folgen des Weltkriegs besonders zu leiden. Die französische Besatzung schreckte die Studenten ab, und so blieben in den ersten Nachkriegsjahren die Studentenzahlen zunächst niedrig. Noch im Wintersemester 1923/24 hatte die Bonner Universität gerade einmal 2 977 Studierende, darunter 336 Frauen.2 Auffällig ist der starke Anteil der Juristen. Im Sommersemester 1926 zählte die Universität 3 921 Studierende, wovon 1 144 (1 103 Männer und 41 Frauen) in der juristischen Fakultät eingeschrieben waren.3 Die Zahlen gingen nach Ende der Besatzung schnell in die Höhe: Im Sommersemester 1928 konnten bereits 5 726 Studenten gemeldet werden, davon 593 Studentinnen.4
Neben seiner Lehr- und Prüftätigkeit an der Universität und bei der Fortbildung der Beamten in Koblenz sowie der Examinierung der Referendare am Oberlandesgericht Köln war Schmitt als Vortragsredner gefragt; nicht nur im wissenschaftlichen Kontext, sondern ebenso von Seiten der Politik wie der Wirtschaft. Und auch als Gutachter gewann er wachsende Reputation. Ende 1925 fragte die Vereinigung der Deutschen Hofkammern, die Interessenvertretung des hohen deutschen Adels, bei ihm an, ob er in der politisch stark umstrittenen Frage der Fürstenenteignung ein Gutachten machen wolle. Schmitt sagte zu, schrieb dieses Gutachten in zwei Tagen nieder und war unsicher, was er als Honorar verlangen konnte; die 7 500 Mark, die dann überwiesen wurden, empfand er als „großartig“ und als „Glücksfall“ (28.1.26). Der Glücksfall sollte schon bald Routine werden, denn es war der Beginn einer Gutachtertätigkeit, die Schmitts Einkünfte deutlich aufbesserte. In den Verhören durch Robert Kempner in Nürnberg 1947 gab er an, dass er vor 1933 durch gutachterliche Tätigkeit jährliche Einkünfte von 10–15 000 Mark gehabt habe.5
Nach der Volkszählung vom 31. Dezember 1926 hatte die Stadt Bonn 91 505 Einwohner, war also eine überschaubare mittlere Stadt. Ihren Mittelpunkt bildete die Universität, auf die sich das Leben mehr oder weniger ausrichtete. Das war ein begrenzter Horizont. Carl Schmitt suchte ihn durch häufiges Reisen zu erweitern. Erstmals erscheint in diesem Tagebuch das Zitat aus dem Anfang der Odyssee, das Odysseus als einen Mann vorstellt, der „vieler Menschen Städte sah und ihr Denken kennen lernte“: καὶ νόον ἔγνω. Schmitt zitiert das, als er am 7. Februar 1929 Unter den Linden in Berlin die vielen Passanten sah, und es [XI] begleitete ihn bis ins Grab: das Zitat (mit der älteren – „juristischeren“ – Lesart νόμον statt νόον) steht auf seinem Grabstein.
Seine Reisen führten ihn zunächst in die mit dem antiken Namen „Illyrien“ bezeichnete kroatische Heimat seiner künftigen Frau Duschka, was er zu einem Text verarbeitete, der seinen Schriften eine weitere Gattung hinzufügte: die Reisebeschreibung. Vor allem aber besuchte Schmitt die großen Städte. Nach München reist er, um seinen Verleger Ludwig Feuchtwanger, aber auch die Bekannten und Freunde aus seiner Münchener Zeit wie Theodor Haecker, Karl Muth, Hans Rupé und Georg Alexander Krause zu besuchen. In Berlin wohnt er bei dem väterlichen Freund, dem preußischen Justizminister Hugo am Zehnhoff; hier hält er im Mai 1927 seinen Aufsehen erregenden Vortrag über den Begriff des Politischen. Immer wieder fährt er nach Hamburg, wo sein engster Freund (und finanzieller Unterstützer) Georg Eisler zu Hause ist. Schmitt wohnt hier bei Georgs Mutter, die ihn nach dem Zeugnis von Annie Kraus „wie einen Sohn“6 behandelte und ihn im Zimmer des gefallenen Fritz Eisler schlafen ließ, des Straßburger Studienfreundes von Schmitt. Aber auch Reisen ins Ausland häufen sich. Im März 1928 reist Schmitt in Erwiderung der Besuche von Jacques Maritain sowie Jeanne und Pierre Linn nach Paris. Dort arbeitet er in Bibliotheken, spricht mit den Kollegen Gaston Jèze und Boris Mirkine-Guetzévitch (der dann die „Verfassungslehre“ besprechen sollte), trifft den Isalmwissenschaftler Louis Massignon, verschmäht aber auch nicht die Attraktionen der Stadt, geht in Buchhandlungen, ins Theater, die Oper und ins Varieté. Noch im gleichen Monat folgt er einer Einladung zu den Davoser Hochschulkursen, wo er zwei Vorträge hält.
Im März/April des Jahres 1929 macht er einen wochenlangen Besuch bei Duschka, die im deutschen Kaiser-Friedrich-Krankenhaus in San Remo ihre Lungentuberkulose zu kurieren sucht. Er nutzt diese Zeit, um die Riviera bis nach Nizza – wo er Veilchen auf die Gräber von Léon Gambetta und Alexander Herzen legt – zu erkunden und anschließend weiterzufahren nach Rom. Hier besichtigt er berühmte Kunstwerke, diskutiert aber auch die Fragen seines Faches mit Gaetano Mosca und Giorgio Del Vecchio, mit denen er bereits in schriftlichem Austausch stand. Schließlich nimmt er die Einladung an, auf dem Kongress des Europäischen Kulturbundes im Oktober 1929 in Barcelona einen Vortrag über das Zeitalter der Neutralisierungen zu halten. Der auf Französisch gehaltene Vortrag begann mit einer für Schmitt typischen Paukenschlag-Eröffnung: „Wir in Mitteleuropa leben sous l’oeil des Russes“; Schmitt hielt ihn für so wichtig, dass er ihn 1932 der Buchausgabe seines „Begriff des Politischen“ beifügte. Von Barcelona reist er weiter nach Madrid, wo er einen Vortrag über Donoso Cortés hält. Er spricht mit dem Verfassungsrechtler Manuel Pedroso, der ihm spanische Übersetzungen von „Die Diktatur“ und „Verfassungslehre“ in Aussicht stellt, erlebt einen Stierkampf und ist sich angesichts des Escorial sicher, dass das durch einen „liberalen Mythos“ zum „Scheusal“ verfälschte Bild Philipps II. in weiterer Zukunft korrigiert werden wird.7 Diese Reise war der Beginn des später so intensiven Verhältnisses Schmitts zu Spanien.
Wissenschaft
[XII] Die Einführung zum Tagebuch von 1921 bis 1924 schließt mit dem Satz: „Fruchtbare Jahre liegen vor ihm“. In der Tat, in den Zeitraum dieses anschließenden Tagebuchs fallen die berühmtesten Titel des Autors Carl Schmitt: der „Begriff des Politischen“ und die „Verfassungslehre“ mit der dazu gehörigen Schrift „Der Hüter der Verfassung“. Neben diesen magistralen Werken hat Schmitt weiteres veröffentlicht: Er greift in die Debatte um einen Beitritt Deutschlands zum Völkerbund ein („Die Kernfrage des Völkerbundes“, 1926), äußert sich über „Volksentscheid und Volksbegehren“ (1927), schreibt zahlreiche Aufsätze und Rezensionen, verfasst Gutachten und hält ständig Vorträge (von denen man zuweilen, über die dürre, nicht einmal das Thema nennende Mitteilung im Tagebuch hinaus, bisher nichts weiß). Mit seinen wissenschaftlichen Veröffentlichungen beginnt Schmitt jetzt auch außerhalb des deutschen Sprachraumes zu erscheinen: schon 1925 liegt „Die Rheinlande als Objekt internationaler Politik“ auf Englisch vor, 1928 folgt die französische Ausgabe von „Politische Romantik“. Die Übersetzung der „Verfassungslehre“ ins Spanische, die ihm Pedroso 1929 ankündigte, ließ auf sich warten, erschien aber dann 1934.
Der „Begriff des Politischen“ war ursprünglich als Teil eines größeren Werkes gedacht,8 verselbständigte sich jedoch im Prozess der Verfertigung. Am 27. März 1927 kommt Schmitt der Gedanke, den Text als eigenen Aufsatz zu veröffentlichen. Er freut sich über sein Werk, das er für sehr gelungen hält, trägt es, sozusagen testweise, im Mai auch in der Vorlesung vor und notiert wiederholt den großen Erfolg. Aber indem er ungeschminkt vom Feind spricht, provozierte er auch. Das lässt sich schön am Beispiel Hermann Hellers zeigen. Dieser war im April für eine Woche Gast bei Schmitt in seinem Friesdorfer Haus und hat sozusagen die Geburtsstunde des „Begriffs des Politischen“ unmittelbar mitbekommen. Sein Brief vom 17. April 1927, mit dem er sich für die „beglückenden Tage“ bei Schmitt bedankt, ist von großer, vorbehaltloser Herzlichkeit. Als Schmitt dann am 20. Mai seinen Text in der Deutschen Hochschule für Politik in Berlin vortrug, sollte Heller ihn in der anschließenden Diskussion „rührend“ verteidigen. Heller schien ganz einverstanden mit Schmitt. Im folgenden Jahr sah das dann plötzlich vollkommen anders aus: Heller griff den Aufsatz an, indem er unterstellte, Schmitt gehe es um die „Vernichtung“ des Feindes. Das traf Schmitt schwer und führte zum Ende des bis dahin ausgesprochen freundschaftlichen Verhältnisses.9 Die Entzweiung von Carl Schmitt und Hermann Heller erfolgte also nicht, wie oft zu lesen, anlässlich des Prozesses Preußen contra Reich 1932; sie entstand 1928 aus einer Lesart des „Begriffs des Politischen“ durch Heller, mit der Schmitt sich böswillig falsch verstanden sah. Er hat darauf reagiert: In der Ausgabe 1932 seiner Schrift ist präzisiert, dass es nicht darum geht, den Feind zu „vernichten“, sondern vielmehr ihn „in seine Schranken zurückzuweisen“.
Gegenüber der knappen Form war die umfassende und systematische Darstellung aller Aspekte eines Gebietes nicht die Sache Schmitts – mit der bedeutenden Ausnahme der „Verfassungslehre“. Der Prozess ihrer Entstehung ist im Tagebuch dokumentiert. Klagte Schmitt 1925 noch: „ich komme zu keiner großen Arbeit“ (1.11.25), so ist im folgenden Sommerse[XIII]mester, in dem er eine Vorlesung über „Grundsätzliche Fragen des modernen Völkerrechts“ hält, davon die Rede, ein „Lehrbuch des Völkerrechts“ schreiben zu wollen (3.8.26). Zugleich ist das verbunden mit „Angst vor meiner Unfähigkeit zu gründlicher Arbeit“ (24.8.26). Sein Vorhaben teilte er auch Feuchtwanger mit, der die Gelegenheit beim Schopfe packen will und umgehend einen Vertragsentwurf schickt. Doch Schmitt zögert wegen des „fürchterlichen Ballastes, den man mitschleppen muß“.10 So kam dieses Lehrbuch nicht über den Stand eines bloßen Projektes hinaus.
Im folgenden Jahr las Schmitt über „Politik (Allgemeine Staatslehre)“ sowie „Deutsches Reichs- und Landesstaatsrecht“, und wieder erwuchs aus dem Vorlesungsstoff ein Buchprojekt. Am 11. Juni dieses Jahres steht im Tagebuch: „will eine Verfassungslehre schreiben“. Noch am selben Tag schreibt er das auch an Feuchtwanger, und der erklärt sich zu den gleichen Konditionen wie beim „Lehrbuch des Völkerrechts“ bereit. Jetzt fängt Schmitt Feuer. „Immer mit Eifer an die Verfassungslehre gedacht!“, lautet der Tagebucheintrag vom 17. Juni. Er hat aber „Angst und Sorge wegen des Titels“ (16.7.27). Einerseits wollte er, da er die Epoche der Staatlichkeit an ihr Ende gekommen sah, keine „Staatslehre“ schreiben, sondern eine systematische Theorie des neuzeitlichen Verfassungsstaates vor allem am Beispiel der Weimarer Verfassung, andererseits wusste er um das gleichzeitige – und vom Verleger geschickt ins Feld geführte – Konkurrenzunternehmen des Berliner Kollegen Rudolf Smend, dessen große Befähigung Schmitt bewundernd anerkannte. Im Juli verdichten sich die Gedanken zu ersten Notizen, und am 31. Juli 1927 heißt es: „Angefangen, die Verfassungslehre zu schreiben.“
War aber Schmitt bei der Abfassung des Begriffs des Politischen sicher und selbstbewusst und mit dem Resultat hochzufrieden, so ist das bei der Verfassungslehre völlig anders. Im Unterschied zur gewohnten essayistischen Form musste er hier eine nüchterne und strengsystematische Darstellung bieten, was ihm eine erhebliche Selbstdisziplinierung abverlangte. Entsprechend mühsam gestaltete sich der Prozess des Schreibens. Schmitt hat „Angst vor der ungeheuren Aufgabe“ (5.9.27), mit der er sich herausgefordert sieht, „dem Liberalismus die Totenmaske abzunehmen“11 und die Grundlage der staatlichen Autorität auf die politische Einheit des Volkes zu gründen.12 Am 14. September beginnt er damit, den wahrscheinlich stenographisch hingeworfenen Text zu diktieren.
Zu Anfang des Wintersemesters hat Schmitt das Diktat weitgehend beendet und beginnt am 22. Oktober mit dem Korrigieren des Typoskripts, das er am 5. Dezember an Feuchtwanger schickt, offenbar ohne eine Kopie zu haben. In den praktischen Dingen des Lebens hilflos, schafft er es nicht, die Sendung als Wertpaket zu versiegeln: „Zufällig kam der Briefträger und nahm es mit. Inzwischen geht es als einfaches Paket, mit 100 Mark versichert.“ Dem Verleger schreibt er: „Es ist mir nicht gelungen, den hohen technischen Anforderungen zu genügen, welche die Post mit Recht an die Verpackung und Versiegelung eines Wertpaketes stellt; schließlich habe ich den Kampf aufgegeben und das Paket in der bescheidensten Form geschickt.“13 Die Zweifel an seinem Werk lassen auch jetzt nicht nach: „immer Angst [XIV] wegen meiner Verfassungslehre, die mir erbärmlich, dilettantisch, flüchtig und oberflächlich vorkommt.“ (31.12.27). Als die Satzarbeiten und Korrekturgänge – bei denen Albert Hensel und Ernst Friesenhahn mitlasen – beendet sind und am 17. März die broschierten Exemplaren der Verfassungslehre eintreffen, ist Schmitt „sehr fröhlich darüber, dann wieder deprimiert.“
Lässt man die vorbereitende Arbeit im Juli und die Korrekturphase – die sich hinzog, weil Schmitt nicht nur Fehler korrigierte, sondern zum Verdruss Feuchtwangers in den Fahnen noch ungewöhnlich viel änderte – außer Acht, so hat Carl Schmitt seine Verfassungslehre, ein anspruchsvolles systematisches Werk von 400 Seiten, in nicht einmal drei Monaten geschrieben. Das ist höchst erstaunlich; umso mehr, als Schmitt in diesen Wochen sein gewohntes Leben kaum geändert hat. Er hält Vorlesungen und Seminare, fährt ins Sauerland, unterhält eine intensive Beziehung zur Geliebten, führt regelmäßig den Hund spazieren, nimmt in Köln Referendarexamen ab, macht die Neuausgabe seiner „Diktatur“ druckfertig, empfängt am 16. August Pierre und Jeanne Linn, die volle zwei Wochen zu Besuch bei ihm wohnen, und um die er sich sehr kümmert, ihnen ausgiebig die Schönheiten des Rheinlands und die Städte Bonn, Köln und Düsseldorf zeigt, empfängt aber auch noch Besuche von Eugen Rosenstock, Carl Brinkmann und Feuchtwanger, wie überhaupt nahezu täglich Besucher im Haus sind, fährt in ein Essener Bergwerk ein, liest nebenher Tschechow und ist auch mal „den ganzen Tag faul und müde“ und hat „herumgeschlafen“ (2.9.27). Er unterhält seine gewohnte umfangreiche Korrespondenz, trinkt viel Wein mit Freunden, sitzt in Cafés und sondiert seinen Wechsel nach Berlin. Daneben die Konzentration für ein so substantielles wissenschaftliches Werk aufzubringen und es in derart kurzer Zeit satzfertig zu machen, ist schwer nachvollziehbar.
Katholizismus und Ehescheidung
Dieses Tagebuch setzt Ostern 1925 mit der Mitteilung ein: „In die Messe, Verlobung mit Duschka“. Das ist eine ebenso lapidare wie gewichtige Aussage. Sie zeigt erstens, dass Schmitt seinen katholischen Glauben, jedenfalls gelegentlich, praktizierte und zweitens dass er seiner Beziehung mit Duschka Todorovi´c eine Verbindlichkeit geben wollte. Diese zweite Ehe ist für Schmitt von kaum zu überschätzender Bedeutung. Mit Duschka gewinnt er einen ruhenden Pol in seinem haltlosen Leben, was freilich durch die lebensbedrohende, über den ganzen Zeitraum dieses Tagebuchs sich hinziehende Tuberkuloseerkrankung Duschkas und ihre dadurch bedingten langen Abwesenheiten immer fragil bleibt. Auch für Schmitts Verhältnis zur katholischen Kirche ist diese neue Eheschließung folgenreich. Die Kirche war für ihn zu diesem Zeitpunkt noch eine Autorität, was man an seinen verzweifelten Bemühungen ablesen kann, den sakramentalen Charakter der Ehe zu achten und sie unter Einhaltung der kirchlichen Vorschriften zu schließen. Das war in diesem Fall nicht einfach. Die erste Ehe mit Carita Doroti´c war vom Landgericht Bonn am 2. März 1924 für ungültig erklärt worden, doch was zivilrechtlich problemlos war, stellte kirchenrechtlich ein Ding der Unmöglichkeit dar. Die katholisch geschlossene Ehe war ein Sakrament und damit unauflöslich. Der einzige Weg zur erneuten Heirat bestand darin, die erste Ehe von einem Kirchengericht als nicht gültig geschlossen erklären zu lassen. Schmitt machte erhebliche Anstrengungen dazu und baute seine Argumentation auf „arglistige Täuschung“ auf; die [XV] Frau habe sich fälschlich als Gräfin ausgegeben. Einen entsprechenden Betrugsparagraphen kannte das damals gültige kanonische Recht allerdings nicht, und so scheiterte Schmitt am 18. Juni 1925 mit seinem Bemühen in der ersten Instanz vor dem Offizialat der Erzdiözese Köln.
Er ruft die zweite Instanz an, das Offizialat Münster, wohin er auch persönlich fährt. Doch ohne den Ausgang des Verfahrens abzuwarten, heiratet er am 8. Februar 1926 Duschka Todorovi´c, obwohl noch zwei Tage zuvor der Oberpfarrer am Bonner Münster ihn mit der „ehrerbietigen wie deutlichen Bitte“ ermahnt hatte, das Wiederverheiratungsverbot zu respektieren; alles andere wäre ein vollkommener Bruch mit der Kirche. Schmitts Reaktion darauf lässt erkennen, wie wenig gleichgültig ihm die kirchliche Autorität zu diesem Zeitpunkt noch war: „Empört, Wut, Schrecken vor dieser Unverschämtheit; zitterte“ (6.2.26). Der Priester Wilhelm Neuß, der sich schon in der ersten Instanz beim Kölner Weihbischof für Schmitt verwendet hatte, versucht auch noch nach der Eheschließung, den Bruch des Freundes mit der Kirche zu vermeiden und schreibt an den Münsteraner Dompropst Adolf Donders.14 Doch es bleibt alles vergeblich; auch die Berufungsinstanz gesteht die Ungültigkeitserklärung nicht zu. Vage Hinweise, wonach Schmitt als letzte Instanz noch die Rota Romana beim Vatikan angerufen habe, sind durch das Tagebuch nicht zu belegen und schon darum unwahrscheinlich, weil er die Ehe schloss, ohne die Entscheidung der zweiten Instanz abzuwarten. Diese Eheschließung erfolgte in einer auffällig beiläufigen Form, zweimal notiert Schmitt am Hochzeitstag: „ein seltsamer Tag“. Seit diesem Tag lebte er kirchenrechtlich in Bigamie und war exkommuniziert, also von den kirchlichen Sakramenten ausgeschlossen.15
In der Folge verschlechtert sich Schmitts Verhältnis zur katholischen Kirche. Es empörte ihn, dass der Betrug durch die erste Ehefrau nicht anerkannt wurde. „Betrug“ ist für Carl Schmitt ein zentrales Thema und zieht sich leitmotivisch durch seine Tagebücher. Zu Beginn des Jahres 1928 liest er den Roman „L’imposture“ (Der Betrug) von Georges Bernanos und notiert: „Bernanos’ L’imposture, schrecklich, er traf irgend einen Nerv bei mir.“ Der größte Betrug war ihm seine erste Ehe. Dabei war er klug genug, um zu sehen, dass es vor allem ein Selbstbetrug gewesen war, dass er die Schwindlerin Carita Doroti´c rechtzeitig hätte durchschauen müssen. Wie sehr diese Erfahrung traumatisch wirkte, sieht man an der Gründlichkeit mit der er alle Quellen über die Verbindung mit Carita beseitigte. Möglicherweise ist das eine Erklärung für das Fehlen der Tagebücher der Jahre 1916 bis 1921,16 also der Krisenzeit mit dem faktischen Ende der Beziehung, der Unterlagen zum Scheidungsprozess, sämtlicher einschlägiger Korrespondenz. Die lebenslange Besessenheit, mit der Schmitt diese Jahre seines Lebens annihilieren, mit der er nicht einmal die Nennung des Namens seiner ersten Frau ertragen wollte, ist beispiellos und zeigt die Schwere der Verletzung.
[XVI] Den „Betrug“ nicht anerkannt zu haben, erklärt die jetzt entstehende Wut auf die Kirche. Priester, die man als Katholik zu jener Zeit mit „Hochwürden“ anzureden pflegte, waren ihm nun „widerliche Pfaffen“. „Wut über die Pfaffen, die mich schlecht behandeln“, heißt es am 10. März 1926. Die „zölibatäre Bürokratie“, die Schmitt 1923 / 25 noch bewundernd (und mit kirchlichem Imprimatur) beschrieben hat, wandelt sich jetzt zum Feind, der es blieb, auch als mit dem Tode Duschkas 1950 die Exkommunikation aufgehoben war: „Vergiß nicht, daß du katholisch bist und zwar katholischer Laie, d. h. Kanonenfutter einer zölibatären Bürokratie“, heißt es am 13. September 1952 im „Glossarium“. Im Paralleltagebuch beschreibt er den Wandel seines Verhältnisses zur katholischen Kirche:
„Meine Grunderfahrung mit der römisch-katholischen Kirche: Ich habe in deutscher Ehrlichkeit die institutionelle Kraft der römischen Kirche gerühmt, dann fechte ich meine Ehe an, weil ich durch eine Schwindlerin mit Urkundenfälschung und kriminellem Betrug zur Ehe bewogen wurde; ich suchte bei der Kirche Schutz vor dem Betrug und glaubte an ihre Art Justiz. Aber siehe da, die Kirche stellt sich auf Seiten der Betrügerin; merkst du endlich etwas, du deutscher Tölpel? Der Betrug liegt in dir. Lasse also die römische Kirche und lasse jene Betrügerin und bleibe bei deiner bescheidenen Harmlosigkeit.“ (s. unten, S. 444)
Dennoch verstand Carl Schmitt sich bis an sein Lebensende dezidiert als katholisch, und dass das mehr war als eine bloße kulturelle Prägung, geht beispielsweise aus der im Glossarium dokumentierten Beschäftigung mit dem Geistlichen Jahr der Annette von Droste- Hülshoff hervor. Aber die Deutungshoheit über das, was katholisch war, behielt er sich selbst vor und überließ sie nicht der Kirche.
Heirat und Haus
Der erneute Ehestand führte zu einer gravierenden Veränderung der Wohnsituation. In Bonn lebte Schmitt in Pensionen bzw. Etagenwohnungen, zuletzt in der Endenicher Allee 20 als Mieter der Witwe des Geheimrats Prof. Johannes Franck. Die Witwe wohnte mit weiteren Familienmitgliedern zusammen im selben Haus, und das war häufig mit Lärm verbunden. Schmitt leidet unter der Belästigung. „Hätte ich erst eine Wohnung“, seufzt er am 17. Dezember 1925, und zwei Wochen später: „schauderhafter Lärm in der Wohnung, nicht zum Aushalten“ (3.1.26). Diesen Qualen wollte er aus dem Wege gehen und sucht schon darum, aber natürlich auch, um mit Duschka einen gemeinsamen Hausstand zu gründen, ein Haus. Er findet es schließlich in Friesdorf, einem alten, ursprünglich selbständigen Dorf, das 1904 nach Godesberg eingemeindet worden war, aber seinen ländlichen Charakter noch bewahrt hatte. Der Bonner Kaufmann Theodor Mendel hatte hier 1923 ein Haus gebaut, das er vermietete.17 Dieses Haus bezieht Schmitt zum 1. September 1926 zunächst allein, da Duschka wieder einmal in der Klinik liegt. An seinen Schwiegervater in Kroatien schickt er am 6. August 1926 „ein Bild unseres neuen Häuschens“. Das ist eine ziemliche Untertrei[XVII]bung; handelt es sich doch um nichts weniger als eine stattliche Villa. Jetzt empfängt er häufig Besucher, die tagelang, manchmal wochenlang bei ihm zu Gast sind. Sie alle staunen über das prächtige Haus, das den für einen Professor üblichen Rahmen deutlich überstieg.
Es wurde auch in einer Weise bewohnt, die einer Villa angemessen war: Die Rede ist von einer Hausdame (Frau Webers), zwei Hausmädchen (Lisbeth und Johanna), einem Gärtner und natürlich auch einem Hund, mit dem Schmitt regelmäßig Spaziergänge über die umliegenden Felder machte. Der Hund wurde angeschafft, weil zweimal des Nachts in das Haus eingebrochen wurde, was dann auch dazu führte, dass Schmitt sich Schusswaffen zulegte und im Garten regelmäßige Schießübungen veranstaltete. Trotz solcher Unannehmlichkeiten reißen in der Folge die begeisterten Äußerungen über die neue Wohnsituation nicht ab: „welch eine herrliche Wohnung“, heißt es am 13. Oktober 1926; „herrlich im Garten, ein ruhiges, intensives Lebensbehagen, wie ich es niemals gekannt habe, wundervoll. Freude an Duschka, Freude an meinem Beruf“ (20.7.27). Die rheinische Landschaft mit dem Siebengebirge trägt ihr Teil zur Begeisterung bei: „das Siebengebirge ist wie eine Krone“ (2.11.27). Immer wieder fährt Schmitt rheinaufwärts, um den Rolandsbogen auf dem Rodderberg mit der schönen Aussicht auf den gegenüber liegenden Drachenfels zu bewundern. Auch setzt er bei Mehlem mit der Fähre ans andere Ufer über, besucht Arnold Schmitz, der mit seiner Familie in Honnef wohnt, ist in Königswinter und wandert im Siebengebirge.
Rheinland und Sauerland
Westfalen und Rheinländer wurden 1946 von der britischen Besatzungsmacht in einem Bundesland vereint, obwohl sie sich traditionell wenig zu sagen haben. Bei Carl Schmitt ist von einem landsmannschaftlichen Gegensatz nichts zu spüren. Er sieht sich als Angehöriger beider Volksstämme, verweist gern auf seine moselländische Herkunft und beschreibt von daher sogar sein Wesen mit „tacito rumore Mosella“ (wie die mit leisem Murmeln dahin fließende Mosel). Allerdings war er vom rheinischen Frohsinn weit entfernt. Während sich die Freunde Oberheid, Becker, und selbst der Hamburger Peterson in den Kölner Karneval stürzten oder den Rektorenball besuchten, blieb er zu Hause. Seiner westfälischen Andersartigkeit war er sich bewusst: „einsam, überall Karnevalstreiben, sehr einsam“ (16.2.26). Wenn es auch keinerlei Hinweise dafür gibt, dass der gebürtige Westfale gegenüber den Rheinländern irgendwelche Reserven hatte, so zog es ihn doch – wie dann auch in seinen Berliner Jahren – immer wieder ins Sauerland, wo er die wahre Erholung fand: „Nach dem Essen auf die Spitze des Saley, im Schnee. Unbeschreiblich schön die Berge des Ebbegebirges, Ruhe, Verschwiegenheit, Kraft und Unberührtheit. Wundervoll“ (14.12.28). Von Beten ist bei dem Katholiken Schmitt im Tagebuch kaum die Rede, es sei denn, er kommt ins Sauerland: „nachmittags mit Jup auf den Saley, herrliches Wetter. Bete zur Landschaft“ (4.3.28). Schließlich unterschied ihn seine unüberhörbare sauerländische Aussprache deutlich von den Rheinländern. Als er 1926 zu einem Vortrag nach Recklinghausen fährt und die Grenze zu Westfalen knapp überschreitet, heißt es: „Froh, wieder in Westfalen zu sein, gerührt von den westfälischen Stimmen“ (29.1.26).
[XVIII] Der Wechsel nach Berlin
Die Berufung Carl Schmitts von der Universität Bonn an die Handelshochschule in Berlin gestaltete sich langwierig und kompliziert, und zwar auf beiden Seiten. Nicht nur gab es in Berlin starken Widerstand gegen Schmitt,18 auch er selbst zeigte sich lange Zeit zögerlich, war unsicher, ob er den Wechsel wollte oder nicht: „Die ganze Nacht wegen Berlin überlegt, Angst vor dem Neuen, dann wieder Freude an der großen Stadt, am Geld verdienen usw.“ (16.9.27). Einmal heißt es: „Welches Glück, dass ich von Bonn weg kann.“ (1.10.27); dann wieder: „Nachts traurig und verzweifelt, entsetzliche Angst vor Berlin“ (5.11.27). Der theoretische Meister der Dezision konnte sich lange zu keiner klaren Entscheidung durchringen und wandte sich an seine Freunde, damit die für ihn entscheiden. Im Tagebuch hält er fest, wer ihm zu-, wer abrät: der Bruder Jup, Georg Eisler, Am Zehnhoff, Oberheid sprachen für Berlin; Erik Peterson war – wohl auch weil er auf den Gesprächspartner nicht verzichten wollte – entschieden dagegen und meinte, es wäre Selbstmord. Verglichen mit der Universität Bonn war die Handelshochschule Berlin klein. Sie umfasste im Sommersemester 1928, in dem Schmitt hier seine Tätigkeit aufnahm, 1 601 Studierende. Dazu kamen, bedingt durch den traditionellen Praxisbezug, 826 andere Hörer.19 An ordentlichen Professoren gab es nicht einmal ein Dutzend; sie wurden allerdings durch einen großen Kreis weiterer Lehrkräfte ergänzt. Carl Schmitt war, nachdem Paul Eltzbacher im Oktober 1928 verstorben war, der einzige rechtswissenschaftliche Ordinarius.
Am 11. Oktober 1927 teilt Schmitt dem Kuratorium der Handelshochschule mit, dass er den Ruf annimmt, und am 2. November 1927 erhält er vom Preußischen Minister für Handel und Gewerbe die Bestallungsurkunde als Nachfolger von Walther Schücking; zum Sommersemester 1928 hatte er seine Lehrtätigkeit aufzunehmen. Aber auch noch lange, nachdem die Würfel gefallen waren, ist Schmitt schwankend; im Februar 1928 notiert er in Friesdorf: „glücklich über die schöne Landschaft, unbegreiflich, dass ich hier weg ging, Dummheit und Feigheit, herrliches Haus.“ In Berlin sieht er sich nach einer neuen Wohnung um und bittet seinen neuen Arbeitgeber um Hilfe.20 Dr. Konrad Jacoby von der Industrie- und Handelskammer Berlin beauftragt mehrere Immobilienmakler, die Angebote von Häusern mit 7 bis 8 Zimmern im Südwesten der Stadt vorlegen. Der in diesen Dingen hilflose Schmitt verlässt sich ganz auf Georg Eisler. Ihn empfiehlt er am 20. November dem geschäftsführenden Vorsitzenden des Kuratoriums der Handelshochschule als seinen Vertrauten.
Am 23. Februar 1928 vermeldet das Tagebuch: „hielt meine letzte Vorlesung, verabschiedete mich am Schluss mit einer schönen Rede, während der ich einen Augenblick vor Tränen und Rührung nicht sprechen konnte.“ Doch so schnell kam Schmitt von Bonn nicht los. Für das Friesdorfer Haus hatte er einen Mietvertrag mit seinem Vermieter Mendel geschlossen, der nicht kurzfristig kündbar war. Das war ihm durchaus recht; Schmitt ist „glücklich, dass ich den Sommer noch hier bleibe“ (24.2.28). Dennoch kam er natürlich nicht umhin, das Friesdorfer Haus aufzugeben und beauftragte den Bonner Makler Stückrath, mit Mendel eine vorzeitige Auflösung des Mietvertrags zu vereinbaren, was dieser dann zu Ende [XIX] Oktober erreichte. Bis dahin war Schmitts Wohnsitz weiter in Friesdorf, wo auch Duschka wohnen blieb. Im Personal- und Vorlesungsverzeichnis der Handelshochschule in Berlin ist Schmitt für das Sommersemester ohne Adresse verzeichnet. An Smend schreibt er am 30. April, dass er „vorläufig“ im Hotel Continental am Bahnhof Friedrichstraße untergekommen sei. Ab Mai wohnte er dann in der Villa des Architekten Muthesius, Potsdamer Chaussee 49, in Nikolassee, wo es „sehr schön und ruhig“ ist.21
Sobald das Sommersemester vorbei war, kehrte Schmitt nach Bonn zurück. Zum Wintersemester fand er in Berlin eine Wohnung in der am Nordrand des Tiergartens gelegenen Klopstockstraße 48;22 wahrscheinlich durch Vermittlung seiner alten Freundin Alice Berend, deren Schwester Charlotte mit ihrem Mann, dem Maler Lovis Corinth, Vormieterin war. Am 19. Oktober beginnt der Umzug durch die Bonner Spedition Norrenberg. Da Carl Schmitt damit völlig überfordert war und Duschka inzwischen in San Remo im Krankenhaus lag, überwachte Frau Braschoß, die ehemalige Vermieterin und Freundin Duschkas, den Auszug in Friesdorf. Jetzt, da es ernst wird, ist Schmitt „traurig“ und „bedrückt“. Er verabschiedet sich von den Freunden und den Nachbarn, fährt ein letztes Mal zu Schmitz nach Honnef, beendet seine Affäre mit Magda. Soweit ist er noch katholisch, dass er sich auch bei seinem zuständigen Ortspfarrer abmeldet, allerdings nicht, ohne ihm im Tagebuch ein „widerlicher, trotteliger Pfaffe“ nachzurufen (20.10.28). Dann fährt er, um sich von Bruder Jup, Lamberts und Am Zehnhoff zu verabschieden, über Köln, München-Gladbach und Düsseldorf nach Plettenberg, wo er noch einige Tage bleibt und durch die vertrauten Berge wandert. In Berlin trifft er am Abend des 28. Oktober ein: „traurig und deprimiert, verzweifelt; Angst, vernichtet“. Nach einer Nacht im Hotel Hessler in der Kantstraße holt er Hanna und Elli, die er als Hausmädchen engagiert hatte, vom Bahnhof ab und bezieht die Wohnung in der Klopstockstraße. Die Rolle der Beaufsichtigung der Möbelpacker, die Frau Braschoß in Friesdorf eingenommen hatte, übernahm hier Alice Berend, zu der Schmitt in den folgenden Jahren auch wieder engeren Kontakt haben sollte.
Berlin war 1928 mit 4 249 800 Einwohnern erheblich größer als heute.23 In der Klopstockstraße wohnte Schmitt zentral und verkehrsgünstig, hatte auch den schönen großen Park fast direkt vor der Haustür. Aber verglichen mit der Villa in Friesdorf war diese Situation doch ein klarer Rückschritt. Schmitt äußert sich zunächst positiv: „der Ofen brennt in meinem Arbeitszimmer, die Bücher stehen in den Regalen, die Wohnung ist wunderbar ruhig. Sehr zufrieden“ (31.10.28). Das war allerdings ein flüchtiger erster Eindruck. Bald stört ihn wieder, wie schon in der Endenicher Allee in Bonn, der Lärm der Mitbewohner. Bereits am 5. November hat er Krach mit dem Kaufmann Österreicher im Parterre. Am 11. ist er „bedrückt von der kleinen, erbärmlichen Wohnung“ und beklagt sich über das Klavierspiel nebenan; am 13. ist es „grauenhaftes Geschrei einer Sängerin, die über mir wohnt“, was in den folgenden Tagen Auswirkungen bei ihm zeigt: „Ohrensausen von dem Geschrei der Sängerin. Scheußlich diese Hölle“. Obwohl die Sängerin nicht aufhört, gewissenhaft zu üben und Schmitt sich immer wieder über ihr „Geschrei“ beklagt, sollte er bis zum Oktober 1931 in der Klopstockstraße wohnen bleiben.
[XX] Durch die Eheschließung mit Duschka und mit der Wohnsituation in Friesdorf hatte Carl Schmitt etwas erreicht, was bei seiner nervösen Unausgeglichenheit für ihn unschätzbar war: Ruhe. Er selbst sagt es am 20. Januar 1928: „wunderbares Glücksgefühl, das schöne Haus, die Ruhe, diese physische Ausbalanciertheit, wunderbar.“ Warum wechselte er da nach Berlin? Wie konnte – um Franz Blei zu zitieren – dieser weinfrohe Mosellaner das rheinische Rebenland mit den Kartoffelfeldern Preußens vertauschen, die nur „Sprit ergaben, aber nicht Esprit“? Wie erklärt sich der Wechsel von einer hoch angesehenen Universität zu einer vergleichsweise bescheidenen Handelshochschule, die zwar seit 1926 Promotions-, aber kein Habilitationsrecht hatte, deren Studenten als angehende Kaufleute die Rechte nur nebenbei studierten, und mit denen Schmitt kaum sein „legendäres Seminar“ (Reinhard Mehring) von Bonn fortsetzen konnte? Ein Zerwürfnis mit der Fakultät oder schwerer Streit mit Kollegen gab es in Bonn nicht, zudem hatte Schmitt deutliche Reserven gegenüber Berlin. An Jacques Maritain schreibt er am 30. Mai 1928, Berlin sei eine „erstaunliche, un-europäische, unchristliche, beinahe unmenschliche Stadt […], die nicht mehr in Europa, sondern zwischen New York und Moskau liegt“.24
Dennoch hatte Schmitt natürlich seine Gründe für den Wechsel. Zunächst gab es da das finanzielle Argument.25 Die Gehälter der Professoren an den staatlichen Universitäten waren höchst unterschiedlich, da Berufungen bzw. die Ablehnung von Rufen über Geld geregelt wurden. Carl Schmitt erhielt Mitte der zwanziger Jahre in Bonn ein jährliches Grundgehalt von 9 630 Reichsmark. Das erhöhte sich nach Inkrafttreten des neuen Preußischen Besoldungsgesetzes am 1. Oktober 1927 auf 11 600 Reichsmark. In der Einkommensskala der Bonner juristischen Professoren lag er damit im unteren Feld; Max Grünhut und Heinrich Göppert bezogen das Gleiche; Schreuer, Zycha, Schulz und – mit 15 000 Reichsmark Spitzenverdiener – Graf Dohna lagen deutlich darüber; ebenso deutlich fiel Hans Dölle mit 6 600 Mark ab. Das war jeweils das Grundgehalt, wozu man weitere Einkommensbestandteile hinzurechnen muss. Kindergeld bezog Schmitt nicht, aber ein Wohngeldzuschuss stand ihm zu. Dieser schwankte zwischen 1923 und 1927 inflationsbedingt zwischen 1 400 und 8 800 Reichsmark. Dazu kamen die Promotions- und Habilitationsgebühren und vor allem die Kolleggelder, die Schmitts Einkommen bei der großen Hörerschaft, die er anzog, theoretisch kräftig erhöhten, praktisch aber in dieser Zeit durch staatliche Kappung begrenzt blieben. Insgesamt dürfte sich das jährliche Einkommen Schmitts am Ende seiner Bonner Zeit auf eine Summe von etwa 15 000 Reichsmark belaufen haben, was nach heutiger Kaufkraft 60 000 Euro entspricht. Da konnte die von der Wirtschaft finanzierte Handelshochschule Berlin ganz andere Angebote machen: Die 30 000 Reichsmark, die ihm Fritz Demuth am 15. September 1927 garantierte, bedeuteten eine glatte Verdopplung des Bonner Einkommens! Carl und Duschka waren, als sie dieses Angebot schwarz auf weiß lasen, „bang vor Staunen“ und öffneten eine Flasche Wein.
[XXI] Zu dem finanziellen Gesichtspunkt, der bei dem im Geldausgeben sorglosen und daher notorisch klammen Schmitt, der sich immer wieder vom Freund Georg Eisler helfen lassen musste, nicht gering zu schätzen ist, kam noch der Ärger über die katholische Kirche. Sie war im Rheinland besonders stark, auch mit ihrem politischen Arm, der Zentrumspartei, die hier einen Stimmenanteil hatte, der den Reichsdurchschnitt um das Doppelte übertraf. Schmitt bekam zu spüren, dass über seine Ehegeschichte in dem kleinen Bonn geklatscht wurde. Der starke politische Katholizismus reichte natürlich auch in die Hochschulpolitik. Bei einem Gespräch mit dem Kurator der Universität hatte Schmitt den Eindruck, dass man ihn „von Bonn weg haben“ wollte, um das Fach zu konfessionalisieren (17.9.27), dass man also an seiner katholischen Zuverlässigkeit zweifelte. Wenn Schmitt im Tagebuch von der „Feigheit“ seiner Entscheidung für Berlin spricht (6.2.28), so ist das auch als Flucht vor dem Klatsch über seine Person in Bonn zu verstehen. Mit dem Wechsel nach Berlin konnte er jedenfalls der Enge des katholischen Milieus entkommen.
Ein weiteres Motiv wird sein, was Ernst Rudolf Huber aus seiner Erinnerung26 berichtet: Schmitt drängte von der Theorie zur Praxis, er wollte im Zentrum der Macht das theoretische Werk durch praktisch-politisches Wirken ergänzen. In dieser Hinsicht diente der Bonner Kollege Erich Kaufmann als Vorbild, der immer stärker von der Universität in die Politik hinüberglitt und als Berater der Regierung tätig war. Es kann kaum ein Zweifel bestehen, dass der Kritiker der indirekten Gewalten durchaus den Ehrgeiz hatte, im Vorhof der Macht Einfluss zu entfalten. Anfang Januar 1928 nimmt Schmitt an einer Tagung in Königswinter teil und hört hier einen Vortrag von Heinrich Brüning, dem späteren Reichskanzler. Er sprach „sehr weise, überlegen, erfahrener Politiker, sehr geschickt, gegen jeden freundlich. Freute mich, in Berlin mit ihm zusammen sein zu können.“ (3.1.28). Zu einer Zusammenarbeit mit dem politischen Katholizismus sollte es jedoch nicht kommen, und das Verhältnis zu Brüning wurde ein ausgesprochenes Nicht-Verhältnis.27 Dafür ergaben sich in der Reichshauptstadt bald Regierungskontakte auf Staatssekretärsebene, so zu dem Ministerialdirektor im Reichsfinanzministerium Herbert Dorn, zum dortigen Staatssekretär Johannes Popitz, der Schmitt dann 1933 zu seinem NS-Engagement bewegen sollte und ein enger Freund wurde,28 zu Erich Zweigert, der ab 1929 Staatssekretär im Innenministerium war.
In Bonn dagegen begegnete Schmitt Politikern noch mit einer deutlichen Reserve. Als er am 10. Juni 1927 mit dem Zentrumspolitiker Albert Lauscher wegen Berufungsangelegenheiten einen Abend verbringt und eine Flasche Wein leert, war das „sehr schön“, und man unterhielt sich auch nett, Schmitt hatte „aber doch das unangenehme Gefühl, mich mit einem Politiker eingelassen zu haben.“ Mit dem Wechsel nach Berlin änderte sich das insofern, als er hier zwar kaum direkt mit Politikern zu tun bekam, wohl aber mit politischen Beamten und dem Brain Trust der Politik. Die Deutsche Hochschule für Politik, an der er [XXII] 1927 seinen „Begriff des Politischen“ vorgetragen hatte, wurde jetzt von ihm regelmäßig besucht, sei es, um Vorträge zu hören, sei es, um selbst einen Vortrag zu halten. Für die Ausbildung des diplomatischen Nachwuchses hatte das Auswärtige Amt Lehrveranstaltungen eingerichtet, zu denen die angesehensten Professoren der Universität, der Handelshochschule sowie der Deutschen Hochschule für Politik herangezogen wurden. Carl Schmitt gehörte dazu und suchte den Umgang mit den jungen Attachés. Auch in den elitären politischen Debattierzirkeln der Hauptstadt war er als Diskutant und Referent gefragt.
Davon blieb seine Thematik nicht unberührt. Diskutierte Schmitt in Bonn mit Gurian, Peterson und Maritain das grundsätzliche, theologisch grundierte Verhältnis von „potestas und auctoritas“, so rückte jetzt der Benjamin Constant entlehnte Begriff des „pouvoir neutre“ in den Mittelpunkt. In der durch wachsende Instabilität geprägten politischen Situation am Ende der zwanziger Jahre stellte sich verstärkt die Frage der Staatsautorität. Was waren die Bedingungen der Möglichkeit staatlichen Handelns, und wie war die Demokratie zu bewahren angesichts der an Einfluss gewinnenden Interessengruppen und vor allem wachsender antidemokratischer Parteien auf der Linken und der Rechten. Schmitts Antwort bestand in einer Weiterführung seiner Verfassungslehre und erschien 1929 als Aufsatz, 1931 dann als selbständige Schrift: „Der Hüter der Verfassung“. Sie war gemeint als Programmschrift zur Rettung der gelähmten Weimarer Republik durch eine Präsidialverfassung; die staatliche Handlungsfähigkeit sollte durch die plebiszitäre Stärkung der Stellung des Reichspräsidenten zurückgewonnen werden. Schmitt suchte damit auch gezielt Politiker anzusprechen und verteilte Sonderdrucke dieser Schrift an sie.29
Mit seinem Rezept eines autoritären Präsidialsystems war Schmitt auch unter liberalen Demokraten durchaus nicht isoliert. So gab es etwa in der Deutschen Hochschule für Politik im Sommer 1929 eine Vortragsreihe unter dem Thema „Probleme der Koalitionspolitik“, in der die aktuelle politische Lage diskutiert wurde. Schmitt sprach am 28. Juni über den „Mangel eines pouvoir neutre im neuen Deutschland“, Hermann Heller am 2. Juli über „Demokratische und autokratische Formen der Staatswillensbildung“, und Alexander Rüstow gab am 5. Juli seinem Vortrag ein Thema, das an Schmitts schon 1921 geprägten Begriff von der „kommissarischen Diktatur“ erinnert: „Diktatur innerhalb der Grenzen der Demokratie“. In der anschließenden Diskussion sprach sich auch Theodor Heuß für eine Stärkung der Stellung des Reichspräsidenten aus, was zeigt, dass angesichts der politischen Ausnahmelage ein „notstandsrechtliches Interim“ (E. R. Huber) bis in die Reihen der Liberalen hinein als Lösung akzeptiert wurde.
Schließlich hat Schmitt, trotz seiner Kritik an Berlin die Vorteile zu schätzen gewusst, die die Metropole bot. Die pulsierende und stimulierende Atmosphäre der Hauptstadt beflügelt ihn: „wie viele Leute sieht man in Berlin“. (20.12.28). Es waren nicht nur die zahlreichen interessanten Menschen, denen Schmitt jetzt begegnete, es war auch das reiche kulturelle Angebot, das Bonn nicht bieten konnte. Die zwanziger Jahre waren die große Zeit des Berliner Theaters; 1927 gab es hier 49 Theater und gleichzeitig drei Opernhäuser (Lindenoper, Charlottenburger Oper sowie Krolloper). Auch im Musikleben behauptete Berlin mit Dirigenten wie Wilhelm Furtwängler, Otto Klemperer, Bruno Walter, Leo Blech und Erich Kleiber weltweit eine Spitzenstellung. Das galt ebenso für das Filmangebot. Es gab fast 400 [XXIII] Kinos, von denen einige riesige Ausmaße hatten, wie etwa der Ufa-Palast am Zoo, der 3 000 Menschen fasste. In der Stadt erschienen 45 Morgen-, zwei Mittags- und 14 Abendzeitungen. Fast 200 Verlage waren in Berlin ansässig.30 Schmitt nahm das alles interessiert wahr und ging nun häufig in Museen, ins Theater und in die Oper. Vor allem auch wurde er zum Kinogänger. Den Stummfilmklassiker „Johanna von Orleans“ von Carl Theodor Dreyer sah er mindestens zehnmal, und jedes Mal war er tief ergriffen.
Kollegen, Freunde, Bekannte, Geselligkeit und ihr Gegenteil
Carl Schmitt war ein ausgesprochen geselliger Mensch, sein Tagebuch lässt geradezu eine Prozession von Zeitgenossen vorüberziehen, mit denen er flüchtig oder auch nachhaltig zusammenkommt; nahezu täglich empfängt er in seiner Wohnung Besucher, auf die er offen und neugierig reagiert. Aber auch hier gilt: Schmitt war ambivalent. Bei aller Geselligkeit legte er Wert darauf, sich nie irgendwelchen Gruppen oder Vereinen angeschlossen zu haben.31 Immer wieder ist das Bedürfnis nach Alleinsein artikuliert: „Das ist doch das schönste, alleine zu sein“(8.12.25). Dann fühlte er sich sicher und stark „wie in meiner Jugend“, was heißen soll: wie in der Zeit vor dem „Betrug“. Diese Reminiszenz an die unbelastete Jugendzeit begegnet im Tagebuch häufig: „einsam für mich noch etwas spazieren, wieder wie in meiner Jugend, verschlossen, sicher, ruhig“ (5.11.25); Schmitt hat das „Gefühl, dass die Kraft meines Lebens in solchen Stunden liegt“ (27.1.28).
Von den zahllosen Menschen, denen Schmitt in diesen Jahren begegnete, ergab sich mit vielen über die flüchtige Begegnung hinaus eine nähere Beziehung. Von seinen juristischen Kollegen in Bonn hatte Schmitt am ehesten zu Heinrich Göppert ein freundschaftliches Verhältnis, die anderen Professoren erscheinen im Tagebuch so gut wie gar nicht, mit Ausnahme von Erich Kaufmann. Für Schmitt wie Kaufmann gilt, dass sie beide aus dem Kreis der Bonner Juraprofessoren herausragten. Beide verband die Ablehnung des Rechtspositivismus, und das Verhältnis war zunächst durchaus freundschaftlich. Man verkehrte auch privat miteinander, und Frau Kaufmann besuchte regelmäßig Schmitts Vorlesungen. Am Tagebuch lässt sich dann ablesen, wie die Freundschaft Schmitts in eine immer stärkere Ablehnung umschlug, wobei die eigentlichen Gründe nicht ganz deutlich werden. Ein schwerer sachlicher Dissens waren die Verträge von Locarno, die eine Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund um den Preis einer Festschreibung seiner Westgrenze vorsahen. Kaufmann, der als Berater des Auswärtigen Amtes an den Verhandlungen beteiligt war, rühmte die Verträge „als eine große Sache“, worauf ihm Schmitt erwiderte: „ich halte es für ein großes Unglück“ (16.11.25). Hinzu kamen private Dinge, die Kaufmann – so sagt Schmitt – in Berlin „herumschwätzte“. Schmitt beschwerte sich wiederholt über „Gehässigkeiten“ Kaufmanns, was übrigens Heller und Smend ebenfalls taten.
Von allen Juristen, mit denen Schmitt in dieser Zeit in Verbindung stand, war ihm Rudolf Smend wohl am nächsten. Schmitt erkannte seine überragende Qualifikation an und war [XXIV] „glücklich, von ihm respektiert zu werden“ (4.2.28). Auch auf der menschlichen Ebene war ihre Beziehung sehr freundschaftlich. Anlässlich seiner Besuche bei Smend spricht Schmitt immer mit Sympathie von ihm und seiner Frau. Nach seinem Wechsel nach Berlin ist er oft mit ihnen zusammen; man besucht gemeinsam Theater- und Kinoaufführungen und trifft sich zum Wein. Aber dennoch gab es einen Vorbehalt bei Schmitt: Er durchschaute Smend nicht und hatte „Angst vor ihm und seiner Hintergründigkeit“ (11.1.29). Außerdem vermutete er bei dem dezidierten Protestanten Smend einen antirömischen Affekt: „er hasst mich offenbar als Katholiken“ (ebd.). Und als Smend 1929 eine ausführliche Einleitung zu einer Ausgabe der Weimarer Reichsverfassung schreibt, gibt es Schmitt einen Stich, dass dort zwar auf eine Reihe von einschlägigen Autoren verwiesen wird, nicht jedoch auf Schmitts Opus magnum, die Verfassungslehre. Die Abneigung, die er bei Smend zu spüren glaubte, machte ihn „traurig“ (26.1.29).
Mit den Kollegen Carl Bilfinger in Halle und Erwin Jacobi in Leipzig treten weitere enge Weggefährten in Schmitts Leben. Jacobi besucht ihn im September 1926, als Schmitt gerade das Haus in Friesdorf bezogen hatte, und zeigt sich begeistert von der Wohnsituation und der rheinischen Landschaft, die Schmitt ihm ausgiebig vorführt. Bilfinger kommt nicht nur zu Schmitt nach Bonn, dieser besucht ihn auch öfter in Halle, und während Duschka in San Remo ist, verbringt Schmitt 1928 das Weihnachtsfest bei der Familie Bilfinger in Halle.
In Berlin machte Schmitt die Bekanntschaft eines jungen Mannes, der „begeistert“ und „fanatisch“ im Jungdeutschen Orden aktiv war: Reinhard Höhn. Zweimal, am 26. Januar und 31. Mai 1929, kam er zu Besuch in die Klopstockstraße und suchte das Gespräch mit Schmitt. Doch der war enttäuscht von dem jungen Aktivisten; Höhn schien ihm „langweilig“ und „nicht klug“. Nach 1933 sollte Höhn dann eine SS-Karriere machen und als Kollege Schmitts an der Berliner Universität ein gefährlicher Feind werden.
Die engsten persönlichen Freunde waren in Bonn nicht Juristen, sondern Theologen: Erik Peterson, Heinrich Oberheid, Werner Becker. Dazu kam der Musikwissenschaftler Arnold Schmitz. An erster Stelle steht ohne Frage Peterson, von dem Schmitt als „meinem besten Freunde“ an Smend schrieb.32 Der Göttinger Privatdozent Peterson wurde zum Wintersemester 1924/25 als Professor für Kirchengeschichte und Neues Testament an der Evangelisch-Theologischen Fakultät nach Bonn berufen. Erstmals ist in Schmitts Tagebuch ein Kontakt am 30. Oktober 1924 verzeichnet. Wenige Wochen später, am 16. Dezember, schreibt Schmitt an Feuchtwanger: „Hier ist ein ganz ausgezeichneter, junger protestantischer Theologe, Erik Peterson, als Gelehrter und als Mensch gleich vortrefflich, ein weißer Rabe also.“33 Damit hat Schmitt seine Gemeinsamkeit mit Peterson bezeichnet; er selbst sollte sich 1952 im Glossarium einen weißen Raben nennen, „der auf allen schwarzen Listen steht“.34 Mit Peterson verband ihn die Hochschätzung Kierkegaards, das Außenseitertum des Hochbegabten und die „Absage an die gesamte Bildungswelt“ (v. Wiese). Peterson war nicht nur der „Prototyp der Käuze“ (Edgar Salin), er war auch ein grandioser Wissenschaftler, der es sich erlauben konnte, seine Vorlesungen öfter ausfallen zu lassen, „weil er ein bohèmehaftes Leben führte. Wenn er trotzdem unerwartet wieder einmal erschien, waren die Hörer immer [XXV] noch da.“35 Die Strenge und Genauigkeit, die sowohl Peterson wie Schmitt in ihrem jeweiligen Fach praktizierten, kontrastierte stark mit ihrer Lebensweise, die sehr unorthodox und antibürgerlich war. Sie saßen täglich in Cafés und Weinstuben, besuchten Bars, Cabarets und Kinos, hatten keinen regulierten Tagesablauf, klagten über ständige Geldnot, was sie nicht abhielt, ihre Studenten großzügig einzuladen. Peterson, der Autor der „Theologie des Kleides“, kleidete sich selbst höchst exzentrisch; oft ging er im Cut und mit Halbzylinder und gab den Bohémien, der z. B. einen Mittelscheitel trug, was längst völlig aus der Mode war. Für diese Exzentrik liefert Schmitt mit seinem Tagebucheintrag vom 4. August 1926 ein schönes Zeugnis: Er berichtet, wie er mit Peterson durch die Stadt ging, dabei seinem Vermieter begegnete und „erschrak, weil ich fürchtete, er würde es bereuen, mir sein Haus vermacht zu haben, wenn er mich in einem schlechten Anzug sieht und Peterson in einem ganz unmöglichen“. Und als Peterson 1929 zu Besuch in Berlin ist und mit Schmitt durch die Stadt geht, notiert dieser: „Kam mir neben Peterson vor wie das Paar Bouvard & Pécuchet.“ (12.1.29).
Schmitt und Peterson sehen sich schon bald nahezu jeden Tag, manchmal sogar zweimal täglich; man könnte dieses Tagebuch der Bonner Zeit „Peterson-Tagebuch“ überschreiben. Wie eng die Freundschaft war, kann man daraus ersehen, dass Schmitt Peterson nicht nur als Trauzeugen für seine Ehe mit Duschka wählte, sondern mit ihm auch seine „erbärmliche Ehegeschichte“ mit der ersten Frau Cari besprach (18.11.25; 5.12.25); ein Thema, das er sonst mit der äußersten Diskretion behandelte.
Da Peterson durch seine Kritik an der liberalen protestantischen Theologie und seine Annäherung an den Katholizismus innerhalb seiner Fakultät isoliert war, wurde ihm das Gespräch mit Schmitt umso wichtiger. Schmitt sei der „einzige vernünftige Mann“ in Bonn und „für einen Professor ungewöhnlich geistreich“, heißt es in einem Brief Petersons an Karl Barth vom Spätherbst 1924. Umgekehrt bezeichnete Schmitt das Gespräch mit Peterson als „für mich eine große Wohltat“,36 und die Arbeiten Petersons als „prachtvoll und hinreißend“.37 Zu dem kontinuierlichen Gespräch mit Peterson sind im Tagebuch nur gelegentlich inhaltliche Angaben gemacht, doch die haben es in sich, weil sie den wechselseitigen Einfluss bezeugen. Peterson machte das juristische und politisch-theologische Denken Schmitts für seine eschatologische Theologie fruchtbar, während umgekehrt der „Theologe der Jurisprudenz“38 von Peterson lernte. Die Faszination eines Denkens vom Ende her verband sie. Schon 1918 taucht bei Peterson der Begriff „Katéchon“ auf,39 der später für Schmitt so zentral wurde. Petersons erste Bonner Vorlesung des Wintersemesters 1924/25 über „Neutestamentliche Bedeutungslehre“ nennt den Katéchon explizit, was die Lukasvorlesung des folgenden Wintersemesters zwar nicht macht, jedoch mit „Geheimnis der Bosheit“ sich auf die entsprechende Bibelstelle (2 Thess 2,6–7) bezieht.40 Im Übrigen ist sie mit ihren [XXVI] Exkursen zu Souveränität, Demokratie, Verfassung und vor allem der auffälligen Verwendung des Ausnahmebegriffs durchtränkt von Schmitt. Für diesen dagegen ist die Bedeutung der frühchristlichen „acclamatio“, Thema von Petersons Habilitationsschrift „Heis Theos“, zentral. „Heis Theos“ zitiert Schmitt in seiner 1927 entstandenen Schrift „Volksentscheid und Volksbegehren“, und „Akklamation“ wird ein wichtiger Begriff in seiner im selben Jahr geschriebenen „Verfassungslehre“.
Das Gespräch mit Peterson mag auch für Schmitts Verständnis des Feindes im „Begriff des Politischen“ wesentlich gewesen sein. Peterson beschäftigte sich in seiner Vorlesung über das Lukasevangelium ausgiebig mit der sog. lukanischen Feldpredigt (Lk 6), dem Pendant zur Bergpredigt im Matthäusevangelium. Petersons theologische Auslegung des biblischen Gebots der Feindesliebe und sein Einfluss auf Schmitts Freund-Feind-Theorem wird durch das Tagebuch erhärtet (vgl. z. B. 14.1.26 und 19.1.26). Für seinen „Begriff des Politischen“ wünschte Schmitt sich Peterson als Rezensent, weil „niemand das besser, fruchtbarer, theologischer und christlicher machen könnte als er“.41
Die Freundschaft mit Peterson sollte ab 1938 verblassen. Mit Heinrich Oberheid dagegen hielt sie lebenslang. Oberheid begann 1926 mit dem Theologiestudium in Bonn, das er hauptsächlich bei Peterson absolvierte, der ihn mit Schmitt bekannt machte. Er hörte dann auch Vorlesungen bei Schmitt und saß in dessen Seminar, wo er durch ein „sehr gutes“ Referat auffiel (2.2.27). Bald entwickelte sich ein enges Verhältnis. Oberheid war ein merkwürdiger Mann. Im Ersten Weltkrieg hatte er sich einen Ruf als harter Nahkämpfer erworben, andererseits hatte er ein weiches Gemüt. Wenn er Schmitt besuchte, sang er gelegentlich, wobei Schmitt seine schöne Stimme bewunderte (1.1.27) und seinerseits in den Gesang einstimmte. Oberheid schwankte zwischen Ökonomie und Theologie. Ein erstes Studium der Theologie brach er ab, um 1919 in Heidelberg Nationalökonomie, Jura und Philosophie zu studieren, was er noch im selben Jahr mit der Promotion abschloss. Anschließend machte er eine rasante Karriere im Stinnes-Konzern, wo er bereits 1923 Direktor war. Das gab er aber schon 1926 wieder auf, um in Bonn erneut Theologie zu studieren. Auch mit dem Schwager Oberheids, Julius Sopp, der als Arzt an der Medizinischen Poliklinik in Bonn arbeitete, hatte Schmitt zeitweise Kontakt, der sich schon darum eng gestaltete, weil Sopp Besitzer eines Automobils war, das Schmitt, der nie in seinem Leben ein Auto, nicht einmal einen Führerschein besaß, gerne in Anspruch nahm.
Zu Waldemar Gurian war die Beziehung Schmitts intensiver, als es der veröffentlichte Briefwechsel erkennen lässt. Die Beziehung beruhte wohl, und zwar was die Anziehung und auch Abstoßung angeht, auf einer „Wesensgleichheit“.42 Über Gurian gehen die Urteile auseinander. Raymond Aron beklagte seine intrigante Bösartigkeit, während Hannah Arendt von ihm sagt, dass er „es niemals wirklich böse meinte“.43 Das sind freilich Urteile über den späten Gurian. Dem Gurian von 1929 bescheinigt Benno von Wiese die „Vereinigung ungewöhnlich hoher Intelligenz, primitiver Scheußlichkeit und fast kindlicher Naivität“.44[XXVII] Gurian traf Schmitt häufig, und er hat von ihm sehr profitiert. Schmitt gab ihm Hinweise auf französische Autoren (Maurras, Lamennais, Maritain) und wies ihn auf das Thema „Totalitarismus“; alles Themen, mit denen Gurian sich dann intensiv beschäftigte und über die er auf Anraten Schmitts (4.3.26) Bücher schrieb. Aber Schmitt profitierte auch von Gurian, der gute Beziehungen nach Frankreich hatte und die erste Übersetzung der Politischen Romantik ins Französische vermittelte. Die Freundschaft zerbrach dann durch wiederholte Indiskretionen Gurians hinsichtlich von Publikationsplänen Schmitts, und als Schmitt zu der Überzeugung kam, dass Gurian verantwortlich war für sein Zerwürfnis mit Hugo Ball, suchte er, wie er an Karl Muth schrieb, „die persönliche Beziehungen mit Gurian zu meiden“.45 Im Herbst 1927 spitzte sich der Konflikt zu. „Heftiger Disput mit Gurian, über den ich mich sehr ärgerte“, notiert Schmitt am 12. September 1927. Am 7. November erhält Schmitt einen langen Brief von Karl Muth, der ihm berichtet, wie Gurian Schmitt für seine eigene Publikationsstrategie ausnutzt. Kurz vor Weihnachten trafen sie sich dann zum letzten Mal. Am 20. Dezember vermerkt Schmitt, dass Gurian ihm zum Abschied nicht die Hand gab. Am Tag darauf heißt es: „mit Eschweiler zu Gurian, der sich lümmelhaft benahm. Ich ging weg. Es ist lächerlich.“ Das war das Ende der Freundschaft. Wie tief das ging, zeigt der Brief, den Gurian nach anderthalbjährigem Schweigen am 7. Juni 1929 an Schmitt schreibt, und mit dem er sich in aller Form für sein Verhalten entschuldigt.46 Eine Abschrift dieses Briefes hat Schmitt noch 1970 mehreren Personen zur Kenntnis gegeben; wohl um deutlich zu machen, dass die heftigen und zum Topos gewordenen Angriffe Gurians ab 1933 auf ihn („Kronjurist des Dritten Reiches“) eine Vorgeschichte haben.
Die Universität dieser Zeit erlaubte noch eine persönliche Beziehung des Professors zu seinen Studenten. Bei Carl Schmitt war das besonders ausgeprägt. Mit seinen Doktoranden – genannt seien nur die Namen Werner Becker, Werner Weber, Ernst Rudolf Huber, Karl Lohmann, Ernst Friesenhahn, Otto Kirchheimer – pflegte Schmitt ein fast kollegiales Verhältnis, und mit nicht wenigen von ihnen blieb er lebenslang befreundet. Selbst Kirchheimer, der als Jude und Marxist 1933 in die Emigration getrieben wurde, nahm nach 1945 den Kontakt zu seinem alten Lehrer über alle politischen Differenzen hinweg wieder auf. Mit keinem von ihnen aber hatte Schmitt in Bonn so vertrauten Umgang wie mit Werner Becker. Man kann schon von mehr als einem „Lieblingsschüler“ sprechen; Werner Becker war in dieser Zeit ein Freund. Dabei war er gar nicht ständig in Bonn anwesend. Er begann zum Wintersemester 1925 ein Zweitstudium der katholischen Theologie, das ihn 1926/27 zu Jacques Maritain nach Paris führte. Benno von Wiese zeichnet Becker in seinen Erinnerungen als „völlig frei von Zweideutigkeit oder geheimer Fragwürdigkeit“. Auffällig ist dagegen, dass der Name eines Bonner Meisterschülers, der sich später zum Freund entwickeln sollte, im Tagebuch 1921 bis 1924 nur zweimal beiläufig, in dem vorliegenden Tagebuch aber für die Bonner Zeit nicht ein einziges Mal fällt: Ernst Forsthoff. Erst mit dem Wechsel nach Berlin begegnen sich Schmitt und Forsthoff öfter.
Carl Schmitt pflegte mit seinen Schülern über die Lehrveranstaltungen hinaus geselligen Umgang, und das galt keineswegs nur für Doktoranden, sondern auch für einfache Studenten. Er begegnete ihnen ohne alle Starallüren, nahm sie mit zum Weintrinken (wo er dann